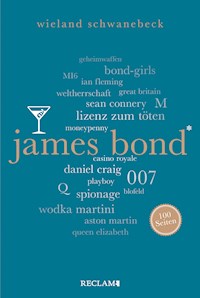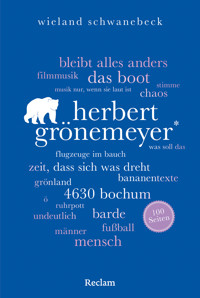6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Reclam 100 Seiten
- Sprache: Deutsch
»Es gibt zumindest einen Weg, mit wildfremden Menschen ins Gespräch zu kommen, ohne sich vorher in Statistiken über die Niederschlagsmenge zu vertiefen: Man spricht ›Loriot‹.« Früher war mehr Lametta, und die Ente bleibt draußen: Die meisten von uns sind mit Loriots Sketchen groß geworden und lieben sie noch heute. Doch wie wurde aus Vicco von Bülow der Herr auf dem Sofa? Wie kam es, dass eine als humorlos verschriene Nation einen feingeistigen Preußen mit einer Nudel im Gesicht zum beliebtesten Deutschen kürte? Vom Stammbaum der Familie Hoppenstedt bis zum Vermächtnis des Freiherrn Knigge lüftet Wieland Schwanebeck nahezu alle Geheimnisse über Loriot.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Wieland Schwanebeck
Loriot. 100 Seiten
Reclam
Für mehr Informationen zur 100-Seiten-Reihe:
www.reclam.de/100Seiten
Für Sarah & Hendrik
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962115
2023 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH nach einem Konzept von zero-media.net
Infografik: annodare GmbH, Agentur für Marketing
Bildnachweis: siehe Anhang
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962115-9
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-20701-7
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Sprechen Sie Loriot?
Na, wer hat Lust auf Humoranalyse?
Lebenslauf des Vicco von Bülow, genannt Loriot
Deutsche & Preußen
Bürgerkriege
Frauen & Männer
Loriot for President!
Lektüretipps
Bildnachweis
Zum Autor
Über dieses Buch
Leseprobe aus Helge Schneider. 100 Seiten
Sprechen Sie Loriot?
Stellen Sie sich vor, man hat Sie zu einem geselligen Abendessen in größerer Runde eingeladen. Sie kennen niemanden, würden aber gern mit Ihrem Gegenüber ins Gespräch kommen – allein, wie vorgehen? Den Bekanntenkreis auf gut Glück nach potentiellen Schnittmengen zu durchforsten (»Kennen Sie Hartmut Schöttel?«), scheint wenig aussichtsreich, und eine zwanglose Aufforderung zum Spiel wird Ihnen möglicherweise als Zeichen der Unreife ausgelegt (»Kennen Sie Schnipp-Schnapp?«). Konversationsfibeln für Menschen, die sich nur mit Stützrädern aufs gesellschaftliche Parkett trauen, empfehlen armselige Sprechblasen über das Wetter (»Es ist etwas kühl für diese Jahreszeit«), aber mit denen kommen Sie auch nicht weit. Denn es ist nicht allzu wahrscheinlich, dass Sie ausgehend von diesem kleinsten gemeinsamen Nenner elegant die Kurve zu persönlichen Erlebnissen finden (»Ich bin Preisträger des Salamo-Preisausschreibens«).
In Deutschland gibt es zumindest einen Weg, mit wildfremden Menschen ins Gespräch zu kommen, ohne sich vorher in Statistiken über die Niederschlagsmenge zu vertiefen: Man spricht Loriot. Obwohl die Wenigsten von uns den Klassiker Loriot in der Schule behandelt haben dürften, tragen viele Menschen seine Sätze, wie der Philosoph Odo Marquard einmal gesagt hat, »als eiserne Schmunzelration« in ihrer Erinnerung. Dabei gelingt Loriot ein unwahrscheinliches Kunststück. Einerseits verfügt er über nahezu universelle Bekanntheit – oder sagen wir: universelle Bekanntheit hierzulande, denn leider ist Loriot nur in Deutschland weltberühmt. Andererseits gilt er vielen als Kultobjekt, über das sich die Eingeweihten in einem eigenen Geheimcode unterhalten. Ihnen genügt meist ein kurzer Satz (»Die Ente bleibt draußen!«), manchmal auch nur einzelne Codewörter (»Ein Klavier! Ein Klavier!«) oder gar eine onomatopoetische Äußerung (»Holleri-du-dödl-di!«, »Kraweel!«).
Kein Wunder, dass es zahlreiche verbriefte Beschwerden über die geradezu penetrant zitierfreudigen Loriot-Jünger gibt. Sie finden sich auch in den Cartoons für Loriot (2012), einem Buch mit Hommagen bekannter Karikaturisten. Darin lässt ©TOM einen Cartoonisten »in der Hölle für Loriot-Hommagen« den gesamten Band verzehren, wozu der Teufel hämisch grinst: »Schmeckt’s?«
»Wir haben Amnesty International. Wir haben Terre des Hommes. Wir haben Ärzte gegen den Atomkrieg. Wer greift eigentlich ein, wenn jemand im Restaurant vierzig Minuten lang ›unheimlich gut‹ Loriot-Sketche nacherzählt?« (Harald Schmidt in seinem Programm Schmidtgift, 1996)
Solche Klagen kann ich nachempfinden. Schließlich mag ja auch keiner die nimmermüden Witzeerzähler, die in geselliger Runde auch nach der 30. Zote nicht den Schnabel halten können (»Na gut, einen hab ich noch!«). Trotzdem würde ich immer gern bei den anstrengenden Leuten am Nebentisch sitzen, die glücklich sind, wenn sie eine Weile Loriot sprechen dürfen. In der Soziologie des Witzeerzählens weiß man um die Wichtigkeit der ›Lachgemeinschaften‹: jener Gruppen, die spontan über alle Standes- und Glaubensgrenzen hinweg durch eine Pointe entstehen und in denen es zumindest für die Dauer des Gelächters einträchtiger und basisdemokratischer zugeht als in jeder Bundestagsdebatte. Die Loriot-Jünger sind eine nostalgische Subspezies der Lachgemeinschaft, denn sie werden von Pointen geeint, denen das Überraschungsmoment längst abhandengekommen ist. Das macht den geteilten Zitatenschatz aber nur noch wichtiger, adelt ihn gar als Bestandteil eines geheiligten Rituals.
Vokabeln wie ›Ritual‹ gefallen mir im Zusammenhang mit Loriot eigentlich nicht, denn sie lassen sein Werk nach einem Museumsstück klingen. Die vielen Zeichnungen, Dialoge und (Kurz-)Filme, die Vicco von Bülow hinterlassen hat, befinden sich aber glücklicherweise nicht hinter Glas und werden auch nicht bloß gelegentlich von geschulter Hand berührt und abgestaubt. Loriot ist immer noch allgegenwärtig – Kalender und Postkarten mit seinen Cartoons erfreuen sich ebenso ungebrochener Beliebtheit wie die DVDs mit seinem Sketch-Archiv, von weiteren Fanartikeln wie z. B. Kartenspielen, Salzstreuern und Buchstützen ganz zu schweigen. Um Loriot komisch zu finden, bedarf es keiner erklärender Fußnoten, und seine Gags sind für uns alle gemacht, die wir in der Mehrzahl nicht Philosophie studiert haben, geschweige denn Pilgerfahrten nach Bayreuth unternehmen. Loriot erzählt von uns, und seine Figuren bleiben schon allein deshalb alterslos, weil sie eigentlich schon immer aus der Zeit gefallen waren. Das omnipräsente Knollennasenmännchen ist dafür das beste Beispiel: ersonnen in den 1950er Jahren, aber gekleidet in die Mode der 1920er.
Es stimmt, dass Loriot für die Fernsehnation stets der freundliche ältere Herr auf dem Sofa geblieben ist und ab und zu mit dem Image des ebenso sturen wie schrulligen Opas Hoppenstedt kokettiert hat. Doch seine Arbeiten verraten eine genaue Kenntnis der Gegenwart, scheinen zum Teil sogar die Zukunft vorwegzunehmen. In Zeiten omnipräsenter Selfies und ständigen Zwangs zur Selbstdokumentation wirken seine bereits in den 1960er Jahren gezeichneten Urlauber, die ihre Umgebung ausschließlich durch den Sucher des Fotoapparats erkunden, sehr prophetisch; in einer Zeitungskolumne Ende der 1950er Jahre erfindet Loriot vorsorglich den Videoschiedsrichter im Profifußball; und Frau Hoppenstedts Versuch, sich im Diplom-Jodelkurs zu entfalten, wirkt auch nicht mehr so ganz absurd – in der legendären Villa Aurora in Kalifornien werden inzwischen sogar Kurse über das Jodeln als Kulturtechnik veranstaltet.
Wir sind alle Loriot
Auch in meinem Alltag komme ich nicht an Loriot vorbei. Damit meine ich nicht bloß jene Gelegenheiten, wenn bestimmte Stichwörter fallen, auf die man sich im Geist sofort den passenden Loriot-Reim macht. (Berichten mir Freunde von Ausflügen nach Bozen, frage ich mich unweigerlich, ob auf dem dortigen Campingplatz die Waschräume wirklich separat liegen.) Nein, ich denke vor allem an die Momente, in denen das eigene Leben einer Loriot-Szene zu ähneln beginnt. Das Bild, das ich in meinem Büro leicht schief aufgehängt habe, wird mich über kurz oder lang in den Wahnsinn treiben. Unbeirrt teilt meine kleine Tochter ihre Sicht auf die Welt auch dann mit, wenn ihr Nudeln im Gesicht kleben. Hin und wieder drehe ich in fremder Umgebung mit klebrigen Obstschalen in der Hand Pirouetten, weil ich den nächsten Mülleimer nicht finden kann, und gelegentlich mag es in unserem Haushalt auch vorgekommen sein, dass eine unzureichend erhitzte Suppe mit den Worten reklamiert wurde: »Das können Sie Ihren Gästen in Neapel anbieten – hier kommen Sie damit nicht durch!«
Seltsam, dass wir uns im Deutschen zwar die Adjektive ›kafkaesk‹ und ›freudianisch‹ leisten, aber Loriot (noch) nicht mit einer entsprechenden Wendung geadelt haben. Mit diesem Gefühl scheine ich nicht allein dazustehen. Der Hashtag #Loriot markiert auf Twitter zahlreiche kleine Alltagsvignetten, die aus dem Hoppenstedt-Universum stammen könnten: wenn Kommunikation schiefläuft, wenn der Bundestagswahlkampf absonderliche Blüten treibt, oder wenn weihnachtlicher Gemütlichkeitszwang für Beklemmungen sorgt.
Vermutlich geht es Ihnen nicht viel anders, sonst hätten Sie nicht zu diesem Buch gegriffen. Möglicherweise haben auch Sie schon einmal dem Drang widerstehen müssen, im Spielzeuggeschäft plötzlich in die altersheisere Stimme von Opa Hoppenstedt zu verfallen und sich zu erkundigen, ob man hier auch mit Spielgeld bezahlen könne. Ja, vielleicht haben Sie auch für sich gedacht, als Sie diesen Band in die Hand nahmen: Schau an, der ist ja schaumolweiß, also »noch etwas weißer als weiß«. Sollte nichts davon auf Sie zutreffen, heiße ich Sie dennoch herzlich willkommen, denn es ist nie zu spät, noch den Weg zu Loriot zu finden und sich mit dem beliebtesten deutschen Humoristen vertraut zu machen. Kann man Popularität überhaupt messen? Otto Waalkes und Michael »Bully« Herbig haben mehr Menschen ins Kino gelockt, bei den Tonträgerverkäufen dürften Mike Krüger und Fips Asmussen die Nase vorn haben, und die Ränge des Berliner Olympiastadions hat Loriot mit seinen bekanntesten Nummern auch nie gefüllt (»Hier, Frühstücksei! Morgens, vier Minuten, und die Olle so, ne? Kennste? Kennste?«).
Entscheidender dürfte aber sein, dass Loriot im Gegensatz zu seinen hier erwähnten Kollegen bei niemandem Augenrollen und heftige Abwehrreaktionen provoziert. Er ist niemals das geworden, was man in England unter Bezug auf eine eigentümlich schmeckende Hefepaste, an der sich die Geister scheiden, ein marmite phenomenon nennt, das die Menschheit sauber in leidenschaftliche Befürworter und erbitterte Gegner teilt. Vielmehr besteht eine imposant hohe Schnittmenge zwischen denjenigen, die Loriot kennen und mit seinem Werk vertraut sind, und jenen, die sich auch als Fans bezeichnen würden. Einer IfD-Umfrage aus dem Jahr 2008 zufolge kannten damals 90 Prozent der Deutschen Loriot, und 70 Prozent schätzten seine Arbeit, quer durch alle Altersstufen und sozialen Milieus. Selbst die von allzu viel »Herren im Bad«-Rezitationen Genervten tragen also dem Urheber des Knollennasenmännchens, des Saugblasers ›Heinzelmann‹ und des Bettenmodells ›Andante‹ (»mit Spannmuffenfederung in Leichtmetall«) kaum etwas nach.
Als Loriot 2011 starb und sich Feuilletons wie Politik vor ihm verneigten, da erzählte jeder Nachruf auch ein bisschen von demjenigen, der ihn verfasst hatte, denn Loriot hatte für viele zur Familie gehört. Der damalige Bundespräsident Christian Wulff bescheinigte Loriot: »Wir haben durch ihn lachen gelernt«, und das gilt sowohl für die steife Wirtschaftswundernation, der Loriot einst ein paar dringend benötigte Lockerungsübungen verschrieb, als auch für uns persönlich, die wir mit seinen Bildern und Sketchen aufgewachsen sind. Wüssten wir noch zu sagen, was wir aus diesem enormen Fundus zuerst kennengelernt haben? Wohl kaum – Loriot gehört zur Familie, er war schon immer dabei. Oder wissen Sie etwa ganz genau, was zuerst kam? Das Huhn, das Ei oder die Beschwerde »Berta, das Ei ist hart«?
Loriots Fernseharbeiten sind nie über längere Zeit vom Bildschirm verschwunden, allenfalls hat sich der Zugriff auf eine ›Referenzedition‹ aufgrund der unterschiedlichen kursierenden Schnittfassungen etwas komplizierter gestaltet. Die unvollständige Ausgabe Sein großes Sketcharchiv ist 2007 durch die aus sechs DVDs bestehende Vollständige Fernseh-Edition ersetzt worden, auf deren Cover der Rennbahnbesucher (»Wo laufen sie denn?«) durchs Fernglas blickt, den Loriot zur Bebilderung eines Wilhelm-Bendow-Sketchs gezeichnet hat. Wer diese Edition im Regal hat, dürfte sich nicht so schnell von ihr trennen und sie auch bei der nächsten Generation noch in guten Händen wissen (sofern diese noch willens und fähig ist, von einer DVD Gebrauch zu machen). Im Unterschied zu seinen beiden Kinofilmen haben Loriots Sketche noch nicht den Weg auf die einschlägigen Streaming-Plattformen gefunden – noch nicht einmal die Folge Weihnachten bei Hoppenstedts. Allerdings steigt diese als Einzel-DVD zum Jahresende immer wieder so zuverlässig in die Charts ein wie »Last Christmas«, die von Wham! eingesungene englische Vertonung von »Früher war mehr Lametta«.
Die Würdigung eines Künstlers im Rahmen des Mediums Buch
Mir fällt es am Anfang eines Buchs notorisch schwer, mein Vorhaben einzugrenzen. Aber bevor sich diese Einleitung zu einer Präambel wie jener des Karnevalsvereins in Ödipussi (1988) auswächst, der wahrscheinlich immer noch auf der Suche nach seinem endgültigen Namen ist (»Verein für Karneval trotz Frau und Umwelt?«), verrate ich Ihnen kurz, was ich im Folgenden nicht tun werde. Weder werde ich eine erschöpfende Analyse des Loriot’schen Werks noch eine lückenlose Biographie vorlegen. Ausgiebiger zum Werdegang Loriots kann man sich an anderer Stelle belesen, etwa in der von ihm selbst stammenden autobiographischen Skizze im Band Möpse und Menschen (1983) oder dem nicht minder lesenswerten Buch Der Glückliche schlägt keine Hunde (2013), in dem Loriots ehemaliger Regieassistent Stefan Lukschy zahllose wunderbare Geschichten versammelt hat.
An einer streng akademischen Analyse werde ich mich ebenfalls nicht versuchen, denn es gibt bereits eine Reihe fundierter germanistischer und kommunikationswissenschaftlicher Studien zu Loriots Schaffen, von denen sich einige in den abschließenden Lektüretipps gelistet finden. Den Wert solcher Arbeiten möchte ich nicht in Abrede stellen, aber sie bergen zwei Gefahren, die ich gern umschiffen möchte. Einerseits wird Loriots Werk in solchen Untersuchungen gelegentlich nur als Illustration z. B. psychologischer Konzepte herangezogen, andererseits neigt der wissenschaftliche Jargon gelegentlich zur Selbstparodie. Sicher braucht es keinen weiteren Band, in dem abermals nachvollzogen wird, wie bei Loriot durch »die Hinzufügung kontrastierender Ingredienzien […] ein komisches Gefälle entstehen« kann (Patrick Süskind). Falls Sie nicht gerade ein seriöses Forschungsinteresse verfolgen, empfiehlt sich die Lektüre mancher dieser wissenschaftlichen Analysen allenfalls in Verbindung mit einem Trinkspiel. Greifen Sie jedes Mal zum Schnapsglas, wenn z. B. das Wort »Kontrastkomik« fällt, und Sie werden bereits am Schluss der Einleitung so besoffen sein wie ein Vertreter der Firma Pahlgruber & Söhne nach einem vorweihnachtlichen Verkaufsbesuch.
Natürlich werden auf den folgenden Seiten sowohl wichtige Stationen von Loriots Werdegang geschildert als auch wissenschaftliche Perspektiven auf seine Arbeit berücksichtigt. Im Vordergrund steht für mich aber eine unterhaltsame Annäherung an die wichtigsten Themen des Loriot-Universums, die zugleich Lust auf eine Wiederbegegnung mit Herrn Hallmackenreuter, Frau Direktor Bartels und Dichterfürst Lothar Frohwein bereiten soll. Unvorhergesehene Heiterkeitsausbrüche in der Nachkriegszeit werden dabei ebenso eine Rolle spielen wie bürgerliche Tugend und Etikette, das Essen, die Medien sowie das Verhältnis der Geschlechter. Die Auswahl der thematischen Schwerpunkte wie auch der Beispiele ist natürlich rein subjektiv. Lassen Sie uns gern darüber streiten, wo ich Ihrer Meinung nach danebengelegen oder etwas übersehen habe. Wenn wir uns über den Weg laufen, dann rufen Sie einfach »Melusine!«, ich antworte mit »Kraweel!«, und schon werden wir uns erkannt haben.
Na, wer hat Lust auf Humoranalyse?
Es gibt mehrere Wege, um einen Witz zu töten. Man kann ihn falsch oder zu oft erzählen, erklären oder analysieren. Loriot führt das im Sketch »Filmanalyse« mustergültig vor. Dort debattieren Experten über einen fünfsekündigen Ausschnitt aus dem Buster-Keaton-Film Cops