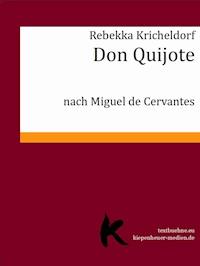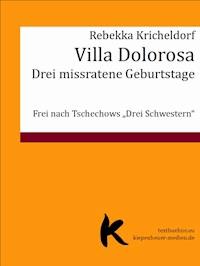9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin, mitten in den Neunzigern. Die Stadt liegt da wie eine utopische Verheißung, offen für alle: für Fabian, den drogenaffinen Partyhengst, den dichtenden Alki Lennard, die depressiv-hysterische Lily, verkrachte Bildungsbürgerkinder und Hausbesetzer, die in verschiedenen Lebens-und Kunstdisziplinen vor sich hin dilettieren. Zwischen ihnen treibt Larissa durch die Stadt, geflüchtet aus der Provinz, möchte irgendwie studieren, ist aber zugleich auf der Suche nach vielfältigen Objekten ihres Begehrens: Sie träumt von dem Einen, Unerreichbaren, folgt Verlockungen am Wege, versucht sich in gesunder Zweisamkeit und verzehrt sich in einer schweren sexuellen Obsession – wie lange kann das alles gutgehen? Denn die Neunziger, das sind auch Abstürze und die Vorboten der Gentrifizierung. Irgendwann stellt sich auch für Larissa die ewige Frage, ob man ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft werden möchte – oder lieber als heiliger Outlaw im glamourösen subkulturellen Slackertum verschwindet. Eine Hommage an das wilde, lebenshungrige Berlin und an die Zeit der wahren Party. Rebekka Kricheldorfs Roman ist ein sprachliches Feuerwerk, scharf gezeichnet und echt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Rebekka Kricheldorf
Lustprinzip
Roman
Über dieses Buch
Berlin, mitten in den Neunzigern. Die Stadt liegt da wie eine utopische Verheißung, offen für alle: für Fabian, den drogenaffinen Partyhengst, den dichtenden Alki Lennard, die depressiv-hysterische Lily, verkrachte Bildungsbürgerkinder und Hausbesetzer, die in verschiedenen Lebens- und Kunstdisziplinen vor sich hin dilettieren. Zwischen ihnen treibt Larissa durch die Stadt, geflüchtet aus der Provinz, möchte irgendwie studieren, ist aber auch auf der Suche nach vielfältigen Objekten ihres Begehrens: Sie träumt von dem Einen, Unerreichbaren, folgt Verlockungen am Wege, versucht sich in gesunder Zweisamkeit und verzehrt sich in einer schweren sexuellen Obsession – wie lange kann das alles gutgehen? Denn die Neunziger, das sind auch Abstürze und die Vorboten der Gentrifizierung. Irgendwann stellt sich auch für Larissa die ewige Frage, ob man ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft werden möchte – oder lieber als heiliger Outlaw im glamourösen subkulturellen Slackertum verschwindet.
Eine Hommage an das wilde, lebenshungrige Berlin und an die Zeit der wahren Party. Rebekka Kricheldorfs Roman ist ein sprachliches Feuerwerk, scharf gezeichnet und echt.
Vita
Rebekka Kricheldorf zählt zu den bekanntesten deutschen Dramatikerinnen, ihre Stücke werden an den renommiertesten Bühnen uraufgeführt, unter anderem am Deutschen Theater Berlin, Schauspielhaus Hamburg oder am Theater Neumarkt Zürich. 2019 wurde Rebekka Kricheldorf mit der Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik geehrt. «Lustprinzip» ist ihr erster Roman. Rebekka Kricheldorf lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Marion Blomeyer
ISBN 978-3-644-10094-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für alle, die wir unterwegs verloren
«Jugend hat einen Anflug von Weisheit und muss ihn bewusst unterdrücken; das ist die Bedingung, unter der sie zu den Fressnäpfen der staatlichen Gemeinschaften zugelassen wird, da von dieser Seite an nichts Echtes in ihrer Natur appelliert wird.»
Tennessee Williams
«So kam ich auf diese Erde mit dem erstaunten Auge der erwachten Eule, um meinen Part zu sprechen»
Lawrence Ferlinghetti
Winter
Ich öffne die Augen und sehe direkt in die Augen eines Hundes. Der Hund ist groß und schwarz und trägt um den Hals ein rotes, zerlumptes Tuch. Er betrachtet mich mit einem ehrlichen, warmen Blick. Ich kenne diesen Hund nicht. Dieser Hund ist ein mir gänzlich unbekannter Hund. Ich stütze mich auf und sehe, dass ich in einem engen, fremden Zimmer liege. An der Wand hängen drei Trainspotting-Poster, einmal Begbie, einmal Sick Boy, einmal der klatschnasse Renton, um dessen Kopf jemand ein großes Herz gemalt hat. Auf dem Teppichboden liegt eine umgekippte Bong, auf der Matratze in der Ecke dösen ein Junge und ein Mädchen, eng ineinander verhakt. Ich stehe auf und schleiche zur Tür. Im Flur liegen noch zwei Menschen, einer im Schlafsack, einer daneben, ich steige über sie, so leise ich kann. Der Hund folgt mir bis zur Zimmertür; als ich über den langen Flur im Treppenhaus verschwinde, schaut er mir nach wie einem Verräter.
Ich falle hinaus in ein fieses Licht. Es sieht nach Sonntag aus. Sonntag auf dem Mond.
Wo bin ich? Wo ist mein Rad?
Es beginnt zu schneien.
Kneipe. Abgefackelter, verschmorter Mülleimer. Bauloch. Glanzloser gastronomischer Versuch. Humana. Hässliches Oma-Café. Brache. Glanzloser gastronomischer Versuch. Rudi’s Resterampe. Zertrümmerte Telefonzelle. Traurige Currywurstbude. Traurige Dönerbude. Mäc-Geiz. Bauloch.
Die Stalinallee ist auch nicht mehr das, was sie mal war.
Eisdiele. Rathaus. Heim für fallengelassene alte Alkis. Chicken total. Mister Minit.
Friedrichshains Lieblingsfarbe ist grau. Die grauen Visagen verschwimmen mit dem Grau der Häuser, dem grauen Himmel und dem Grau des Asphalts. Grau auch die Träume der wenigen ansässigen Singvögel. Die Ossis (grau) schleppen sich freudlos durch den Kiez. Sie sehen aus wie Fotos in alten Alben, die längst keiner mehr durchblättert. Sie scheinen aufgegeben zu haben, und zwar alles, ihre Vergangenheit, ihre Zukunft, aber vor allen Dingen ihre Gegenwart. Der Säuferanteil ist hoch. Schon morgens kleben die Freunde des Frühschoppens auf den Parkbänken oder den Hockern der Imbissbuden. Manchmal läuft ihnen eine Laus über die kaputte Leber, dann schreien sie in den Himmel und schwenken böse ihre Billigbierflaschen. Mit den Krätze-Punks aus den besetzten Häusern haben sie nichts zu tun, obwohl doch ihr Tagwerk nahezu dasselbe ist: murren und saufen. Sie müssten die besten Kumpels sein, hassen sich aber wie die Pest. Ein großer Graben aus Unverständnis für das Lebenskonzept des jeweils anderen trennt sie.
Ich laufe herum, esse einen Döner, lasse anschreiben, laufe weiter, vorbei an den sozialistischen Prachtbauten, laufe durch den schmutzigen Matsch, laufe ins Ring-Center, setze mich auf eine Bank und beobachte die armen, vom Kapitalismus gefickten Schweine beim Kaufen von sinnlosem Krempel, stehe auf und laufe weiter, bis es dämmert.
Call-Shop. Späti. Riesiges Grillrestaurant, in dem keiner drin sitzt. Dönerbude (Neueröffnung!). Bauloch.
Von einem der brüchigen Balkone, die aussehen, als könnten sie dir jederzeit auf den Kopf knallen und deinem vielversprechenden, jungen Leben ein Ende bereiten, ruft mir ein Besuffski zu: He, Mädchen, Mädchen, wie viel Uhr ist es?
Ich sag mal: Acht.
Der Balkon-Master schreit: He, Mädchen, Mädchen, morgens oder abends?
Ist doch egal, rufe ich zurück und laufe weiter.
In der Bänschstraße wurde mitten auf dem Gehweg ein Scheiterhaufen aus Gegenständen errichtet. Der Akt des Verbrennens ist vorbei, nur die verkohlten Überreste, inzwischen durch die Schnee-Feuchte pappig geworden, deuten darauf hin, dass Gewalt stattfand. Was einmal ein Kleid, ein Paar Schuhe, eine CD-Sammlung war, liegt als schwarzes Geklumpe auf dem Gehweg wie ein Mahnmal für die Vergeblichkeit allen irdischen Glücksstrebens. Es sieht nach gängigem Eifersuchtsdrama aus. Jemand war wütend. Jemand wurde verletzt. Jemand wurde betrogen, verraten, enttäuscht. Jemand hat endgültig genug, wirft die Habseligkeiten eines anderen aus dem Fenster, hastet die Treppe runter, übergießt den Haufen mit Benzin, zündet ihn an, fühlt sich besser, fühlt sich gereinigt, befreit, ha, sehr gelungen, die Teufelsaustreibung, kann jetzt einen trinken gehen, kann weiterziehen, ins nächste Drama.
Da mir weiter nichts einfällt, wo ich hinlaufen könnte, laufe ich nach Hause.
Ich durchmesse meine geräumige, kahle Wohnung. Ich laufe durch alle Zimmer, hebe den Telefonhörer ab, lege ihn zurück auf die Gabel. Ich ziehe meine mit rotem Autolack bemalten, drei Nummern zu großen Springerstiefel aus, komme zum Ergebnis, dass sie nicht mehr zu mir passen, werfe den linken aus dem Fenster, hänge den rechten an die Decke, als Kunstprojekt, laufe weiter durch die Wohnung, jetzt auf Socken.
Ich öffne die Tür zum kleinen Zimmer, in dem Konrad sitzt und kifft, und sage:
Raus.
Konrad sieht mich traurig an. Oder leer. Oder stoned. Dann geht er. Drei Monate hing er mir jetzt auf der Pelle. Das reicht.
Nachdem Konrad weg ist, hängen die süßlichen Kiffschwaden noch eine Weile im kleinen Zimmer. Ich setze mich auf den Boden und trinke den Rest aus dem Tetra Pak Rotwein, das noch irgendwo rumstand, Domkellerstolz, mit einem Mönch mit roter Nase drauf.
Dann fange ich an zu weinen.
Scheiß Heroin.
Aber wer weiß, ob das der wirkliche Grund für Timos Abgang war. Gründe, Nein zum Leben zu sagen, gibt es schließlich genug. Vielleicht hatte er einfach schon mit Mitte zwanzig die Schnauze voll, vom Atmen, von der Sonne, von den Frauen, von den ewigen Entscheidungen. Leben, denke ich, ist vor allem eines: sehr, sehr anstrengend, und lasse mich rücklings auf den versifften Teppichboden fallen, der schon drin war, als ich einzog, und der bleiben wird, für immer, ich weiß es. Für eine Aufhübschung meiner Wohnstatt bin ich zu erschöpft.
Der letzte Blick in sein Gesicht: Als wir uns erfolgreich zu ihm durchgefragt hatten, an seine Tür klopften und da dann standen, hilflos wie zwei Zeugen Jehovas. Mir geht’s nicht so gut, kommt morgen wieder, sagte das bleiche Gesicht, bevor die dazugehörigen Hände uns die Tür vor der Nase zuschlugen. Keine Frage, er war wieder drauf. Im Oma-Café um die Ecke, das wir unter den feindseligen Blicken der Omas betreten hatten, die wohl mit unserem Stil nicht klarkamen, berieten wir, was zu tun sei. Ich war dafür, sofort Hilfe zu holen, Konrad sagte: Lassen wir ihn in Ruhe; er braucht seinen Raum.
Den Raum, den hat er sich ja jetzt genommen.
Ich nehme meine Wanderungen durch die Bude wieder auf und statte den Highlights meiner Mülllandschaft einen Besuch ab: dem dreckverkrusteten Ofen. Den mit durchgerissenen indischen Tüchern zugehängten Fenstern. Dem Klamottenmeer mit seinen Klippen aus malerisch gestapelten Müllsäcken. Den Büchertürmen neben dem Bett, die vom Teppichboden hinauf an die sehr weit entfernte Decke ragen. Manchmal weht nachts ein Geist vorbei, dann fällt einer der Türme polternd um und begräbt mich unter mehreren Bänden scharfkantiger Beatliteratur.
Ich besuche den kaputten Wasserhahn. Wenn ich die Klospülung drücke, spritzt ein Wasserstrahl vom Spülbecken in der Küche gegen den schimmligen Kühlschrank.
Kleine, schwarze Käfer leben mit mir. Manche mögen Holz, manche lieber Dreck. Sie sind nicht die einzigen Mitbewohner: Neuerdings wohnt auch eine Taube im Klo. Ich besuche die Taube und sage: Hallo, Taube. Die Taube grüßt nicht zurück.
Nackte Glühbirnen an schmucklosen Strippen: edelste Existenzialisten-Wohnkultur von der Stange.
Im Keller hab ich zwei safrangelbe Autositze gefunden; in ihnen sitzt es sich ganz gut. Man kann in ihnen sanft hin und her schaukeln, während leise die Holzwolle aus den Löchern rieselt. Von irgendwoher rollt mir eine alte Flasche Oettinger entgegen. Ich öffne sie und kippe mir den Inhalt versonnen in den Hals.
Der Tag tot, die Nacht noch nicht geboren, reizloses Zwischenreich, das am besten weggesoffen sein will. Ich bleibe in meinem Sitz sitzen und blase ein tiefes Uhhh in meine leere Flasche. Ich könnte in die Bar ohne Kühlschrank schauen. Die Bar, die einfach Bar heißt, eine Schlichtheit und Reduktion aufs Wesentliche, die mir gefällt. Ein Loch im Kiez, hinein in einen noch schmutzigeren Siff, mit Sperrmüllsofas ausgestattet. Die Bar ohne Kühlschrank serviert lauwarmes Bier und lauwarmen Wodka für je eine Mark, an guten Tagen auch richtige Drinks. Ein paar Besetzer betreiben sie, Freaks, die eine noch viel längere Fluchtroute aufweisen können als ich, die sich nach Berlin aufgemacht haben, um wer weiß was für haarsträubenden Verhältnissen in Russland, Frankreich, Amerika, Irland oder Brasilien zu entkommen.
Manchmal fliegen Geschichten durch den Raum, Geschichten von prügelnden Eltern, Armut und Elend, aber oft bestehen die Geschichten auch aus der altbekannten Klage über Spießigkeit und Geistesenge, Küche, Kammer, enge Welt, so entsteht kein Held singen die Puhdys und singen somit unsere Hymne, die Hymne all jener, die zu wild oder zu zart für ein angepasstes Dasein sind, die bei der Aussicht auf den vorgestanzten Lebensweg unter freundlichen, beschränkten Normopathen in einem beliebigen Provinzkaff eine Beklemmung in der Brust spüren und besser ihr Bündel packen und sich trollen; nichts wie weg hier, bevor dir das Realitätsprinzip das Hirn aus dem Schädel frisst.
Die Kundschaft ist vielfältig: Vom Kierkegaard zitierenden Edelbohemien über minderjährige Punks, die meist im Rudel auftreten, bis hin zum letzten, zahnlosen Asi, der kaum imstande ist, seinen Namen zu artikulieren, findet hier jeder seinen Platz.
Gestern saß ein Clown am Tresen, der die hässliche Fratze der Erinnerung an den Stunden vorher nur mit Mühe überstandenen Kindergeburtstag mit etlichen lauwarmen Gin Tonics zu vertreiben suchte. Um fünf fiel er vom Hocker; Punks stiegen über ihn, Hunde beleckten sein Ohr.
Aber mir ist nicht nach Gesellschaft. Ich denke an Timo und schaue aus dem Fenster, ins kahle Draußen, wo inzwischen ein Schneesturm tobt. Der erste Mann, der jemals in mir war. Mit seinen Vorgängern nur Geknutsche und halbgares Fummeln, aber für ihn war ich richtig entbrannt. Und das leider nicht als Einzige. Dann ist er nach Berlin gezogen. Das ist schon Jahre her, ferne Zeiten, in denen die Welt klein war und ich ahnungslos, sich die Zukunft noch bedeckt hielt und Konrad noch auf Jungs stand.
Timo, von uns allen der Begabteste, der in seinem zum Atelier umgemünzten Mini-Erdgeschosszimmer wilde Farbkreationen auf die Leinwand warf –
Timo, der mal einen ganzen Tag lang in der Fußgängerzone in einer Baumkrone saß, Sitzstreik, Protest gegen eine unerwiderte Liebe, und es damit zwar nicht schaffte, das Zurückgeliebtwerden zu erzwingen, aber immerhin, dass die Angebetete abends mit einem heißen Tee und einem Lächeln vorbeikam –
Timo, der wusste, dass den Wagemutigen die Welt gehört, denen, die sich zeigen und entblößen und zum Affen machen, die auf die Maske der Coolness spucken und das Urteil der Welt nicht fürchten, denn freedom is just another word for nothing left to lose –
Timo, der Einzige von uns, der der Staatsgewalt die Stirn bot, der die Bullen, die wegen nächtlicher Ruhestörung bei ihm einritten, weil er die Anlage wieder mal auf Maximum Boost hatte, freundlich begrüßte, ich bin Aquarius, und ihr seid Idioten, darf ich euch trotzdem einen Schnaps anbieten? –
Timo, der aufgebrochen war, um in der Großstadt sein Talent zu entfalten, der uns bei seinen seltenen Heimatbesuchen anschrie, was macht ihr hier noch, was sitzt ihr hier in Kleinkackhausen auf euren Ärschen und lasst das Leben an euch vorüberziehen, und wundersame Märchen erzählte von besetzten Häusern und riesigen Fabriketagen für hundertfünfzig Mark, von schrägen Typen mit freien Hirnen und strahlenden Augen, von Partys in Kellerbars und endlosen, erregten Debatten auf löchrigen Dächern, von Nacht und Sex, Exzess und Poesie –
Timo, in den alle verliebt waren, auch Konrad, bis der dann die Eine traf und Herz und Libido dem weiblichen Geschlecht öffnete und fürderhin vom Sog der Timo-Kraft gerettet ward –
Bis die Eine Konrad sitzenließ und Konrad nach Berlin kam und sich bei mir einnistete.
Aber jetzt ertrage ich sein bekifftes Engelsgesicht nicht mehr. Die Stadt ist groß. Er wird schon einen anderen Ofen finden, an dem er sich wärmen kann.
Und Timo, Timo liegt unter der Erde und wird von Würmern angefressen. Die Puren und Ungeschützten und Radikalen springen über die Klinge vor ihrer Zeit und lassen uns mit den Lauwarmen allein. Ich bin nur dankbar, dass ich nicht diejenige war, die ihn finden musste. Ein Timo, der nicht quicklebendig wie ein junger Faun zwischen seinen Farbtöpfen herumspringt und alle mit seinem Charme betört, sondern ein Timo, der in einem schwarzen Zimmer in einem besetzten Haus tot von der Decke baumelt – nein, danke, muss ich nicht sehen. Die Henker dieser Erde behaupten ja, dass ihren Opfern bei Genickbruch noch ein Letzter abgeht. Es wäre ihm zu wünschen, er kam gern. Na ja, wahrscheinlich kommt jeder gern, nur bin ich bei den meisten nicht dabei und kann mich demnach nicht in ihre verzückten Gesichter verlieben.
Dass Timo jetzt weg ist für immer, übersteigt meine Vorstellungskraft. Der Tod übersteigt meine Vorstellungskraft. Aber vielleicht ist Altwerden ja auch überbewertet.
Ich stehe auf, nehme den Fernseher fest in meine Arme, trage ihn ein wenig herum und werfe ihn aus dem Fenster. Das gehört sich so; das ist Rock ’n’ Roll.
Morgen werde ich mich neu erfinden.
Es scheint eine verheißungsvolle Sonne. Beschwingt betrete ich den Bildungsbunker. Gewusel taschenbehängter Leiber, die Steinfiguren schweigen erhaben. Ich spüre schon wieder eine Mundtrockenheit, verdränge sie aber tapfer und laufe durch die Flure, auf der Suche nach dem richtigen Raum für das Einführungsseminar Alte Geschichte. Je näher ich dem Seminarraum komme, desto schwindliger wird mir. Außerdem zieht sich mein Magen zusammen, mir ist, als müsse ich mich gleich übergeben. Zu der Übelkeit gesellt sich nun auch noch eine Atemnot, mir bricht Schweiß aus, das Herz rast. Alles, alles psychosomatisch, sage ich mir und laufe weiter. Vor dem Seminarraum stehen sie schon und warten. Stehen da mit ihren Taschen, lachen und plaudern, als sei es das Normalste der Welt. Ich stelle mich dazu, verleugne meinen Zustand, tu so, als sei ich eine von ihnen, gebe mich als zugehörig aus, verstecke mich vor mir selbst in der Herde, spiele das weiße Schaf. Ein paar Minuten halte ich durch, aber als sich die Tür öffnet und die Herde in den Raum drängt, gebe ich auf und renne aufs Klo.
Raus hier, raus hier, raus hier.
Ich haste mit langen Schritten aus der Uni, in einem gerade noch so als entspannt durchgehenden Tempo. Ich will ja keine Aufmerksamkeit erregen. Als ich den gebührenden Sicherheitsabstand erreicht habe, ziehe ich mein Päckchen Vietnamesen-West aus der Tasche, klopfe eine Kippe raus, zünde sie an, nehme einen tiefen Zug: Erlösung. Ich schlendere Richtung U-Bahn, plötzlich hab ich’s nicht mehr eilig, werde vom Flüchtenden zum Flaneur. Mit jedem Meter, der sich zwischen mich und das Gebäude des Grauens legt, fühle ich mich leichter. Es ist, als zöge ich mit jedem Zug frischen Lebensmut in meine Lungen.
Immerhin, ich hab’s versucht.
Die Sonne, verstehe ich jetzt, scheint auch nicht verheißungsvoll, sondern grausam; ihre Strahlen sind heute extra gleißend, um mir meinen missratenen Versuch besonders deutlich auszuleuchten. Mich überkommt eine radikale Wut. Was, wenn du diejenige bist, die falsch ist? Schon mal daran gedacht?, schnauze ich die Sonne an. Wirklich. Wann hätte je irgendetwas Überwältigendes in deinem Beisein stattgefunden? Die Geburt welcher Großartigkeiten geht noch mal auf deine Rechnung? Gute Dinge ereignen sich immer nur im Mondlicht. Die Sonne hasst jeder, weil sie für alles zu Vermeidende steht. Arbeit. Mühsal. Rechnungen zahlen. Ja, Knechtschaft und Sklaverei sind sonnenbeschienen.
Wohingegen der Mond alles bescheint, was Spaß macht. Lachen. Lieben. Gartenpartys. Fremde, heiße Haut.
Es ist zu hell für wahre Größe. Ich fahre nach Hause.
In der U5 steht plötzlich Janek vor mir.
Ich mache das verdutzte Gesicht, das man macht, wenn Leute an für sie nicht vorgesehenen Orten auftauchen. Dann werde ich etwas verlegen, was mir ständig bei Jungs passiert, die ich schon mehrfach als erotische Inspiration missbraucht habe, weil ich denke, dass man mir das ansieht. Aber woran, bitte, soll man das sehen? Ich seh ja auch nicht, wer sich alles auf mich einen runterholt.
Janek hängt seinen biegsamen Jungskörper lässig in die Halteschlaufe. Sein Rabenhaar ist länger als früher, was ihm gut steht. In der Provinz hab ich ihn manchmal mit Konrad im Schrottvogel gesehen, er stand elegant und appetitlich im Trockennebel und rauchte oder trank oder grinste oder sprach mit Mädchen und nahm mich kaum wahr. Ich war zu klein, zu jung, zu dumm. Jetzt bin ich bemerkbar. Wurde auch Zeit.
Was machst du denn hier? Originelleres fällt mir nicht ein. Eine blöde Frage, da jeder, der halbwegs bei Sinnen ist, früher oder später hier landet. Janek lacht. Ein schönes Lachen, offen und frech. Ich will es sehr dringend häufiger sehen, in allen denkbaren Lagen, zu allen denkbaren Zeiten.
Ich wohne hier. Also, bald. Aber erst mal geh ich nach Indien, für ungefähr ein Jahr. Ich muss hier jetzt raus. Gib mir deine Nummer, ich meld mich, wenn ich wieder da bin.
Schnell fummele ich einen Stift aus der Tasche, reiße dem armen Jack ein Stück Rückseite aus der Taschenbuchausgabe von Desolation Angels und schreibe meine Nummer darauf. Janek greift nach dem Zettel, sagt: Schön, dich getroffen zu haben, bis dann, grinst, winkt, springt aus der Bahn, ist weg.
Indien.
Ich male mir unser Leben aus, in einem Jahr, wenn Janek zurück ist. Er wird die Reise überstanden haben, ohne zu einem dieser dumm schwätzenden Pseudo-Erleuchteten geworden zu sein. Im Gegenteil, die Reise hat ihn weitsichtig und erfahren gemacht. Und noch schöner, falls das überhaupt geht. Er hat durch das Herumklettern im Himalaya Muskeln entwickelt, sein Shirt spannt sich über den leicht gebräunten Oberarmen, er riecht nach Sonne, Sex und Zukunft.
Auch ich habe mich in diesem Jahr entwickelt. Ich bin faszinierend und belesen und trage nur noch bodenlange Seidenkleider, die mir wahnsinnig gut stehen. Wir werden unzertrennlich. Bei Tag stromern wir durch die Straßen auf der Suche nach irgendeinem Blödsinn, den wir unternehmen können. Bei Nacht nimmt er mich so gekonnt, wie es nur ein Indienheimkehrer vermag, denn eine versaute indische Geliebte, die schon viele, viele Männer in die Liebeskunst einführte, hat ihm das gesamte Kamasutra beigebracht. Am Ende war er so gut darin, dass sie zugeben musste, noch kein Westlicher vor ihm habe dieses Niveau an Geschicklichkeit je erreicht. Nach dem Lustrausch rauchen wir, und ich lese ihm aus Charles’ Tagebuch vor. Charles hat nichts dagegen, denn genau für solche wie uns hat er es geschrieben, für erschöpfte Liebende am Rande der Nacht, an genau solche wie uns dachte er, als er in seiner Mansarde in Paris saß und sich die Wartezeit auf die schwarze Hure, auf die er so versessen war, mit Schreiben erträglich machte.
Station Biesdorf-Süd, fuck. Ich bin, berauscht von der Begegnung, vier Stationen zu weit gefahren. Ich steige aus und schaue mir die Gegend an, ein Fehler. Und am sechsten Tag war Gott auf schlechtem Koks und erschuf Lichtenberg. Schnell mache ich kehrt und steige wieder in die U-Bahn, entgegengesetzte Richtung.
Ich kaufe mir ein paar Biere, gehe nach Hause, lege mich ins Bett und warte auf die Dämmerung. Weil das zu lange dauert, stehe ich wieder auf, setze mich in die Küche, an den Tisch aus weißem Plastik mit dem Loch in der Mitte für den Sonnenschirm, den Chrissy mir von der Terrasse des Bella Napoli geklaut hat, und betrachte die Schimmelkulturen um mich her mit stiller Solidarität.
Eine Angst steigt in mir auf. Angst, die sich zu Gewissheit aufbläht, dass sie mich kriegen werden.
Ich werde einen Fehler machen. Einen fundamentalen, unumkehrbaren Lebensfehler. Ich werde ihnen auf den Leim gehen. Sie werden mich einfangen, einsargen, kaltstellen. Ich werde nicht die sein, die entkommt, ich werde zu denen gehören, die es nicht geschafft haben, zu denen, die rauswollten, doch auf der Flucht über ihre Schnürsenkel stolperten und auf die Fresse fielen. Ich werde, kaum gestartet, untergehen. Ich springe auf und renne in den noch immer nicht verreckten Tag, marschiere die üblichen Straßenzüge entlang, panisch und verwirrt. Es wäre dringend nötig, runterzukommen, sich zu beruhigen, eine neue Sichtweise auf die Dinge zu entwickeln, aber wie, wie soll ich das denn schaffen, bitte?
Keine Krankenversicherung. Keine Meldeadresse. Auf der Straße leben. In der Anonymität verschwinden. Das wär vielleicht die Rettung. Freiheit lockt, aber ich wittere auch dort eine Falle.
Ich gehöre nicht zu ihnen.
Nicht zu den Mädchen mit den fetten Ritznarben auf den Armen, deren Rumgevögel keine Lebensfreude zugrunde liegt, sondern irgendein Onkel, Vater, Stiefvater, der besoffen seine dumpfen Tage mit ein bisschen Vergewaltigung versüßte. Nicht zu den Straßenjungs, diesen armen Kreaturen mit Hund und Hautausschlag, die nicht aus Posertum auf der Straße leben, sondern weil sie sonst nirgendwohin können; weil es den Ort, an dem jemand auf sie wartet, nicht gibt.
Aber ich gehöre auch nicht zu den Bildungsbürgerkindern, die sich ab und zu hierher verirren und so tun, als wären sie vom selben Schlag. Ein, zwei Jahr verfilztes Haar, dann flugs heim in den höheren Sozialstatus, wo es kuschlig ist und gut duftet und alle Geburtsglücksschweine im Chor deinen Namen grunzen. Während die echten Asis leider hierbleiben müssen. Für immer.
Und ich? Ich gehöre nirgendwohin. Jeder bleibt mir fremd. Versuche ich, mir einen Vertrauten zu entwerfen, einen, in dessen bedingungslosem Verständnis ich mich aufgehoben fühlen könnte, dann manifestiert sich gerade nur ein Wesen vor meinem geistigen Auge: der Junge mit dem Rabenhaar, den ich vorhin in der U-Bahn traf. Ich weiß, wie dumm das ist. Er kommt zwar aus demselben Kaff wie ich, aber wir waren füreinander nicht viel mehr als verschwommene Gestalten im Bildhintergrund. Ich kenne ihn nicht. Er kennt mich nicht. Aber dennoch lässt mich die Hoffnung nicht los, dass er es sein könnte. Der eine. Der Große Verbündete, nach dem ich schon mein Leben lang suche. Ich glaube nicht an Wunder, aber ich glaube an die Gunst des Zufalls, die Chuzpe des Weltgeists und die Erhabenheit des Augenblicks. Und vielleicht, vielleicht war das vorhin ja so was Derartiges; vielleicht hat uns der Weltgeist zugezwinkert.
Chrissy und Zoe sitzen in der Bar und schimpfen. Sie sind im Krieg mit ihren Nachbarn, einer Bande Franzosen, die gern in ledernen Nazi-Mänteln durch den Kiez stolzieren und sich für Westernhelden halten. Die beschwerten sich über den Gestank im Hof, der davon kommt, dass Chrissy und Zoe nachts in Tetra Paks pinkeln, da ihnen besoffen der Weg zum Klo zu weit ist, und die dann morgens aus dem Fenster werfen. Seitdem heißen sie Les Mesdames Pipi und bekamen von den Franzosen ein Katzenklo vor die Tür genagelt. Woraufhin Chrissy und Zoe in Signalrot VOM BESATZER ZUM BESETZER an die Hauswand sprühten. Woraufhin Laurent Chrissy Eva Braun nannte. Woraufhin Chrissy Laurents Küche zertrümmerte. Woraufhin Laurent, Jean und Eric Chrissy die Treppe runterwarfen. Woraufhin Zoe alle drei mit einem Hexenfluch belegte. Woraufhin erst mal Waffenstillstand eintrat. Es könnte sich genauso gut um einen Nachbarschaftsstreit in Hinterfuckingen handeln oder Sanktödersterbing, wo Bürger Maier aus Wut über Bürger Müllers Eiche, die ihm die Sonne von der Veranda klaut, Bürger Müllers Hund vergiftet, und nicht um ein besetztes Haus in Berlin. Unter Großstadt hatte ich mir anderes erhofft.
Elegante Exzentriker mit gewagten Empfindungen. Freigeister, die mit revolutionären neuen Ideen und frischen Moralvorstellungen aufwarten. Nicht aber diesen dörflichen Kleingeist, der auch noch die letzte Besetzerseele zu durchdringen scheint. Wahrscheinlich haben die vielen Christopher-Isherwood-Romane meine Vorstellungswelt versaut, mich in die Falle gelockt, mir einen Glitzer versprochen, der sich bei genauem Hinsehen als rentnerbrauner Straßenstaub entpuppt.
Ich komme nach Hause, er kauert da.
Sein in stinkende Fetzen gehüllter Körper, sein verbeultes Gesicht, seine schwarzen Locken.
Keiner beherrscht die Kunst des Kauerns besser als Lennard. Er kauert in Hauseingängen und in Hinterhöfen, auf Bordsteinen und Barhockern. Oder, wie jetzt, auf Treppenabsätzen. Er kauert und trinkt, trinkt und kauert, denkt nach, ist sich selbst genug.
Während ich die Tür öffne, schultert Lennard seine Berlinale-Tasche, die Oettingerflaschen scheppern. Es hat keinen Sinn, ihn rauszuschmeißen, morgen ist er wieder da, wie ein Vampir, den man in einer schwachen Minute über die Schwelle bat und nun nie mehr loswird. Gut, dass ich diese Autositze im Keller gefunden habe, da kann ich Lennard sogar einen Sitzplatz anbieten. Ich gehe mit einem Roman schwanger, aber ich glaube, ich treibe ab, sagt Lennard. Er fummelt seinen Tabak aus der Jackentasche und dreht uns krumme Zigaretten. Er berichtet von seinem gescheiterten Versuch, sich mit seinem alten Presseausweis freien Zutritt zur Nan-Goldin-Ausstellung zu verschaffen. Sein Ausweis ist ein von der Kleinen Zeitung ausgestellter, ranziger Lappen und seit sechs Jahren abgelaufen. Es klebt ein Foto von ihm drauf, das ihn in dem sauberen, nahezu intakten Zustand zeigt, in dem ich ihn nie kennengelernt habe. Er war also wirklich mal ein echter Journalist. So, wie er wirklich mal einen echten Drehbuch-Preis bekommen hat für ein echtes Drehbuch, das nie verfilmt wurde. Behauptet er. Und es gibt, behauptet er, einen von ihm verfassten Essay über Werner Schwab in einer Anthologie. Mag wahr sein, hilft ihm jetzt aber auch nicht weiter.
Lennard will nach Mexiko. Wegen Malcolm Lowry.
Lennard schwärmt von der aparten Magersüchtigen, die er neulich in der Bahnhofsmission kennenlernte. Je kaputter eine ist, desto größer ist ihre erotische Wirkung auf ihn. Leider funktioniert diese Verzauberung andersrum nicht so gut, und Lennard sieht bereits ziemlich kaputt aus.
Inzwischen hat er sich aus dem Sitz erhoben und schlurft mit seinem Oettinger in der Hand durch die Wohnung. Er legt den Kopf schief und betrachtet die Rücken meiner gen Decke gestapelten Bücher. Er kommentiert einige Werke mit höhnischem Mundwinkelzucken, andere mit freudigem Auflachen. Er fummelt behutsam einen Band aus einem der Büchertürme, erstaunlicherweise, ohne den Turm zum Einsturz zu bringen, presst ihn an die Brust und sagt: Leih ich mir mal.
René Crevel, Der schwierige Tod.
Ich nicke und nehme still vom Buch Abschied. Lennards Verhältnis zum Gegenstand ist sehr entspannt. Leiht man ihm was, so kann man es in der Regel als Spende ans Universum betrachten. Hat man Glück, bekommt man es wieder, allerdings sieht es dann aus, als sei es einmal quer durch die Hölle gereist.
Ich geh ins Kino. Kommst mit?
Ich schüttle den Kopf. Lennard winkt schlaff mit dem Buch und geht.
Ich stelle mir Lennard in Mexiko vor. Wie er staubige Landstraßen entlangschlurft, die Berlinale-Tasche mit Bieren gefüllt, auf deren Etiketten unaussprechliche Namen stehen, Pxcptl, Xhuascxl, wie er einsam in Kaschemmen trinkt, auf der Suche nach dem mystischen Etwas, dem Land hinter den Spiegeln, dem großen, heiligen Spiritus, Schutzpatron der Säufer und Literaten. Ich sehe vor mir, wie er ausgeraubt wird und am Ende, man ahnt es, ermordet, genau wie der Konsul in Unter dem Vulkan. Aber Lennard kriegt seinen mageren Anarchoarsch eh nie in ein Flugzeug. Davor stehen so viele Hürden, das Beschaffen des Geldes für ein Flugticket, der Kauf dieses Flugtickets, das Erreichen des Flughafens am richtigen Tag, ja, sogar zur richtigen Uhrzeit, und das auch noch nüchtern genug, um in die Maschine gelassen zu werden. Nein, das wird wohl nichts für ihn mit dem poetischen mexikanischen Tod.
Dass Fabi auch nie Ruhe gibt. Ständig muss man ihm was in den Mund schieben, damit er zufrieden ist, sagt sein Freund Simon und klingt dabei nur halb vergnügt.
Simon liegt auf dem Sofa und schaut Lindenstraße. Ich bin gekommen, um Fabian abzuholen, aber er ist noch nicht da. Ich setze mich zu Simon, was er gerade so duldet. Von Fabi weiß ich, dass Simon Frauen nicht besonders mag. Eine Weile schweigen wir.
Gestern hab ich aus Wut auf Fabi sechs Biere getrunken, sagt Simon. Und natürlich prompt gekotzt, wegen der Medikamente.
Früher war Simon Koch. Jetzt ist er Fernsehzuschauer. Zum Ausgehen ist er zu schwach.
Immerhin bin ich noch da, sagt Simon und lacht ein eher schrilles Lachen. Was man vom Großteil meiner Jugendfreunde nicht sagen kann.
Fabian macht immer einen unheimlichen Terror, wenn ich’s ohne Kondom getrieben habe. Dann schreit er herum wie ein Irrer. Glaub bloß nicht, dass dich dein Hetentum vor AIDS schützt, zeterte er kürzlich, obgleich ich solcherlei nie behauptet habe. Glaub bloß nicht, dass du nicht auch Risikogruppe bist. Ich sagte nichts, dachte aber, falsch. Ich bin überhaupt keine Gruppe.