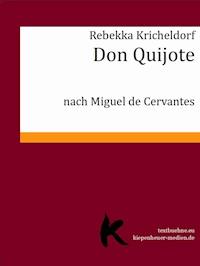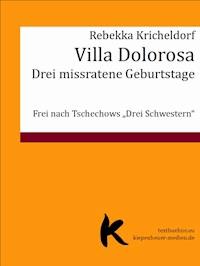19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alexander Verlag Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was wäre angemessener, als im Theater gemeinsam über uns selbst, das Leben und den Tod zu lachen? Vehement und präzise verteidigt Rebekka Kricheldorf die Komik im Theater. Sie erläutert ihren spezifischen Beitrag zum Theater der Gegenwart, der Figuren aus der Märchen- und Mythenwelt, aus Popkultur und Comic aufgreift, der Verstörung erzeugt und Ambivalenzen sucht – Gebrauchsdramatik statt Literatur für die Ewigkeit. Ergänzt wird der Band um Werkstattberichte und Erläuterungen zu dem mitabgedruckten Stück Werwolf. Eine Mythengroteske (UA 2019) sowie ein Nachwort des Herausgebers. Das Buch basiert auf Rebekka Kricheldorfs Vorlesungen im Rahmen der 8. Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Rebekka Kricheldorf, Dem Tod ins Gesicht lachen
Rebekka Kricheldorf, 1974 in Freiburg im Breisgau geboren, studierte Romanistik an der Humboldt-Universität Berlin und Szenisches Schreiben an der Hochschule der Künste Berlin. 2004 war sie Hausautorin am Nationaltheater Mannheim und von 2009 bis 2011 Dramaturgin und Hausautorin am Theaterhaus Jena. Von 2013 bis 2019 war sie als Jurorin für den Osnabrücker Dramatikerpreis tätig. Sie schrieb zahlreiche Auftragswerke für verschiedene Theater, u. a. das Staatstheater Kassel, das Deutsche Theater Göttingen und das Deutsche Theater Berlin. Sie erhielt mehrere Stipendien und Preise, z. B. den Verlegerpreis und den Publikumspreis des Heidelberger Stückemarkts, den Kleist-Förderpreis, den Schiller-Förderpreis des Landes Baden-Württemberg und den Kasseler Preis für Komische Literatur, sowie mehrere Einladungen zu den Theatertagen in Mülheim und den Autorentagen in Berlin. 2020 schrieb sie ihren ersten Roman, Lustprinzip. Rebekka Kricheldorf lebt in Berlin.
Johannes Birgfeld, geb. 1971, ist nach Lehrtätigkeiten in Bamberg, Sewanee (TN/USA) und Oxford Studiendirektor i. H. an der Universität des Saarlandes für Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Initiator der Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik. Forschungen zur deutschsprachigen Literatur vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart sowie zur Geschichte von Drama und Theater.
Rebekka Kricheldorf
Dem Tod ins Gesicht lachen
Ein Plädoyer für Komik und die Feier des Absurden im Theater
Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik
Mit einem Nachwort herausgegeben von Johannes Birgfeld
In dieser Reihe sind bereits erschienen:
Albert Ostermaier: Von der Rolle oder: Über die Dramatik des Verzettelns
She She Pop: Sich fremd werden. Beiträge zu einer Poetik der Performance
Falk Richter: Disconnected. Theater Tanz Politik
Milo Rau: Das geschichtliche Gefühl. Wege zu einem globalen Realismus
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Fachrichtung Germanistik an der Universität des Saarlandes.
Der Abdruck des Stückes Werwolf. Eine Mythengroteske erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebs-GmbH, Berlin. Aufführungsrechte liegen bei der Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebs-GmbH und müssen dort eingeholt werden.
(www.kiepenheuer.medien.de)
Originalausgabe
© by Alexander Verlag Berlin, 2022
Alexander Wewerka, Fredericiastr. 8, D-14050 Berlin
[email protected] · www.alexander-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten.
Satz und Layout: Antje Wewerka
Umschlaggestaltung: Antje Wewerka
Umschlagfoto: Rebekka Kricheldorf (Privatarchiv)
Schlusslektorat: Christin Heinrichs-Lauer/Rahel Schäfer.
Dank an Amélie Müller
ISBN 978-3-89581-608-6 (eBook)
Erste Vorlesung
Über Komik
Zweite Vorlesung
Über verstörende Unterhaltung
Dritte Vorlesung
Über Werwölfe
Anmerkungen zu den Vorlesungen
Werwolf
Eine Mythengroteske
»Theater, das […] uns gemeinsam unsere Unzulänglichkeit zelebrieren lässt«
Mythenverwurstung und Schöpfungskritik, Gebrauchsdramatik und Theater als Lust: Rebekka Kricheldorfs Theater der verstörenden Unterhaltung
Nachwort von Johannes Birgfeld
Danksagung
Erste Vorlesung
ÜBER KOMIK
Liebe Anwesende,
ich gebe es gleich zu: Die analytische Selbstbefragung, die Suche nach Methodik und rotem Faden in meiner Arbeit, das Festlegen und Beschreiben einer künstlerischen Agenda ist meine Sache nicht. Oder, besser: war meine Sache – bisher – noch nicht.
Jetzt werde ich durch die ehrenvolle Auszeichnung mit der Saarbrücker Poetik-Dozentur gezwungen, nein!, ermuntert, ebendies zu tun, was mich in einen gewissen Konflikt stürzt. Denn ich wählte meinen Beruf nicht zuletzt deshalb, um das Tun von Erwachsenen-Tätigkeiten so gut es geht zu vermeiden. Schreiben bedeutet neben dem hehren Anspruch, Steigbügelhalter des Wahren, Schönen und Guten zu sein, eben auch: weckerlos leben, im Schlafanzug zur Arbeit kommen und den ganzen Tag mit selbst ausgedachten Freunden spielen.
Eine Dozentur ist das Gegenteil dessen. Sie ist eindeutig ein Erwachsenen-Job. Selbstreflexion, Theoriebildung, anderen erzählen, wie’s läuft, anständige Klamotten anhaben. So fühle ich mich gerade ein bisschen wie eine Figur aus einem Roman von Wilhelm Genazino, einer dieser nicht mehr ganz jungen Männer, die von ihrer Lebensgefährtin genötigt werden, irgendwas Pragmatisches zu tun, sich eine neue Hose kaufen oder einen ordentlichen Job suchen, und darauf mit einem Mix aus bockigem Trotz und zerknirschter Einsicht reagieren.
Hinzu kommt, dass ich eine gewisse Scheu davor hege, mich zu tief in die Innenschau zu begeben. Denn die Autorin ist nicht ganz frei von der etwas paranoiden Befürchtung, dass man einen Preis dafür zahlt, seine eigene Arbeit zu gut zu durchschauen. Dass das Zu-Gut-Bescheid-Wissen über die eigenen Kniffe, Tricks und Beweggründe zu einer trügerischen Sicherheit und gefährlichen Routine im eigenen Schaffen führen könnte. Andererseits ist nicht von der Hand zu weisen, dass man als schreibende Person im Laufe der Jahre Eigenheiten ausbildet, wiedererkennbare Obsessionen pflegt, einen Stil, eventuell gar eine Handschrift entwickelt, die dann auch kenntlich und beschreibbar sind. Und vielleicht ist ein wenig Selbsterkenntnis ja doch auch ganz hilfreich.
Ich gebe auch zu, dass mich Kollegen-Berichte aus der Schreibwerkstatt oft langweilen. Und mein Glaube daran, dass die meisten Texte klüger sind als ihre Autoren, ist unerschütterlich. Ja, oft bestätigt sich sogar die Regel, je interessanter das Werk eines Autors, desto langweiliger das, was er darüber zu sagen hat, und möglicherweise andersrum.
Ich werde den Kopf aus der Schlinge dieses Dilemmas ziehen, indem ich diese Vorträge exakt so halte, wie ich meine Stücke schreibe. Ich schreibe meine Stücke, ja, ich gestehe es, hauptsächlich, um mich selbst bei Laune zu halten. Keine aufklärerische Mission, kein ausgefuchster Weltenrettungs-Plan steckt dahinter, sondern reiner, kleiner Egoismus. Ich schreibe, was ich schreibe, selten in dem Glauben, es könne etwas bewirken, sondern meist, weil ich es schreiben muss, für mich; weil die Weltaneignung, die Verarbeitung der Existenz-Fragen, die ich nicht beantworten kann, für mich nur über Literarisierung zu bewerkstelligen ist. Ja, das ist fast schon therapeutisches Schreiben.
Ich verstehe meine Stücke als Suchbewegungen, als Sprach- und Denk-Experimente, an denen eine interessierte Öffentlichkeit gern teilhaben darf, sofern sie glaubt, es könne da ein Gemeinsames in unserem Hadern und Zweifeln geben. So werde ich auch hier keinen stringenten Gedanken entwickeln, der am Ende in ein großes, klar umrissenes Fazit mündet, sondern mich mäandernd durch Themengebiete bewegen, wie ein Affe von Ast zu Ast schwingen, vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen und retour.
Ich habe mich nie ernsthaft mit Zweck, Form und Ziel meines Schaffens auseinandergesetzt. Im Zuge sich häufender Fremdzuschreibungen verfestigte sich dann mein Selbstbild als ›Komödiantin‹ und ›Märchentante‹. Natürlich sind beide Zuschreibungen nicht abwegig. Sowohl Komödie als auch Märchen spielen eine große Rolle in meinen Stücken, aber manchmal wird es mir bei dieser eingeschränkten Sicht auf mich selbst doch etwas unbehaglich. Es ist ein Unbehagen, das sich aus derselben Quelle speist wie das, was mich immer davon abhielt, eine Visitenkarte drucken zu lassen, mit mir herumzutragen und bei passenden Anlässen sogenannten wichtigen Menschen in die Hand zu drücken. Mit so einer Pappkarte in der Tasche, auf der schwarz auf weiß steht, wer ich bin und was ich mache, eine Pappkarte, geschmackvoll-selbstironisch gelayoutet, vielleicht in Form einer Schreibmaschine, mit einer solchen Pappkarte, so argwöhnte ich, sperre ich mich endgültig in den Käfig eines Identitäts-Entwurfs, bin ich rettungslos dazu verdammt, das, was ich behaupte zu sein, in alle Ewigkeit zu bestätigen, mein zur Marke, zum Label, zum Branding gewordenes Ich mit seinen immer gleichen Unique Selling Points zu reproduzieren, ein One Trick Pony, das immer und immer wieder über dieselbe, von ihm selbst aufgebaute Hürde springen muss.
Vor vielen Jahren bezeichnete mich ein Kritiker als eine Vertreterin des »deutsche[n] Plüschhasentheater[s]«.1 Das fand ich gut, darin fühlte ich mich erkannt, auch wenn bis dato nur ein einziger Hase in meinen Stücken auftauchte,2 möge er nun Plüsch tragen oder nicht, ein Hase, der sich sehr wichtig nimmt, ein Hase, der empört erklärt,
Eine Welt ohne Hasen
Wäre besser gar nicht erschaffen
Eine Welt ohne Hasen
Ist ein sinnentleerter Planet
Eine Welt ohne Hasen
Ist das Traurigste
Was man sich denken kann.
und so dem hegemonialen Anthropozentrismus die aus Hasen-Perspektive einzig vernünftige Theorie entgegenhält, nämlich die von der eigenen Spezies als Krone der Schöpfung.
Also, wenig echte Plüschtiere in meinen Stücken, aber die Assoziationskette, die Menschen in Tierkostümen auslösen, passt ganz gut zu meinem Autorinnen-Selbstbild.
Mein erster Vortrag wird sich mit der Komik befassen, denn ich fühle, dass die Komik dieser Tage ganz besonderen Schutz benötigt. Das Spektakel, die Farce, die Verstellung, das Absurde, die Albernheit und das Lachen – sie alle müssen in dieser Zeit der Eindeutigkeit, des Authentizitäts-Wahns und des Verlusts des zweideutigen Sprechens mit aller Kraft verteidigt werden. Und, ja, wenn es sein muss, auch analysiert, ergründet, erklärt.
Komik. Ein großes Wort, ein weites Feld. Zur Komik gaben schon viele geistreiche Menschen Kluges von sich; ich werde mir herauspicken, was mir wichtig zu sein scheint, und anderes unter den Tisch fallen lassen. Komödien-und Lachtheorien trieben mich nie um, sie sind bei Bedarf in den Nachschlagewerken nachzuschlagen.
Das hier wird eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit der Komik, weshalb ich weit in der Zeit zurück gehe, tief in die Mottenkiste der autobiografischen Anekdoten greife und dieses selbstgeschriebene Gedicht herausfische. Es geht so:
Es lebte einst
ich weiß nicht wo
ein Mensch
der hieß Gorilla Joe
er war nicht schön
er war nicht klug
doch Haare hatte er genug
die hingen tief ihm ins Gesicht
so sah er nie das Sonnenlicht.
Na ja, weder gelungen noch besonders originell. Ich habe es wohl so mit dreizehn, vierzehn Jahren verfasst. Es gehört zur Gattung der Schmähgedichte und war Teil eines Spiels, das mir und meinen Freundinnen ermöglichte, die Ödnis eines Schultages halbwegs unbeschadet zu überleben. Das Spiel ging so: Man nahm sich den jeweils aktuellen Favoriten der Freundin vor und schmähte ihn in Grund und Boden. Heute ist der kunstvoll ausgeführte Diss ein elementarer Bestandteil des Battle Rap, aber davon wussten wir noch nichts.
Es folgt ein weiterer Auszug aus einem Beispiel der Text-Gattung Schmährede:
»Sie, der in dieser Welt für gar nichts steht, der höchstens Krätze ist am Steiß der Natur, der so tief fallen wird, wenn ich ihm meine Unterstützung entziehe, daß ein Floh auf der Erde ihn nicht vom Pflaster unterscheidet, Sie sind so stinkend und schmutzig, daß man sich bei Ihrem Anblick fragt, ob Ihre Mutter Sie nicht durch den Hintern geboren hat. […] Auch ist Ihr Fleisch nichts anderes als unter der Sonne schrundig gewordene Erde, die dermaßen mit Mist gedüngt ist, daß Sie heute, hätte alles, was da gesät wurde, Wurzeln geschlagen, einen Hochwald auf den Schultern trügt.«3
Es handelt sich hier um einen öffentlichen Schmähbrief, gegen einen Herrn namens Soucidas gerichtet, und der ihn verfasste, kann sozusagen als Erfinder des Battle-Rap, also Eminems Ururahn angesehen werden. Er hieß Cyrano de Bergerac und lebte im 17. Jahrhundert, also kann ich meine albernen Schreibanfänge getrost in eine große, hoch literarische Traditionslinie einreihen.
Aber zurück zur lebenserhaltenden Funktion der Komik: Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann sehe ich mein junges Ich unter der Bank heimlich entweder lesen oder schreiben, also Witze kritzeln. Denn neben Schmäh-Gedichten gab es noch viele andere Formate: Bilderwitze, Kurzgeschichten in Geheimschrift, Lehrer-Karikaturen, Schwänke und Nonsens-Lyrik. Ich kritzelte im Laufe meiner Schulzeit ganze Waschkörbe davon zusammen und war sogar Herausgeberin einer Witzzeitung, mit der beeindruckenden Auflagenstärke von einem Exemplar.
Heute ist mir klar, was das war: Das frühe Trainieren einer Überlebensstrategie. Der Quatsch war aus der Not geboren. Der Not, diese hässliche, unzulängliche Realität, bestehend aus quälend ödem Schulalltag, dumpfen Mitschülern und uralten Lehrern, wenn ihr schon nicht zu entrinnen war, wenigstens mit satirischem Geblödel zu veredeln. Sowohl der Pseudo-Wichtigkeit der Schule, als auch dem schlecht behaupteten Ernst der Erwachsenenwelt das subversive Lachen des Unterlegenen entgegenzuschmettern. Denn schon damals ahnte ich, dass dieser Ernst nur ein großer Betrug sein kann, ein Schmierentheater zur Verleugnung der Tatsache, dass die Veranstaltung Leben eine komplett absurde ist.
»Humor«, meint der Psychiater Victor Frankl, »ist eine Waffe der Seele im Kampf um ihre Selbsterhaltung«,4 und er hat immerhin nicht nur die Schulzeit überlebt, sondern auch den Holocaust.
Humor als Waffe also. Der Machtlosen, Rechtelosen, Unterdrückten, Schwachen und Unfreien. Was Schüler meistens ja sind, denn sie werden gezwungen, sich an einem Ort aufzuhalten, an dem sie nicht sein wollen, Dinge zu tun, die ihnen fremd sind, und Dinge zu unterlassen, die sie gerne täten. Diesem Zwang kann mit vielen Strategien begegnet werden. Stille Anpassung. Offene Revolte. Oder eben Zurückschlagen mittels Komik.
Letztendlich macht mein älter gewordenes Ich dreißig Jahre später immer noch das Gleiche, nur, dass ich jetzt, statt zur Ordnung gerufen zu werden, dafür bezahlt werde. Ich habe meine subversive Überlebenswaffe zum Beruf gemacht. Schreiben ist nicht mehr das Verbotene, das man nebenher macht, unter der Bank, um sich vor dem eigentlich, vermeintlich Wichtigen zu drücken, sondern es ist selbst zum Wichtigen, Eigentlichen geworden.
Ich wählte die Komik nicht, die Komik wählte mich. Warum sie das tat, muss man die Komik fragen.
Irgendwann ist man dann kein Kind mehr. Man ist also angeblich frei und kann tun und lassen, was man will. Doch die Zwänge, sie sind nach wie vor da, sie haben sich nur verwandelt. Ja, sie nehmen sogar zu, denn jetzt gibt es zwar keine Schulpflicht mehr, aber andere, noch schlimmere Pflichten. Verantwortung muss übernommen, Rollen müssen gespielt, Triebe unterdrückt werden. Du musst Geld verdienen, dich dem Arbeitsmarkt unterwerfen, den sozialen Regeln anpassen. Du hockst in einem Großraum-Büro und musst blöde Kollegen ertragen, und blöde Vorgesetzte, denen du hinterrücks, für einen kurzen comic relief, eine lange Nase drehst.
Du stehst auf einem Empfang und hast, warum auch immer, eine Erektion, musst aber so tun, als sei nichts, musst den Geschlechtslosen mimen, und schon fühlst du dich von dir selbst entfremdet, klafft eine Kluft zwischen dem Tier, das du bist, und dem schwanzlosen Pappkameraden, den du darstellen musst, und du löst die innere Spannung mit einer Zote, die dir kurz den Krawattenknoten der Zivilisiertheit lockert.
In der Kluft zwischen Trieb und Zivilisation gedeiht die Komik aufs Vortrefflichste. Das Unbehagen in der Kultur sucht sich sein Ventil im Gelächter. Und die Erwachsenenwelt ist voll von Situationen kultureller Anpassung, die mit deinem Trieb kollidieren.
Selbst, wenn du es geschafft haben solltest, dich von allen sozialen und kulturellen Zwängen befreit zu fühlen, so sitzt du noch immer im Gefängnis deines Körpers und stöhnst unter dem Joch der Vergänglichkeit. Und musst, wie wenig du auch sonst musst, eines schließlich doch noch müssen, nämlich sterben. So ist, egal, wie frei du bist, immer jemand da, dem aufsässig ins Gesicht gelacht gehört: Dem Lehrer oder der Gesellschaftsnorm, dem König oder der Kanzlerin, der Mühsal oder dem Tod.
Der große deutsche Humorist Robert Gernhardt sagt dazu: »Die Komik ist tatsächlich der Zauberstab, der aus Leid Lust, aus Unterlegenheit Überhebung, aus Einsamkeit Anerkennung, aus Wut Witz, aus Scheiße Bonbon macht.«5
Ich stand einmal zur Osterzeit an einem düsteren, regnerischen Tag in der Friedrichstraße, als vier bunte Päckchen an mir vorbeiliefen. Vier bunte Osterpäckchen im Regen, in denen Menschen steckten, irgendwelche prekäre Zeitgenossen, die einen erniedrigenden Job im Spaßkapitalismus machen mussten: Ein kurzes, stummes Dramolett. Ähnliche Motive tauchen aufgrund ihrer unmittelbar tragikomischen Wirkung häufig in Filmen und Theaterstücken auf.
Ob einer als Bratwurst verkleidet Werbung für eine Imbissbude läuft oder eine in tonnenschwerem Bärenkostüm auf ein Filmfestival hinweisen muss: Jedes Mal erzeugt der Kontrast zwischen der traurigen, existenziell verzweifelten Lage des Menschen und der fröhlichen Albernheit seiner Kostümierung ein bitteres Lachen. Der Plüschhase winkt von fern.
Auch der umgekehrte Kontrast erzeugt Komik: Jedwede krampfhafte Bemühung um Seriosität wirkt in einer unseriösen Welt zutiefst komisch. Man denke nur an eine Brexit-Verhandlung im Britischen Unterhaus. Die Inkongruenz von hoher Erwartung und Banalität des Realen ist ein Hauptproduzent komischer Situationen. Überall, wo Würde und Größe, Heiligkeit und Erhabenheit angestrebt werden, ist der tiefe Fall nicht fern. Deshalb zielen so viele klassische Witze auf feierliche Momente ab. Der Furz bei der Hochzeits-Zeremonie, die verbrannte Weihnachtsgans, Leichen, die während Beerdigungsreden aus Särgen kippen: Die Konfrontation des Würdevoll-Erhabenen mit der Trivialität menschlicher Fehlbarkeit entlarvt die innere Komik jedes Seriositätsversuchs.
Komik entsteht durch das Durchkreuzen von Erwartungen, das Verschneiden von Hohem und Niederem, das Mischen von Scheiße und Gold. In der Komik werden Unvereinbarkeiten offengelegt und Ambivalenzen gefeiert. Mit hehrer Absicht zieht man aus, greift nach den Sternen der Vernunft, um dann um so slapstickhafter über seine Kleinheit zu stolpern. Keiner hat diese menschliche Komödie so meisterhaft in Szene gesetzt wie ein Mann, dem mein Komik-Verständnis viel zu verdanken hat, nämlich Wilhelm Busch, weshalb ich mich nun eine Weile ihm und seinem Werk widmen will.
Was faszinierte eine, sagen wir mal, Zehnjährige so an den kruden, mitunter grausamen Geschichten von an Bäume geknoteten Seelen, besoffenen Dörflern, geschroteten Kindern, rauchenden Fröschen und abgeschnittenen Katzenschwänzen? Rückblickend erkläre ich es mir so, dass ich wohl in einem Anfall von früher Klarsicht den Seelenverwandten erkannte. Dass mir klar wurde, dass so und nicht anders dieser absurden Welt die Stirn geboten, dem Konzept des Todes begegnet und der menschlichen Niedertracht ins Gesicht gelacht gehöre.
Und: Es war komisch, bitter komisch. Schwarzer Humor, so lernte ich, kann genossen werden. Noch heute, in einer Zeit, in der unter dem Label Komik viel Unkomisches produziert wird, finde ich kaum etwas komischer als einen Busch-Zweizeiler. Und warum das so ist, möchte ich exemplarisch für Buschs Gesamtwerk anhand eines Ausschnitts aus der Frommen Helene erläutern.
Die fromme Helene ist eine brave Jungfer, deren Lebensweg uns Busch vom Backfischalter bis zum aberwitzigen Unfall-Tod, in dem eine Schnapsflasche und eine umgekippte Petroleumlampe eine Rolle spielen, in Wort und Bild nahebringt. Im achten Kapitel ehelicht Helene, man kann sagen, aus Angst vor Altersarmut, den dicken Herrn Schmöck, der oft und viel dem Weine zuspricht (wie die Busch-Figur generell recht gern einen hebt, eine Vorliebe, die sie mit meinen Figuren teilt).
Eines Abends verspeist Schmöck zum Dinner einen Fisch. Es kommt, wie es kommen muss: Eine Gräte bleibt ihm im Halse stecken. Die Zeichnung zeigt Schmöck, der im Erstickungskampf das Tischtuch mit sich riss, mit eben jenem wie einem Leichentuch bedeckt unter dem Stuhl liegen. Zwei noch intakte Fische, durchs Eiswasser des umgekippten Champagnerkübels glitschig geworden und in Fahrt gekommen, sind ihm aufs Gesicht gerutscht, während wir im Vordergrund, quasi als Memento Mori, das abgenagte Skelett des bereits verspeisten Fisches, also des Mörder-Fischs, sehen. Die kippende Champagnerflasche wird geistesgegenwärtig von dem allzeit bereit und servil hinter Schmöck stehenden Diener Jean ergriffen. Insgesamt also ein sehr dynamisches Bild. Die Bildunterschrift lautet:
»Bums! Da! Er schließt den Lebenslauf. –
Der Jean fängt schnell die Flasche auf.«6
Für mich ist in diesem Bild plus Zweizeiler alles enthalten, was man von großer Komik erwarten darf: schwarzer, schwärzester Humor, also Humor, der sich mit den letzten Dingen befasst, den Dingen, an denen ein Lach-Tabu haftet, Unfälle und Missgeschicke, Krankheit und Tod. Man lacht, und es ist alles andere als ein unschuldiges Lachen. Dennoch lacht man nicht so sehr über Schmöck, als vielmehr über die Skurrilität seines Todes, ein kleiner, aber feiner Unterschied, der das existenzielle Gelächter vom menschenverachtenden Gelächter unterscheidet. Man lacht auch über Jeans Kaltschnäuzigkeit im Umgang mit des Brotherrn Tod, hat aber großes Verständnis für seine Prioritätensetzung, paktiert mit seinen niederen Instinkten und applaudiert heimlich seinen Gelüsten, weil man sie teilt. Man ahnt, dass sich für Jean die Gelegenheiten, an ein gutes Fläschchen Champagner zu kommen, nicht eben häufig bieten. Natürlich rettet er die Flasche, denn was wäre an Schmöck noch zu retten? Von den eigenen Tafelfreuden dahingerafft – eine Tragödie! Aber muss es gleich noch die Flasche kosten?
Tragik, Komik, hohe Erwartungen und banales Ende, grausam und absurd wie der Rest des Lebens. Dazu passt ein Zitat von Jean Paul:
»Der Humor, als das umgekehrte Erhabene, […] erniedrigt das Große, […] um ihm das Kleine, und erhöhet das Kleine […], um ihm das Große an die Seite zu setzen und so beide zu vernichten, weil vor der Unendlichkeit alles gleich ist und Nichts.«7
Wenige Kapitel zuvor sahen wir, wie Schmöck sich in Helenens und seiner Hochzeitsreise nach Heidelberg in die sexuelle Dysfunktion trinkt, mit Flasche um Flasche Witwe Klicko, wie Busch das edle Franzosengesöff verballhornend nennt und so dem Ansinnen des Kleinbürgers, einen auf feinen Herrn zu machen, im Vorbeigehen eins aufs Dach gibt. Sehr zum Ungemach der frischen Braut Helene natürlich.8
Wir lernen Schmöck als einen kennen, der, so wie bei Busch häufig, begeistert den niederen Trieben frönt, in diesem Fall dergestalt, dass die Befriedigung des einen die Befriedigung des anderen unmöglich macht – was Buschs Menschenbild auch bereits ganz gut zusammenfasst, denn nach ihm besteht der Mensch hauptsächlich aus Trieb: Fressen, Saufen, Blödsinn machen.
Mann tappe nicht in die Falle, das tragikomische Ableben des Herrn Schmöck als antikapitalistische Mär vom mächtigen Gierschlund zu lesen, der via Grätentod seiner gerechten Strafe zugeführt wird. So politisch ist Busch nämlich nicht. Er ist in der Wahl seiner Opfer völlig unparteiisch. Lehrer, die sich für Poeten halten, Spießer auf Freiersfüßen und gierige kleine Hündchen bekommen ebenso ihr Fett weg wie alte, dicke Männer, dürre, junge Frauen, Gänse und Frösche, Affen und Raben, Erwachsene und Kinder. Er nimmt einfach jeden Lach-Anlass, den der Mitmensch und das Mit-Tier in ihrer Jämmerlichkeit bieten, ohne Ansehen von Klasse, Alter, Intellekt, Geschlecht oder Spezies.
Gut, manche Charaktere werden mit etwas schonungsvollerem Pinselstrich gezeichnet, manche Storyline verrät subkutane Sympathien für den einen oder anderen, aber aller Interpretationswillen der Nachgeborenen täuscht nicht über den Umstand hinweg, dass sich aus unserem Urvater des comic strips einfach kein politisches Kapital schlagen lässt. Mal wirkt er geradezu revolutionär, mal fast schon reaktionär. Auf wessen Seite steht Busch? Ich würde sagen: Er steht klar auf der Seite des Gelächters. Und er diskriminiert in diesem Lachen keinen, indem er ihn aus dem Kreise der zu Verspottenden ausschließt.
Buschs Komik ist keine Waffe im Kampf um Aufklärung und Veränderung, ist also nicht gesellschaftskritisch, sondern eher menschenkritisch oder, um es mit dem Busch-Forscher Gottfried Willems zu sagen, schöpfungskritisch.9
Man kann die Schadenfreude, zu der man durch Buschs fiese Menschendarstellungen eingeladen wird, leicht als herablassenden Sadismus missverstehen. Aber wer genau hinschaut, wird entdecken, dass Busch eine Meta-Ebene aufmacht, dass zum Beispiel bei vielen von Busch gezeichneten Missgeschicken eine schadenfroh lachende Gruppe hinter einer Hecke lauert, der Akt des Auslachens also mitgezeichnet und somit ebenfalls an den Pranger gestellt wird. Und genau so verfährt er auch in der moralischen Bewertung des Menschlich-Allzumenschlichen: Man bekommt Niedertracht und Gemeinheit in sämtlichen Varianten aufs Brot geschmiert, aber es ist nicht der Missetäter, der im Zentrum des Spotts steht, es ist der Moralist, der sich über diesen erheben zu können glaubt.
Gottfried Willems sagt dazu: Busch »geht […] mit allen ins Gericht, die sich auf das hohe Roß der ›sittlichen Entrüstung‹ schwingen und dabei die eigene mangelhafte Person vergessen.«10 Busch kritisiert also weniger die Unmoralischen, die Maxe und Moritze, sondern fragt eher, wie es denn um die Moral der Moralisten bestellt sei, woher all die Zeigefinger gen Himmel hebenden Onkel Noltes und Witwe Boltes eigentlich die Chuzpe nähmen, sich so über den Mitmenschen zu erheben. So kann Buschs Werk als ein Plädoyer für Bescheidenheit gelesen werden, als eine große Ermahnung zur Selbstkritik. Wovor Busch warnt, ist die Selbstgefälligkeit, der Irrtum, sich für vernünftig, rechtschaffen und gut zu halten und den Mitmenschen für verkommen, fehlgeleitet und böse. Busch wittert, ähnlich wie Molière, hinter dem Moralisieren der Moralisten keinen schöngeistigen Enthusiasmus für das Ideal, sondern immer nur Neid und Missgunst, dem anderen den Genuss dessen zu vermiesen, was einem selbst verwehrt bleibt.
Ein gutes Beispiel hierfür ist die Figur der Arsinoé in Molières Der Menschenfeind/Le Misanthrope ou l’Atrabilaire amoureux (1666), welche die Koketterie ihrer Freundin Célimène tadelt, angeblich aus einem Gefühl für Anstand und Tugend heraus, in Wirklichkeit aber aus Frustration darüber, dass sie selbst nicht attraktiv genug ist, um ein paar Verehrer für sich zu begeistern.
Und wer kritisiert den Moralisten der Moral, also Busch selbst? Das erledigt der Autor gleich mit: Humor hat man, komisch ist man. So ist die klassische Busch-Figur in ihren Missgeschicken, Bösartigkeiten und niederen Triebzielen zwar komisch, aber meist humorlos, da sie selbst kein Bewusstsein ihrer Komik hat, also keine Distanz zu sich selbst, keine Selbstironie. Ganz anders Busch. Er schaut nicht von oben herab, er bezieht sich mit ein. Sein skeptisches Menschenbild macht vor dem eigenen Ich nicht Halt. Seine eigenen Laster – unter anderem Trunksucht und exzessiver Tabakgenuss – werden ebenso schonungslos dem Spott ausgesetzt. Er weiß sehr wohl, dass er mitgemeint ist, dass die menschliche Komödie auch ihn betrifft. Er übt deshalb auch keine Gesellschaftskritik im klassischen Sinne, denn das hieße, mit dem großen Onkel-Nolte-Finger auf andere zu zeigen, während man sich selbst auf der richtigen Seite wähnt. Aber Buschs Kunst ist eine, die den Abstand zu sich selbst bewahrt, auf dass ein klarer Blick nicht nur auf die Schwächen der anderen, sondern auch auf die eigenen Schwächen möglich sei. Denn zu glauben, man könne die Welt mittels Kunst verändern, ist nicht nur löblich und ehrenhaft, sondern auch eitel. Zuerst ist es nämlich erforderlich, sich über die zu Kritisierenden zu erheben, und dafür ist Busch zu bescheiden. Er sieht Komik eher als Mittel, die verzweifelte Lage des Menschen ungeschönt zur Kenntnis zu nehmen und die Welt trotzdem mit Heiterkeit zu betrachten
Ohne allzu versöhnlich zu sein, spendet Busch auch Trost im Hinweis auf kleine Fluchten. Er begegnet dem von ihm ausgestellten Exzess des Genießens immer auch mit großer Empathie. So breitet er den Todeskampf des Raben Hans Huckebein, der sich in einem dieser Busch-typischen Unfälle selbst stranguliert, zwar detailreich aus, lässt aber viel Verständnis für denjenigen durchschimmern, der sich lieber selbst erwürgt, als vom Rebensaft zu lassen. Und so zeichnet er dem von einer physisch recht kräftezehrenden Begegnung mit zwei Gänsen sich im Gras erholenden Frosch nicht nur einen Wundverband auf den Kopf, sondern auch eine Pfeife ins Maul: »Drei Wochen war der Frosch so krank,/Jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank!«11
So, jetzt habe ich sehr lange über Wilhelm Busch geredet, doch mit gutem Grund, denn vieles, was über ihn zu sagen ist, würde ich auch gern über mich sagen können.
Aber zurück zur Komik:
Robert Gernhardt unternimmt eine, wie ich finde, sehr hilfreiche Unterscheidung zwischen purer und angewandter Komik.12 Pur ist für ihn eine Komik ohne Mission und Zweck, eine Komik, die sich vor keinen Karren spannen lässt, eine Komik, die nur ein Ziel verfolgt, nämlich komisch zu sein. Als aktuelles Bühnenbeispiel wäre hier vielleicht der Regisseur Herbert Fritsch zu nennen, an dessen anarchisch-bonbonbuntem Nonsens sich die Geister scheiden. Demgegenüber steht die angewandte Komik, also alle Komik, die etwas bezweckt, die sich als Werkzeug subversiver Aufklärung einsetzen lässt, die in der Hand des Gesellschaftskritikers als Waffe instrumentalisiert wird.
Die Witzpuristen haben meine größten Sympathien, ich winke ihnen von Ferne bewundernd zu, kann mich ihnen aber nicht voll und ganz zugehörig fühlen, denn ich kann es nicht lassen, ab und zu den Onkel-Nolte-Finger zu heben, was viele meiner Arbeiten nicht in dem Olymp des existenziellen, schöpfungskritischen Gelächters, sondern in den Niederungen der satirischen Gesellschaftskritik verortet.
Bei der Gesellschaftskomödie handelt es sich, sofern sie über das schenkelklopfend Boulevardeske hinaus geht, meist um angewandte Komik. Sie überspitzt Charaktereigenschaften von Individuen, Gruppen oder Klassen mit dem Ziel, sie durch Verdeutlichung zu kritisieren. Es ist also nicht der unparteiische Galgenhumor Buschs, sondern das gezielte Anprangern von Missständen. Aber um Missstände anprangern zu können, muss man sie zuerst einmal ausfindig gemacht haben, also genau wissen, auf welcher Seite das Übel steht. Damit rückt man bedenklich nah ans Bescheidwissen, läuft also Gefahr, sich mit Selbstgewissheit zu infizieren, die der Schreibende per se besser vermeiden sollte, da sie paradoxerweise das Gegenteil dessen ist, was der Mensch eigentlich für einen guten Humor braucht, nämlich Selbstzweifel.
Eine Satirikerin ist aber immer auch eine Moralistin. Was nicht gleichbedeutend sein muss mit moralisierend.
Wenn ich mein Werk durchleuchte und es nach den dortigen Komik-Vorkommen abklopfe, finde ich durchaus Spuren von Aufklärungskomik und Missstände-Anprangerungs-Didaktik, in manchen Stücken mehr, in manchen weniger. Etwas deutlicher Richtung Witzpurismus neigt sich vielleicht Prinzessin Nicoletta (2003),13 mein allererstes Stück. Diese Geschichte rund um eine aufsässige Prinzessin, die sich wegen eines wohlschmeckenden Bratapfels in den Koch verliebt, der am Ende bösartigen Intrigen zum Opfer fällt, ist ein fröhliches Spiel mit Versatzstücken aus Mythen und Märchen, Literatur und Popkultur. Weder weist es über sich hinaus, noch ist es eine Metapher für oder eine Parabel auf irgendwas. Es ist genau das, was es ist, und am Schluss erzählt uns ein sprechender Kopf von seiner Sehnsucht nach dem Sommer.
Wenn eine unter Druck stehende Dramaturgin partout einen Bezug zu einer wie auch immer gearteten Relevanz ins Programmheft schreiben muss, kann sie darin vielleicht etwas über soziale Abhängigkeiten und Sündenbock-Thematik erkennen. Aber das überdeckt doch schwerlich die Tatsache, dass der Kern des Stückes ein radikal unpolitischer, relevanzbefreiter und zweckfreier ist. Prinzessin Nicoletta würde ich als ein Stück bezeichnen, das die Gernhardtsche Forderung nach purer Komik zwar nicht restlos, aber ansatzweise erfüllt.
Die meisten meiner anderen Stücke sind eher Mischformen aus zweckfreier und zweckgebundener Komik. Zum Beispiel Fräulein Agnes (2017).14