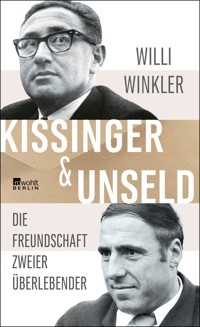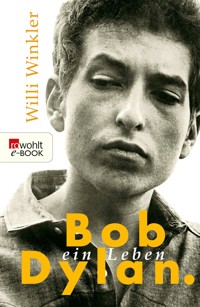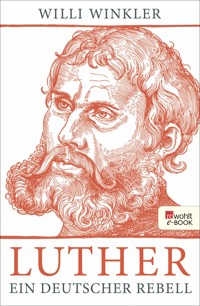
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
«Allein in der Berufung auf sein Gewissen stürzte Martin Luther eine Welt um, wie es sonst nur Kopernikus gelang.» Er war der größte Rebell, den die deutsche Geschichte aufzuweisen hat – und wollte doch nichts weniger sein. Martin Luther hat mit den sagenhaften Hammerschlägen, mit denen er seine 95 Thesen an das Tor der Schlosskirche zu Wittenberg nagelte, das Mittelalter beendet und ein neues Zeitalter begründet: das, in dem wir heute leben. Die von ihm angestoßene Reformation wirkte wie ein ungeheurer Modernisierungsschub, auf Kunst und Alltagsleben, Literatur, Wissenschaft und Publizistik; Luthers Bibelübersetzung ist der Grundtext für das heutige Deutsch. Vor allem aber gab der entlaufene Augustinermönch den Deutschen zum ersten Mal einen Begriff von der Individualität des Menschen: Du allein verfügst über dich, nicht der Kaiser, nicht der Papst, niemand außer Gott. Luther ist eine einzigartige Figur in der europäischen Geschichte. Ohne ihn wäre die Welt ärmer – auf jeden Fall eine andere. Willi Winkler geht es darum, den ganzen Luther in den Blick zu nehmen, ihn als den Mann zu zeigen, der seine Welt vom Kopf auf die Füße gestellt hat, vor dem Hintergrund des aufregenden 16. Jahrhunderts, in dem die Neuzeit beginnt. Rechtzeitig zum Reformationsjahr erscheint diese große Biographie, die alle Anlagen zum Klassiker hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 898
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Willi Winkler
Luther
Ein deutscher Rebell
Über dieses Buch
«Allein in der Berufung auf sein Gewissen stürzte Martin Luther eine Welt um, wie es sonst nur Kopernikus gelang.»
Er war der größte Rebell, den die deutsche Geschichte aufzuweisen hat – und wollte doch nichts weniger sein. Martin Luther hat mit den sagenhaften Hammerschlägen, mit denen er seine 95 Thesen an das Tor der Schlosskirche zu Wittenberg nagelte, das Mittelalter beendet und ein neues Zeitalter begründet: das, in dem wir heute leben. Die von ihm angestoßene Reformation wirkte wie ein ungeheurer Modernisierungsschub, auf Kunst und Alltagsleben, Literatur, Wissenschaft und Publizistik; Luthers Bibelübersetzung ist der Grundtext für das heutige Deutsch. Vor allem aber gab der entlaufene Augustinermönch den Deutschen zum ersten Mal einen Begriff von der Individualität des Menschen: Du allein verfügst über dich, nicht der Kaiser, nicht der Papst, niemand außer Gott. Luther ist eine einzigartige Figur in der europäischen Geschichte. Ohne ihn wäre die Welt ärmer – auf jeden Fall eine andere.
Willi Winkler geht es darum, den ganzen Luther in den Blick zu nehmen, ihn als den Mann zu zeigen, der seine Welt vom Kopf auf die Füße gestellt hat, vor dem Hintergrund des aufregenden 16. Jahrhunderts, in dem die Neuzeit beginnt. Rechtzeitig zum Reformationsjahr erscheint diese große Biographie, die alle Anlagen zum Klassiker hat.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Berlin · Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
Umschlagabbildung «Bildnis Luthers als Junker Jörg» (1522) von Lucas Cranach d. Ä./akg-images
ISBN 978-3-644-12381-6
Hinweis: Die Seitenangaben im Personenregister und im Bildnachweis beziehen sich auf die Seiten der Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Wir sind alle nur zufällig. Wir machen weder Geschichte noch die Kultur. Wir haben keinen Einfluss, sondern tauchen einfach auf.»
Saul Bellow
«Hette ich die sache so weit gesehen, als sie Gott lob kommen ist, so hette ich das maul gehalten.»
Martin Luther
Prolog
Albrecht Dürer erreicht die Nachricht am 17. Mai in Antwerpen. Da ist Luther bereits zwei Wochen wie vom Erdboden verschwunden. Niemand weiß Genaueres über seinen Verbleib, es gibt nur Gerüchte. «Als bald waren 10 pferd do, die fürten verrätherlich den verkaufften frommen, mit dem heyligen geist erleuchteten mahn hinweg, der do war ein nachfolger Christj vnd deß wahren christlichen glaubens. Und lebt er noch oder haben sie jn gemördert, das ich nit weiß»[1], klagt sein Anhänger Dürer verzweifelt. Einen Monat zuvor war Martin Luther auf dem Reichstag in Worms erschienen. Karl V. hatte ihn vorgeladen und verlangt, dass der Mönch, der ihm so hager und eiferglühend gegenüberstand, seine Schriften widerrufe, aber Luther wollte nicht gehorchen. Er widerrief nicht, weil er sich im Recht glaubte. «Es sey dann das ich durch gezeugnus der geschrifft oder aber durch schynlich vrsach (dann ich glaub weder dem Bapst / noch dem Concilio allein / wyl es am tag ligt / das die selben zů mermalen geirret vnd wider sich selbs geredt haben) überwunden würd. Ich bin überwunden durch schrifft / so von mir gefürt vnnd gefangen im gewissen / in dem wort gottes / derhalben ich nit mag noch will widerrůffen / dwyl wider gewissen beschwaerl ich zů handeln vnheilsam vnnd vnfridlich ist.»[2] Solange er nicht durch das Zeugnis der Schrift überzeugt werde oder aber durch stichhaltige Gründe, werde er nicht widerrufen; er glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, es sei hinlänglich erwiesen, dass beide mehrfach geirrt und sich widersprochen hätten. Für ihn gebe es nichts zu widerrufen, erklärte er, er habe nur geschrieben, was ihm sein Gewissen eingegeben hätte.
Unverschämter, selbstbewusster, moderner geht es im mittelalterlichen Jahr 1521 nicht. Mit dem Gewissen hatte in Worms niemand gerechnet, nicht damit, dass ein Mönchlein sich mit diesem windelweichen Argument gegen den mächtigsten Mann der Welt auflehnen würde, der ihn und die Causa Lutheri insgesamt nur als überaus lästige Station auf dem Weg zur Konsolidierung seiner monarchischen Ansprüche betrachtete. Der Papst gönnt ihm die Bestellung zum Kaiser nicht, Frankreich macht ihm seine Rechte streitig, die Türken bedrohen wie immer das Reich, die spanischen Stände zu Hause revoltieren und lassen sich nur mit Hilfe der Heiligen Inquisition niederhalten. Karl V. will dieses schrecklich aufsässige Deutschland so schnell wie möglich wieder verlassen, will aufbrechen zu neuen Taten und neuen Kriegen. Er herrscht über ein Weltreich, das sich von Ungarn bis Südamerika spannt, in dem die Sonne fast nie untergeht, und hat vor sich die deutschen Fürsten, die jeden finanziellen Beitrag für seinen Unterhalt verweigern. Gegen diese weltliche Macht stellt sich der eine einzige Luther als jemand, der nicht von dieser Welt ist, vor der er sich doch verantworten soll und es auf keinen Fall tun wird, schließlich sei er «gefangen im gewissen in dem wort gottes». Widerrufen mag er nicht, «Got helff mir. Amen.»[3]
Der Auftritt auf dem Reichstag in Worms wird ein Weltaugenblick der Rebellion und begründet den Protestantismus. Der siebenunddreißigjährige Dr. Martin Luther (der akademische Titel bleibt ihm sein Leben lang wichtig) zeigt einen bis dahin unerhörten Mannesmut vor Königsthronen, und es ist diese Unerschrockenheit, die ihn zum Stifter einer neuen Religion werden lässt. Bestimmt hat er nicht die Donnerworte gesprochen, die ihm die Überlieferung gern zuschreibt: «Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.» Aber so wie er hatte noch niemand mit der Majestät zu reden gewagt, die deshalb verfügte, was fällig und unausweichlich wurde. Wie vom Papst gewünscht, erklärte Karl den Bettelmönch aus Wittenberg zum Ketzer. Seine Schriften wurden verboten, Verleger, die sie trotzdem herausbrachten, bestraft (noch im selben Jahr wurde Luthers wegen in Leipzig ein Drucker hingerichtet), umlaufende Exemplare waren einzusammeln und zu vernichten, ihr Autor galt fortan als vogelfrei.
Doch der Kaiser, eine ganze Generation jünger als sein Widersacher, keineswegs ungebildet, durch seine burgundisch-flandrisch-spanisch-deutsche Herkunft sogar ungleich weltläufiger, unterschätzt die Revolution, die in Deutschland ausgebrochen ist. Nur vier Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung ist Martin Luther bereits zum erfolgreichsten Autor in der Geschichte des Buchhandels aufgestiegen. Ende 1519 hat er mit fünfundvierzig Einzelpublikationen eine Auflage von zweihundertfünfzigtausend Stück erreicht. Seine überwiegend lateinisch geschriebenen Texte erscheinen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Venedig und Rom.[4] Europas führender Intellektueller, Erasmus von Rotterdam, hat Luthers Thesen, mit denen seine Rebellion begann, nach London an Thomas Morus weitergeleitet, den Berater des englischen Königs. In Briefen, Vorreden, Pamphleten, Schmähschriften und Drucken entwickelt sich schnell eine ungeheure Sekundärliteratur.
Im Kupferstich hat ihn Lucas Cranach als halben Heiligen gezeichnet, ein Bild, das in unendlichen Variationen hinaus in die Welt geht. Hans Holbein der Jüngere huldigt ihm in einer Karikatur als «Hercules Germanicus», die Leichen seiner erschlagenen Feinde vor sich; von der Nase baumelt ihm ein gefesselter Papst. Ulrich von Hutten, der von Maximilian, Karls Vorgänger als Kaiser, zum poeta laureatus gekrönt wurde, appelliert an den Kurfürsten Friedrich den Weisen, sich des «Doctor Martinus Luther, von allen menschen verlassen», anzunehmen. Er empfiehlt zugleich, sich im Kampf gegen das verkommene Rom, das von seinem Rachefeldzug gegen Luther nicht lassen will, der «allerhefftigsten artzneyen» zu bedienen.[5] Der Nürnberger Ratsherr Lazarus Spengler schreibt 1519 eine anonyme «Schutzrede» für Luther, in der es heißt, dass der Leser Luthers ebenso wie jener, der Predigten seiner Anhänger gehört hat, durch die Suche nach Wahrheit frei werde von Gewissensnöten, «vil tzwefliger irsal vnd scrupel verwickelter conscientz entledigt ist»[6]. Und ein Buchhändler in Basel jubelt, nachdem er im Oktober 1518 einen Luther-Sammelband herausgebracht hat, dass er noch kein Buch besser verkauft habe. «Noch niemals hatte ein Autor seine Sache derart rasch, derart umfassend und derart genau dem lesenden Publikum vermitteln können.»[7]
Nach dem Bannspruch, während die Reichsstände noch über ihn beraten und der Kaiser an seinem Verdikt formuliert, verlässt der Ketzer Worms. Der Rückweg und freies Geleit sind garantiert für einundzwanzig Tage, nicht länger. Trotzdem schickt Luther den kaiserlichen Herold, der ihn begleitet, bald zurück, er reist weiter ohne Schutz, vogelfrei. Auch davon hat Albrecht Dürer erfahren und fürchtet das Schlimmste: «O Gott, ist Luther todt, wer wird uns hinfürt das heilig evangelium so clar fürtragen! […] O ihr alle fromme christen menschen, helfft mir fleissig bewainen diesen gott geistigen menschen.»[8]
Luther wusste aber sehr wohl, wie ihm geschah, meldete er doch sein vorläufiges Schicksal rechtzeitig «dem fursichtigen Meister Lucas Cranach» in Wittenberg, dem er einen nicht geringen Teil seines Ruhms verdankte. Der solle sich nicht sorgen, wenn der Mönch nicht nach Wittenberg zurückkomme. «Ich laß mich eintun und verbergen, weiß selbst noch nicht wo.»[9] Ihr gemeinsamer Schutzherr und Arbeitgeber, Kurfürst Friedrich von Sachsen, hatte sich zwei Tage zuvor mit seinen Räten über das weitere Schicksal Luthers besprochen. Es wird also zu einem Überfall kommen, Berittene werden Luther festnehmen und entführen, damit er vor den kaiserlichen Häschern wie den frommen Eiferern verborgen ist und sein Kurfürst sich nicht rechtfertigen muss für ihn.
Wohl ist dem Schutzhäftling dabei nicht, doch er hat keine andere Wahl. Unweigerlich kommt ihm Christus in den Sinn, der zu seinen Jüngern spricht: «Uber ein kleines / so werdet ir mich nicht sehn.» Er sagt es bei Joh 16,16, ehe er in Jerusalem einzieht, wo ihm bald der Prozess gemacht und er hingerichtet wird.
Luther aber wird kein Leid geschehen. Hingerichtet wurde gut hundert Jahre vorher der böhmische Prediger Jan Hus, weil er sich dem Papst widersetzt hatte. Luther betrachtet Hus als Märtyrer und bedauert fast, dass die Vorladung auf den Reichstag für ihn so glimpflich ausgegangen ist; dem großen Auftritt hätte, wie er etwas selbstgefällig klagt, ein noch größerer Abgang folgen können. Lieber hätte er von Tyrannenhand den Tod erlitten, schreibt er Cranach, doch müsse er «guter Leut Rat nicht verachten, bis zu seiner Zeit»[10]. Er hat auf dem Höhepunkt seines Ruhms zu verschwinden, was ihn erst recht berühmt machen wird.
Dem Kaiser und den Reichsständen schickt er noch mal ein Protokoll seines Auftritts und wiederholt, was er gesagt hat oder sagen wollte: «So ich verweiset wurd, das ich solt geirret haben, wolte ich alle irtumb widerruffen und der erst sein, der meine bücher in das fewr wolt werfen und mit den füssen darauf tretten.»[11] Wenn sich erweisen sollte, dass ich geirrt habe, dann, bitte, dann könnt Ihr meine Bücher ins Feuer werfen oder sie mit Füßen treten – er würde es ihnen gleichtun. Aber es gibt ja keinen Grund, seine Bücher ins Feuer zu werfen. Sie sind ohne Irrtum, weil sie aus der Schrift kommen, und er nur das geschrieben hat, was ihm sein Gewissen befahl. Frech vergleicht Luther sich auch in diesem Abschiedsbrief an seine weltlichen Herren mit Christus, «mein herr und got», der «fur seine feind am Creuz gebetten hat»[12]. Wie Christus will er für seine Widersacher beten.
Für den «lieben gevattern und Freunde» Cranach setzt er noch hinzu, was seinen theologischen Ruf künftig wie Donnerhall begleiten wird – das antirömische, das deutsche Sentiment. Es mag einen deutschen Kaiser geben, eine Art deutscher Sprache, doch gibt es noch längst kein Deutschland. Luther aber macht sich zu dessen Botschafter und Rechtsvertreter: Wir gegen Rom. Er ist ganz überrascht davon, wie leicht ihm der Auftritt fiel in Worms, wie rasch sich dieser verordnete Bußgang – niemand hat in Deutschland die erzwungene Wallfahrt vergessen, die Heinrich IV. nach Canossa unternehmen musste – zu einem beispiellosen Triumphzug entwickeln konnte. «O wir blinden Deutschen», schreibt er, «wie kindisch handeln wir und lassen uns so jämmerlich die Romanisten äffen und narren!»[13]
Heinrich Heine, der vor diesem Deutschland nach Frankreich fliehen musste, kann ihn gar nicht genug preisen: «Ruhm dem Luther! Ewiger Ruhm dem theuren Manne, dem wir die Rettung unserer edelsten Güter verdanken, und von dessen Wohlthaten wir heute noch leben! […] Die Feinheit des Erasmus und die Milde des Melanchthon hätten uns nimmer so weit gebracht wie manchmal die göttliche Brutalität des Bruder Martin.»[14] Also fangen wir an.
Erstes Kapitel
Der Kaiser will auch noch Papst werden
Am 17. August 1511 erkrankte Julius II. aus heiterem Himmel. Ein heftiges Fieber hatte den Papst befallen, er geriet in Atemnot und hörte auf zu essen. Seine Berater, seine Ärzte fürchteten um das Leben des Heiligen Vaters. Den deutschen Kaiser erreichte die Nachricht am 26. August in Trient. Maximilian I., der sich so gern als «den letzten Ritter» inszenierte und sich dafür bewundern und von den Humanisten feiern ließ, war der frömmste Mann im ganzen Reich. Jeden Morgen, auch wenn es früh zur Jagd ging, besuchte er die Messe. Eine Zeitlang plante er sogar, seinen glaubensschwächeren Untertanen einen Katechismus zu schenken. Ohne Geld ging es aber nicht. Als Maximilian 1512 in Trier vom «Heiligen Rock» hörte, ließ er ihn aus dem Altar heben, in dem er über Jahrhunderte verborgen gewesen war, und zur Verehrung ausstellen. Der Kaiser kniete wie alle anderen vor dem unzertrennten Rock Christi. Frömmigkeit, Propaganda und das liebe Geld sind hier nicht zu trennen. Dem gemeinen Volk fiel die Entrichtung der Gebühren für Ablässe aller Art leichter als den Reichsständen die Zustimmung zu den Steuern, auf die der Kaiser angewiesen war.
Der Habsburger war zwar 1486 von den Kurfürsten zum deutschen König gewählt und anschließend gekrönt worden, noch immer aber fehlte ihm der Segen des Papstes, den ihm Alexander VI. hartnäckig verweigert hatte. Dabei wäre es so einfach gewesen: Seit die gottlosen Türken 1453 Konstantinopel erobert hatten, war auch der oströmische Teil des einstigen Imperiums untergegangen. Die Türken versuchten, ihre Eroberungen nicht nur zu festigen, sondern unternahmen immer wieder Angriffe auf das Kernland. 1480 konnten sie die apulische Hafenstadt Otranto in Besitz nehmen. Der Papst plante einen Kreuzzug gegen die Türken und schickte Raimund Peraudi als seinen Legaten und obersten Ablassprediger nach Deutschland. Maximilian unterstützte ihn nach Kräften, denn der Kreuzzug hätte ihm Gelegenheit geboten, mit seinem Heer durch Italien zu ziehen und sich beiläufig in Rom vom Papst zum Nachfolger der römischen Kaiser krönen zu lassen. Doch Alexander fürchtete nichts mehr als einen Habsburger als Kaiser, und so kam es ihm zupass, dass die Venezianer Maximilian den Durchzug durch ihr Gebiet verweigerten. 1508 gelang in Trient, der südlichen Residenz des Kaisers, wenigstens eine kleindeutsche Lösung: Im Einvernehmen mit dem neuen Papst Julius II. durfte Maximilian fortan den Titel «Erwählter Römischer Kaiser» führen.
Der Türkenablass war Steuer und ein gutes Werk zugleich, und er war erschwinglich. Für den Lebensunterhalt von nur einer Woche würde er die zu erwartenden Jenseitsstrafen lindern. Peraudi war es allerdings 1476 gelungen, die Bemessungsgrundlage gewaltig zu verbreitern, indem er die Ablassmöglichkeiten ins Unendliche erweiterte: Mit der päpstlichen Bulle «Summaria declaratio bullae indulgentiarum» dehnte er den Ablass bis ins Totenreich. Martin Luther erklärte später, dass es ihm «dazumal schier leid» tat, «das mein vater und mutter noch lebeten, Denn ich hette sie gern aus dem fegfeur erlöset mit meinen Messen und ander mehr trefflichen wercken und gebeten.»[1]
Der Türkenablass war aber auch ein Geschäft zwischen der römischen Kurie, den deutschen Landesherren und ihrem ehrgeizigen und ruhmsüchtigen Kaiser. In Deutschland war das Misstrauen gegen die römische Kurie groß, zu viel ging an Gebühren und Zahlungen über die Alpen; man fühlte sich zunehmend ausgeplündert. Deshalb sollte das gesammelte Kreuzzugsgeld auch fürs Erste im Land bleiben. Peraudi hatte erfolgreich vor den bösartigen muslimischen Reitern gewarnt, die gute Christen verschleppen würden. So kamen in einem Jahr zweihundert- bis vierhunderttausend Gulden zusammen,[2] gesichert in eisenbeschlagenen Kisten mit vier Schlössern für die weltliche und geistliche Obrigkeit, für den päpstlichen Legaten und das Reichsregiment.
Der Kreuzzug fand dennoch nicht statt. Inzwischen war Frieden mit den Türken geschlossen worden. Als er in Augsburg wieder einmal seine Gemahlin als Pfand hatte hinterlassen müssen, weil er nicht in der Lage war, die aufgelaufenen Kosten für sich und seine Entourage zu begleichen, ließ Maximilian einige der im Handelshaus Fugger verwahrten Truhen aufsprengen und konfiszierte vierzigtausend Gulden mit der Behauptung, Peraudi und der Papst wollten sich das Geld unrechtmäßig aneignen. Nach Alexanders Tod behauptete Maximilian sogar, der Papst habe ihm das gesammelte Geld übereignet. «Gottesraub» warfen ihm seine Feinde vor, aber sein zeitweiliger Kanzler Melchior von Meckau – Alexander hatte ihn noch kurz vor seinem Tod zum Kardinal erhoben – war ihm gutachterlich behilflich.[3]
Was sollte Maximilian auch tun? Der «letzte Ritter» war ein besonders armer Ritter, weil er seine Position wie seinen Ruhm nur mit viel Geld behaupten konnte und das viele Geld nie wieder hereinholte, sondern zum Hauptschuldner der Fugger geworden war. Gewählter Kaiser war er zwar, aber nur die Krönung durch den Papst würde ihm seinen Rang als erster unter den europäischen Fürsten bestätigen. Dafür brauchte er nicht nur die elenden Kurfürsten, die sich auf ihn verständigt hatten, sondern auch den Papst. Mit jedem musste er aufs Neue verhandeln. In Rom wechselten sich in munterer Reihe die Borgia, die Della Rovere und die Medici ab, fast alle ins Amt gekommen, weil sie in der Lage waren, das ehrwürdige Kardinalskollegium zu bestechen. Sie starben hintereinanderweg und waren nicht bereit, auch nicht gegen immer größere Summen, dem Kaiser die ihm zustehende Krone aufs Haupt zu drücken.
Nun, als es Julius, der seit 1503 auf dem Papstthron saß, so schlecht ging, sah Maximilian die Gelegenheit, sogar noch mehr als die Kaiserkrone zu gewinnen: Er wollte Papst werden. Bei aller Frömmigkeit war sein religiöses Interesse an dem Amt gering, es ging um den Einfluss in Europa und unweigerlich um die mit dem kirchlichen Amt verbundenen Einnahmen. Dafür suchte er sogar eine Allianz mit den Franzosen, die Spanier hatte er ohnehin auf seiner Seite. Die Kardinäle schließlich waren bereits zum großen Teil vom regierenden Papst abgefallen, hatten, schon bevor die Nachricht von der Krankheit des Papstes beim Kaiser ankam, in ewiger Rivalität für den Herbst ein schismatisches Konzil in Pisa einberufen.
Die Heirat mit Bianca 1494 hatte Maximilian vorübergehend von der Schuldenlast befreit; ihr Onkel Ludovico hatte sie im Tausch gegen den Mailänder Herzogtitel mit einer Mitgift von vierhunderttausend Dukaten ausgestattet. Das Geld war aber längst verbraucht. Seiner Tochter Margarethe, Statthalterin der Niederlande, die ihn nach dem Tod der Bianca Maria Sforza im Dezember 1510 fürsorglich aufgefordert hatte, sich doch wieder eine Frau zu suchen, schrieb er am 18. September 1511 aus Brixen, dass er keine Lust habe, sich noch mal zu vermählen. Vielmehr habe er «den Beschluss und Willen gefasst, nie wieder einer nackten Frau nachzustellen». Das hieß aber keineswegs, dass er keine Pläne hatte. Der ehelose Stand war so ziemlich die einzige formale Voraussetzung für das Amt, das er anstrebte. «Und wir schicken morgen den Herrn von Gurk, den Bischof, nach Rom zum Papst, um einen Weg zu einer Einigung mit ihm zu finden, dass er uns als Koadjutor annimmt, damit wir sicher sein können, nach seinem Tod die Papstwürde zu erhalten, Priester und später heilig zu werden und» – der Satz hört überhaupt nicht mehr auf – «Ihr notwendigerweise nach dem Tod gezwungen sein werdet, mich anzubeten, was mich sehr stolz machen würde.»[4]
Die ironische Wendung, die der Satz zuletzt nimmt, hat manche am Ernst des Vorhabens zweifeln lassen, wenn sie nicht gleich, wie der Haushistoriker der Fugger, von «hellem Wahn»[5] sprechen. Aber ist es so einfach, nur Wahn? Zu jener Zeit, Anfang des 16. Jahrhunderts, gab es, den Theoretiker Niccolò Machiavelli vielleicht ausgenommen, keinen weitsichtigeren Strategen, keinen umtriebigeren Plänemacher als diesen Maximilian. Der Historiker Ferdinand Gregorovius gönnt ihm den bewährten Titel des letzten Ritters, sieht ihn aber auch als «einen der ersten Politiker»[6]. Sein neuester Plan war nicht ganz abwegig und keineswegs ohne Präzedenzfall: Amadeus VIII., Herzog von Savoyen, hat es 1439 als Felix V. immerhin zum Gegenpapst gebracht. Ein Schisma, eine Kirchenspaltung mit Papst und Gegenpäpsten, war durchaus wieder vorstellbar. Maximilian erwog auch die Option, sich zum Papst der nördlichen Länder aufzuwerfen, mit Habsburg als der besten denkbaren Hausmacht, gegen die ein regulärer Nachfolger des Della Rovere drunten in Rom nichts hätte ausrichten können.
Das Papsttum, der Bischof von Rom als Stellvertreter Gottes auf Erden, eingesetzt von Christus persönlich, war nie irdischer als in dieser Zeitenwende. Die meisten Renaissance-Päpste waren zunächst gar keine Priester, sie wurden bei Bedarf erst in letzter Minute von einem willfährigen Bischof geweiht, dann rasch befördert, weiter nach oben, weil sich die eine oder andere Familie durchgesetzt hatte. Im Zweifel war immer ein Zweitgeborener da, der einerseits versorgt werden musste und andererseits die Garantie bot, dass die Familie an der Macht blieb, sie im göttlichen Amt vielleicht sogar noch vermehrte.
Luthers deutsche «Los von Rom»-Theokratie hatte einen bedeutenden Vordenker, den deutschen König Maximilian, der so gern gekrönter Kaiser des Heiligen Römischen Reiches geworden wäre. Die über die Jahrhunderte in langwierigen Auseinandersetzungen erkämpfte Vormachtstellung des Papstes verleitete Maximilian dazu, seinerseits nach diesem Amt zu streben, «kein romantischer Traum», wie der Historiker Hermann Wiesflecker schreibt, «sondern eine ernsthafte und gefährliche Versuchung, die deutsche Kirche von Rom loszulösen und an sich zu bringen, ein Gedanke, mit dem Maximilian zeitlebens gespielt hatte»[7]. Bisher, so hatte der deutsche Kaiser in einem anderen Brief, zwei Tage zuvor, an Paul von Liechtenstein geschrieben, den Marschall des Tiroler Regiments, habe er wohl Bedenken gehabt, sich nach dem Amte zu strecken: «Nun finden wir in uns selbs, auch in grund also ist, uns nichts billichers [ehrlicheres] höhers oder pessers zusteen, als berüert [das erwähnte] bapstumb zu überkhomen.»[8]
Maximilians Idee ist alles andere als heller Wahn, sondern überlegte Politik, nur ein Beispiel für sein universalmonarchistisches Denken. Allerdings war Kaiser Maximilian nicht der Einzige, der von einer Universalmonarchie träumte, auf der Gottes Segen ruhen sollte. Davon träumten in dieser Zeit auch Süleyman der Prächtige, Iwan der Schreckliche und erst recht die schnell wechselnden Herrscher in Rom, die die wiedererstarkte päpstliche Autorität zum Inkasso bei den weltlichen Fürsten wie beim gemeinen Kirchvolk nutzten, um die Universalität ihrer Kirche, also Roms, zu festigen.
Jetzt, genau jetzt, in diesem historischen Augenblick, sei die Gelegenheit da, schreibt Maximilian an seine Tochter, und sie müsse ergriffen werden. Die Spanier seien auf seiner Seite, die Stadt Rom auch. Volk und Adel von Rom wollten ihn als Papst und auf keinen Fall, dass die Kaiserkrone an einen Spanier, einen Franzosen oder gar an einen Venezianer falle. Es komme jetzt darauf an, sich die Tiara zu sichern und dann die Kaiserkrone an Karl, «an unser aller Sohn», weiterzureichen. Die Kaiser- und die Papstkrone – die Medici machten vor, wie Macht zu erobern sei – in einer Familie! Wenn der Papst zu schnell sterbe, gelange er, nach wie vor ohne offizielle Krönung durch das nicht nur geistliche Oberhaupt des Abendlandes, nicht rechtzeitig nach Rom, um sich schon einmal einzuwohnen und mit der reich remunerierten Bearbeitung des künftigen Kardinalskollegiums zu beginnen. Die Gelegenheit sei jetzt, im Sommer 1511, günstig wie nie.
Das war nicht bloß ein tollkühner Plan, sondern ein Staatsstreich von oben: nämlich ein klarer Verstoß gegen die Goldene Bulle von 1356, wonach es allein die Kurfürsten sind, die über den deutschen Kaiser zu bestimmen haben. «Ich beginne auch die Kardinäle zu bearbeiten, wofür mir bei der Zerstrittenheit, die unter ihnen herrscht, zweihundert- oder dreihunderttausend Dukaten sehr von Nutzen wären.» Maximilian bittet seine Tochter, die heikle Angelegenheit vorderhand noch geheim zu halten, und setzt seine Unterschrift als «Vater MAXIMILIANUS, künftiger Papst» darunter. Ein kleines Postskriptum schickt er hinterdrein, damit Margarethe begreift, wie ernst und glücklich zugleich die Lage ist: «Beim Papst steigt das Fieber, er kann nicht mehr lange leben.»
Nett war das nicht, aber es ging ja auch um ein gutes Geschäft. Als solches trug der Kaiser die Angelegenheit seiner Geschäftsbank in Augsburg an, dem Handelshaus der Fugger, denn mit Gebeten allein ist es nicht getan. Er bot ein Drittel aus den zu erwartenden Einnahmen aus dem Papstamt, wenn sie mitziehen würde; als Vorschuss erwartete er fünfhundertdreiunddreißigtausend Fl. (Rheinische Gulden) oder vierhunderttausend Dukaten.[9] Über den Geheimen Rat Liechtenstein, der sich praktischerweise gerade in Augsburg aufhielt, bot Maximilian zudem vier mit Kleinodien gefüllte Truhen als Pfand. Fugger zögerte und verzichtete damit wohlberaten auf den ohne Zweifel – aber eben nur auf den ersten Blick – lukrativen Handel. Das hatte nichts mit Gottesfurcht oder gar einem plötzlich wiedererwachten Respekt vor dem Amt des Papstes zu tun; ein Bankier, ein Finanzier, der auf Expansion und Stabilisierung gleichzeitig aus ist, kann es sich nicht ohne weiteres mit einer wichtigen Partei verderben. Fugger hielt die vatikanische Münze, lebte also weniger in der Sonne der Kurie als der des amtierenden Papstes. Er schaffte nicht nur deutsches Geld nach Rom, sondern zog die Annaten, die Gebühren für Ämtererwerbungen, aus mehreren nordfranzösischen Bistümern ein, das hieß, dass er deswegen nichts hätte unternehmen können, was der französische König als offenen Affront empfunden hätte.
Der Einfachheit halber erholte sich der Papst aber, das tückische Fieber verließ ihn, sein Appetit kehrte zurück. Es war nur ein Anfall gewesen, und zu dem Zeitpunkt, da Maximilian noch auf den Tod hoffte, war Julius auch schon wieder gesund. Seine Autorität allerdings war nach wie vor gefährdet. Maximilian ließ nicht ab von seinen großmonarchischen Plänen, verhandelte mit den abtrünnigen Kardinälen, mit Frankreich, mit Spanien. Die Franzosen wollten ihm die Krönung als Kaiser gewähren, aber nichts von einem Papst Maximilian wissen. Diplomatisch geschickt schlugen sie den für alle käuflichen und auch von den Spaniern umworbenen Bischof von Gurk, Matthäus Lang, als möglichen Nachfolger von Julius II. vor. Die Spanier gewannen Lang für sich, der bremste seinen Kaiser, und auch Melchior von Meckau riet seinem Herrn vom Schisma ab. Julius II. verbündete sich mit Venedig, Aragonien, dem englischen König, versöhnte sich am Ende sogar mit dem Habsburger und verband sich mit ihm in der «Heiligen Liga» gegen Frankreich, und fürs Erste war alles vergessen. Nur die chronische Geldnot des Kaisers war damit nicht behoben.
Zweites Kapitel
Martin Luther reist nach Rom
Seinem Förderer Johann von Staupitz, dem Generalvikar der deutschen Reformkongregation der Augustinereremiten, soll in Rom geträumt haben, ein Eremit werde aufstehen und das Papsttum angreifen. «Das haben wir zu Rom nicht können erkennen», wird Luther später dem Kanzler seines Kurfürsten erklären und auf seine bewährte drastische Art hinzusetzen: «Wir sahen dem Papst ins Angesicht, jtzung sehen wir ihm in Ars [Arsch], außer der Majestät. Und ich Doctor Martinus Luther hab nicht damals gedacht, daß ich derselbe Eremit seyn sollte.»[1]
Es ist zu unwahrscheinlich, aber genau so kam’s.
Rom war die Hauptstadt der Welt und sollte noch bedeutender werden, ein Ort, an dem fromme Touristen der fromme Schauder packte. Die Ewige Stadt, das dekadente Rom, das Rom der Riesenbaustellen und der klerikalen Verschwendungssucht, müsste ihn völlig erschüttert haben, aber es gibt, abgesehen von seinen eigenen späten Erzählungen, keinen noch so bescheidenen Hinweis darauf, dass Luther überhaupt je in Rom war. Bis heute ist keine Urkunde, kein Brief, keine noch so kleine Abrechnung aus diesem zettelsüchtigen Zeitalter aufgetaucht, mit der sich seine Dienstreise, die auch eine Pilgerfahrt war, dokumentieren ließe. Jahrzehnte später, in den Tischreden, geht es häufig um Rom und den Papst, da schimpft er auf die «Hauptstadt der Laster» und weiß genau, dass dort der Teufel seinen Sitz hat, aber zu dem Zeitpunkt hat er – «ich, Doctor Martinus Luther!» – längst gewonnen. Der Mann aus der nebelhaften Provinz irgendwo in Deutschland hat über das Zentrum der Welt und dessen ganze Verkommenheit gesiegt.
Eine Ansicht der Stadt Rom aus der Schedel’schen Weltchronik. Martin Luther kommt 1511 nicht in die Hauptstadt der spirituellen Welt, sondern in ein gottvergessenes Geschäftszentrum.
Dennoch betont er mehrfach, dass er unter keinen Umständen auf den Augenschein hätte verzichten wollen. Im Rückblick spielt die Reise eine große Rolle, und sie wird größer mit dem Abstand der Jahre. «Sey mir gegrüßt, du heiliges Rom!»[2] will er beim Anblick der Ewigen Stadt ausgerufen und sich auf den Boden geworfen haben. Das war sicher auch die Erschöpfung nach der fast zweimonatigen Fußreise, aber vor allem die Reaktion eines tiefgläubigen Mannes, der sich dem Göttlichen und damit der Erlösung in Rom viel näher glaubte als irgendwo sonst auf Erden.
In jenem Frühherbst 1511, in dem Maximilian wieder einmal nach der Kaiserkrone griff und außerdem Papst werden wollte, pilgerte Martin Luther zusammen mit Johann von Mecheln nach Rom, dorthin, wo Maximilian trotz aller Anstrengung nie ankommen sollte. In der Leitung des Augustinerordens war ein heftiger Streit ausgebrochen zwischen den strengen Observanten und jenen, die sich dieser Reformkongregation, in der der Generalvikar Johann von Staupitz die deutschen Augustinerklöster zusammenschließen wollte, verweigerten. Die Gruppe der Renitenten, jener Klöster, die sich nicht anschließen wollten (und dabei von der Stadt Nürnberg unterstützt wurden), ließ der Generalprior Aegidius von Viterbo am 1. Oktober 1511 exkommunizieren. Eine Einigung schien nicht mehr möglich, deshalb wurden Luther und Mecheln von Staupitz nach Rom geschickt mit der Bitte, den Streit zu klären.
Der Kirchenhistoriker Hans Schneider hat überzeugend dargelegt, dass Luthers Romreise auf den Herbst 1511 datiert werden muss, also ein Jahr später als bisher angenommen.[3] Als Eckdaten nennt Schneider den 4. Oktober, an dem Johann von Mecheln in den Senat der Theologischen Fakultät zu Wittenberg aufgenommen wurde, und den 26. November, der letztmögliche Tag, an dem sie ihre Petition überhaupt dem Augustiner-Ordensgeneral in Rom übergeben konnten, da dieser hernach die Stadt verließ.
So plausibel Schneider seine These vorträgt, die Reise selber ist nach wie vor ein nicht ganz kleines Wunder. Auch wenn Luther, wie bislang vermutet, nicht im Dezember über den vermutlich tief verschneiten Gotthard musste, bleibt immer noch eine bald eintausendsechshundert Kilometer lange Strecke. Nach der Darlegung Schneiders beginnt die Romreise nämlich nicht, wie ebenfalls bislang vermutet, in Erfurt, sondern noch mal einhundertachtzig Kilometer oder sechs Tage weiter nordöstlich in Wittenberg, wo Luther an der Universität lehrte. Eintausendsechshundert Kilometer in weniger als acht Wochen, das ist bei durchschnittlich dreißig Kilometern pro Tag eine ungeheure Leistung, zumal Luther unterwegs auch noch krank wurde und ein Hospital aufsuchen musste.
Selbstverständlich führen alle Wege nach Rom, aber über die Alpen empfehlen sich nur zwei Routen, die östliche und die westliche. Luther wählte die westliche über die Schweiz und scheint auf dem Rückweg die Alpen sogar noch weiter umgangen zu haben, indem er über das Rhônetal nach Deutschland zurückkehrte. In einem atemberaubenden Tempo muss Luther mit Mecheln von Wittenberg südwärts über Nürnberg nach Augsburg, Ulm und Chur gezogen sein, überquerte dann den Septimerpass, gelangte nach Chiavenna, Mailand, Bologna, Florenz und Siena, bevor er schließlich Rom erreichte. Sie folgten einer bewährten Pilgerroute, die es sogar als Karte mit recht genauen Entfernungsangaben von dem Erfurter «Kompassbauer» Erhard Etzlaub gedruckt gab, erschienen zum Jahr 1500, um den Pilgern in jenem Jubeljahr den Weg in die Heilige Stadt zu weisen. Dennoch war die Reise gefährlich, immerhin herrschte in beinah jeder Stadt irgendwann die Pest, es gab fast kein Jahr, in dem es nicht irgendwo zu kriegerischen Auseinandersetzungen kam, und überall drohten Wegelagerer. Die Reise zu Fuß, die Fortbewegungsform der Armen, also der großen Mehrheit der Bevölkerung, war auch für die Bettelmönche vorgeschrieben; eine Erleichterung, etwa dass sie ein Fuhrwerk benutzt hätten, war nirgends vorgesehen.
Ein anderer Reformator, der Hl. Franziskus, war viele Jahre vor ihnen nach Rom gezogen, um sich vom Papst die Regel für den von ihm gegründeten Orden bestätigen zu lassen. Damals ging es um die Erneuerung der Kirche. Für Luther und die deutschen Augustiner in Erfurt und Wittenberg ging es um eine bürokratische Angelegenheit, die wenig bedeutend war und allein für den Orden der Augustiner von Belang, aber offenbar nur in Rom entschieden werden konnte. Vom Ordensgeneral oder einem seiner Vertreter ist zu dem Fall nichts überliefert. Ganz unbedeutend kann die Angelegenheit dennoch nicht gewesen sein, schließlich war Deutschland die wichtigste außeritalienische Provinz. Wie sich erwies, wollte man von Rom aus dann doch nicht eingreifen und überließ alles Weitere den zerstrittenen Parteien und dem Geschick von Staupitz. Die Reise war also vollkommen vergeblich – oder sie wäre es gewesen, wenn sich Luther nicht einen eigenen Bildungssinn abgezwackt hätte.
Noch vier Wochen blieb er in der Stadt, bis zur Jahreswende 1511/12. Da er damit einerseits den italienischen Ordensbrüdern Kosten verursachte und ihn zu Hause in Wittenberg Lehrverpflichtungen erwarteten, darf man annehmen, dass ihm die Augustiner den längeren Aufenthalt nur ungern gewährt haben. Er musste aber bleiben: In Italien herrschte zwar ständig Krieg, doch so bedrohlich wie im Herbst 1511 war die Situation lange nicht gewesen.
1499 hatte Frankreich das Herzogtum Mailand erobern können, mit dem Maximilian den Condottiere Ludovico Sforza beliehen hatte. Nun aber war Julius II. entschlossen, die Macht in der Kirche zurückzugewinnen und zugleich als weltlicher Herrscher über Italien zu regieren. Frankreich sollte aus Oberitalien vertrieben werden, der Papst und niemand sonst in Italien herrschen. Für ihn marschierten zwanzigtausend Schweizer Söldner, finanziert von den allzeit liquiden Fuggern. Im Dezember griff Julius persönlich in den Kampf ein. Luther wird von dieser Europapolitik recht wenig mitbekommen oder gar verstanden haben. Er wusste nicht, dass Maximilian auf die Papstwürde spekulierte und dass die Kardinäle bereits von Julius abgefallen waren. Er wusste nicht, dass der wiedererstandene Julius am 5. Oktober 1511 in der Augustinerkirche Santa Maria del Popolo, in deren Konvent die beiden Deutschen wahrscheinlich untergekommen waren, den Zusammenschluss zur «Heiligen Liga» bekannt gegeben hatte, mit der die Franzosen aus Italien hinausgedrängt werden sollten. Luther wird von dem Konzil gehört haben, das am 5. November im Dom von Pisa eröffnet und später nach Mailand verlegt wurde, aber ob er überhaupt ahnte, dass es sich dabei keineswegs um eine innerreligiöse Revolte, sondern um einen Machtkampf der Kardinäle mit dem Papst handelte, ist zweifelhaft.
Er war doch nichts als ein Pilger, einer unter Tausenden, die jedes Jahr nach Rom strebten im sicheren Bewusstsein, dort Vergebung zu erlangen, eine Linderung der allzeit drohenden Strafen im Jenseits. Zwar hatte Luther in Erfurt die Generalbeichte bereits zweimal abgelegt, erzählte er viel später in den Tischreden, aber es war noch immer nicht genug, wieder musste er beichten, so «das ich wolde eyne gantze beychte von jugent auf geschehen thuen vnd from werden»[4]. Fromm war er schon, er wollte noch frömmer werden. Kein Ort, der besser dafür geeignet gewesen wäre als Rom, wo, wie er sich erinnert, die Märtyrer ihr Blut für den Glauben vergossen haben. Doch es sollte anders kommen. Im Rückblick erkennt er, was ihm die Pilgerschaft zur «Hure Babylon» verdorben hat: «Sie ist nu zerrissen, und der Teufel hat den Papst, seinen Dreck, darauf geschissen.»[5] Den Tischgenossen in seinem bürgerlichen Haushalt in Wittenberg wird er später ausgiebig die Prachtentfaltung des Papstes schildern. Der Bettelmönch Martinus ist darüber empört, dass der Papst sich die Füße küssen lässt, während Christus den Jüngern die Füße gewaschen hat.
Der regierende Papst liebte die Macht ebenso sehr wie den Prunk. Am 26. November 1511 feierte Julius II. den Beginn seines neunten Pontifikatsjahres und wohnte einem aus diesem Anlass gehaltenen Hochamt in St. Peter bei; er feierte wohl auch seine glückhafte Gesundung. Womöglich bezieht sich Luther auf dieses nicht ganz und gar kirchliche Fest, wenn er beklagt, dass der Papst «das sacrament [die Monstranz also] in der procession umbtregt, yhn musz man tragen, aber das sacrament stet fur yhm wie ein kandel weynsz auff dem tisch»[6]; er will getragen werden, aber die Monstranz steht auf dem Tisch, als wär’s ein Krug Wein. Nichts weiß Luther von der Renaissance, nichts davon, dass Julius sich wie seine Vorgänger und Nachfolger zwar als kirchlicher Würdenträger, aber in erster Linie als Fürst verstand. Wenn der Papst ausreitet, geht die Klage weiter, dann begleiten ihn «bey drey oder vier tausent maul reytter»[7]. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass er das alles gesehen hat, es könnte sich um antiklerikale Fabeln handeln (viertausend Reiter!).
Und wie sollte der fromme Eremit in seinem Bedürfnis, womöglich noch frömmer zu werden, auch nur ahnen, dass der nämliche Julius, den er durch dessen pompösen Lebensstil am heiligen Sakrament freveln sieht, ernsthaft daran denkt, den Bußprediger Savonarola, den sein Vorgänger Alexander VI. 1498 erhängen und verbrennen ließ, heiligzusprechen? Raffael hatte diesen Erzketzer 1509 in Julius’ Auftrag in den Stanzen des Vatikans unter die Gelehrten und Heiligen gemalt, die mit Christus über das Sakrament diskutieren. Er hat auch seinen Patron gemalt, als biblisch alten Mann, als Patriarchen würdigster Gestalt; doch Julius II. war ein eifriger Kriegsherr, den ein unberechenbares Schicksal in die Kirche verschlagen hatte. Luther wird in seiner ersten deutschnationalen Schrift «An den Christlichen Adel teutscher Nation» (1520) die Frage stellen, was den zu jeder kriegerischen Tat bereiten «blutseuffer» Julius so hoch erhoben hat.[8]
Das ganze Rom blieb ihm fremd, und wird ihm immer noch fremder im Abstand der Jahre. Die Renaissance erreichte ihn nicht, allenfalls in den drastischen Darstellungen von Kardinälen, die mit ihren Kurtisanen tafelten und tranken, wenn sie nicht, für ihn noch weit schlimmer, die Worte der Liturgie nur mehr im Spott gebrauchten. Dass Rom ein gigantisches Kunstprojekt war, sah er auch in den vier oder sechs Wochen dort nicht. Während des Pontifikats von Nikolaus V. (1447 bis 1455) war die Antike hoffähig geworden. Dieser Papst, meint Gregorovius, habe Rom «in eine päpstliche Festung verwandelt»[9]; vor allem ist Rom unter seiner Herrschaft zur Kunststadt geworden, die es auch in der römischen Kaiserzeit nie war. Nikolaus war ein Gelehrter, den es selber nicht nach Reichtum verlangte, nur Bücher sammelte er unersättlich. Bis in die baltischen Städte schickte er seine Gesandten, damit sie ihm kostbare Handschriften besorgten. Es wurde Mode, gebildete Männer more classico über die Antike und die Gegenwart Gedichte schreiben zu lassen oder sie dafür zu bezahlen, dass sie bei Reden und Bullen aushalfen. An der Kurie ging es liberaler zu als in der ganzen fünfzehnhundertjährigen Geschichte davor. Nikolaus V. holt Lorenzo Valla an seinen Hof, obwohl der doch die Konstantinische Schenkung, mit der das Papsttum seinen irdischen Machtanspruch begründete, als Fälschung entlarvt hatte. Er hatte auch begonnen, eine Umgestaltung des Petersdoms zu planen, der die Christenheit und ihren Glauben aufs prächtigste symbolisieren sollte – und am Ende die Kirchenspaltung brachte.
Nikolaus gilt als erster Renaissance-Papst. An seiner Frömmigkeit wird keiner zweifeln, doch wusste er, dass der Glaube nicht allein von der Angst vor der Hölle lebt. Als er seine letzte Stunde nahen fühlte, versammelte er die Kardinäle um sich und hielt eine programmatische Ansprache, die mit höchsttönender Bescheidenheit an die Nachwelt gerichtet war und seinen Nachfolgern in der päpstlichen Verschwendungskunst als Rechtfertigung dienen konnte. Das Volk in seinem schwachen Glauben, sagte er, füge sich der Autorität erst durch den Anblick monumentaler Bauwerke. «Große Werke der Architektur, welche geschmackvolle Schönheit mit imponierender Größe vereinigten, sollten mit dazu beitragen, die Autorität des Heiligen Stuhles zu erhöhen.»[10] Das Volk will die Verschwendung, verkündete der Papst, das Volk muss überwältigt werden zum Glauben: «Also nicht aus Ehrgeiz, aus Prachtliebe, aus leerer Ruhmsucht und Begier, unsern Namen zu verewigen, haben wir dieses große Ganze von Gebäuden angefangen, sondern zur Erhöhung des Ansehens des Apostolischen Stuhles bei der ganzen Christenheit, und damit künftig die Päpste nicht mehr vertrieben, gefangen genommen, belagert oder sonst bedrängt werden möchten.»[11]
Was wusste er, der kleine Mönch aus Mitteldeutschland, von dem großen Ganzen, das dem Papst und bald noch mehr seinen Nachfolgern vorschwebte? Luther konnte doch nicht ahnen, dass das Papsttum, an das er 1511 noch unverbrüchlich glaubte, auf dem Höhepunkt seiner weltlichen Macht stand und gleichzeitig wankte wie nie zuvor. «Als ein toller heiliger» sei er «durch alle kirchen und klufften» gepilgert, sagt Luther später,[12] und von der Politik wird er so wenig mitbekommen haben wie von der Rechtfertigungslehre des Nikolaus, der alle weiteren Päpste folgten. 1506 hatte Papst Julius II. persönlich den Grundstein für den neuen Petersdom gelegt, der nicht nur die größte Kirche der Christenheit werden, sondern mit seiner Kuppel aufragen sollte über dem künftigen Grab des Bauherrn. Seit Konstantinischer Zeit galt der vatikanische Hügel als der Ort, an dem der Apostel Petrus nach seiner Hinrichtung während der Verfolgung unter Kaiser Nero 67 nach Christus bestattet wurde. Selbstverständlich war es ein frommes Werk, dem ersten Papst und Statthalter Christi auf Erden dieses Monument zu errichten, doch ungleich wichtiger war es dem machtbewussten Nachfolger, mit der Monumentalkirche auf sich und seine eigenen Taten verweisen zu können.
Die wiederentdeckte Antike interessierte Luther nicht, erst recht blieb ihm die Bauwut fremd, die schiere Veräußerlichung des Glaubens. In der Schule in Magdeburg und Eisenach, auf der Universität in Erfurt wird er das eine oder andere von den klassischen Autoren zu lesen bekommen haben, aber in seinen Reiseberichten reagiert er wie ein Banause: «Denn da jtzt Häuser stehen, sind zuvor die Dächer gewest; so tief liegt der Schutt; wie man bei der Tiber wol siehet, da sie zween Landsknechts-Spieß hoch Schutt hat.»[13] Er war doch nicht in die Welthauptstadt gezogen, in die Machtzentrale von Augustus und Vespasian, von denen die schäbigsten Ruinen zeugten, sondern ins heilige Rom. Was sollten ihm die Trümmer der Römer?
Luthers Erzählungen vom verkommenen Rom können auch Wandersagen gewesen sein, wie sie in der traditionell antiklerikalen Stadt entstanden waren und wie sie als bereitwillig geglaubte Folklore auch von frommen Pilgern mit nach Hause genommen wurden. Eine Sage hatte allerdings den Vorzug, auch noch wahr zu sein: die wundersame und höchst lehrreiche Geschichte um den Bischof von Brixen, der zweieinhalb Jahre zuvor, im Frühjahr 1509, in Rom verstorben war. Kardinal war er auch gewesen, «und sehr reich, und als er war todt gewesen, hatte man bei ihm kein Geld gefunden, denn allein ein Zeddelin eines Finger lang, das in seinem Aermel gesteckt war. Als nu Papst Julius denselbigen Zeddel bekommen, hat er balde gedacht, es würde ein Geldzeddel sein, schickt bald nach der Fugger Factor in Rom und fraget ihn, ob er die Schrift nicht kenne? Der selbige spricht ja, es sei die Schuld, so der Fugger und seine Gesellschaft dem Cardinal schuldig wären und machte dreimal hunderttausend Gülden.»[14]
Der Bischof von Brixen, Melchior von Meckau, hatte mit allerhöchstem Segen einige der lukrativsten Pfründe des Abendlandes in seine Hand gebracht. Er stammte aus Sachsen, aus dem Bistum Meißen, wo er als Dompropst angefangen hatte, aber schon bald konnte er seine kirchliche Laufbahn in Rom fortsetzen. Außerdem hatte er als Kanzler für Sigismund den Münzreichen, Erzherzog von Österreich, und für den Kaiser persönlich gewirkt, unter anderem als Brautwerber um Bianca Maria Sforza. In weltlichen wie in geistlichen Belangen zu Hause, befolgte er wie kein anderer das Prinzip der hohlen Hand: Es geschah auf seinem Territorium nichts, ohne dass er beteiligt gewesen wäre. Wenn er als Gesandter Maximilians nach Venedig reiste, wurde er vom Senat mit hundert Dukaten bedacht. Später, in Rom, beklagte er sich beim venezianischen Gesandten, dass er schlecht behandelt worden sei, und die Stadt machte ihm ein weiteres Mal Geschenke im Wert von zweihundert Dukaten.[15] Zeitweilig war Meckau des Kaisers Statthalter in Tirol, wo Kupfer und Silber abgebaut wurden, und natürlich finanzierte er dessen Kriege. Bei einer seiner Charaden erwog der unberechenbare Maximilian vorübergehend auch, seinen Berater zum Papst wählen zu lassen. Meckau musste dem Kaiser ständig Geld leihen, aber er war auch einer der reichsten Männer Europas, Humanist außerdem, ein geschätzter Bauherr und Auftraggeber der Künstler. Freigebig ließ er malen, formen, bauen, doch längst nicht alles, was ihm aus Stadt und Land an Revenuen zufloss, war damit zu verbrauchen. Wohin mit dem Geld, wenn es nach kirchenamtlicher Lehre keinen Zinsertrag bringen durfte? So wurde Meckau als Bischof von Brixen stiller Teilhaber im Handelshaus Fugger, im frommen Wissen, dass es den deutschen Kaiser und Tiroler Landesherrn nach den Zuwendungen aus Augsburg verlangte wie den Verdurstenden in der Wüste nach Wasser. Meckaus Einlage war also mündel- und auch sonst sicher. Die Nähe zur Edelmetallförderung in Tirol, die auch den Bischof nährte, wird ihn davon überzeugt haben, dass Fuggers Investitionen vernünftig und sogar lukrativ waren. In Schwaz wurden vierundfünfzig Prozent des europäischen Silbers gefördert. Zwischen 1487 und 1494, in nur sieben Jahren, sollen die Fugger allein hier vierhunderttausend Gulden Gewinn gemacht haben.[16]
Die Verbindung zum Bischof von Brixen war besser als jedes Bankgeheimnis: Da der Prälat das Zinsverbot umging, also nicht gegen weltliche, aber gegen kirchliche, aus der Heiligen Schrift begründete Gebote verstieß, wird er sein finanzielles Engagement an keine noch so kleine Kirchenglocke gehängt haben. Das Bankhaus konnte deshalb recht frei darüber verfügen. Meckaus Teilhaberschaft begann am 30. April 1496 mit einer ersten Einlage, die allerdings aus den Schulden stammte, die Kaiser Maximilian bei ihm gehabt hatte. Zunächst waren es nur zwanzigtausend Gulden, doch ermöglichte diese Kapitalerhöhung den Fuggern, in den ungarischen Unternehmensteil zu investieren, der ebenfalls auf den Abbau von Kupfer und Silber setzte. In einer weiteren Einlage schoss der Bischof 1505 108931 Gulden nach.[17] 1506 zog er endgültig nach Rom, nicht ohne sein Kapital und auch weidlich kirchliches Gerät mitzunehmen, das er als sein Eigentum deklarierte. Beim Domkapitel fürchtete man bereits um sein Vermächtnis. In Rom wurde Meckau krank. Er verfasste ein Testament, wonach sein Haupterbe Santa Maria dell’Anima werden sollte, die deutsche Nationalkirche.
Zuletzt kamen so, die Zinsen nicht mitgerechnet, 152931 Gulden zusammen, eine ungeheure Summe für diese chronisch unterkapitalisierte Zeit. Das entsprach drei Viertel des Einlagekapitals der Fugger. Als Melchior von Meckau 1509 starb, fanden die frommen Männer der Anima in seinen Kleidern die Quittungen,[18] von denen Luther hörte, ausgestellt von Jakob Fugger persönlich und lautend auf phantastische Summen. Sogleich erhob sich Streit um diese Einlagen, die aus der stillen Teilhabe ein politisches Problem machten: Die Kurie beanspruchte das Vermögen ebenso wie der Kaiser, wie das Bistum Brixen, wie die leiblichen Verwandten in Sachsen. Peinlich war die Geschichte in jedem Fall und sollte deshalb auch geheim bleiben. Dass der ehrwürdige Bischof noch ein Deputat von zwanzigtausend Dukaten unterschlagen hatte, das er für seinen Bruder an die Anima weiterleiten sollte, tarnt die offizielle Monographie der Kirche als «Formfehler im Testament» und übergeht schamhaft sogar den Namen des Dukatenhorters.[19]
Das war der «Vorteil» Fuggers, wie er den Zins bezeichnete. Hier gestaltet sich sein Vorteil ganz und gar immateriell. Da an der höchsten Autorität des Papstes nicht zu zweifeln war und auch nicht an seiner Absicht, das gehortete Vermögen seines Spekulantenkardinals Meckau dem Kirchen- oder dem Julius-Schatz zuzuschlagen, konnte Jakob Fugger nichts ausrichten. Doch die Firma wäre sofort zahlungsunfähig gewesen, wenn ihr auf einen Schlag drei Viertel ihres Einlagekapitals entzogen worden wäre, ein Argument, das beim Kaiser und König verfing. Maximilian hatte bei seinem letzten Feldzug in Italien, es ging wieder einmal gegen Venedig, eine Niederlage hinnehmen müssen, weil die finanzielle Unterstützung aus Augsburg für den chronischen Schuldenmacher diesmal ausgeblieben war. Über Jahre wurde nun hin und her verhandelt. In dieser «finanziellen ménage à trois»[20] verfügte Maximilian, dass das Kapital nicht ausgezahlt werden dürfe. Am Ende siegte tatsächlich der Kaiser, der auf seinen älteren Ansprüchen bestand. Maximilian teilte sich die Beute mit dem Papst, dem gefällig zu sein Fugger auch bei dieser Gelegenheit nicht unterließ, während er den Kaiser mit Warenlieferungen zufriedenstellen konnte. Luther ist hier wieder mit einer Anekdote zur Stelle, mit der er die Sensationsgier seiner atemlos staunenden Zuhörer stillt: Drei Tonnen Goldes habe Fugger in Rom vorweisen können[21] und damit Julius II. von seiner Validität überzeugt. Der Papst musste an dem ungeliebten Handelspartner Fugger festhalten, denn so viel konnte der französische König nicht aufbieten und auch der englische nicht.
Das war die römische Wirtschaft, wie Luther sie am Rande erlebte. Es war nicht seine Welt, die durchrationalisierte und für die Organisatoren äußerst lukrative Frömmigkeitsindustrie. «Da ich auch so ein toller heilige[r] war, lieff [ich] durch alle kirchen und klufften, gleubt alles, was daselbs erlogen und erstuncken ist.»[22] Luther übte sein Priesteramt weiter aus, das hieß, er feierte, wann immer es ging, die Messe und ärgerte sich, wenn die einheimischen Kleriker ihn – «Passa, passa!» – vom Altar wegdrängten, weil er ihnen in seiner norddeutschen Frömmigkeit zu lang brauchte. Er besuchte die heiligen Stätten mit ihren kostbaren Reliquien. In Rom wurde das Schweißtuch der Hl. Veronika ausgestellt, das das einzig wahre Abbild des leidenden Christus zeigt. Es gab auch verschiedene Marterwerkzeuge, die ebenfalls mit dem Erlöser in Berührung gekommen waren, oder auch die Köpfe der Stammväter Petrus und Paulus (was zumindest bei Petrus seltsam ist, weil er nicht enthauptet, sondern gekreuzigt wurde).
Luther besuchte fleißig die sieben Hauptkirchen Roms – die Lateranbasilika, den Petersdom, San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo, Santa Croce in Gerusalemme, San Sebastiano –, er besuchte auch die Scala Santa, die heilige Treppe, die sich angeblich im Palast des Pontius Pilatus befunden hatte und über die der leidende Christus geführt worden sein soll. Wer alle achtundzwanzig Stufen kniend bewältigt und auf jeder ein Vaterunser gebetet hatte, erwarb einen vollkommenen Ablass, den Luther seinem Großvater Heine Luder widmete. «Sed in fastigium veniens cogitabam: quis scit, an sit verum»; als er aber oben angekommen war, dachte er: «Wer weiß, ob es wahr ist!»[23] Eine Einsicht post festum.
Seine späteren Zuhörer unterhielt Luther gern mit antirömischen Schauergeschichten. Doch auch ohne Einblick in die Geschäfte der Kurie, in das Machtstreben von Papst Julius, die finanziellen Transaktionen zwischen den Fuggern und geldsüchtigen Kirchen- und weltlichen Fürsten – dieses sagenhafte Rom konnte dem Fundamentalisten aus dem Norden nur fremd vorkommen.
Drittes Kapitel
Die doppelte Anna
Der fromme Pilger war nicht immer fromm, sondern zu Höherem bestimmt. Sein Vater hatte für Martin Luther die juristische Laufbahn vorgesehen, neben dem Arztberuf die beste Wahl für Akademiker, die ohne den Schutz der Kirche auskommen wollten. An den vielen neuen Universitäten sammelten sich um die Halbjahrtausendwende begabte Landeskinder. Georg Spalatin, der später zwischen dem Kurfürsten und Luther vermitteln sollte, Johannes Eck, der die päpstliche Bulle gegen ihn erwirkte, auch der Ablasslegat Raimund Peraudi erlangten ihre einflussreiche Stellung in der diplomatischen Welt durch die akademische Bildung, die ihren Vätern und Großvätern noch nicht zugänglich gewesen war. In dieser Zeit, lange als Frühkapitalismus charakterisiert, lösten sich zum ersten Mal die bis dahin so streng bewachten Klassengrenzen auf.
Luther hat seinen ungewöhnlichen Aufstieg als noch größer, noch unwahrscheinlicher dargestellt, als er es ohnehin gewesen war. Trotz seiner bescheidenen Herkunft habe er es zum «Doctor der heiligen Schriefft», zum «adversarius papae»[1] gebracht, vom Bauernsohn zum Widerpart des Papstes. Aber Martin Luther, Sohn des Hans Luder, ist nicht nur der Reformator und der, der beim Bibel-Übersetzen den Leuten aufs Maul geschaut hat, er ist auch der Autor der Luther-Legende. Nachdem er es versäumt hatte, seinen Namen nach Humanistenart zu latinisieren, änderte er den väterlichen Luder wenigstens in den schneidigeren Luther. Gewagt ist die Etymologie, die er dazu entwickelte: Es sei eine Ableitung des griechischen eleutherosbeziehungsweise eleutherius – der Befreier wollte er also sein und der Befreite. Namen sind bekanntlich Schicksal; beide Formen trafen somit auf den Mönch zu, der sich 1517 mit seinen Ablassthesen zur Fundamentalkritik an Kirche und Finanzwirtschaft entschloss. Sein zunächst nur theologisch gemeinter Beitrag innerhalb einer akademischen Diskussion wies von Anfang an weit darüber hinaus. Der erste Brief, den er mit dem Namen Luther verschickte, ging an seinen Gegner Albrecht von Brandenburg, den Kurerzbischof von Mainz.
Wie im Bildungsroman musste Luther sein Leben ganz tief unten beginnen, ehe es sich so weit oben erfüllen konnte. Ein «armer hewr» (Hauer) sei sein Vater gewesen, behauptete er mit dem evangelischen Feuer des nimmermüden Geschichtenerzählers. «Die mutter hatt al yhr holtz auff den rucken eingetragen»[2], sagte er einmal, oder noch einprägsamer: «Ich bin der Sohn eines Bauern, meine Vorfahrn, mein Vater sind rechte Bauern gewest. Also haben sie vns erzogen.»[3] Aber im thüringischen Möhra, wo sie herkommt, gehörte die Familie Luder bereits zur Oberschicht. Weil Hans Luder als Erstgeborener nach dem geltenden Erbrecht vom Hof gehen musste, wenn er dort nicht als unverheirateter Knecht dienen wollte, vor allem aber weil sich im Bergbau bessere Verdienstmöglichkeiten boten, verließ er Möhra und arbeitete zunächst in den Kupferschiefergruben im benachbarten Kupfersuhl. Bald ging er auch da weg und zog einhundertfünfzig Kilometer weiter nach Norden.
Die Bergwerke in der Grafschaft Mansfeld am Ostharz nahmen zum Ende des 15. Jahrhunderts einen solchen Aufschwung, dass alle Zuwanderer gebraucht wurden. Ein Onkel von Hans Luders Frau wirkte als oberster Bergverwalter. Eine Erbschaft Margarethe Luders wird geholfen haben, sich dort einzukaufen. Der Bergbau wurde seit Mitte des 15. Jahrhunderts, als es erst wenige und kaum größere Städte gab, zu einer regelrechten Industrie im ländlichen Raum, vor allem versprach er einen erheblich höheren Ertrag als die unberechenbare Dreifelderwirtschaft. «Denn der jährliche Gewinn eines Bleibergwerks ist, wenn man ihn mit den Früchten des besten Feldes vergleicht, der dreifache von diesem oder wenigstens der doppelte. Um wie viel also übertrifft die nämlichen Feldfrüchte der Gewinn eines Silber- oder Goldbergwerks!», schwärmt Georg Agricola in seinem Lehrbuch «De re metallica Libri XII».[4] Die Gegend um Mansfeld entwickelte sich Anfang des 16. Jahrhunderts zum Gebiet mit der größten Silberproduktion Europas. In schmalen Flözen, in günstigen Fällen drei übereinander, fand sich unter Tage Kupfer. Beim Einschmelzen ließ sich im Saigerverfahren außerdem eine geringe Menge Silber gewinnen, genug allerdings, um die Grafen von Mansfeld reich und die Hüttenmeister wohlhabend zu machen. Die Arbeit unter Tage war so hart, dass die Schicht nur sechs bis acht Stunden dauerte; in der Landwirtschaft konnten es im Sommer leicht zwölf bis vierzehn Stunden werden. Der Wochenlohn betrug kaum mehr als dreizehn Groschen (einundzwanzig Groschen ergaben einen Gulden).[5]
Das Gemälde von Hans Hesse ziert den 1521 geweihten Bergaltar der Stadtkirche St. Annen in Annaberg. Nirgendwo in Europa wurde im 16. Jahrhundert mehr Silber produziert.
Der Bedarf an Kupfer stieg unaufhörlich. Nach den Pest-Pandemien, in denen die Bevölkerung dezimiert worden war, begann sie nun wieder erstaunlich schnell zu wachsen. Die gesamte Wirtschaft erlebte einen – weitgehend kreditfinanzierten – Boom. Überall wurden Brücken gebaut, Klöster gegründet, Kirchen instand gesetzt, neue Wege angelegt. 1491 entdeckte man am Schreckenberg im Erzgebirge reiche Silbervorkommen; die dort wenige Jahre später gegründete Stadt wurde nach der Patronin der Bergleute benannt, der in der Heiligen Schrift nirgends erwähnten legendenhaften Großmutter Jesu: Annaberg. Die Hl. Anna genoss in Mitteldeutschland eine solche Verehrung, dass der Kurfürst von Sachsen, Friedrich der Weise, 1493 von seiner Pilgerreise ins Heilige Land einen ihrer Daumen mitbrachte und in seine Reliquiensammlung aufnahm. (Merkwürdigerweise heißt es auch von seinem Konkurrenten Albrecht, dass er einen echten Anna-Daumen besessen habe.)
Die allmähliche Umstellung der Kriegführung auf den Halbdistanzkampf brachte nicht nur das Ende des Rittertums, sondern erforderte vor allem erhebliche Investitionen, von denen wiederum jene Fürsten profitierten, denen das Schürfrecht zugefallen war. Die beständig weiter aufrüstenden deutschen Herrscher verlangte es nach den jeweils neuesten Feuerwaffen. Für die Kanonen brauchte es ebenso wie für den exponentiell wachsenden Buchdruck große Mengen an Kupfer. Mit der ostentativen Frömmigkeit wuchs auch der Silberbedarf: Es wurde für die immer filigraneren Kunstwerke benötigt, die in den Werkstätten in Nürnberg und Augsburg entstanden. In Silber gefasst waren zudem die abertausend Reliquien, die deutsche Fürsten in ihren Wunderkammern anhäuften und bei besonderen Gelegenheiten gegen Gebühr für einen Ablass feilhielten. So profitierte auch der Vater Luthers von der Fiskalisierung der Religion, gegen die sein Sohn eines Tages aufstehen sollte.
Für den Biographen ist traurig wenig bekannt über die frühen Jahre des späteren Reformators. Alle Angaben, die dem Historiker, dem Psychologen, dem gemeinen Luther-Versteher helfen würden, fehlen einfach. Nicht einmal sein Geburtsjahr steht fest. War er ein gutartiges Kind, das sich einen Hasen hielt und dem das Herz brach, als er geschlachtet wurde? Wollte er den Mädchen auf der anderen Straßenseite gefallen? War er ein guter Schüler, weil ihn – das immerhin dürfte als sicher gelten – die Eltern zeitüblich mit Schlägen erzogen? Nichts weiß man, abgesehen von dem, was Luther selber erzählte. «Mein mutter steupet mich vmb einer eingen [einzigen] nuß willen usque ad effusionem sanguinis»[6], bis Blut floss, und auch der Vater habe ihn gelegentlich richtig verhauen, sogar so, dass ihn, den Vater, die Tat reute. Alles nicht besonders überraschend.
Wer hätte auch etwas über seine Jugend festhalten sollen? Es ist ein noch weitgehend illiterates Zeitalter, neunzig Prozent der Deutschen können überhaupt nicht lesen und schreiben. Die Kirchenbücher verzeichnen bestenfalls schlichte Daten: Taufe, Eheschließung, Tod. Nichts Ungewöhnliches also und vor allem nichts, was auf die weltbewegende Rolle Luthers vorausdeuten würde.
Martin Luther wird – so will es sein Freund und Hagiograph Philipp Melanchthon – am 10. November 1483 in Eisleben geboren und am nächsten Tag auf den Namen des Tagesheiligen getauft. Luther selber hielt 1484 für sein Geburtsjahr. «Nullus est certus de navitatatis tempore», die Zeit seiner Geburt sei alles andere als sicher, erklärt er in den Tischreden, «denn Philippus et ego [Melanchthon und ich] sein der sachen vmb ein jar nicht eins.»[7] Der sterngläubige Melanchthon schwankte lange und hatte zunächst 1484 und einen Termin zweieinhalb Wochen früher im Oktober favorisiert, weil da die Planeten Saturn und Jupiter angeblich beinahe in einer Linie zur Sonne standen und damit die großen Dinge schon ankündigten, die sich mit der scheinbar niedrigen Geburt im Mansfelder Land andeuteten; ein Horoskop, das aber erst für den bereits berühmten Luther erstellt wurde, sollte die reformatorische Revolution nicht unter einen unglücklichen Stern bringen. Dafür sorgten später die Luther-Gegner: Der Vater sei ein homicida, ein Totschläger, gewesen und habe deshalb aus seiner Heimat in Möhra fliehen müssen; die Mutter nichts Besseres als eine Badmagd, eine Hure; Luthers Geburt daher unehelich, wenn er nicht gleich die Frucht des Verkehrs war, den die Mutter mit einem Incubus, also praktisch mit dem Satan persönlich pflog.[8] Vor allem sein Widersacher Johannes Cochläus tat sich mit solchen Schmähungen hervor. «Wenn der Teufel der Lere nichts kan anhaben, so legt er sich wider die Person, Leuget schmehet, flucht und tobet wider die selbigen», klagt Luther am Ende seines Lebens. «Gleich wie der Papisten Beelzebub mir thet, da er meinem Euangelio nicht kund widerstehen, schreib er, Ich hette den Teufel, were ein Wechselbalck, Meine liebe Mutter eine Hure und Bademagd.»[9] Er führt die Klage allerdings in der Schrift «Von den Juden und ihren Lügen», in der er seinerseits an Schmähungen nicht spart.
Martin Luther war das zweite von mutmaßlich neun Kindern. Die Familie zog ein halbes Jahr nach seiner Geburt um. Der Vater arbeitete sich bald zum wohlhabenden Hüttenmeister hoch, 1507 besaß er in der Stadt Mansfeld bereits ein großes Haus, das sich über zwei Grundstücke ausdehnte. Vorn an der Hauptstraße befand sich das Wohnhaus, dahinter der Hof, die Wirtschaftsgebäude und der Garten. Bei Grabungen kamen in den vergangenen Jahren Überreste von Küchenabfällen zum Vorschein, die belegen, dass der Luder’sche Haushalt gut ausgestattet war und man abwechslungsreich aß. Süß- und Salzwasserfisch gab es, sogar Weintrauben und Feigen, die sich ein armer Hauer niemals hätte leisten können. In der Bürgerschaft stieg Hans Luder auf und waltete zeitweise als «Schauherr» (Geschworener). Die hart erarbeiteten Einnahmen aus dem Bergwerks- und Hüttenbetrieb wurden ergänzt durch Diäten in Höhe von jährlich achtzig Gulden, die sich unter anderem aus Strafgeldern ergaben. Außerdem verlieh er Geld und kaufte zur Absicherung eine kleine Landwirtschaft. Es war ein Vermögen auf Pump, denn nicht anders als die höchsten Herren im Land verschuldete er sich, um überhaupt investieren und kaufen zu können. Luder blieb sein Leben lang Schuldner.
Für seinen Sohn war ein Platz in der Verwaltung vorgesehen. Das Kind zeigte keinerlei Neigung, sich dem väterlichen Plan zu widersetzen. Vom fünften Lebensjahr an besuchte Luther die Mansfelder Lateinschule, dann zusammen mit dem Hüttenmeistersohn Hans Reinicke die der «Brüder vom gemeinsamen Leben» in Magdeburg, schließlich die städtische Pfarrschule Sankt Georg in Eisenach, wo er zu den Kurrende-Sängern gehörte, die vor allem in der Adventszeit durch die Straßen zogen. Dieses zwar erbauliche, aber demütigende Ritual hielt sich, ungeachtet jeder Reformation, bis ins 19. Jahrhundert. Die Schüler sangen fromme Lieder und hofften auf großzügige Spenden von Bürgern, die sich der frierenden Kinder erbarmten. Die Musik wurde ihm trotzdem nicht verleidet: Er übte sich auf der Laute; später werden ihm die Protestanten eine Reihe großer Lieder zu verdanken haben. Im Lateinischen erwarb er die von einem Schüler erwartete Geläufigkeit; schriftlich war es ihm bald näher als das Deutsche. Die Komödiendichter Plautus und Terenz waren ihm am liebsten, den Vergil studierte er auch.
Als «Martinus Ludher ex Mansfeldt» im April 1501 mit siebzehn die Erfurter Universität bezog, verdiente sein Vater schon so viel, dass dem Sohn kein Nachlass gewährt werden konnte; die vollen Studiengebühren wurden fällig. Es lief weiter alles nach Plan: In kürzester Zeit erlangte der junge Luther den baccalaureus und den Grad eines magister. Das studium generale