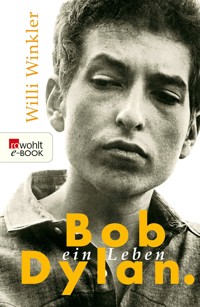
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Anfang der Sechziger stieg Bob Dylan in weniger als drei Jahren zum Herold des neuen Amerika auf. Seine Songs begleiteten die Jugendbewegung bald in der ganzen Welt. Die Beatles sogen begierig jedes seiner Worte auf, die Byrds machten sie zum Gemeingut. James Dean gab das Tempo der neuen Zeit vor, und nie war es schöner, jung zu sterben. Alle folgten diesem Muster: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones – Bob Dylan hat es überlebt. Er fing mit Elvis an, mit Little Richard und mit Buddy Holly – und spielt noch immer. «There is no success like failure», singt er seit jetzt 50 Jahren, und ein besonderer Erfolg sei das ja nicht. Aber darf man dem Künstler trauen? Lügt er da nicht schamlos? Keiner ist so erfolgreich gescheitert wie Bob Dylan. Deshalb macht er auch weiter. Dafür hat er überlebt. Und wer überlebt hat, der geht querfeldein. Die Tournee darf niemals aufhören. 2016 wurde Bob Dylan der Nobelpreis für Literatur zuerkannt. Willi Winklers launig-subjektives Buch ist ein gelungener Entschlüsselungsversuch dieses rätselhaften, ewig hakenschlagenden, keinen Erwartungshaltungen entsprechenden Charakters.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Willi Winkler
Bob Dylan
Ein Leben
Inhaltsverzeichnis
Zitat
Die Legende vom heiligen Hobo BOY FROM THE NORTH COUNTRY
Die diebische Elster VILLAGE VOICE
Glory Days I SING THE BODY ELECTRIC
Speed Kills AMPHETAMINE JAHRE
Der englische Patient HÖRSTURZ
Motorcycle Nightmare DIE LEGENDE LEBT
New Morning TOD UND WIEDERGEBURT
Nach ihm die Sintflut SONG AND DANCE MAN
«Blood On The Tracks» DYLAN MALT SEIN MEISTERWERK
Glaubensgewissheiten und andere Irrfahrten HE NOT BUSY BEING BORN IS BUSY DYING
Heute dreißig Jahr NUN SINGET UND SEID FROH
Der Sänger, nicht der Song THE NEVER ENDING TOUR
Immer weiter und unsterblich BOB IS GOD
Some speak of the Future FADE OUT
Bücher und anderes
Diskographie
Fotonachweis
Die Legende vom heiligen Hobo
BOY FROM THE NORTH COUNTRY
Als Erzählung leidet das Leben Jesu unter dem Mangel, dass praktisch nichts über seine Kindheit und Jugend bekannt ist. Er wurde unter nicht ganz eindeutigen Umständen geboren, zur vorgeschriebenen Zeit beschnitten und im Tempel dargestellt. Dort, er war wohl zwölf, verlor ihn seine Mutter aus den Augen und fand ihn wieder, wie er im Kreis der Schriftgelehrten hermeneutische Probleme der Bibellektüre diskutierte. Da kündigte sich Großes an. Zwölf erst, und schon ein richtiger Gelehrter! Aber sonst? Legenden mussten helfen, die Aussparung zu überbrücken. Jene zum Beispiel vom Jesusknaben, der nach Kinderart mit Lehm bazelte und dabei Vogelähnliches formte. Er klatschte in die Hände, der Kleine, und schon verwandelte sich die irdische Schwere in reine, überirdische Leichtigkeit, und die Vögel – vo-la-re! – erhoben sich in die Luft. Oder die Dornenkrone, die der unschuldige Knabe in der Werkstube seines Vaters, des übrigens sauber düpierten Zimmermanns Josef, zusammenflicht, worüber seine Mutter auch gleich in Tränen ausbricht: Jessasmaria!
Nach dieser schönen und gewiss heiligmäßigen Art und Weise der Präfiguration wird noch fast jede Künstlerlegende gestrickt. Denn irgendwoher, so haben wir es in der Schule und von der Milieutheorie gelernt, irgendwoher muss der Bub es doch haben. Die Geburt als gestiefelter und gespornter Erwachsener ist seit der göttlichen Athene leider etwas aus der Mode gekommen. Und da man eher nichts weiß, Aufzeichnungen selten sind, Augenzeugen vergessen und noch lieber verdrehen, und der biographische Gegenstand erst recht der Legende den Vorzug vor der Wahrheit gibt, setzt der Bildungsroman spätestens im Mutterleib ein.
Oder hier.
Bob Dylan kam als Robert Allen Zimmerman am 24.Mai 1941 in der nordamerikanischen Stadt Duluth zur Welt.1Seine Mutter Beattie fühlte die Wehen nahen und sagte zu ihrem Mann Abraham: «Oh, Mercy!»
Könnte jedenfalls sein.
Was man weiß, hilft auch nicht weiter: Haushaltsgeräte verkaufte der Vater, die Mutter war eine Frohnatur, insgesamt ein liberales jüdisches Elternhaus in katholischer Umgebung, aber ohne viel religiöses Brim und Borium – musste er deshalb später den Fundamentalismus nachholen? Die fehlende Prägung, rachsüchtig meldete sie sich siebenmal siebenfach: Robert Graves; bisschen Hindu- und Buddhismus; Bibelstudien im altväterlichsten Geiste; dann wieder die Vineyard Foundation; die Lubavitcher; und dass außer ihm sowieso alle verdammt seien?
Könnte doch sein.
Was man weiß, ist nichts. Behilft man sich also mit jesusmäßigen Geschichten. Der Vater, Abe, streng, aber zum Glück wohlhabend, wurde Zeuge, wie sich bei seinem Erstgeborenen schon früh das kommende Talent zeigte. Trällerte er denn nicht bereits als Kleinkind ins väterliche Bürodiktaphon? Und bei Geburtstagen, gaben sie ihm nicht sogar Geld dafür, dass er sang? Und er war doch erst drei oder vier Jahre alt. Der Musikkritiker Robert Shelton bezieht diese Anekdoten direkt von der Familie, wenn sie ihm nicht der erwachsene Mythenfabrikant Bob Dylan gleich selber soufflierte. Die Legende wird gedruckt, das weiß jeder Western-Regisseur, und nicht etwa die Wahrheit. 1964, als sich Bob Dylan, im konspirativen Verein mit Manager Albert Grossman, schon ziemlich gut auf sein öffentliches Image verstand, unterlief den beiden der Kunstfehler, dass aus einer als PR geplanten Story im Nachrichtenmagazin «Newsweek» eine Enthüllungsgeschichte wurde: Dylan heißt in Wirklichkeit Zimmerman, verriet die Reporterin; er war gar nicht jahrelang auf der Landstraße; und seine Liedtexte sind sowieso banal. Außerdem, der bekannteste davon, der von «Blowin’ In The Wind», sei überhaupt nicht von Dylan, sondern den habe er einem Oberschüler abgekauft – sagen wir mal so: Der Wahrheitsfindung diente die Geschichte vielleicht nicht, aber sie mehrte den Ruhm des vermeintlich Entlarvten ganz ungemein.
In Hibbing wuchs Bob Dylan auf, siebzig Meilen von Duluth entfernt. Also noch kleiner, noch metropolenferner, noch näher an der kanadischen Grenze. In Hibbing wurde Eisenerz gefördert, eins der größten Vorkommen in den Vereinigten Staaten. Dafür hatte man die Häuser zuweilen sogar umgesetzt, die Straßenführung geändert und die ganze Stadt unterhöhlt. Nun war das Metallvorkommen ziemlich erschöpft, die Grundstückspreise verfielen, die Leute wurden arbeitslos. Hibbing in der Nachkriegszeit hätte sich gut als Schauplatz für ein B-Picture geeignet; eine sterbende Stadt, Existentialismus nach außen gestülpt. «Used to play in the cemetery/Dance and sing and run when I was a child», singt Dylan 1974 in dem Lied «Nobody, ’Cept You». Tod, Vergänglichkeit, Verlustgefühle sind große Themen schon in den Songs, die er auf seiner ersten Platte, «Bob Dylan», vorträgt; Pose natürlich, denn was hat ein junger Mann von zwanzig Jahren mit dem Tod zu schaffen? Ja, was? Er aber hatte das Sterben seiner Heimatstadt gesehen. Auch kein reiner Spaß.
Wer nichts weiß von Dylan, weiß doch, dass er seinen Namen geändert hat, und zwar, weiß jeder weiter, aus Verehrung für den walisischen Dichter Dylan Thomas, der 1960 unter klassischen Umständen sein Leben im New Yorker Chelsea Hotel versoff und gottgefällig verschied. In seinen Texten gibt Dylan nicht den geringsten Hinweis auf Dylan Thomas, zu finden ist nur ein Robert Milkwood Thomas, eines seiner vielen Pseudonyme als Sessionmusiker bei Freunden, das sich notfalls auf Thomas’ Hörspiel «Under Milk Wood». (1954) beziehen könnte. Wahrscheinlicher als Taufpate ist der Seriendarsteller Matt Dillon, ewiger Sheriff in den «Rauchenden Colts». Die Form mit dem y sieht natürlich um vieles edler, auch keltischer und britisch-protestantischer aus, so weit wie möglich entfernt also von einer jüdischen Herkunft. Der Antisemitismus war in den Fünfzigern und Sechzigern gewaltig in den USA.
Für einen halbwegs intelligenten Teenager gab es nichts zu lernen in Hibbing außer Rock ’n’ Roll. Der kam aus dem Radio, der ließ sich kaufen, und wie sonst hätte man sich gegen die Zumutungen der Schule und der Eltern wehren können? Die Eltern wollten natürlich nur sein Bestes, und dazu gehörten regelmäßiger Schulbesuch, Zimmer aufräumen, nett und früh zu Hause sein. «Thought I’d shaken the wonder and the phantoms of my youth/Rainy days on the Great Lakes, walkin’ the hills of old Duluth.» Bloß weg da.
Bob Dylan musste fort von zu Hause. Sein Vater wies ihn zurecht, wenn er nur wagte, die Stimme zu erheben, und zerriss einmal sogar ein Bild von James Dean. Die bekannten Leiden eines Knaben. Längst vorgeschrieben im Buch der Bücher, in der ersten Künstlerlegende. Auch Jesus verließ Vater und Mutter und seine Heimatstadt, weil er nicht so ganz von dieser Welt war. Die Diskussion mit den Schriftgelehrten hatte es doch bestimmt: Bethlehem oder später Nazareth war einfach zu klein für einen, der so lebhaft träumte; er musste weiter. Auf Vorhaltungen seiner Mutter wollte er dann nichts mehr wissen von ihr. «Das sind meine Mutter und meine Brüder», sagte er und wies auf seine Jünger. Kann man ja verstehen. Auch begreiflich, dass später immer wieder jemand Dylan an seine provinzielle Herkunft erinnern musste und damit alles zu erklären meinte. Beim großen Vorläufer lautete der Vorwurf nicht weniger kleinlich (Mt 13,54f.): «Woher hat dieser Mann seine Weisheit, woher die Kraft, diese Werke zu tun? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns?» Gute Frage.
Der Reporter Larry Sloman hat im Herbst 1975Beattie Zimmerman eine Bestätigung dafür entlockt: «Dylan ist Dylan, und ich bin Zimmerman. Was mein Sohn geschafft hat, hat er ohne seinen Vater und mich geschafft. Er wurde uns geboren, aber dann ging er fort und machte alles ganz allein.»
Er nahm den Highway 61 und suchte das Weite. Oder: «Hibbing ’s a good ol’ town/I ran away from it when I was 10, 12, 13, 15, 15½, 17 an’ 18/I been caught an’ brought back all but once.»
Gelogen, alles.
Izzy Young vom Folklore Center in Greenwich Village, in dem er anfangs Tag für Tag rumstand und sich an den Instrumenten bediente, hat Dylan noch ein paar weitere Bausteine für den Künstlerroman geliefert. In Minnesota geboren, ja, aber schon als Kind sei er nach Gallup in New Mexico (gelegen praktischerweise an der Route 66) umgezogen, ein blinder (oha!) Straßensänger in Chicago habe ihn den Blues gelehrt, in Kalifornien (wo er nie war) habe er Woody Guthrie kennengelernt, in Nashville sei er, logisch, auch gewesen und, genau, Carl Perkins singe seine Lieder (Chuzpe, denn das hätte man notfalls nachprüfen können), und wenn er bei Bobby Vees Band geblieben wär’, dann wär’ er heute Mil-li-o-när! Aber Geld, nein, also wegen des Geldes würde er nicht Musik machen.
Cool.
Was man weiß, was die unermüdlichen Dylan-Schliemänner ausgraben konnten, ist kein großer Schatz, sondern eine normale Kindheit in der Provinz. In der schön kurzen Autobiographie «11Outlined Epitaphs». (schon wieder Gräber!) hat er diese Kindheit flaubertromantisiert: «The town I was born in holds no memories/but for the honkin’ foghorns/The rainy mist/an’ the rocky cliffs/I have carried no feelings…» Er spielte wohl früh Rock ’n’ Roll mit seinen Freunden und vernachlässigte lehrbuchmäßig die Schule, aber weiter als bis Duluth kam er nie, und auch dort schaffte er es erst hin, als er mit 16 sein erstes Motorrad hatte. Als Bob Dylan 16 war, sang Elvis (22 damals) «Hound Dog» und Chuck Berry «Sweet Little Sixteen». Drei Jahre vorher hatte sich Marlon Brando auf ein Motorrad gesetzt und als Anführer einer Gang eine kalifornische Kleinstadt terrorisiert. Als die jungen Männer gefragt werden, wogegen sie rebellieren, lautet die Antwort: «Was wollen Sie haben?» Genau, Rebellen ohne Grund waren sie, aber mit einem Motorrad und dem Elvis-Blues.
Fast möchte man sich, so wenig überraschend ist alles, was bei den Biographen Spitz, Scaduto, Shelton und Williams über die Anfänge Dylans steht, ein kleines, schulmäßiges ödipales Drama vorstellen: «Oh God said to Abraham, ‹Kill me a son›/Abe says, ‹Man, you must be puttin’ me on›. (…)/Well Abe says, ‹Where do you want this killin’ done?›/God says, ‹Out on Highway 61›.» Wäre natürlich schöner, und Psychoanalyse kann sowieso jeder, aber, sorry folks!,der Mann macht euch wieder was vor, erleidet das bekannte Drama des begabten Kindes und träumt sich nur zusammen, was ihm andere vorgelebt haben. Und der Highway 61 führt von Minnesota aus in den Süden, durch Memphis und schließlich nach New Orleans. Weg, bloß weg.
Manchmal hat Dylan es ganz offen ausgesprochen, wo er herkam und wo er hinwollte. «In times behin’, I too/wished I’d lived/in the hungry thirties/an’ blew in like Woody/t’ New York City…» usw. Wollte einer sein, wie einmal ein anderer gewesen ist, für ein Zehnerl und ein Fünferl spielen in der U-Bahn und den Hut herumgehen lassen in den Bars an der Eighth Avenue, wie er weiter ironisch romantisiert. So renommiert einer, der nicht arm war und hungrig schon gar nicht. Bevor er aufs College nach Minneapolis entlassen wurde, musste er, so eine apokryphe Geschichte, für die Sommermonate in ein Besserungsinstitut in Pennsylvania. Probleme reicher Leute Kinder. Man darf an Salingers Holden Caulfield denken, den in vielen Jugendverwahranstalten fallierten Verzögling, die Flucht aus dem Internat vor Weihnachten, die Romantik Manhattans, aber das väterliche Unverständnis ist auch bei diesem jungen Mann unabweisbar. Dylan war, so viel wenigstens kann man verlangen, unverbesserlich. Vielleicht hat er im Internat trotzdem etwas fürs Leben gelernt, denn als er von Minneapolis nach New York ziehen wollte, kehrte er kurz nach Hause zurück, um sich das Reisegeld zu erbitten. Für diesen Auftritt, so wieder eine der schönen Geschichten, ließ sich der große Performer gern die Haare schneiden.
Andererseits, wie hätte Vater Abe sich denn sonst verhalten sollen? Sein Sohn interessierte sich nicht für die Schule, er wollte nichts Besseres werden und schon gar nicht den väterlichen Laden übernehmen; auf dem Klavier, das im Wohnzimmer stand, hämmerte er bloß herum und war sich sogar für die angebotenen Unterrichtsstunden zu gut, und dass er sich ausgerechnet einen tödlich verunglückten Darsteller von jugendlichen Delinquenten zum Vorbild nahm, entspräche nicht einmal in James Deans Film «…denn sie wissen nicht, was sie tun» der väterlichen Vorstellung von sozialem Aufstieg.
An der Universität Minneapolis sind keine akademischen Leistungen des Studenten Zimmerman belegt. Vernünftig, wie er war, gab er sich sofort auf. Die Kunst lockte, und auch wenn das Künstlercafé nur «The Ten O’Clock Scholar» hieß, konnte man dort auftreten, und auf die Frage nach seinem Namen antwortete der Junge aus dem Norden: «Bob Dylan.» Ein paar Wochen kellnerte er auch in North Dakota und hätte, so wieder die Legende, als Pianist bei dem erwähnten Bobby Vee anfangen können; allein die Band konnte sich kein Piano leisten und der mögliche Mitspieler erst recht nicht. Das war die Geschichte, wie er beinah einmal Millionär geworden wäre.
Bestimmt vernachlässigte er seine Bildung nicht, sondern suchte sich seine Freundinnen nach dem Umfang ihrer Plattensammlungen aus, hörte bei ihnen die alten Folksongs und verdarb sich systematisch die sanfte, nach Ohrenzeugen sogar liebliche und unbedingt engelhafte Stimme. Offensichtlich wollte er ein anderer werden.
Den Sommer 1960 verbrachte Dylan in Denver und Umgebung. Denver liegt in Colorado und fast tausend Meilen weiter im Westen, Gelegenheit also, die Legende fortzustricken. Und wo wir schon davon sprechen: War diese geographische Entrückung nicht ein wenig wie Jesu vierzigtägige Exerzitien in der Wüste?
Der 19-Jährige wird kaum gewusst haben, dass Denver in der Mythologie der «Beats» das ausgelagerte Herz der Bewegung war. Neal Cassady wohnte hier, Kerouac kam manchmal auf Besuch, Ginsberg schaute gelegentlich vorbei. Für die Männer von der Ostküste war Denver der Wilde Westen, eine Goldgräberstadt und schon deshalb näher am amerikanischen Urquell. In Denver will Dylan in einem Striplokal aufgetreten sein und ein bisschen Gangsterei kennengelernt haben. Auf jeden Fall wollte er, als er nach fünf Wochen wieder nach Minneapolis zurückkam, Mundharmonika spielen wie Sonny Terry. Außerdem redete er komisch, mit den Elisionen und Dehnungen des Westerners oder, wie das Schimpfwort lautete, dem Hinterwäldlerdialekt eines «Okie». Die «Okies» waren die fast schon legendären Armen der Dreißiger. Bob Dylan hatte diese schöne Zeit knapp verpasst; der nur sechs Jahre ältere Elvis durfte bei seinem Vater noch das ganze Elend jener Zeit erleben: Hunger, Arbeitslosigkeit, Scheckbetrug, Diebstahl, Knast. In seinem Roman «Früchte des Zorns». (1939) schildert John Steinbeck das Elend der Landbevölkerung vor allem in Oklahoma, die Opfer der Wirtschaftskrise und zugleich der jahrelangen Trockenheit wurde und schließlich ihr Heil nur mehr im Aufbruch nach Westen sah, Richtung Kalifornien. Aber wichtiger als Steinbeck wurde für Dylan der Folksänger Woody Guthrie. Der hatte die Armut selber erfahren, war aus dem dürr gewordenen Texas mit den anderen Flüchtlingen nach Kalifornien aufgebrochen, hatte die Ausbeutung dort erlebt und in Hunderten von Songs eine offene Gesellschaft angeprangert, in der man alles darf, besonders wenn man sich auf der besseren Seite des Lebens befindet und die Schlechtergestellten «mit einem Federstrich ausplündert».
Woody Guthrie war ein Held. Außerdem war er auf den Tod krank. Bei seiner Rückkehr nach Minneapolis lieh Bobby jemand Woody Guthries Autobiographie «Bound For Glory», und seitdem wollte er nur noch sein wie Woody. Bob Dylan redete wie Guthrie, sang wie Guthrie und spielte ihn auch schon, den Hobo, der den Daheimgebliebenen erzählt, wie hart das Leben auf der Landstraße und in Güterwaggons ist.2Gleichzeitig las er Jack Kerouac («On The Road» war 1957 erschienen), Gary Snyder, Frank O’Hara, hörte von Allen Ginsberg und dass es anderswo noch mehr gab als den Mittleren Westen. «Es war», wird er später erzählen, «diese ganze Szene unvergesslich, diese Jungs und Mädchen, von denen mich manche an Heilige erinnerten…»
Heilig werden, dreimal heilig.
Er wollte, sagte er den einen, nach New York, ans Krankenbett von Woody Guthrie. Er wollte nach New York, sagte er den anderen, um reich zu werden. Diesmal hatte er nicht gelogen; beides ging in Erfüllung. Und er schüttelte den Staub seiner Heimatstadt (auch den von Minneapolis) von den Füßen, schon weil der Prophet in seiner Heimatstadt nichts gilt, und zog hinaus in die weite Welt.
Unterwegs hörte er Muddy Waters in Chicago, fuhr dann mit dem Musiker Dave Berger weiter nach Osten: «Wir fuhren, ohne anzuhalten, und er sang ununterbrochen. Es war furchtbar nervig, immer dieser monotone Stil und auch noch mit diesem Woody-twang. Schließlich sagte ich ihm, er solle verdammt nochmal endlich aufhören.» Etwas schöner die Legende, Dylan sei in einem Schneesturm nach New York getrampt. Mein lieber Mann! Ankunft New York, sagen die Historiker, die alles nachgeprüft haben, am 24.Januar 1961, und es war natürlich bitterkalt. («I froze right to the bone», erzählt er im ersten Stück seiner ersten Platte.) Eigentlich fast so kalt wie im nördlichen Minnesota. Und hat es nicht auch hier geschneit?
Robert Shelton hat sich von Dylan tatsächlich aufbinden lassen, er habe sich zwei Monate als Strichjunge am Times Square herumgetrieben, auch gutes Geld gemacht («manchmal hundert Dollar die Nacht»), aber alles gleich wieder verjuxt. Künstlerpech. Überhaupt harte Zeiten in New York für einen Künstler; Vorschrift damals. Der Ehren-Beatnik Herbert Huncke zum Beispiel war Stricher und Hehler am Times Square, hätte als Kleinkrimineller beinah Ginsberg und Burroughs ins Gefängnis gebracht, die ihn dafür noch umso mehr verehrten. Wahrscheinlich hatten seine Eltern das Bürgersöhnchen Robert mit genügend Geld für die erste Zeit ausgestattet.
Bob Dylan fand jedenfalls erstaunlich schnell in die Szene. Er konnte Hunderte von Folksongs auswendig. Am Tag nach seiner Ankunft fuhr er hinüber nach New Jersey, suchte Woody Guthrie im Greystone-Krankenhaus auf und spielte ihm Guthrie-Stücke vor. Lob, großes Lob. Als Dylan auch noch seinen «Song To Woody» vortrug, geschrieben, wie das Originalmanuskript weiß, «von Bob Dylan in Mills Bar an der Bleecker Street in New York City am 14.Tag des Februar, für Woody Guthrie», war der adorierte Sänger unweigerlich begeistert. «Der Junge hat eine gute Stimme. Seine Texte sind vielleicht nicht so gut, aber singen kann er sie.» Die Vorlage war da, und die Schrift erfüllte sich: «Und das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe.». (Mt 3,17)
Natürlich wurde er sogleich wohlgefällig aufgenommen und von Guthries Freunden adoptiert. Die Frauen bemutterten ihn, die Männer nahmen ihn nicht ernst. Er bekam abgetragene Sachen und ausreichend zu essen. Beichten wollte er bei Woody Guthrie, wie er einem befreundeten Journalisten anvertraute, aber dieser war kein geeigneter Beichtvater. Offenbar hatte Dylan schon nach kurzer Zeit genug von Guthrie; er war ihm zu egozentrisch, zu menschlich. «Woody war mein letztes Idol.»
Zeit für ein neues, für ihn.
In Gerde’s Folk City in der Fourth Street war jeden Montag Amateurabend, und Dylan spielte dort Mundharmonika, Gitarre, gelegentlich auch Klavier. Er war Woche für Woche da, fiel aber noch nicht auf. Fiel doch auf, weil er Geschichten auf der Bühne erzählte, sich über Leute lustig machte, pointenlose Witze feilbot. Er kam immer wieder, spielte, sang, ließ sich auslachen für seinen eher seltsamen Vortrag, spielte weiter. Jeden Montag trat er auf, bis ihm der Besitzer Mike Porco einen Job versprach. Wieder eine Lossagung von zu Hause. Porco nahm ihn mit zur Gewerkschaft, zahlte ihm die achtzig Dollar Aufnahmegebühr und leistete dann für den Minderjährigen die Unterschrift als Vormund, denn «mein Vater ist tot».
Der Waisenknabe trug ein auffälliges Cordhütchen, das er herumgehen ließ nach dem Vortrag. Honorar gab’s nämlich keins, nur Trinkgeld; «drum habe ich mir eines Tages einen Hut aufgesetzt». Auch wenn er kaum was wusste von der Welt, er kannte sich doch aus in ihr, denn er hatte von James Dean und Marlon Brando und Elvis Presley mehr gelernt als der handelsübliche Folkie. «Stil war wichtiger als technische Fertigkeiten, und von Stil hatte die Folkbewegung nicht die leiseste Ahnung.»
Der mützenbewehrte Bob Dylan war damals kein Gitarrist, sondern Mundharmonikaspieler. Er konnte es nur nicht oder, je nach Lesart, sogar viel besser. Während andere in die Mundharmonika hineinbliesen, saugte er die Luft aus ihr heraus. Mit seiner Mundharmonika begleitete er im Sommer 1961, immerhin, Harry Belafonte. Im April 1961 war er zum ersten Mal auf einem Plakat zu sehen gewesen: Er spielte mit dem Bluesmusiker John Lee Hooker bei dessen fünftägigem Engagement in Gerde’s Folk City – und Geld gab es auch. Er wurde noch immer bemuttert, junge und ältere Frauen entdeckten seine Hilfsbedürftigkeit, die er natürlich sofort auszunutzen verstand. Freunde vermittelten ihn nach Cambridge, Massachusetts, wo er Eric Von Schmidt und dessen Folksammlung kennenlernte, dann Carolyn Hester und deren damaligen Mann Richard Fariña. Und er befreundete sich mit Suze Rotolo, deren Eltern schon wieder über eine gewaltige Plattensammlung verfügten.
Die diebische Elster
VILLAGE VOICE
Die amerikanische Musikszene lag 1961 auf den schleichenden Tod danieder. Sie wartete ahnungslos auf den Import ihres eigenen Sounds durch die Beatles, die da längst noch nichts von ihrer historischen Aufgabe ahnten und in Hamburg betrunkene Seeleute bei Laune halten mussten. Elvis hatte die zwei Jahre bei der Army nicht ohne Schaden überstanden, Chuck Berry war wieder mal im Gefängnis wegen seiner Techtelmechtel mit Minderjährigen, und auch Jerry Lee Lewis musste sich unbedingt versündigen. Little Richard hatte sich gerade wieder vom Rock ’n’ Roll als Teufelszeug losgesagt und nahm mehrere Freisemester als Prediger. Oh, Lord! Die Musikindustrie litt nach wie vor unter dem Payola-Skandal. Diskjockeys in den einflussreichen Radiosendern hatten sich systematisch bestechen lassen und wie befohlen von der Industrie favorisierte Stücke gespielt. Der Rock ’n’ Roll war erst mal erledigt, die übrig gebliebene Popmusik war wieder schneeweiß, kommerziell natürlich und vor allem unterirdisch schlecht. Die weißen Jungs und Mädels beherrschten den Markt mit ihrem hundertprozentig kernseifigen Liedgut. Dem Gerechtdenkenden blieb da als einzige Zuflucht nur die Folkmusik, die sich, erstaunlich genug, in New York konzentrierte und von Greenwich Village aus das Schicksal der ausgebeuteten Landbevölkerung und der Minenarbeiter beklagte.
Bob Dylan kam wie gerufen: ein gutaussehender, vielleicht sogar engelhafter Knabe, der sich lang schon von seinem sanften Tenor verabschiedet hatte und dahinraspelte wie ein Alter. Ein Landei, das die abgebrühten New Yorker mit seinem komischen, silbenschluckenden Dialekt bluffen konnte, der bestimmt echt sein musste, denn so redete doch niemand in der ganzen Stadt. Der welterfahrene Landfahrer erzählte von staubigen Highways, von der Einsamkeit und von allem, was man sich in Greenwich Village notfalls selber zusammenreimen konnte, aber ihm wollte man die reine Unschuld abkaufen.
Sein Ehrgeiz, das wusste man in Hibbing, das wusste man in Minneapolis, nur nicht in New York, sein Ehrgeiz ging auf die Jukebox. Er wollte berühmt sein wie Elvis oder wie Buddy Holly. Der hatte es sogar trotz seiner komischen Brille geschafft, warum also sollte nicht Folk die richtige Methode sein? Für die New Yorker Boheme-Dörfler war Dylan ein Naturbursche, und sei es, weil sie nicht hören wollten, was er da für sie spielte. «Ich spielte die Folklieder wie Rock ’n’ Roll. Damit konnte ich auffallen in dem ganzen Gedrängel und wurde gehört.»
So konnte er den New Yorkern etwas zeigen, das sie längst kannten, aber fast ebenso lange schon wieder vergessen hatten: Woody Guthrie, sein Pate, seine einzige Respektsperson, sein Vorbild, lebte unerkannt in New Jersey (dass er bereits mit Huntington-Chorea im Endstadium im Krankenhaus lag, half Patient wie Besucher). James Dean war Schauspieler in New York gewesen und wurde ein Star in Kalifornien. Der war auch schon wieder fünf Jahre tot und lange genug entrückt, dass sich Dylan seiner bedienen konnte. Auf dem Cover von «The Freewheelin’ Bob Dylan» geht der Sänger gekrümmt und in etwas zu engen Hosen in James-Dean-Pose durch New York, zu seinem Glück drückt sich bereits ein Mädchen an ihn. Alles eine Frage des Stils.
Es ging dann, wie die Legende weiß, alles sehr schnell. Das spätere Image noch nicht, aber Bob Dylan wurde im September 1961 innerhalb weniger Tage gemacht. Vermutlich am 14.September probte man in einem Apartment in der West 10th Street für Carolyn Hesters Album «That’s My Song»; Dylan sollte die Folksängerin auf der Mundharmonika begleiten. Mit bei der Probe war der CBS-Produzent John Hammond, der Entdecker von Billie Holiday und Count Basie. Hammonds Sohn (ebenfalls ein John; er sollte später bei etlichen Dylan-Aufnahmen dabei sein) hatte ihm bereits von Dylan erzählt. Der Vater sah diesen Dylan, hörte ihn auch, war aber offensichtlich vor allem von der Präsenz des jungen Menschen so sehr beeindruckt, dass er ihm gleich einen Plattenvertrag gab. (Die Legende soll auch hier ihr Recht behaupten und vermelden dürfen, Hammond habe Dylan noch am selben Tag und ohne ihn überhaupt gehört zu haben verpflichtet.) Ähnlich wird die alle geschäftlichen Bedenken überwältigende Sympathie überliefert, die fast zur gleichen Zeit Brian Epstein ergriffen haben soll, kaum dass er die Beatles im Cavern Club sah. Am 26.September begann Dylan sein erstes richtiges Engagement in Gerde’s Folk City als Begleitung der Greenbriar Boys, und drei Tage später schon erscheint Robert Sheltons Hymne «Bob Dylan: A Distinctive Stylist» in der «New York Times». Am gleichen 29.September wird Carolyn Hesters Platte aufgenommen; Hammond produziert, Dylan begleitet sie bei drei Stücken.
«Mit seinem engelhaften Gesicht und dem dichten, widerborstigen Haarschopf, den er zum Teil mit einer schwarzen Huckleberry-Finn-Cordmütze bedeckt», schwärmt der einflussreiche Folkmusikkritiker der «Times», «sieht Mr.Dylan wie eine Kreuzung aus Chorknabe und Beatnik aus. An seiner Kleidung könnte er noch arbeiten, aber wenn er mit seiner Gitarre oder Mundharmonika oder am Klavier hantiert und neue Songs schneller komponiert, als er sie sich überhaupt merken kann, gibt es keinen Zweifel daran, dass er vor Talent aus allen Nähten platzt.» Nicht einmal der rückversichernde Hinweis auf seine erfundene Vergangenheit fehlt, hier selbstverständlich zum Besten gewendet: «Wenn es um seine Herkunft und seinen Geburtsort geht, ist Mr.Dylan nicht sehr gesprächig, doch zählt hier weniger, wo er herkommt, sondern viel mehr, wo er hingeht. Und sein Weg scheint direkt nach oben zu zeigen.» Der Mann, kann man gar nicht anders sagen, er sollte recht behalten.
Robert Shelton hat die Zukunft der Folkmusik gesehen und Bob Dylan entdeckt, aber es war natürlich nicht so einfach. Der Junge mit der Mundharmonika hatte den unbestechlichen Journalisten lange bearbeitet. Hatte ihn angerufen und zu seinen Auftritten eingeladen. Hatte sich bei Shelton zu Hause in dessen Folksammlung umgehört, bei ihm neue Stücke ausprobiert und schließlich, so eine nicht völlig unplausible Sage, seine Freunde den Artikel abnicken lassen, bevor er in der erst recht unbestechlichen «New York Times» erscheinen durfte. Und dann, als endlich in der Zeitung stand, dass er der kommende Star sei, begann er seinen Auftritt mit einer Verlesung der schönsten Stellen dieses Artikels. Das Wort, das Lied war Fleisch geworden.





























