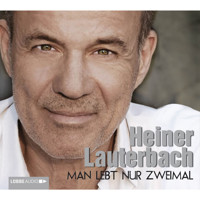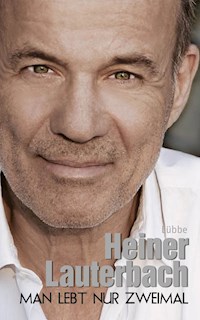
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Heiner Lauterbach zählt zu Deutschlands beliebtesten und meistbeschäftigten Film- und Fernsehstars. In den letzten Jahren hat sich der einstige Partylöwe im besten Sinne neu erfunden: Als Schauspieler, als Familienvater, als Mensch und Partner. Der Mann, der lange im Leben nichts ausgelassen und dafür manche Quittung verpasst bekommen hat, blickt gelassener und selbstkritischer auf die Dinge, die das Leben ausmachen: Liebe, Erfolg, Gesundheit, Freundschaft und Verantwortung. Persönlich, offen und selbstironisch schreibt Heiner Lauterbach die Autobiografie seines neuen Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
TitelImpressumWARUM DIESES BUCH?I. FAMILIEIch hatte einen TraumDie Wurzeln des GeschreisHysterische HygieneMeine drei AraberDer Entertainment-PAPIDie zeit VergehtDer alte VaterHelikopter-ElternErziehung – die schwierigste Sache der WeltDie Eislauf-MamiKinderstarsSchauspielkurs für alleBei MutternSchöne BescherungII. DAS LEBEN VERÄNDERNDer GesundheitsmannNie zu spätDer LifterMildernde UmständeTheoretischer VegetarierDie Alkohol-DiätRausch-GifteViel Rauch um NichtsDer innere SchweinehundAb in den JungbrunnenGolf mit SchnuffiGolf mit HeinerIII. DIE LIEBEDie glückliche Ehe – Das InterviewÜberzeugungenDie Vorteile der TreueTop Twenty der IdiotenUnterlassene RichtigstellungDie EheDie Gnade des BlindwerdensOffene BeziehungsformenKünstliche SchönheitEchte TraumfrauenMännerrollenSchöne MenschenDas KreischometerÄlter WerdenEin Mann ist so treu wie seine GelegenheitenWenn Frauen Männer managenIV. SCHAUSPIELEREIDer beste Beruf der WeltTourette-Syndrom-TheaterEs gibt keinen Kitsch, nur schlechte FilmeSchlechte SchauspielerAuf eine Rolle vorbereitenSchauspielmodenUnser eigener FilmIm AuthentizitätswahnWir sind alle SchauspielerFilm ist KriegFilme müssen frauenaffin seinWeitverbreitete RealitätsverzerrungDrehbücher und Besetzungen – Was ist ein guter Film?Selber ProduzierenStalingradVom HeldendurchschnittsalterIm JugendwahnUnterschätzte LangeweileBei SchneeflittchenMein Beitrag zur deutschen FernsehunterhaltungQuotendruck und SparzwangV. RUHMDie Last des ErfolgsProminenz als ReligionsersatzKlassenbewusstseinStars als VorbilderBegrenztes SendungsbewusstseinHilfe! Charity!Roter TeppichFilmbälleDer Ruf des GeldesWerbung und »die Kreativen«Erfolg – wer Glück hat im Spiel, hat auch Geld für die LiebeGlück kann man nicht erzwingenVI. FREUNDE UND FREIZEITGanoven-FreundeFreundschaftenEnde der RomantikNeid unter FreundenIn Gesellschaft Fussball guckenIhr seid alle IndividuenMagische KräfteVom Zauber der MusikDas Ende vom AnfangBILDTEILHeiner Lauterbach
MAN LEBT NUR ZWEIMAL
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2013 by Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln
Umschlaggestaltung: Manuela Städele
Umschlagmotiv: © Viktoria Lauterbach
Fotos im Innenteil: © Viktoria Lauterbach
E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-8387-2593-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
WARUM DIESES BUCH?
Stellen Sie sich einmal vor, Romeo Montague – Sie wissen schon, der junge Geliebte Julias, Verona, Balkon und so – wäre mein Jahrgang. Stellen Sie sich weiterhin vor, in letzter Minute wäre der Rettungswagen in der Familiengruft von Verona eingetroffen.
Die Notärzte entdecken Romeo und Julia, wie sie da vergiftet und erdolcht auf dem harten Marmorboden liegen. Stellen Sie sich des Weiteren vor, die Ärzte treffen früh genug ein, um die beiden jungen Italiener wieder ins Leben zurückzuholen. Romeo pumpen sie den Magen aus, stabilisieren seinen Kreislauf mit ein paar Infusionen. Julia bekommt Blutkonserven, noch auf dem Friedhof leiten die Ärzte die Not-OP ein, sie rettet der jungen Frau das Leben. Nach ein paar Wochen werden die beiden kerngesund aus dem Krankenhaus entlassen. Die verfeindeten Familien Montague und Capulet sind sehr gerührt von der Größe einer Liebe, für die ihre Kinder sogar bereit gewesen waren, sich selbst aufzugeben. Sie versöhnen sich nicht erst, wie von Shakespeare vorgesehen, über den Gräbern ihrer Kinder, sondern auf deren Hochzeit. Was gibt das für ein rauschendes Fest! Die Flitterwochen von Romeo und Julia sind fantastisch. Pures Glück: zwei wunderschöne, junge Menschen, das Leben, eben noch bereit, für den anderen geopfert zu werden, jetzt in seiner ganzen Wunderbarkeit noch vor sich.
Die Medien sind aus dem Häuschen. Die Boulevardpresse stürzt sich mit Anlauf auf die beiden, Brad Pit und Angelina Jolie erblassen vor Neid. Was für Bilder und Geschichten! Ich bin mir sicher, jeder Klatschreporter zieht Geschmacksfäden, wenn er nur darüber nachdenkt.
Ja, und dann? Wie wäre es weitergegangen mit den zwei glücklich Verliebten?
Die meisten Geschichten hören genau da auf, wo es eigentlich spannend wird. Nach dem Happy End oder, wie in diesem Fall, nach dem tragischen Unglück. Die meisten Filme handeln von einem Glücksversprechen oder einer Hoffnung, die aber dann, wenn die Drachen getötet und die Verbrecher gefangen sind, im wahren, eigentlichen Leben, nicht mehr eingelöst werden. Eine große Liebe wie die von Romeo und Julia muss nicht den Beweis antreten, dass sie auch den Alltag übersteht. Was meiner Meinung nach die viel größere Herausforderung ist.
Womit hätten die beiden ihre Zeit verbracht – mit Bällen, pardon: Events, wie man heute sagt, Theaterbesuchen? Julia ist zu Beginn der Tragödie nicht einmal fünfzehn Jahre alt. Was, wenn sie sich mit Anfang zwanzig in ihren spanischen Reitlehrer verliebt? Wie gehen die beiden damit um? Wie schaffen sie es dennoch, glücklich miteinander alt zu werden?
Wir werden Romeo nie sehen, wie er gemütlich zu Hause abhängt, Chips futtert und die Sportschau guckt.
Es gibt auch keinen Film darüber, womit sich Pretty Woman und Richard Gere im Jahr fünf ihrer Ehe die Zeit vertrieben hätten. Dabei wäre es durchaus interessant zu erfahren, ob der schnöselige Richard sich weigert, den Müll runterzubringen. Und ob Julia wohl jemals die Angewohnheit ablegt, sich auf die Couch zu legen, ohne diese hohen Stiefel auszuziehen, die ihr bis über die Knie reichen. Vielleicht entdecken die beiden eine gemeinsame Leidenschaft für Kreuzworträtsel oder freuen sich, weil sie eine günstige Rentenversicherung abgeschlossen haben.
Der russische Schriftsteller Leo Tolstoi behauptet am Anfang seines Romans Anna Karenina: »Alle glücklichen Familien ähneln einander; jede unglückliche aber ist auf ihre eigene Art unglücklich.« Ich frage mich, ob die Sozialwissenschaft das schon mal überprüft hat. Selbst wenn es so wäre – warum kenne ich nicht wenigstens einen Roman, der davon handelt, wie es ist, ein zufriedenes Leben zu führen? Während es umgekehrt Millionen Bücher über Familien gibt, deren Leid so groß scheint, dass es kaum zwischen zwei Buchdeckel passt? Wäre es nicht viel nützlicher, einmal zu beobachten, wie man es erreicht, zufrieden zu sein und vor allem: es auch zu bleiben?
Vielleicht sind wir Menschen ein wenig süchtig nach Unglück. Vielleicht messen wir den Extremsituationen manchmal mehr Bedeutung zu als ihrer Bewältigung. Vielleicht sind uns unsere schwierigsten Söhne und Töchter insgeheim die Liebsten.
Keine Frage: Es ist aufregend, Bären zu töten, mit dem Schiff um die Welt zu segeln, um eine Liebe zu kämpfen, sich gegen den Feind zur Wehr zu setzen, Aliens zu jagen, einen Auftragsmörder zu schnappen oder die Schranken zwischen den sozialen Schichten einzureißen. Die Film- und Literaturgeschichte ist voll von diesen Geschichten. Die Menschen mögen das.
Auch mein Leben zwischen Exzessen, Affären und nächtelangen Partys möchte ich um keinen Preis der Welt aus meiner Biografie verbannen. Das war eine wilde Zeit, ich bereue sie nicht. Doch genauso froh bin ich heute, dass ich es geschafft habe, meinem Leben noch einmal eine Wende zu geben. Ich habe mich gefragt: Wäre das nicht eine Erzählung wert? Eine Geschichte über das Glück, das ich heute empfinde. Über die Freude an meiner Gesundheit und der meiner lebenslustigen kleinen Familie? Haben nicht alle gesagt, als ich meine erste Biografie geschrieben habe: »Ja, der spuckt jetzt große Töne. Lasst uns einmal abwarten, wie er in zehn Jahren darüber reden wird.« Viele dachten, ich würde es nicht lange aushalten ohne Wein, Weib und Gesang. Das traute Familienleben, das wäre nichts für mich.
Es gibt da etwas, dass vielleicht noch viel schwieriger zu beschreiben ist als die Wandlung von Mr. Hyde zu Dr. Jekyll: das dauerhafte Glück. Die Fähigkeit, die kleinen Mäkeleien des Alltags zu überstehen, und ein Leben in Gleichmut und Frieden zu führen, ohne große Ausschläge nach oben, aber daher auch nicht mehr nach unten. Die Fähigkeit, seine eigenen kleinen Probleme zu relativeren und sich für das Glück im Alltag zu entscheiden.
Es ist ja eigentlich absurd: Wenn im Kino überhaupt einmal ganz normale Szenen mit ganz normalen, glücklichen Menschen gezeigt werden, dann handelt es sich meist um den Anfang eines Psychothrillers. Das Glück dient in diesem Fall lediglich dazu, das darauf folgende Grauen nur noch schrecklicher über die heile Welt hereinbrechen zu lassen. Fast schon instinktiv ist man als Zuschauer darauf geeicht, mit dem Schlimmsten zu rechnen, sobald nur ein wenig Idyll oder harmonisches Familienleben gezeigt wird. Eine junge Frau, die fröhlich lachend in einen Wald hineingeht? Der Zuschauer ahnt bereits, worauf das hinausläuft. Sie kann eigentlich nur zerhackt und in blauen Müllbeuteln verpackt wieder herauskommen.
Filme, die sich mit der wirklich schwierigen Frage beschäftigen, wie man glücklich wird und wie es nach dem Happy End weitergeht, sie werden so gut wie nie gedreht. Und wenn ich mich in der Welt der Literatur so umschaue, komme ich zu dem Schluss, dass Bücher auch nicht von wirklich glücklichen Menschen geschrieben werden. Zumindest schreiben sie selten über ihr Glück.
Die zehn Jahre nach meinem Bruch mit dem alten Leben sind längst vergangen. Ich bin heute zufriedener, als ich es je war. Es war gar nicht einmal so schwer, das Leben zu ändern. Ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt nicht mehr ich selbst bin, dass der Heiner von früher der echte gewesen ist. Wie auch immer: Es hat sich gelohnt, das Ruder noch einmal herumzureißen. Auch wenn man es sich in besonders schlechten Momenten nicht vorstellen kann – es ist wirklich nie zu spät dafür. Und genau davon möchte ich hier erzählen. Und wenn es nur einen einzigen Menschen gibt, der dieses Buch liest und daraufhin beschließt, es mir gleichzutun, dann lohnt sich das für mich bereits. Denn ganz ehrlich: Alle Partys und Räusche der Welt sind es einfach nicht wert, auf das zu verzichten, was ich heute habe.
Der amerikanische Schriftsteller William Faulkner ist offensichtlich ein direkter Nachfahre Leo Tolstois. Er hat einmal gesagt, dass er nur über unglückliche Menschen schreibt, weil glückliche Menschen langweilig seien: »Nur Gemüse ist glücklich.« Ich will hier nicht über Gemüse schreiben. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass die Kollegen Tolstoi und Faulkner ein wenig übertreiben. Denn die Frage, wie man es schafft, ein zufriedenes Leben zu führen und ob es überhaupt möglich ist, etwas zu ändern, wenn das eigene Leben wie festgefahren scheint, sie wird wohl jeden von uns beschäftigen. Viele wollen vielleicht nicht drüber schreiben, weil sie Angst haben, dass es keiner lesen mag. Ich wage den Versuch.
Ich will aber auch gleich eines sagen: Ich bin natürlich kein Wissenschaftler und ich habe auch keine speziellen Techniken entwickelt oder Mittelchen entdeckt, von denen ich hier berichten könnte. Ich habe auch keine Internetadresse, auf der man dann die Pillen oder Tinkturen dazu bestellen könnte. Ich will auch kein Missionar sein. Meine bescheidene Botschaft ist vielmehr, dass jeder sein Leben ändern kann, so wie ich das gemacht habe – gerade weil ich ein ganz normaler Mensch bin. Davon abgesehen, dass ich Schauspieler bin und mir im Leben vielleicht ein paar krasse Dinge mehr passiert sind als dem Durchschnittsbürger, halte ich mich nicht für anders. Ich bin auch gewiss kein Philosoph oder Theologe, ich habe mir einfach im Laufe der Zeit nur so meine Gedanken über das Leben gemacht.
Woher kommen wir, wohin gehen wir, und was kann man überhaupt wissen über uns und den Stoff, aus dem das alles gemacht ist? Die Wissenschaftler suchen unter Hochdruck nach Antworten, und ich verfolge diese Suche schon seit Jahren sehr gebannt; sei es nun die Suche im Großen, im Weltall, mit seinen schwarzen Löchern, den roten Riesen, Supernovas, der Urknall-Theorie und der Quantenmechanik. Oder, für viele Physiker noch spannender, die Suche im Kleinen, die Welt der Quarks und des nun am CERN entdeckten Higgs-Teilchens. Am Ende gelangt man immer an die gleiche Frage: ob man überhaupt etwas wissen kann, ob so etwas wie Erkenntnis grundsätzlich möglich wäre.
Die kleinen Probleme, die mich im Alltag heute natürlich noch genauso nerven wie früher, relativieren sich aber, wenn man einmal einen Schritt zurücktritt und versucht, eine andere Perspektive auf das Leben einzunehmen.
Wenn ich morgen in einen Wald gehe und im Vorbeigehen auf einen Ameisenhaufen spucke, dann wird die von meiner Spucke getroffene Ameise einen Mordsschrecken kriegen. Sie wird denken, ein Ameisen-Tsunami habe sie erwischt. Kein Gehirnforscher dieser Welt wird ihr nur im Entferntesten vermitteln können, was gerade passiert ist. Dass es andere Lebewesen außer ihr und ihren Brüdern und Schwestern gibt, wird sie sich nicht vorstellen können. Dass dieser enorme Schatten da über ihr ein Mensch ist, der denken und bewusst handeln kann. Dass dieser Mensch gleich in sein Auto steigt und mit 200 Sachen über eine Autobahn in eine Großstadt rast, am nächsten Tag in ein Flugzeug steigt oder sich die Mondlandung auf YouTube ansieht. Es wird ihr auch mit noch so viel Geduld nicht in ihren kleinen Ameisenkopf hineinzubringen sein, dass es den Mond gibt oder Teilchenbeschleuniger oder Alkoholprobleme. Aber letztlich: Wer sagt mir eigentlich, dass ich in einer grundsätzlich anderen Situation lebe als diese Ameise, die nur ihren Waldboden kennt und ihren Ameisenbau und den Weg zur nächsten Eiche. Wer sagt überhaupt, dass ich mir einbilden darf, mehr zu verstehen von dem, was um mich herum so alles vor sich geht? Vermutlich gucken wir Menschen einfach nur in einem etwas vergrößerten Maßstab auf das Ganze. Obwohl wir letztlich genauso wenig vom Universum wissen wie die Ameise vom Mond. Aber ich fürchte, das, was für uns die Unendlichkeit ist, ist der Mond für die Ameise.
Auf diesem Glauben beruht meine heutige Lebensphilosophie. Wir wissen nichts und sind von keiner großen Bedeutung in der galaktischen Unendlichkeit. Dass ich erkannt habe, wie belanglos meine Existenz letztlich ist, könnte mich geradewegs in die Resignation führen. Stattdessen versuche ich lieber, die Dinge gelassener zu nehmen. Was mir übrigens nicht immer gelingt. Die Dinge gelassener zu nehmen würde ich auch vielen meiner Mitmenschen empfehlen. Wie zum Beispiel Kritikern und Nörglern, Society-Experten, den vielen selbsternannten Wächtern des guten Geschmacks, die sich garantiert melden werden, wenn dieses Buch erschienen ist. Nach dem Motto: Muss denn schon wieder ein Promi ein Buch schreiben? Was glaubt denn der Lauterbach uns noch unbedingt mitteilen zu müssen? Diesen Leuten kann ich nur sagen: Der Rücken meines Buches wird maximal 5 Zentimeter breit. Das heißt, wenn’s im Regal steht, ist man in 0, 2 Sekunden dran vorbeigelaufen. Tun Sie’s einfach. Und regen Sie sich nicht auf.
Aber denen, die nicht so denken, die bereit und interessiert sind, sich ohne Häme oder Sarkasmus auf eine kleine Reise zu begeben, durch die Welt meiner Phantasie, denen wünsche ich nun viel Spaß.
I. FAMILIE
ICH HATTE EINEN TRAUM
An normalen Sonntagen bin ich der Erste in unserer Familie, der wach wird. Ich öffne die Augen und höre nichts. Im Sommer vielleicht ein paar Vöglein zwitschern, im Winter nur noch das Blut in meinen Ohren rauschen. Ich genieße diese Stille sehr. Ich atme tief durch und denke – der Tag kann kommen. An normalen Sonntagen.
Vorsichtig schäle ich mich aus der Decke. Meine Frau Viktoria, die neben mir liegt, seufzt nur kurz zufrieden (zumindest interpretiere ich das so) und dreht sich dann auf die andere Seite. Ich schaue sie mir genau an. Ich mache das gerne: Menschen, die mir vertraut sind, die ich sehr mag, im Schlaf beobachten. An unseren Kindern kann ich mich gar nicht sattsehen, wenn sie schlafen. Im Wachzustand ginge das gar nicht. »Was guckst’n so blöd Papa?« oder ähnliche Fragen würden das schöne Bild, das ich gerade noch vor Augen hatte, ziemlich martialisch zerstören. Also hebe ich mir meine Beobachtungsphasen für die Zeiten auf, in denen die Objekte meiner Begierde pennen. Wie zum Beispiel an einem normalen Sonntagmorgen.
Ich schleiche mich dann ins Kinderzimmer und beobachte unsere schlafenden Kinder. Ich liebe unsere Kinder. Und zwar so sehr, dass eigentlich keine Steigerung mehr möglich wäre. Und dennoch – wenn sie schlafen und so friedlich aussehen, wenn sie sich so ungestört und hemmungslos beobachten lassen, wenn man nichts von ihnen hört, außer den gleichmäßigen, ruhigen Atem und, wenn’s hoch kommt, vielleicht einmal ein wohliges Grunzen – dann, Gott möge mir verzeihen, dann lieb ich sie noch ein klitzekleines bisschen mehr als sonst.
Ich schleiche mich die knarzige Treppe zur Küche hinunter und bleibe vor der Fensterfront stehen. Ich schaue auf den Starnberger See. Auch nach 14 Jahren noch kann ich mich an diesem Blick erfreuen. Tau steht auf der Wiese im Garten und durch den zarten Nebel bricht die morgendliche Sonne, um sich glitzernd im See zu spiegeln. Es kommt mir vor, als sei der Tag in eine Frischhaltefolie verpackt und ich darf ihn als Erster auswickeln.
Nun bereite ich für meine Lieben ein Frühstück vor, das sich gewaschen hat und seinesgleichen suchen dürfte. Meine Rühreier à la Papa sind bekannt bis ins Nachbardorf, in dem einige Freunde meiner Kinder wohnen, die ab und an bei uns übernachten. Mein Obstsalat ist ein sonntägliches Muss. Die Croissants sind frisch aufgebacken und das Knusprigste, das man je erlebt hat, der Tee …
Wenn alles fertig ist, hab ich in der Regel in den oberen Regionen schon erste Lebenszeichen vernommen. Der Duft von gerösteten Zwiebeln, Knoblauch und frischen Croissants ist in dieser Kombination vielleicht nicht jedermanns Sache, aber meine Lieben hat er längst aus ihren Betten springen lassen und für erste Betriebsamkeit gesorgt. Beziehungsweise für den ersten Streit unter den Kindern. Das ist ganz normal bei Maya und Vito. Bis zum Frühstück haben die locker drei Zankereien und eine größere Handgreiflichkeit hinter sich, die in einem Weinkrampf des Unterlegenen endet. Noch schneller als sie sich streiten, versöhnen sie sich wieder. Es ist wirklich unglaublich. Man will gerade Luft holen, um sie zu zwingen, den Streit zu beenden, da liegen sie sich zärtlich in den Armen und busseln sich ab.
Ich rufe dann: »Schnuffi, Schnecke, Tiger, das Frühstück ist fertig!« Es poltert kräftig auf der Treppe, die Kinder kommen in die Küche gerannt und wuseln um mich rum. Wenn sie gut drauf sind, kommen dann Kommentare wie: »Mmh, das riecht aber lecker« oder »Mann, hab ich’n Hunger.« Bei normaler Stimmung eher: »Was gibt’s denn heute?« Bei schlechter Laune: »Schon wieder Rührei« oder »Ich will aber keinen Obstsalat.« Bei Obstsalat gibt es dann allerdings meinen obligatorischen Vortrag: Wie viele Kinder auf der Welt sich die Finger lecken würden nach frischem Obst, geschweige denn einem vom liebsten Pappili der Welt persönlich angefertigten Salat.
Während ich dann die restlichen Köstlichkeiten auf dem Tisch verteile, starten unsere unzähligen Rituale. So habe ich mir zum Beispiel angewöhnt zu fragen: »Wer ist Eurer Meinung nach eigentlich der liebste Pappili auf der ganzen Welt?« Ich finde nämlich, dass mir die Kinder nicht immer die Aufmerksamkeit schenken, die mir gebührt. Sie brauchten natürlich nicht lange, um rauszukriegen, was meine ersehnte Antwort war, und hatten genauso schnell raus, dass ich denjenigen, der als Erster antwortete, für den Rest des Tages ein ganz klein wenig bevorzugte. Oder sagen wir, für die nächsten zehn Minuten. Mit der Zeit wurden sie immer routinierter und schneller. Wenn ich heute, wo auch immer, sage: »Kinder, ich hab da mal ’ne Frage. Wer …«, schnellen ihre Arme hoch und sie zeigen in meine Richtung. Sie schaffen das inzwischen, ohne mich dabei anzusehen und ohne ihre eigentliche Tätigkeit zu unterbrechen. Obwohl das für Außenstehende sehr mechanisch wirken mag und es zum Beispiel bei Viktoria meist nur noch ein augenrollendes Kopfschütteln hervorruft, habe ich persönlich sehr viel Spaß an unserem kleinen Ritual.
So läuft das also an den normalen Sonntagmorgen. Das heißt, das ist so nicht ganz richtig. Mit normal meinte ich vielleicht ersehnt, erhofft, gewünscht. An den ersehnten – also ehrlich gesagt den unnormalen Sonntagmorgen – läuft es so wie gerade beschrieben ab.
An den normalen hingegen so.
Ich liege im Bett. Bis hierhin stimmt noch alles. Mein eben noch schöner Traum verwandelt sich in einen Albtraum. Ich höre kreischende Hyänen, während mir ein gefährlicher Drache heiße Luft entgegenspeit. Bevor ich vollends verglühe, wache ich auf. Und erschrecke zusätzlich. Millimeter über meinem Gesicht erkenne ich meinen Sohn Vito, der mich anpustet.
»Was machst du da?«, will ich schlaftrunken wissen.
»Ich puste.«
»Wieso?«
»Nur so.«
Aus Angst, das Niveau dieser Konversation an einem so frühen Sonntagmorgen nicht halten zu können, drehe ich mich aus seiner Pustrichtung auf die andere Seite. Das interpretiert mein fünfjähriger Sohn sofort als Schwäche und stürzt sich, einem jungen Rüden gleich, mit Geheul auf die wehrlose Beute. »Es ist dein Sohn und du liebst ihn«, meditiere ich, der mit Yoga eigentlich nichts am Hut hat, vor mich hin.
Das Hyänengeschrei habe ich mittlerweile als meine Frau und Tochter ausgemacht, die im Kinderzimmer ohrenscheinlich ihre morgendliche Debatte führen. Es dürfte mal wieder um die Garderobe meiner Tochter gehen. Ich habe mich oft gefragt, wie es kommt, dass sie sich in dieser Frage bis heute nicht ein einziges Mal einig waren. Ich meine, schon rein mathematisch gesehen, müsste der Zufallsfaktor doch eigentlich dafür sorgen, dass sie, sagen wir, jedes 20ste mal identische Kombinationen auswählen, sich also beide für dieselben Sachen entscheiden, die meine Tochter dann am jeweiligen Tag anzuziehen hätte.
Wobei die Lautstärke meiner Liebsten nichts mit der Heftigkeit der Auseinandersetzung zu tun haben muss. Ich habe manchmal im zweiten Stock unseres Hauses im Büro gesessen und aus der Küche, die im Parterre liegt, ein mordsmäßiges Geschrei gehört. Nicht selten bin ich dann runtergelaufen, um das Schlimmste zu verhindern. Unten angekommen musste ich feststellen, dass sie ein ganz normales Gespräch führten. Oft lagen sie sich sogar liebevoll in den Armen und schäkerten, während ich angenommen hatte, dass sie sich gleich an die Gurgel gehen.
Meine Frau ist Libanesin. Also habe ich drei Araber im Haus, und die sind nun mal so laut. Die stehen zehn Zentimeter vor mir und brüllen mir ins Gesicht, wenn sie wissen wollen, wie spät es ist. So verwandeln meine drei Araber unser Bauernhaus am Starnberger See ab und an in einen orientalischen Bazar und machen aus St. Heinrich Bagdad.
Doch zurück zu meinem Sohn Vito, den ich inzwischen am Rumpf mit ausgestreckten Armen von mir halte, sodass mich seine wild zappelnden Arme und Beine nicht treffen können.
»Komm, wir schmusen noch’n bisschen, Tiger«, sag ich und weiß gleichzeitig, dass ich Blech rede. Mein Sohn kann nicht schmusen. Oder sagen wir so – er schmust anders. Ich bezeichne das gerne als Kampfschmusen oder Vollkontaktschmusen. Wenn man ihn denn überhaupt mal zum Schmusen überreden kann, brüllt er einem ins Ohr: »O.k., schmusen wir« und drückt sich so fest an einen, dass jeder Nanometer Haut in Kontakt steht. Das Ganze dauert dann 2,8 Sekunden und es hat sich ausgeschmust.
Also – an einem nicht, aber eigentlich doch normalen Sonntag stehe ich dann auf, wir machen alle zusammen Frühstück und lassen es uns schmecken. Die Kinder schreien und toben. Streiten sich im Zwei-Minuten-Takt. Dann fängt Viktoria auch an zu schreien, weil ich sie sonst nicht verstehe. Und weil es bei uns zu Hause nach einer einfachen Regel geht. Wer am lautesten schreit hat recht. Vito klettert mir mittlerweile auf der Schulter rum und stößt mir seine Knie ins Kreuz. Maya benutzt mein Bein, das ich vor Erschöpfung hoch auf den Nachbarstuhl gelegt habe, als Reckstange. Die Eier sind ein bisschen zu weich, der Tee ein bisschen zu kalt. Irgendwie ist es schön. Ich fühl mich wohl. Trotzdem bin ich nach einer Stunde so gerädert, als hätte ich gerade einen Marathonlauf hinter mir. Ich befreie mich von den Kindern. Viktoria kennt das schon: »Ich bin fix und fertig, Schnuffi«, sage ich noch und bin im Schlafzimmer verschwunden. Die Atmung wird langsamer, der Puls beruhigt sich. Den Leuten dankend, die Türen und Mauern erfunden haben, schließe ich mich ein und lege mich in mein Bett. Ich werde noch ein Stündchen schlafen. Ich mach das sonntags immer so. Ich bin nach dem gemeinsamen Frühstück einfach zu kaputt, um mich dem Tag zu stellen. Ich werde schlafen. Und träumen. Ich werde träumen, es ist Sonntag. Ich wache auf und höre nichts. Es ist still. Ein paar Vöglein zwitschern vielleicht. Im Sommer. Im Winter höre ich nur das Blut in meinen Ohren rauschen …
DIE WURZELN DES GESCHREIS
Ich habe ja schon in vielen Ländern gedreht, und daher ganz gute Vergleichsmöglichkeiten, was die landestypischen Distanz- und Lautstärkegewohnheiten betrifft. Generell lässt sich sagen: Je weiter man von München aus Richtung Mittleren Osten kommt, desto lauter wird es. Italien hat schon einen erheblich höheren Grundton als Deutschland.
Als ich 2008 und 2009 in Israel die Kommissar Ochajon-Reihe für das ZDF drehte – der Jerusalemer Hauptkommissar entstammt den Romanen der 2005 verstorbenen israelischen Autorin Batya Gur –, hatte ich schon Probleme, mich an die vorherrschende Grundlautstärke zu gewöhnen.
Ich besuchte dort regelmäßig das Fitnessstudio unseres Hotels. Als ich dort zum ersten Mal erschien, um meinen Körper zu ertüchtigen, wunderte ich mich nicht schlecht, dass da jeder der zehn Fernseher eingeschaltet war und auf voller Lautstärke lief. Alle auf unterschiedlichen Sendern, versteht sich. Der Laden war ungefähr zur Hälfte gefüllt, sodass fünf Fernseher völlig nutzlos vor sich her flimmerten. Das schien die dort versammelten Israelis aber nicht zu stören. Einige hatten sogar noch die Muße, nebenher auf ihrem Handy zu telefonieren. Natürlich mussten sie dafür ziemlich brüllen, um das Spektakel zu übertönen. Andere, denen die Entertainmentauswahl offensichtlich nicht groß genug war, hatten noch Ohrstöpsel drin, aus denen vermutlich Geräusche kamen, die ich gar nicht kennen will. Ich begab mich auf den letzten freien Crosstrainer und fing mit meinem Workout an. Zu meinem Bedauern musste ich feststellen, dass die Herrschaften auch noch untereinander kommunizierten. Da flog schon mal ein Handtuch über mich hinweg, dass sich mein rechter Nachbar vom Linken auslieh, oder jemand übergab das Handy seinem Kumpel, der dem Zuhörer am anderen Ende nochmals die ganze Geschichte auf hebräisch in die Muschel brüllte. Meine »Friede sei mit dir«-Gebete murmelnd, schwitzte ich vor mich hin. (Meine Frau hat mir beigebracht, in Momenten, in denen ich die Geduld zu verlieren drohe, »Friede sei mit dir« vor mich her zu sagen. Das hilft wirklich.) Ich hatte das Gefühl, viel früher zu schwitzen als sonst. Vermutlich lag es am Krach.
Ein stattlicher Israeli betrat den Raum. Ein Baum von einem Kerl. Wüste Tätowierungen bedeckten seine Oberarme, die den Umfang meiner Oberschenkel hatten. Eine toilettendeckelgroße Hand hielt sein Handy schon am Ohr. Offensichtlich hatte er jemand in der Leitung, den er nicht mochte. Während ich dankbar darüber war, nicht der Mann zu sein, mit dem er sich gerade unterhielt, baute sich dieses Tier genau vor meinem Crosstrainer auf. Gerade so weit entfernt, dass ich ihm mit den ausladenden und hin und her schwingenden Teilen meines Gerätes nicht die Schienbeine zertrümmern konnte. Ich wollte es nicht glauben. Er machte einfach keine Anstalten weiterzugehen. Der Raum war ungefähr 200 Quadratmeter groß und ziemlich leer. Aber er hatte sich genau den einen Quadratmeter vor meinen Augen ausgesucht, der mich seinen heißen Atem spüren ließ. Hin und wieder trafen sich unsere Blicke und ich muss zugeben, dass mich seine gefährlich blitzenden Augen erheblich einschüchterten. Mit einem letzten Fluch beendete er sein Gespräch. Nun wandte er sich mir zu. Ich hatte das Gefühl, es wäre besser, ihn nicht zu provozieren. Ich grinste ihn an. Freundlich, aber unaufdringlich. Darauf brüllte er mich an.
Ich war mir keiner Schuld bewusst. Trainierte ich an seinem Gerät, hatte ich eine Reservierungstafel übersehen oder sonst irgendeine unsichtbare Regel verletzt? Ich verstand seine Sprache nicht, aber beim Reden traten seine Adern am Hals hervor, und was er da ausstieß, verhieß nichts Gutes.
Ich schaute mich im Studio um. Niemand schien unseren Disput zu bemerken. Mir wurde es ein wenig mulmig. Würde es zu einer Prügelei kommen, ich müsste schon zu extremer Heimtücke greifen, um da heil wieder herauszukommen. Leider war ich auch völlig unbewaffnet zum Sport gegangen.
Da sah ich seine Schneidezähne blitzen, seine Mundwinkel Richtung Ohrläppchen wandern. Konnte das sein? Er lächelte. Der wollte gar keinen Streit. Er musste etwas völlig Harmloses gesagt haben. Ich hatte mir nur seine Lautstärke nicht anders als mit einer handfesten Verärgerung erklären können.
Ich lächelte zurück, zuckte mit den Schultern: »I do not understand you«, entschuldigte ich mich und trainierte weiter. Nette Leute, diese Israelis, dachte ich. Sehr kontaktfreudig.
Von da an grüßten wir uns immer. Das Tier und ich. Irgendwie war er mir ja gleich sympathisch gewesen.
HYSTERISCHE HYGIENE
Spätestens nach meinem Israelaufenthalt wusste ich also, woher die Vorliebe meiner Familie für Unterhaltungen im angehobenen Dezibel-Bereich stammt. In Deutschland hat man ein viel größeres Ruhebedürfnis und hält auch einen gewissen Sicherheitsabstand zu seinen Mitmenschen. Ich spreche da gerne von der Spuckzone. Ich mag es gar nicht, wenn Gesprächspartner den Spuckabstand überwinden und die Spuckzone betreten. Journalisten machen das ganz gerne. Allerdings liegt das oft am Lärm der Umgebung. Wenn man beispielsweise auf dem Münchner Filmball interviewt wird, rücken sie einem immer mehr auf die Pelle und halten einem das Mikrofon unmittelbar unter die Nase, weil einfach so ein affenartiger Krach herrscht. Das ist dann stets das gleiche Spiel. Der Journalist kommt näher, ich weiche zurück. Er kommt wieder näher, ich weiche wieder zurück. So habe ich schon Interviews geführt, die am Haupteingang angefangen haben und vor der Damentoilette endeten, welche auf der diagonal gegenüberliegenden Ecke des Saals lag.
Ich muss gestehen, ich bin in solchen Dingen sowieso sehr empfindlich. Böse Zungen würden behaupten: hysterisch. Auf einer Theatertournee saß ich mal mit meinen Kollegen in einem Autobahnrestaurant im hessischen Raum. Der Kellner kam mit meinem Essen an den Tisch. Er stand genau vor einem Fenster, durch welches die Sonne schien:
»Sachese ma’ Herr Laudebach, häddese was dagesche, sisch gleisch in unse’m Gästebuch einzutrare?«
Ich sah ihn im grellen Gegenlicht und musste beobachten, wie sich beim Sprechen der Hauch seines Atems in Form von einer Art Wasserdampf vor seinem Mund bildete und sich langsam auf meinem Essen niederließ. Gepaart mit größeren Stücken von Spucke und was er sonst noch so im Mund hatte. Ich musste an die unzähligen Male denken, bei denen man mir in ähnlicher Weise das Essen serviert hatte und mir wurde ein wenig schlecht. Vermutlich deswegen brachte ich nur ein einsilbiges »klar« heraus und streckte meine Hand aus, um mein kontaminiertes Mahl entgegenzunehmen, bevor er nochmals den Mund öffnen konnte und sich ein erneuter Sprühregen auf meinem Essen niederlassen würde.
»Wie jetz’? Da hamse also was dagesche?«
Ein neuerlicher Schwall senkte sich auf meinen Hackbraten. Während ich mein Essen nicht aus den Augen ließ, stammelte ich:
»Wie?«
»Dann wollese also net?«
Mein Arm wurde immer länger und ich versuchte etwas flehendes in meinen Blick zu legen, aber der gute Mann schien mir den Teller nicht geben zu wollen, bevor diese Frage geklärt war. Ich musste mich jetzt auf das Gespräch konzentrieren, um Schlimmeres zu verhindern.
»Ich gebe Ihnen gleich gerne ein Autogramm in Ihr Gästebuch«, fasste ich seine Bitte nun, den Blick immer noch nicht vom Essen nehmend, unmissverständlich zusammen.
»Das is abä nett, Herr Laudebach. Wissen Se, vore ba Dach, da wa dä, na wie hiess e widdä, dä …«
Ich hielt es nicht mehr aus. Ich stand auf und riss ihm meinen Hackbraten aus der Hand.
»Bringen sie mir gleich einfach das Buch«, sagte ich und lächelte, so gut es die Situation zuließ.
»Klar doch, das mache mä.« Der Vesuv auf zwei Beinen verzog sich. Ich setzte mich an den Tisch und starrte auf meinen Teller.
»Mmh, das sieht aber lecker aus. Ich hätte mir vielleicht doch was bestellen sollen«, hörte ich meinen Kollegen neben mir sagen. Ich sah ihn an. Er glotzte gierig auf mein Essen. Ich sah zu meinem Essen. Dann wieder zu ihm. Er hatte noch nie zu meinen absoluten Lieblingskollegen gehört. Klar, er war nett. Er war ein guter Schauspieler. Aber darum ging es hier nicht. Ich fragte mich: Was meinst du, Heiner, gehört er zu den zehn nettesten Kollegen, die du kennst? Nein, beschloss ich und schob ihm den Hackbraten hin:
»Hier, kannste haben.«
»Quatsch, hab ich doch nur so gesagt.«
»Ne ehrlich, kannste haben. Ich hab nich gewusst, dass da Kartoffelbrei dabei is.«
»Aber du stehst doch so auf Kartoffelbrei«, sagte jetzt ein anderer Kollege, der, wie ich gerade bestimmte, auch nicht zu meinen zehn Lieblingskollegen gehörte.
»Aber nich zum Hackbraten« beendete ich die Diskussion und beobachtete Kollege eins beim Verzehr meiner Speise. Ich war nicht gerade stolz auf mich. Aber andererseits – was hatte ich schon Großartiges gemacht? Ich hatte meinem Kollegen meinen Hackbraten überlassen. Ich sah, wie er sich genüsslich einen Bissen in den Mund schob und guckte weg. Ich werde ihn zu diesem Hackbraten einladen, beschloss ich. Ich sah in die Runde. Ach was, ich werde sie alle einladen.
Meine Frau nennt mich ja oft Monk. Nach dem amerikanischen Detektiv der gleichnamigen Serie. Der mit den vielen Spleens. Und ich muss gestehen – ganz unrecht hat sie nicht.
Monk hat eine Assistentin. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Sie kennt seine Macken und hilft ihm, diese Eigenarten möglichst unauffällig auszuleben.
Ich habe eine Frau. Wir beide sind ein eingespieltes Team. Monks Assistentin hat zum Beispiel immer Hygienetücher dabei, die sie automatisch rausholt, nachdem Monk jemandem die Hände schütteln musste.
Das machen wir normalerweise nicht. Aber – um auf den Münchner Filmball zurückzukommen – da hat meine Assistentin, pardon, meine Frau schon mal das eine oder andere Tuch dabei. Nur so. Für alle Fälle.
Ich bin sowieso kein Freund vom Händeschütteln. War ich noch nie. Entweder Kuss mit Zunge oder gar nix. Wenn’s nach mir ginge, würden wir das wie die Japaner halten. Die Hände falten und in gebührendem Abstand (Spuckzone) leicht verneigen. Ende.
Man glaubt ja gar nicht, wie viel Milliarden Bakterien und Keime bei einmal Händeschütteln den Wirt wechseln. (Für die im Medizinischen nicht ganz so fitten: Das heißt wirklich Wirt und ist nicht etwa eine von mir, in Bezug auf mein altes Leben, erfundene Wortkreation.) Die Menschen waschen sich überhaupt viel zu wenig die Hände. Ich muss zugeben, dass ich aber auch erst mit zunehmendem Alter einen Hang zur Handhygiene entwickelt habe.
Als Kind habe ich mir nur die Hände gewaschen, bevor ich mein neues Fahrrad angefasst habe. Später dann hin und wieder mal vor dem Essen, wenn wir irgendwo fein eingeladen waren. Als junger Mann dann nach dem Klo und vor der Liebe. Eigentlich sage ich immer Toilette, aber das hätte hier irgendwie nicht gepasst. Heute wasche ich mir tausend Mal am Tag die Hände. (Aus Angst vor Ansteckung.) Das hat Viktoria letztlich auch dazu bewogen, sich auf dem Filmball in die Rolle meiner Assistentin drängen zu lassen. Sie hat sich gesagt, bevor sie den Abend ohne mich verbringt (weil ich nur unten auf der Toilette beim Händewaschen bin), reicht sie mir lieber diskret die Desinfektionstücher nach dem Händeschütteln.
Ich genieße diese Momente sehr. In denen sie sich ganz bewusst und fast schon offiziell dazu herablässt, meine Assistentin zu sein. Vor fünfzig Jahren wäre das wohl das ganz normale Verhalten einer ganz normalen Ehefrau gewesen. Aber heute? Mit dem ganzen Gleichberechtigungskram? Da wird solche Tätigkeit mit Frondienst gleichgesetzt. Und der ist ja verboten unter Eheleuten.
Jedenfalls koste ich das sehr aus, dass ich sie da in der Hand habe. Ich sage ihr dann schon in der Limousine auf dem Weg zum Bayerischen Hof:
»Also Schnuffi, für heute Abend bist du wieder meine Assistentin. Du weißt, woher das Wort kommt?«
Sie verdreht die Augen und guckt mich genervt an. Sie weiß es, will es nur nicht artikulieren. Aber ich schone sie nicht und bringe das zu Ende.
»Von assistieren. Das kommt aus dem Lateinischen und heißt, Du tust was ich sage.« Ich liebe den Filmball.
MEINE DREI ARABER
Ich sprach ja schon davon, dass meine Kinder die Schreisucht meiner Frau geerbt haben. Nun könnte man sagen: Vito und Maya sind auch von mir (zumindest sprechen viele Indizien dafür) – sie müssten also auch einen Teil meines dezenteren Kölner Gemüts mitbekommen haben. Dennoch scheinen die europäischen Gene machtlos gegenüber den Arabischen, denn ich muss immer wieder feststellen, dass meine Kinder typisch orientalische Verhaltensmuster an den Tag legen. So feilschen sie zum Beispiel wahnsinnig gerne.
Wenn Viktoria und ich mal gemeinsam mit unseren Kindern einkaufen gehen und wir eine Metzgerei betreten, spielt sich ungefähr folgende Szene ab.
Wir sind noch nicht ganz durch die Tür, da brüllt mein Sohn in arabischer Grundlautstärke:
»Metzger, gib mir eine Wurst!«
»Das heißt bitte«, ergänzt Viktoria mechanisch, während sie sich die Ware im Verkaufstresen betrachtet.
»Außerdem hat der Mann einen Namen, mit dem man ihn ruft«, ergänze ich, während ich schon nach einer passenden Wurst für meinen Wurstsalat Ausschau halte. Der Metzger nutzt die Zeit, um unsere erzieherischen Maßnahmen komplett zu hintertreiben und Vito das verlangte Stück Fleisch über den Tresen zu reichen. »Hier, mein Kleiner, da haste deine Wurst.«
»Wie heißt er denn?«, will meine Tochter wissen. Ich kann mich noch nicht zwischen einer Lyoner und einer normalen Fleischwurst entscheiden. Vito bietet mir brüderlich die Hälfte seiner Wurst an.
»Papa, wie heißt er?« Das war wieder Maya.
»Wer?«
»Der Metzger.«
»Woher soll ich das wissen?«
Ich schaue zum Metzger, der das gehört hat. Ich lächle ihn an, nach dem Motto – Kinder! Er lächelt nicht zurück. Mir fällt ein, wie oft wir hier schon eingekauft haben. Eigentlich müsste ich seinen Namen kennen.
»Wie heißt du?«, will Vito nun vom Metzger wissen. Wieder mein »Kinder!«-Lächeln. Der Metzger lächelt immer noch nicht.
»Wenn ich deinen Namen sage, krieg ich dann noch ’ne Wurst?«
»Vito, das is ’ne Metzgerei und nicht die Heilsarmee. Wir kaufen Wurst und die kannst du dann zu Hause essen.« Ich versuchte das Geschachere, das sich nun anbahnte, zu verhindern.
»Ich heiße Limm und wennstes richtig sagst, kriegst noch’n Stück.«
»Und wenn ich Ihren Namen und bitte sag, krieg ich dann zwei Stücke«, schaltet meine Tochter Maya sich in die Verhandlungen ein. Jetzt ist es zu spät. Meine kleine Familie ist im Feilsch-Fieber. Auch Viktoria hat schon glühende Augen. In Sekundenschnelle verwandeln sie die kleine Münsinger Metzgerei in einen arabischen Bazar.
Wenn ich mit Viktoria alleine einkaufen gehe, gestaltet sich die Szene nicht weniger peinlich für mich. Auch wenn wir nur eine Krawatte für mich kaufen wollen, fängt sie spätestens an der Kasse mit der Feilscherei an.
»Was kann man denn da machen?«, fragt sie den Verkäufer.
»Wie machen? Womit?«, fragt der verdutzt zurück.
»Na mit dem Preis …«
Mehr krieg ich meistens nicht mit, weil ich da schon draußen bin. Mir ist das immer peinlich. Ich habe Viktoria schon oft gebeten, das nicht zu tun. Zumindest nicht in meinem Beisein. Aber sie kann’s nicht lassen. Sie hat das einfach im Blut. Es ist ja auch nicht so, dass ich mich im Nachhinein nicht drüber freuen würde, Geld gespart zu haben. Meistens klappt es nämlich. Die Leute sind nicht mal böse oder genervt. Im Gegenteil. Oft habe ich das Gefühl, die mögen das. Am Anfang dachte ich, das sind selber Menschen mit arabischen Wurzeln, die gerne feilschen. Mit der Zeit wurden es aber zu viele, sodass ich die Theorie verwerfen musste. Vielleicht können sie einfach dem Charme meiner Frau nicht widerstehen. Ich könnte das gut verstehen. Ich kann’s ja auch nicht.
DER ENTERTAINMENT-PAPI
Abends sitze ich mit meinen Kindern oft noch auf dem Sofa, bevor wir sie ins Bett bringen. Vito und Maya haben schon ihre bunten Schlafanzüge an. Sie sind ein bisschen albern, weil sie langsam müde werden. Das heißt, sie sind auch albern, wenn sie hellwach sind. Eigentlich sind sie immer ein bisschen albern. Dafür überkommt die Kinder abends eine fast engelsgleiche Sanftheit, die ihren Charakter normalerweise nicht auszeichnet und die mein väterliches Herz natürlich sehr rührt. Obwohl Vito und Maya sich über den Tag oft zanken, können sie dann sehr lieb miteinander sein.
Wenn Vito seiner Schwester mit feierlichem Ernst den Lieblingsball schenkt, guckt er dabei fast so staatstragend wie ein Politiker.
»Hier Maya, der ist für dich. Weil ich dich so lieb habe.«
Ich ahne allerdings, dass er es auch am nächsten Tag wie ein Politiker halten wird. Getreu dem berühmten Adenauer-Zitat: »Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.« Damit weiß ich wenigstens schon, worüber morgen gestritten wird.
Aber jetzt sind die zwei allerliebst. Tagsüber schafft man es kaum, ein Kind auf den Schoß zu nehmen und beispielsweise ein Gespräch mit ihm zu führen, weil sie, wie aufgezogene Duracell-Puppen, einfach nicht still sitzen können. Aber abends, kurz vor dem Zubettgehen, liegen sie wie Watte in meinen Armen. Ich lese ihnen noch ein wenig vor. Der Räuber Hinkefuß, Die kleine Hexe Schrumpeldei, Die Abenteuer des Ritter Rost, Der Plumssack – oder auch aus den Märchen aus 1001 Nacht. Es ist ihnen meist egal, was ich lese. Kindern ist es glaube ich wichtiger, wie man liest, als was man liest. Zum Glück einiger Kinderbuchschreiber.
Kinder sind das beste Publikum. Man kann an ihren Gesichtern genau ablesen, wie sie bei einer Geschichte mitgehen. Ob sie etwas fasziniert oder eher langweilt. Sie haben noch nicht gelernt, ihre Gefühle zu verbergen wie die Erwachsenen.
Wenn ich Maya und Vito dann im Arm halte und es riecht im Raum nach Erdbeershampoo, nach Bettgehzeit und Kinderzahnpasta, würde ich den Moment oft gerne festhalten. Einfach einfrieren und aufheben. Für schlechte Zeiten.
Natürlich sind meine Kinder ein bisschen verwöhnt, was das private Unterhaltungsprogramm angeht. Wer hat schon einen Profi-Vorleser zu Hause. Wenn ich ihnen Geschichten erzähle oder aus einem Buch vorlese, stelle ich mir auch immer vor, ich säße in einem Studio bei irgendeinem Rundfunksender und müsste eine CD besprechen. Ich versuche keine Fehler zu machen und betone die Dinge, wie sich das für einen Schauspieler gehört, der ein Kinderbuch liest. Deswegen bin ich in der Familie auch der Favorit, was das Vorlesen betrifft. Die meisten Dinge machen sie schon noch lieber mit der Mami. Gerade Vito ist ein ganz schönes Muttersöhnchen. Doch Lesungen und Rühreier (à la Papa), das ist meine Sache.
Aber die Konkurrenz schläft nicht. Wir haben hinten im Auto ein kleines Entertainment-Programm, zwei Fernseher mit CD-Player, die in die vorderen Nackenstützen eingebaut sind. Eigentlich nur für lange Fahrten gedacht, als Nothilfe sozusagen, wenn gar nichts mehr geht. (Die Eltern unter Ihnen werden das kennen.) Wenn man mit mehreren Kindern längere Strecken im Auto verbringen muss, gibt es nicht viele Möglichkeiten, das ohne Nervenzusammenbruch zu überstehen. Eigentlich nur zwei. Entweder man hat besagtes Entertainmentprogramm oder man ist taub. Weil ich Kinder in aller Regel mag und finde, dass sie unseren Schutz brauchen und verdienen, habe ich eine dritte Variante bewusst ausgeschlossen. Ich würde sie nicht unter Valium setzen. Wenn man aber nicht über eine dieser Möglichkeiten verfügt, bilden sie sehr schnell ihr eigenes Entertainmentprogramm im Font des Wagens.
Vito (nach einem Kilometer): »Mir ist langweilig.«
Maya (die (noch) liest): »Dann lies was.«
Vito: »Ich kann aber nicht lesen.«
Maya: »Pech gehabt.«
Vito (nach zwei Kilometern): »Ich hab Hunger.«
Maya (nach fünf Kilometern): »Ich hab Durst.«
Vito (nach sieben Kilometern): »Ich muss mal.«
Maya: »Wie lange ist es noch?«
Vito: »Die Maya hat mir die Zunge rausgestreckt.«
Maya: »Mama, darf ich auf deinem Handy spielen?«
Vito (nach zehn Kilometern): »Ich hab Durst.«
Maya (nach 12 Kilometern): »Mir ist schlecht.«
Vito (nach 15 Kilometern): »Sind wir bald da?«
Maya (nach 18 Kilometern): »Der Vito hat mich an den Haaren gezogen.«
Vito (nach 20 Kilometern): »Mir ist immer noch langweilig.«
Und dann geht das Spiel von vorne los. Bei einer mittleren Urlaubsfahrt von uns aus in den Süden Italiens, sagen wir runde 1000 Kilometer, ist es meinem Sohn dementsprechend hundert Mal langweilig und meine Tochter muss fünfzig Mal auf die Toilette. Das sind natürlich nur Richtwerte, die variieren können.
Ich kenne nur ein Kind, dem im Auto auf Reisen diese Verhaltensweise nicht nachgesagt wurde und wird. Mich. Das heißt, als ich klein war. Gott und meine Eltern sind Zeugen. Meine Mutter erzählt diese Geschichten sehr gerne. Wenn sie mit ihren Kindern, also mit meiner Schwester und mir, nach Italien gefahren ist, hat sie mich auf den Rücksitz gelegt. Wir waren noch nicht aus der Ausfahrt, da war ich schon im Bubu-Land. Kurz vor dem Brenner bin ich das erste Mal aufgewacht und habe gefragt: »Sind wir schon über die Mülheimer Brücke?« (Eine Rheinbrücke in Köln.) Meine Mutter ist mit mir kurz zum Pinkeln gegangen. Dann hab ich mich wieder aufs Ohr gehauen und durchgepennt. Bis Rimini. Das nenn ich pflegeleicht.
Wir waren beim Entertainmentprogramm im Auto stehen geblieben. Bei den Fernsehern.
Auf kurzen Strecken sind sie tabu. (Es sei denn, ich lasse mich von meiner Frau fahren und sitze selber hinten.) Wenn ich Vito in den Kindergarten fahre, muss ich also ein vernünftiges Gegenprogramm liefern, sonst wird gemeckert.
Am liebsten mag Vito, wenn ich über Lucky Luke singe. Ich habe ihm mal die Geschichte des sagenumwobenen Cowboys erzählt, der schneller war als sein Schatten. Seitdem ist er von ihm begeistert und versucht ebenfalls schneller zu werden als sein Schatten. Ich habe jetzt schon Angst vor dem Tag, an dem er damit aufhört. Dann weiß ich, dass er kein Kind mehr ist. Jedenfalls musste ich immer mehr Geschichten über Lucky Luke erfinden und schließlich Lieder über ihn singen. Also fange ich an:
»Lucky Luke das war ein Wilder, der schoss auf alle Straßenschilder.« Diese Zeilen müssen spontan erdacht werden, auf Zuruf sozusagen, sonst hagelt es Proteste von den billigen Plätzen. Wir fahren durch das schöne Alpenvorland Richtung Kindergarten.
»Noch ’ne Strophe!«, ruft Vito begeistert. »Jetzt Lucky Luke in den Bergen!« Sie sehen: Vito gibt mir gerne die Themen vor. Wo Lucky sich gerade befindet oder was er durchzustehen hat.
Also gut: »Lucky Luke versteckt sich in den Bergen. Da kann ihn niemand finden, außer den Zwergen«, gröle ich. Wir kommen an einer Weide mit Kühen vorbei.
»Jetzt bei den Kühen«, ruft mein Kleiner mit roten Bäckchen.
»Lucky Luke ist Cowboy, deshalb liebt er Kühe. Nur mit dem Melken hat er seine Mühe.«
Das holperte ein wenig, macht aber nix, die Jury hinten ist gnädig und noch in einem Alter, in dem man leicht zu begeistern ist.
»Und noch ’ne Strophe Lucky Luke. Jetzt bei den Kängurus!« Zum Glück ist der Kindergarten gleich im Nachbarort.
Auf dem Rückweg höre ich dann Klaviermusik, zum Entspannen.
DIE ZEIT VERGEHT
Die Kinder halten einem am besten vor Augen, wie vergänglich alles ist. Ich beobachte mit einer gewissen Wehmut, wie schnell sie älter werden. Gerade wenn sie so zwischen drei und sechs Jahre sind, wenn sie anfangen, die Welt zu begreifen, noch staunen und fasziniert sind von allem – das ist ein tolles Alter. Sie sind dann einfach nur zum Knuddeln. Ich kann mich zum Beispiel jedes Mal freuen, wenn ich nach Hause komme und die kleinen Schühchen auf der Treppe sehe. Ich schaffe es einfach nicht, an ihnen vorbeizugehen, ohne zu lächeln. Letztens ist es dann passiert. Der Moment, vor dem ich solche Angst hatte. Ich habe auf der Treppe ein paar Schuhe gesehen und konnte nicht einordnen, ob sie von meiner Tochter oder meiner Frau sind. Schrecklich. Da war für mich ein Lebensabschnitt vorbei.
Und bevor man sich versieht, sind sie in der Pubertät. Dann laufen sie mit fettigen Haaren und pickelig herum und finden alles krass und abgefahren. Sie stechen sich Tattoos und zieh’n sich Ringe durch die Nase. Was die Eltern sagen ist ätzend, und Bock hat man sowieso auf nix. Wenn sie überhaupt nach Hause kommen, dann nur um ihre Kippen auf dem Teppich auszudrücken. Mit ’nem Gettoblaster auf der Schulter und Johnny im Arm. »Papa, das is Johnny. Der zieht jetzt bei uns ein. Johnny is DJ und so cooool. Sein Piercing kann man rausnehmen, is das nich krass?!« Mir graust schon davor. Am liebsten würde ich ihnen das Älterwerden verbieten.
Ein Gefühl, das ich vor der Geburt meines ersten Kindes überhaupt nicht kannte, war das der Sorge. Meine Mutter hat sich immer Sorgen um mich gemacht. Ich empfand das als befremdlich, ehrlich gesagt sogar: lästig. Wenn ich nachts noch Auto gefahren bin, hat sie mich gebeten: »Melde dich, wenn du angekommen bist«, weil sie fürchtete, dass ich vielleicht zu müde sein und beim Fahren einschlafen könnte. Sorge – klar, ich kannte den Begriff und wusste, wie man ihn definiert, aber ich hatte das Gefühl selbst vorher nie empfunden. Das ändert sich, sobald ein Kind da ist. Ein eigenes Kind. Dann bekommt dieser Begriff ein Gesicht. Da reicht es, dass du beobachtest, wie es mal unaufmerksam über die Straße läuft. Sofort hast du vor Augen, dass es das immer macht und bist in Sorge. Und Gefahren lauern überall.
Jedes Mal, wenn ich mit Viktoria telefoniere und sie von irgendwoher losfährt, um nach Haus zu kommen, oder wenn sie von hier wegfährt, sage ich: »Fahr bitte vorsichtig!« Das ist wie ein Mantra. Man muss sich regelrecht zwingen, das mit der Sorge nicht zu übertreiben. Wenn mir damals meine Mutter erzählt hätte, dass es mir sorgentechnisch bei meinen eigenen Kindern mal genauso ergehen würde – ich hätte ihr nicht geglaubt. Aber so sind sie eben – die Kinder.
DER ALTE VATER
Viktoria und ich haben vor einiger Zeit beschlossen, keine Kinder mehr in die Welt zu setzen. Ich wollte mich von Harald (Dirty Harry) Schmidt nicht fragen lassen: »Sag mal, Heiner, Kinder in deinem Alter? Ist das noch Erektion oder schon Leichenstarre?«
Dass ich schnell müde werde, wenn ich mit den Kindern spiele, hat sicher auch damit zu tun, dass ich so spät noch einmal Vater geworden bin. Die Natur wird sich was dabei gedacht haben, dass sie die Menschen normalerweise früh zu Eltern macht und mit 65 in den Ruhestand schickt. Als Vito geboren wurde, war ich 54. Normalerweise wechselt man in diesem Alter keine Windeln mehr. (Man denkt vielleicht eher schon darüber nach, bald selbst wieder welche zu tragen.)
Klar, es hat auch Vorteile, ein alter Vater zu sein. Ich schreibe bewusst nicht »älterer Vater«, sondern »alter Vater«. Es ist in meinen Augen eine dumme Sitte der Gesellschaft geworden, das Wort »alt« nicht mehr aussprechen zu wollen. Obwohl es auf der Erde mehr alte Menschen und ältere alte Menschen gibt als jemals zuvor, sind sie offiziell und linguistisch verschwunden, weil man selbst die ältesten der Alten nur als »die Älteren« bezeichnet. Wenn fünf Hundertjährige zusammenstehen und jemand sollte sie bitten beiseitezutreten, würde er sagen (oder brüllen):
»Könnten die älteren Herrschaften vielleicht Platz machen?«
Wenn die Hundertjährigen ähnlich sprachphilosophisch unterwegs wären wie ich, dürfte sich eigentlich keiner von ihnen von der Stelle rühren.
Auf alle Fälle ist man in meinem Alter weniger belastbar als mit jungen Jahren. Auch was Lärm betrifft. Lautes Kinderspielzeug ist bei uns tabu. Freunde oder Bekannte, die lautes Spielzeug mitbringen, kommen auf die schwarze Liste.
Auf meinen Top Ten der akustischen Schwerverbrechen stehen zum Beispiel hektische Computerspiele ganz weit oben. Sie kommen gleich hinter Motorsägen, Zahnarztbohrern und Presslufthammern. Das Einzige, was ich wirklich gerne laut höre ist Musik (wenn’s kein Free Jazz ist).
Obwohl, wenn meine Kinder spielen und sich ausnahmsweise mal vertragen – wenn sie dann jauchzen, lachen und vor Freude laut kreischen – das ist dann auch wie Musik in meinen Ohren. Im Grunde ist es heute sogar meine Lieblingsmusik.
HELIKOPTER-ELTERN
Gelegentlich kommt es in Erziehungsfragen zu Patt-Situationen: Was den einen Elternteil freut, ärgert den anderen. So geschehen zum Beispiel an einem schönen Spätsommertag bei uns auf der Terrasse.
Viktoria und ich saßen bei Kaffee und Kuchen. Vito war noch ein Baby. Dementsprechend lieb lag er in seiner Wiege, und Maya spielte vor uns auf der Terrasse. Genauer gesagt, sie klaubte Blätter vom Boden auf, stopfte sie in eine Kiste, um dann was weiß ich mit ihnen zu machen. Mit der Verzückung eines liebenden Vaters beobachtete ich sie dabei, während ich Vito wippte. Viktoria erzählte mir irgendwas von Handwerkern, die wieder mal nicht gekommen waren. Es war das reinste Familienidyll. Hätte uns jemand fotografiert – Magazine wie Schöner Wohnen oder Eltern hätten keine Sekunde gezögert, und uns auf ihren Titel platziert.
Maya schienen die Blätter auf dem Boden ausgegangen zu sein, deswegen pflückte sie jetzt welche von einem Zierbaum, der auf unserer Terrasse stand.
»Maya, lass das bitte. Du darfst nur die Blätter nehmen, die du auf dem Boden findest«, ließ ich sie wissen.
»Warum?« Ich hätte meine nagelneuen Golfschläger darauf gewettet, dass sie diese Frage stellen würde. Und wie jedes Mal traf mich die Frage dennoch gänzlich unvorbereitet. Warum durfte sie nicht ein paar Blätter vom Bäumchen pflücken?
»Weil …« sagte ich lang gezogen, mit Blick auf meine Frau, »weil …«, Viktoria tat so, als würde sie meinen Blick nicht bemerken, »weil … ich das nicht möchte.« Nun sah mich Viktoria doch an. Solche rhetorischen Schwächen war sie von mir nicht gewohnt. Das war ja wohl auch das dämlichste aller Argumente und für wissensdurstige Kinder wie die unsrigen gänzlich unbefriedigend. Das heißt, wie man es nimmt. Es eröffnete ihnen andererseits die Möglichkeit, so unmittelbar und wie gnadenlos nachzuhaken:
»Warum?«
»Weil wir die Bäume gekauft haben, damit wir sie anschauen können und nicht, damit du ihnen die Blätter abzupfst«, stellte Viktoria mit einer Logik fest, um die ich sie fast ein wenig beneidete.
Man sah Maya an, dass sie sich auf die Lippen beißen musste, um nicht noch einmal »warum« zu fragen. Gehorsam unterbrach sie das Gezupfe.
Brav ist sie schon, dachte ich noch stolz, bevor ich meine Kaffeetasse in die Küche brachte. Ich war nämlich ebenso brav und befolgte nach über fünfzig Jahren noch die Regel, die meine Mutter mir seinerzeit eingebläut hatte: ›Gehe nie mit leeren Händen in die Küche‹. Viktoria kam mir mit dem Rest, also ein paar Tellern, Gabeln, der Kaffeekanne, der Kuchenplatte, der zusammengefalteten Tischdecke, einer angebrochenen Milch, den Wasserflaschen und noch ein paar anderen Kleinigkeiten hinterher und wir räumten die Sachen weg. Auf einmal stupste mich Viktoria an und zeigte Richtung Glastür nach draußen. Maya, die offenbar dachte, dass wir sie nicht mehr beobachteten, stand da und rüttelte an dem Zierbäumchen. Ein paar Blätter fielen herunter. Die sammelte sie ein, verstaute sie in ihrem Karton und fing wieder an zu rütteln. Diesmal wesentlich heftiger. Viktoria und ich mussten lachen.
Meine Frau war ein bisschen sauer auf Maya, weil sie nicht gehorcht hatte. Das heißt, eigentlich hatte sie ja gehorcht. Und auch wieder nicht. Ich freute mich insgeheim, denn ich fand es ganz schön clever von Maya. Wer hatte nun recht? Entscheiden Sie selbst.
Dass ich mein spätes Familienglück ganz gut genießen kann, heißt aber nicht, dass ich jetzt Vollzeitpapi bin und nichts anderes mehr zu tun hätte, als meine Kinder zu betüddeln – wie diese Profi-Eltern, die Kindererziehung zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben und immer alles besser wissen, wenn es um pädagogische Fragen geht. Ich lese auch keine Erziehungsratgeber, bereite keine Babybreichen zu, noch züchte ich eigens Pastinaken dafür in unserem Garten.