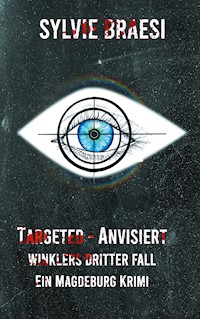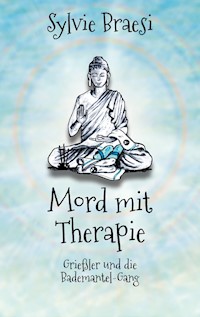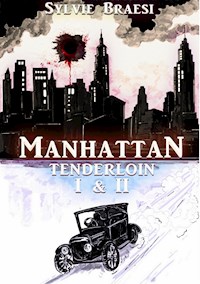Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Knox ist enttäuscht. Zuerst muss er sich in sein neues Leben in Chicago reinfinden und, statt spektakuläre Verbrechen aufzuklären, wird er lediglich mit der Aufklärung eines Vermisstenfalles betraut. So hat er sich das nicht vorgestellt. Währenddessen macht seinen Freunden in New York, Malone und Coulson, nicht nur ihre Trauer über Knox vermeintlichen Tod zu schaffen. Sie bekommen es auch mit mehreren kniffligen Mordfällen und einer nicht identifizierbaren Wasserleiche zu tun.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 850
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch
Knox ist enttäuscht.
Zuerst muss er sich in sein neues Leben in Chicago reinfinden und, statt
spektakuläre Verbrechen aufzuklären, wird er lediglich mit der Aufklärung eines
Vermisstenfalles betraut.
So hat er sich das nicht vorgestellt.
Währenddessen macht seinen Freunden in New York, Malone und Coulson, nicht
nur ihre Trauer über Knox vermeintlichen Tod zu schaffen.
Sie bekommen es auch mit mehreren kniffligen Mordfällen und
einer nicht identifizierbaren Wasserleiche zu tun.
Sylvie Braesi
Geboren und aufgewachsen in Magdeburg.
Sie hat eine Ausbildung als Heimerzieherin und war u.a. als Dozentin und
Vermittlungscoach in der Erwachsenenbildung sowie als Kabarettistin tätig.
Sie schreibt Krimis und Kurzkrimis.
Die beiden ersten Bücher der Manhattan Trilogie veröffentlichte sie 2018. Das
dritte Buch dazu, Manhattan Revenge, erschien 2019.
Gemeinsam mit einer anderen Magdeburger Autorin veröffentlichte sie 2019 ein
Buch mit Magdeburger Kurzkrimis unter dem Titel,
Magdeburger Mord(s)geschichten.
Ihre Bücher veröffentlicht sie als Selfpublisher.
Der Mensch will getäuscht sein. Das verlangt seine Natur, welche nach Täuschung lechzt und die Wahrheit mehr fürchtet als Feuer und Schwert. Johannes Scherr
Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde Bibel, Altes Testament, Das zweite Buch Mose (Exodus)
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Epilog
Prolog
Silvester 1899 - Chicago
Elli hielt Leos Hand ganz fest. Seit Stunden waren sie in der Kälte unterwegs und hatten noch keinen Unterschlupf gefunden. Doch die Kälte war nicht das Einzige, was ihnen zusetzte. Sie hatten auch schon zwei Tage nichts mehr gegessen.
Tagsüber versuchten sie es mit Betteln und in der Nacht durchwühlten sie Abfälle.
Die besten Sachen gab es natürlich dort, wo Hotels oder Restaurants waren, aber die Geschwister hatten keine Chance. Sie waren noch Kinder und durch das ständige Hungern und Frieren viel zu schwach, um sich gegen die anderen Bettler durchzusetzen. Also versuchten sie etwas anderes.
Bei den reichen Leuten gibt es so viel zu essen, da bleibt immer was übrig, hatte Leo gemeint. Doch auch das war wenig erfolgreich gewesen.
Alles, was übrigblieb, wurde unter den Bediensteten aufgeteilt und wenn wirklich etwas in den Müll kam, dann bedeutete das noch lange nicht, dass sie es sich holen konnten.
Die Grundstücke wurden gut bewacht und Bettler nicht geduldet. Einmal waren sogar Hunde auf sie gehetzt worden.
Auch heute liefen sie wieder ziellos durch die Straßen.
Ellis Tränen waren längst versiegt, die Kälte machte ihre Hände und Füße gefühllos und der Hunger wuchs ins Unerträgliche.
„Leo bitte, ich kann nicht mehr.“ Leo zeigte keine Reaktion, so als hätte Elli gar nichts gesagt. Vielleicht musste sie lauter sprechen.
„Leo bitte, halt an! Mir ist so kalt, ich will nicht mehr weiterlaufen!“
Ihre Hände hatten sich gelöst und Elli war stehengeblieben. Erst nach ein paar Metern schien Leo zu bemerken, dass die Schwester nicht mehr folgte, hatte sich umgedreht und war zurückgekommen.
Behutsam legte Leo die Hand auf Ellis Schulter und sprach leise auf sie ein.
„Nur noch ein bisschen Elli, versprochen. Wir suchen uns einen Unterschlupf, dann kannst du dich ausruhen. Vorhin sind wir an einem leeren Haus vorbeigekommen, da können wir diese Nacht bleiben.“
„Ich kann nicht mehr weiter, ich will mich hier ausruhen, nur ein bisschen.“
„Das geht nicht. Hier ist nichts weit und breit, was uns vor der Kälte schützt.“
„Da drüben sind ein paar Bäume und Sträucher. Bitte Leo!“
„Elli, hör mir zu, dort drüben ist ein schlechter Ort zum Ausruhen. So müde wie wir sind, würden wir schon bald einschlafen und erfrieren. Nur noch ein paar Schritte und wir sind bei dem Haus. Dort kannst du dich ausruhen und vielleicht finden wir dort etwas, was wir verkaufen oder eintauschen für etwas zu Essen eintauschen können.“
Irgendwie war es Leo auch diesmal wieder gelungen, die kleine Schwester zum Weiterlaufen zu bewegen und wirklich, nach ein paar hundert Metern war das Haus wie ein dunkler Schatten vor ihnen aufgetaucht.
Es hatte sich dann allerdings als ziemlich üble Bruchbude erwiesen. Aber es war dort immer noch besser, als irgendwo auf der Straße.
Während Elli sich kraftlos in eine Ecke kauerte, lief Leo durch das Haus, auf der Such nach Essbarem oder wenigstens etwas, was ihnen in ihrer Lage helfen konnte. Doch da war nichts außer einer alten löchrigen Decke.
Leo versuchte, Elli und sich so gut es ging darin einzuwickeln und stellte fest, dass es kaum für einen reichte. Trotzdem war Elli bald in einen Dämmerschlaf gefallen und Leo spürte wie ihr Zittern etwas nachließ.
Wie lange werden wir noch aushalten? Wie lange können wir dieses Leben noch ertragen?
*
Leo und Elli waren schon immer arm gewesen. Die Mutter nähte Tag und Nacht für einen Hungerlohn und der Vater arbeitete in einem der vielen Schlachthäuser.
Mit dem Geld, was beide Eltern verdienten, hätte die Familie ganz gut über die Runden kommen können. Doch das meiste Geld trug der Vater in die Kneipen.
An jedem Zahltag wartete die Mutter auf sein Heimkommen, in der Hoffnung, dass er diesmal nicht so spät kam und doch etwas Geld mitbrachte. Doch ihre Zuversicht schwand mit jeder vergehenden Stunde immer mehr.
Wenn der Vater endlich in die armselige Wohnung kam, war er meist betrunken.
Er rief ungeduldig nach seinem Essen, doch da kein Geld im Haus war, fiel das nur kärglich aus. Der Vater konnte schon nüchtern ein rauer Geselle sein, dem schnell die Hand ausrutschte. Mit ausreichend Alkohol intus wurde aus ihm ein rasender Bulle.
Es war fast unmöglich, ihn aufzuhalten. Keiner wusste das besser als ihre Mutter.
Sie war es, die seinen Jähzorn zu spüren bekam. Leo sah die Spuren an ihr und konnte ihr doch nicht helfen.
Was kann ein Kind mit zehn Jahren gegen so einen rasenden Vater schon ausrichten?
Alles, was die Kinder tun konnten, war in Deckung gehen und beten, dass es bald vorbei war und die Mutter noch lebte.
Die Angst der Kinder um das Leben der Mutter war nicht unbegründet. Eines Nachts tobte der Vater wieder besonders heftig.
Leo nahm Elli an die Hand und zog sie mit in den Hausflur. Unter der Treppe war ihr Versteck, wo sie schon oft auf das Ende der Raserei des Vaters gewartet hatten. Doch diesmal schien es kein Ende zu nehmen. Von den Nachbarn ließ sich keiner blicken, man kannte die Schreie und das Gebrüll zu gut und hier hatte jeder genug mit sich selbst zu tun.
Am nächsten Morgen waren die Kinder von lautem Getöse schwerer Schritte geweckt worden. Elli hatte sich verwundert umgesehen. Sie lag im Bett neben Leo. Wie waren sie hierhergekommen? Elli konnte sich nicht erinnern. Hatte die Mutter sie nach oben geholt?
Bevor sie Leo fragen konnte, wurde die Tür aufgerissen und ein Polizist hatte sich in die kleine Kammer gezwängt.
Man holte die Kinder aus dem Bett und zerrte sie nach draußen.
In der Küche sah es aus wie auf einem Schlachtfeld. Die Mutter lag auf dem Boden vor dem Schrank. Die Schranktüren waren herausgerissen worden und das wenige Geschirr lag zerbrochen auf dem Boden. Der Vater saß auf einem Stuhl, den Kopf nach hinten gelehnt, den Mund weit geöffnet. Man hätte denken können, er schläft seinen Rausch aus.
Elli dachte: Sie werden ihn noch aufwecken und dann wird er furchtbar wütend werden, weil sie alle durch seine Wohnung trampeln.
Aber der Vater würde nie wieder aufwachen. In seiner Brust stach ein Messer und um die Einstichstelle hatte sich ein roter Fleck gebildet.
Ein Fotograf war schon dabei, seinen Apparat aufzubauen um die Szenerie aufzunehmen.
Nachbarn wurden befragt und ein Coroner gerufen. Dessen Einschätzung war kurz und bündig: Tod durch Gewalteinwirkung.
Von den Kindern erfuhr man nichts, die standen zu sehr unter Schock und hatten wohl auch nichts gesehen.
Im abschließenden Bericht beschrieb die Polizei das Geschehen wie folgt: Der Ehemann hatte unter Alkoholeinfluss seine Frau, wie so oft, verprügelt, sie außerdem gewürgt und mit dem Kopf auf den Tisch geschlagen. Davon hatte die Frau schwere Verletzungen davongetragen. Da nicht nachzuweisen war, dass sich noch eine dritte Person am Tatort aufgehalten hatte, war die einzig mögliche Schlussfolgerung, dass die Frau sich in Todesangst diesmal gewehrt haben musste. Sie hatte wohl das Messer, ein Küchenmesser, zu fassen gekriegt und zugestochen. Ihr Mann musste zwar auf der Stelle tot gewesen sein, aber die Verletzungen der Frau waren zu schwer, als dass sie noch Hilfe für sich hätte herbeirufen können.
Ein paar Stunden Polizeiarbeit, ein kurzer Bericht, mehr war der Fall nicht wert.
Die Kinder kamen in ein Waisenhaus, das von einem Reverend Carrington geführt wurde. Der Hort der christlichen Nächstenliebe entpuppte sich für die beiden Kinder bald als eine ganz besondere Art von Hölle.
*
Doch auch das Leben auf der Straße war nicht viel besser. Seit Monaten schlugen sie sich mehr schlecht als recht durch. Leo wusste, wenn sie morgen nichts zu essen bekamen, blieb ihnen keine Wahl, Elli musste zurück in dieses furchtbare Haus.
Leo war sich sicher, nach allem, was Elli dort erlebt hatte, würde sie lieber sterben wollen, als dorthin zurück zu kehren. Aber das kam nicht in Frage. Egal, wie schlimm es dort auch war, wenigstens würde sie dort Essen und ein Bett bekommen.
Leo konnte allerdings nicht dortbleiben. Nur Kinder unter vierzehn Jahren wurden aufgenommen und Leo war schon fünfzehn.
Darum hatte Leo das Waisenhaus auch vor einem Jahr verlassen müssen.
Ellis Schreie hatte man noch durch die ganze Straße gehört, als Leo gehen musste.
Leo war zu einem Ehepaar geschickt worden und hatte in ihrem Haus alle möglichen Arbeiten erledigen müssen. An jedem der wenigen freien Nachmittage, war Leo zum Waisenhaus gegangen und hatte Elli besucht und jedes Mal war der Abschied mit denselben Beteuerungen, Elli bald aus dem Waisenhaus zu holen, herzzerreißend gewesen. Nicht das Leo es nicht so gemeint hätte, doch dazu war es nicht gekommen.
Eines Abends waren die Leute vom Waisenhaus plötzlich bei Leos Herrschaft aufgetaucht und hatten Leo einem langen, unangenehmen Verhör unterzogen.
Elli war ihnen weggelaufen und wurde gesucht.
Es hieß, Elli hätte gestohlen.
Sie wollten von Leo wissen, wo sie war, fragten nach ihrem Versteck und drohten sogar mit Schlägen. Doch Leo wusste nichts und nach einer Stunde gingen sie wieder, nicht ohne sogar mit dem Gefängnis zu drohen.
Leo war sich sicher, dass die Geschichte mit dem Diebstahl nicht stimmte. Elli war nicht diejenige von ihnen, die so etwas tat.
Spät am Abend, als alles ruhig war, hatte Leo im Bett gelegen und gegrübelt, wo Elli sein konnte. Bevor die Grübelei aber etwas gebracht hatte, war Leo von einem Klicken aufgeschreckt worden. Jemand hatte einen Stein an Leos Fenster geworfen und es war sofort klar, dass es nur Elli gewesen sein konnte.
In dieser Nacht waren sie zusammen davongelaufen.
*
Es kam Leo jetzt wie der schlimmste Verrat vor, die kleine Schwester wieder dorthin zurück zu schicken, doch hier auf der Straße würde sie sterben.
Natürlich würde Elli nicht freiwillig ins Waisenhaus zurückgehen.
Also blieb Leo keine andere Wahl.
Sich vorsichtig aus der Decke zu wickeln, war der Anfang. Jetzt hatte Elli die Decke wenigstens für sich. Was für ein schwacher Trost.
Leise schlich Leo in Richtung Tür und wollte unbemerkt das Haus verlassen.
Doch plötzlich war da ein Gedanke. Was, wenn Elli plötzlich erwachen würde und merkte, dass sie allein war?
Also kam Leo noch einmal zurück und flüsterte der Schwester leise ins Ohr.
„Schlaf noch ein bisschen. Ich bin bald zurück und bringe etwas zu essen mit.“
Elli hatte im Halbschlaf gemurmelt und genickt. Sogar ein kleines Lächeln war über ihr Gesicht gehuscht.
Als Elli später von einem Geräusch geweckt wurde, hatte sie sich erschrocken nach Leo umgesehen. Doch dann war ihr eingefallen, was Leo ihr zugeflüstert hatte. Ich bin bald zurück und bringe etwas zu essen mit.
Etwas zu essen!
Elli war aufgesprungen und zu der windschiefen Tür gelaufen, durch die sie in der letzten Nacht eingedrungen waren.
Da waren Schritte auf den Stufen vorm Haus und jemand zerrte an der Tür. Erst kam eine Hand zum Vorschein, dann ein Arm und schließlich schob sich eine Gestalt durch die enge Öffnung.
Das ist nicht Leo! Wo ist Leo?
Elli war starr vor Schreck, als sie erkannte, wer sich da durch den Türspalt schob. Der Reverend!
Seine grauen Augen blickten sie kalt und unbarmherzig an, während sein Mund sich zu einem hässlichen Lächeln verzog.
„Da ist ja unser blonder Engel, wir haben dich schon so vermisst. Alle haben dich schon so vermisst. Das wird ein hübsches Wiedersehensfest geben.“
Erst als der Mann sie grob packte, fiel der erste Schreck von ihr ab und sie versuchte sich aus seinem Griff zu befreien. Leider ohne Erfolg. Auch ihr Geschrei nutzte ihr nichts.
Unbarmherzig zerrte der Mann sie auf die Straße zu einer wartenden Kutsche.
Längst war ihr klar geworden, dass man sie ins Waisenhaus zurückbringen wollte.
Aber wie hatten die sie finden können und das jetzt noch, nach all den Monaten?
Die Antwort entdeckte sie neben der Kutsche und schlagartig war die letzte Kraft in ihr erloschen.
LEO!
Widerstandslos ließ sie sich in die Kutsche heben, in der eine Wärterin sie erwartete. Wie durch einen dicken Nebel drang Leos Stimme zu ihr durch.
„Verzeih‘ mir Elli, aber es ging nicht anders. Wir wären hier draußen gestorben, du wärst gestorben. Das konnte ich nicht zulassen.“
Ein letztes Mal bäumte sich Elli auf und schrie.
„Aber du hast es mir versprochen, Leo! Du weißt es doch!“
Im nächsten Moment hielt ihr die Frau ein Tuch vor das Gesicht und das Letzte, was Elli bewusst wahrnahm, war, dass ihr endlich warm wurde.
Leo sah der davonfahrenden Kutsche hinterher, nur mit Mühe die Tränen zurückhaltend.
Die Faust, tief in der Tasche, brannte wie Feuer. Nein, es war nicht die Faust, es waren die Münzen, die darin lagen.
Leo zog die Faust aus der Tasche, öffnete sie und warf einen langen Blick darauf.
Aus der Verwunderung wurde plötzlich blanke Wut und mit aller Kraft schleudert Leo die Münzen weit von sich.
Elli! Meine kleine Schwester. Ja, ich weiß es. Ich weiß, dass sie dir wehtun werden, aber du wirst überleben, du bist stark. Was ich getan habe, habe ich nur getan, weil ich dich nicht mehr beschützen konnte. Hoffentlich kannst du mir eines Tages verzeihen. Ich werde es nie können.
Kapitel 1
Freitag, 16. Februar 1912 - New York
Der Tag war eisig gewesen, doch das war ihm nur recht so. Je kälter es war, desto weniger Menschen waren unterwegs. Wer nicht unbedingt aus dem Haus musste, der blieb lieber im Warmen.
Das traf natürlich umso mehr auf den Abend und die Nacht zu. In den letzten Stunden waren gerade mal zwei Leute die Straße entlanggekommen und Kutschen oder Autos sah man hier noch seltener.
Die meisten Etablissements im Tenderloin Bezirk waren bereits sehr gut besucht und nach Hause wollte um diese Zeit noch niemand.
Er stand regungslos in einer Toreinfahrt und starrte hinüber zu dem Haus auf der anderen Straßenseite. In diesem Haus, das wusste er, wurden alle möglichen Dienstleistungen angeboten.
Es gab Glücksspiel, Prostitution mit Frauen, Männern und Kindern und jede Menge Alkohol. In den drei Etagen gab man sich mit viel Aufwand den Anschein eines ganz normalen Amüsiertempels, wie es ihn in Massen im Tenderloin gab.
Doch der Anschein trog.
In der obersten Etage gab es Räumlichkeiten, die den normalen Gästen nicht zugänglich waren. Dort wurden auch die absonderlichsten Wünsche erfüllt, so wie heute Nacht. Das Besondere dabei war, dass der Kunde verlangt hatte, in dieser Nacht müsse das Haus für andere Besucher und Gäste geschlossen bleiben.
Man wolle unter keinen Umständen gestört werden.
Das Ansinnen des Mieters war ungewöhnlich, doch die Summe, die für dieses Extra geboten wurde, war zu verlockend und machte den Verlust mehr als wett.
Die Gäste dieser Nacht gehörten einem exklusiven, schwer zugänglichen Club an.
Er hatte ein ganz besonderes Interesse an diesem Club und war diesen Leuten schon länger auf der Spur. Alles wurde geheim gehalten, nichts drang nach außen. Zu guter Letzt war es nur ein Zufall gewesen, dass er eine Spur gefunden hatte.
Um Mitglied in diesem Club zu werden, genügte es nicht, dass man reich war und sich den exorbitanten Mitgliedsbeitrag leisten konnte. Man brauchte auch die Empfehlung von mindestens einem langjährigen Mitglied, um dem Club beitreten zu können.
Die Mitglieder trafen sich in unterschiedlichen Abständen, jedes Mal an einem anderen Ort, welcher erst kurz vorher bekannt gegeben wurde. Vorsicht und Geheimhaltung wurden wirklich großgeschrieben. Bei dem, was sie auf ihren Treffen trieben, war das auch unerlässlich.
Wenn ein solches Treffen anstand, mieteten sich alle Mitglieder unter falschem Namen ein Zimmer in einem Hotel. Dort reisten sie als ganz normale Geschäftsleute an und nach zwei oder drei Tagen wieder ab. Zu ihren Soireen, wie sie es nannten, kamen sie immer maskiert und blieben somit unerkannt. Die Fahrzeuge, die sie hin und zurück brachten, wurden nicht über das Hotel geordert.
Heute Nacht fand so eine Soiree in diesem Edelbordell im Tenderloin statt und der Mann, den er treffen wollte, war ein Mitglied in diesem Club.
Allein das herauszufinden, hatte ihn ein ganz hübsches Sümmchen und mehrere Monate Arbeit gekostet.
Zweimal hatte er an der falschen Örtlichkeit auf der Lauer gelegen.
Dann bekam er endlich den Tipp, auf den er solange gewartet hatte. Ein Mädchen aus dem Bordell erzählte ihm, von einer bevorstehenden, sehr geschlossenen Gesellschaft.
Das musste der nächste Treffpunkt sein. Hier würde die heutige Soiree stattfinden.
Nach und nach waren die Mitglieder eingetroffen. Sie kamen immer einzeln.
Auch der Edelfettsack, auf den er wartete, war dabei gewesen. Er beobachtete das Kommen der Leute ganz genau. Dann begann das Warten.
Inzwischen dauerte die Soiree schon länger als drei Stunden. Bei dem Gedanken daran, was dort oben abging, wurde ihm so schlecht, dass er sich fast übergeben musste. Doch daran konnte er nichts ändern, so leid ihm das auch tat.
Nach einer weiteren halben Stunde kam endlich Bewegung in die Sache. Ein Auto fuhr vor und nach ein paar Minuten öffnete sich die Tür zum Club.
Der Mann, der herauskam, sah sich erst vorsichtig nach rechts und links um, bevor er, immer noch maskiert und den Zylinder tief ins Gesicht gezogen, schnell zum Auto lief. Der Chauffeur hielt die Wagentür schon geöffnet, so dass der Mann sofort einsteigen konnte.
Das war nicht der Edelfettsack, auf den er wartete. Jetzt würde es aber nicht mehr lange dauern.
Er lief bis zur nächsten Straßenecke, zu seinem dort abgestellten Hansom Cab.
Der Bursche, dem er den Wagen anvertraut hatte, war auf dem Bock eingeschlafen. Er gab ihm den vereinbarten Lohn, was dessen Müdigkeit schnell verfliegen ließ und er verschwand mit seinem Lohn in der nächsten Kellerbar.
Mit einem letzten Blick in den Fahrgastraum vergewisserte er sich, dass alles bereit war. Die Decke lag auf dem Sitz, seine Tasche stand darunter. Was er sonst noch brauchte, hatte er in der Jackentasche.
Er tätschelte dem Pferd die Flanke. Sein Schnauben war ein deutliches Zeichen dafür, dass es jetzt lieber im warmen Stall stehen würde.
„Tut mir leid, alter Junge. Da musst du noch etwas warten.“
Langsam fuhr er mit dem Hansom Cab um die Ecke und näherte sich dem Haus.
Ein paar Meter vor dem Eingang hielt er an, so als warte er auf einen Gast.
Immer wieder fuhren Autos oder Kutschen einzeln vor, um jemanden abzuholen.
Der Edelfettsack ließ sich nicht blicken, aber das war ganz normal. Erst wenn die Ankunft eines Fahrzeugs gemeldet wurde, kam der Fahrgast heraus.
Nur dass die Kutsche des Edelfettsacks heute nicht kommen würde, dafür hatte er gesorgt.
Nachdem der Kutscher den Edelfettsack abgesetzt hatte, war er wieder zurück in den Mietstall gefahren, von dem er seine Aufträge bekam. Dort erwartete ihn eine Nachricht, dass sein Kunde in dieser Nacht keine Heimfahrt brauchen würde.
Blieb nur die Frage, wie der Edelfettsack auf das Ausbleiben seiner Kutsche reagieren würde.
Er könnte sich eine andere Kutsche kommen lassen oder den wartenden Hansom mieten.
Die Frage wurde schließlich beantwortet. Ein Diener kam auf die Straße gelaufen und winkte ihn hektisch heran.
„Hast du einen Fahrgast?“, fragte der Diener.
„Siehste einen, Kumpel?“, gab er zur Antwort.
Der Diener ging nicht weiter auf die Antwort ein. Er lief zurück ins Haus und kam kurz darauf mit dem Edelfettsack wieder heraus.
Er war schon vom Bock runtergesprungen und hielt die Decke über dem Arm.
Mit der freien Hand half er dem Edelfettsack in die Kutsche und legte ihm die Decke über die Beine. Dabei verrutschte der Mantel des Fahrgasts und gab den Blick frei auf ein Hemd, das eine merkwürdige Farbe aufwies. Aber es war kein farbiges Hemd, es war ein blutiges Hemd.
Der Ekel, der ihn überkam, war so stark, dass er fast die Worte seines Fahrgastes überhört hätte. Nicht weiter schlimm. Es war die Adresse des Edelfettsacks und die war nicht wichtig. Dahin würde er ganz sicher nicht fahren.
Als er nicht gleich reagierte, schnauzte der Fahrgast ihn an: „Weißt du überhaupt, wo das ist, Kerl?“
Das brachte ihn zurück in die Gegenwart.
Zeit, zu handeln.
Während er „Natürlich Sir, gleich geht’s los“, murmelte, zog er etwas aus seiner Jackentasche. Dann stieg er auf das Trittbrett und tat so, als würde er die Decke zurechtrücken wollen.
Bevor der Edelfettsack dagegen protestieren konnte, kniete er schon auf ihm, zog die Maske vom Gesicht und drückte ihm ein mit Chloroform getränktes Tuch auf Mund und Nase.
Da sein Fahrgast stark alkoholisiert war, dauerte es ein paar Sekunden, bis er sich zu wehren begann. Doch, anstatt die Luft anzuhalten, versuchte er zu schreien und atmete dadurch die Dämpfe erst richtig ein.
Der Widerstand dauerte nicht lange.
Sein Fahrgast war zwar größer und schwerer als er, aber mit mehr Fett als Muskeln. Ein letztes Grunzen und sein Körper erschlaffte. Vorsichtshalber hielt er das Tuch aber noch weiter auf das Gesicht, gedrückt, selbst als die Gegenwehr schon erlahmt war.
Erst als er das Gefühl hatte, dass es nicht gut war, noch länger vor dem Club zu stehen, zog er die Hand zurück.
Jetzt sah der Fahrgast aus, als ob er schlief.
Schnell zog er aus seiner Tasche unter dem Sitz eine kleine Flasche mit billigem Fusel. Den kippte er über den Fahrgast. Der Geruch des Alkohols übertünchte den des Chloroforms, was bei einer etwaigen Kontrolle hilfreich sein konnte.
Jetzt wurde es aber wirklich Zeit loszufahren, denn ein anderes Gespann war im Anmarsch. Gerade noch konnte er um die Ecke verschwinden, bevor das nächste Gefährt vor dem Club ankam.
Auch wenn der Drang nach dem, was er tun wollte, immer größer wurde, zwang er sich doch dazu, ruhig zu bleiben und das Pferd nicht anzutreiben.
Eile ist nicht nötig, Eile ist gefährlich. Man macht Fehler, wenn man seine Arbeit in Eile verrichtete.
So hatte er es von seinem Vater gelernt. Damals bezog sich das allerdings auf andere Tätigkeiten.
Der Fahrgast jedenfalls würde sicher noch eine Weile schlafen. Das Chloroform verflog zwar schnell an der frischen Luft, aber er hatte ziemlich viel davon eingeatmet. Sollte er am Ziel noch immer bewusstlos sein, würde er ihn eben wecken müssen.
Es gab Möglichkeiten, das Erwachen zu beschleunigen und bei dem was jetzt kam, sollte sein Fahrgast unbedingt wach sein.
Nach einer halben Stunde erreichten sie das Ziel, eins von mehreren alten Gebäuden, die vor einigen Jahren noch einer Druckerei gehört hatten. Jetzt wurde sie nur noch von Raten, Mäusen und Vögeln bewohnt und zeitweise von ihm.
Die Gegend war ideal für sein Vorhaben.
Es gab weit und breit keine Wohnhäuser, nur ein paar Bahngleise auf denen Güterzüge verkehrten. Das war auch nachts der Fall, was sich als günstig für ihn erwies.
Das Hansom Cab fuhr er in einen Schuppen, wo er von der Straße oder den Gleisen aus nicht gesehen werden konnte. Als erstes versorgte er das Pferd, dann stieg er eine Treppe hinab in den Keller.
„So, nun kannst du dich ausruhen, Kumpel“, raunte er dem Pferd zu. Erst für morgen war die Rückgabe vereinbart. Er hatte also noch genug Zeit, sich um seinen Gast zu kümmern.
Für den war schon in einem Kellerraum, im Haus nebenan, alles vorbereitet. Der Raum hatte dicke Wände, aber keine Fenster, war also bestens für sein Vorhaben geeignet. Jetzt musste er den Edelfettsack nur noch da runter bugsieren.
Es ging leichter, als er befürchtet hatte. Die Übungen der letzten Wochen mit schweren Säcken zahlte sich jetzt aus.
Endlich war alles fertig. Er trat einen Schritt zurück und ließ seinen Blick über die Szenerie gleiten.
So hatte er es sich immer wieder vorgestellt.
Zeit, den Gast aufzuwecken.
*
Das Erste, was der Mann wahrnahm, als er wach wurde, war die Kälte. Es war eiskalt!
Wieso war es so kalt?
War er nicht Zuhause in seinem Bett?
Wo war er?
Er musste nur nachdenken, dann fiel es ihm bestimmt wieder ein.
Aber das Denken fiel ihm so schwer.
Wieso?
Nur langsam kam die Erinnerung zurück. Stück für Stück fügten sich die Gedanken wie Puzzleteilchen zusammen.
Er war im Club gewesen, doch die Soiree war vorbei.
Er wollte nach Hause.
Die Kutsche kam nicht.
Da war eine andere Kutsche, nein ein Hansom Cab.
Er stöhnte.
Der Kutscher!
Etwas Feuchtes wurde ihm auf das Gesicht gelegt.
Ein Tuch, es roch süßlich.
Er bekam keine Luft mehr.
War er entführt worden?
Das kann nur ein Traum sein. Er musste aufwachen.
Er wollte schreien, doch mehr als ein weiteres Stöhnen brachte er nicht zustande.
Und endlich begriff er auch wieso. Ein Knebel verhinderte, dass er schreien oder sprechen konnte. Er war an einen Stuhl gefesselt und er war nackt.
Man hatte seinen Oberkörper an die Stuhllehne gebunden, jedes seiner Beine war an ein Stuhlbein fixiert und seine Hände waren hinter dem Rücken fest verschnürt.
Mit aller Kraft versuchte er, sich zu befreien, warf sich hin und her in der Hoffnung, dass der Stuhl vielleicht umfiel und zerbrach.
Er konnte nicht ahnen, dass der Stuhl mit Eisenwinkeln am Boden festgeschraubt worden war.
Nach und nach begann er seine Umgebung wahrzunehmen und blanke Panik erfasste ihn.
Der Raum, soweit er ihn einsehen konnte, war fensterlos und erinnerte ihn an einen Raum in seinem Haus. Zwei Ölfunzeln spendeten ein wenig Licht, doch er hätte gern darauf verzichtet, zu sehen, was ihn sonst noch umgab.
Ein Holztisch stand etwa zwei Meter von ihm entfernt und darauf waren einige Dinge aufgereiht, Dinge die ihm erschreckend bekannt vorkamen.
Er sah Ledergurte; Zangen; einen Eispickel; lange, dünne, spitze Nadeln; Messer und sogar ein Skalpell. Er gab ein grauenvolles Geräusch von sich. Es klang wie das Jaulen eines von Schmerz geplagten Tieres.
Oh Gott! Das war kein Traum!
Wieder versuchte er zu schreien, ohne Erfolg.
Plötzlich spürte er, wie sich zwei Hände auf sein Schultern legten. Jemand stand hinter ihm.
Eine Stimme flüsterte in sein Ohr.
„Bist du endlich wach, mein Lieber?“
Er erstarrte und die Stimme flüsterte weiter.
„Weißt du, wer ich bin?“
Hecktisch schüttelte er den Kopf.
„Ich bin dein schlimmster Albtraum,“ kam die Antwort.
Die Person ging langsam um den Stuhl und blieb vor ihm stehen.
Es war ein junger Mann, nicht sehr groß und schlank. Das schmale, bleiche Gesicht war ihm gänzlich unbekannt.
Der Mann sah mit seinen dunklen Augen auf ihn herab, breitete die Arme aus und rief:
„Willkommen in deiner ganz persönlichen Hölle!“
Als das Opfer wieder versuchte zu schreien, begann sein Peiniger zu kichern.
Erst ganz leise, doch dann immer lauter, bis es ein schrilles Lachen war.
Er wandte sich ab und ging zum Tisch.
Der Edelfettsack wimmerte leise. Plötzlich war so gar nichts mehr edel an ihm, nur noch fett.
Während der Mann die verschiedenen Dinge in die Hand nahm, so als würde er sie genauer betrachten wollen, redete er weiter.
„Ich weiß da ein paar wirklich böse Sachen von dir. Du schlägst gerne Frauen und wenn Sie am Boden liegen, weinen und darum betteln, dass du aufhörst, dann kommst du erst richtig in Fahrt. Was du dann mit ihnen anstellst, ist so pervers, dass einem bei der Vorstellung daran schon schlecht wird. Für dich ist der Spaß am Größten, wenn Sie nicht mehr schreien können, sondern nur noch winseln. Dir ist egal, dass sie krepieren. Wahrscheinlich glaubst du sogar, dass es eine Gnade für sie ist, wenn sie sterben, du gottverdammtes, krankes Arschloch.
Mit angsterfüllten Augen sah der Kerl ihn an und versuchte doch tatsächlich zu sprechen.
Warum nicht? Mal sehen was er so von sich gab.
Er lockerte den Knebel und zog ihn dem Opfer aus dem Mund. Sofort sprudelten die Worte aus ihm nur so heraus.
„Ich geb’s zu, ich bin ein schlechter Mensch. Aber ich werde es nie wieder tun, wirklich. Ich verspreche es. Ich kann mich bessern, aber bitte tun Sie mir nichts.
Ich schwöre bei Gott, ich werde ein besserer Mensch.“
Das war ja nicht mit anzuhören. Der Knebel wanderte zurück in den Mund.
Tränen rannen über das feiste Gesicht des Fettsacks und der Mann drehte sich angewidert von ihm weg.
Jetzt fängt der Fettsack auch noch an zu flennen.
„Du schwörst bei Gott? Das reicht mir nicht. Ich will, dass du deinen Schwur mit deinem Blut besiegelst?“
Heftiges Nicken war seine Reaktion.
Mit einem Schritt war der Mann wieder bei seinem Opfer. Mit großer Schnelligkeit fuhr seine Hand nach vorn und zog mit dem Skalpell einen Schnitt senkrecht und waagerecht über die Brust des Fettsacks. Der gab ein quiekendes Geräusch, wie ein angestochenes Ferkel, von sich.
„Was bist du nur für ein Jammerlappen, ich hab‘ deine Haut doch kaum angeritzt. Es blutet ja fast gar nicht. Glaubst du, dass es für den Schwur reicht?“
Diesmal war das Nicken kaum zu sehen.
„Ich weiß nicht. Ist auch egal. Deswegen bist du ja gar nicht hier.“
Der Fettsack hob den Kopf.
Was wollte der Mann von ihm? Warum war er dann hier?
Als hätte der Mann seine Gedanken gelesen, sagte er leise:
„Ich zeige dir, warum du wirklich hier bist.“
Er kam mit einem Tablett in der Hand auf ihn zu und hielt es so, dass er sehen konnte, was darauf lag.
„Erkennst du es wieder?“
Natürlich erkannte er es. Es war sein Rasiermesser, noch voll mit dem Blut aus der Soiree.
Der Mann nickte. „Ja, du erkennst es. Das ist dein Rasiermesser. Wie ich sehe, hast du es heute Nacht fleißig benutzt.“
Der Mann drehte es spielerisch hin und her.
„Das ist ein sehr interessanter Club, in welchem du Mitglied bist. Und nicht nur du, nicht wahr?“
Alle Hoffnung war dahin. Wenn der Mann von dem Club wusste, war er verloren.
„Ihr trefft euch heimlich für eure dreckigen Spiele, du und deine widerwärtigen Freunde. Ich weiß, was ihr da tut und ich werde es beenden.“
Wieder machte er eine Pause und ließ das Rasiermesser über die Brust des Fettsacks gleiten. Er hielt es dicht an eine seiner Brustwarzen. Der Fettsack geriet in Panik.
Plötzlich ließ der Mann von ihm ab und begann wieder zu reden:
„Also, ich sag‘ dir was. Wenn du mir die Namen der anderen Clubmitglieder nennst, lasse ich dich laufen. Wie findest du das?“
Der Fettsack sah ihn mit aufgerissenen Augen an.
Das war völlig unmöglich. Er hatte einen Schwur geleistet.
Wenn er den Club oder die Mitglieder verriet, würde er der Hauptakt der nächsten Soiree werden. Und er wusste nur zu gut, dass das ernst gemeint war.
Außerdem kannte er gar nicht alle Mitglieder. Er schnaufte und versuchte den Knebel auszuspucken.
„Willst du mir was sagen?“, fragte sein Peiniger, sah ihn abwartend an und lachte plötzlich.
„Oh entschuldige, mit dem Knebel kannst du ja gar nicht sprechen.“
Kaum war der Knebel aus seinem Mund, fing der Fettsack laut an zu schreien.
„Aaaaaah! HILFE! HILFE! Helft mir doch! Irgendjemand!“
Sein letzter Schrei war kaum noch zu hören. Sein Schluchzen übertönte es.
Der Mann hatte sich vorgebeugt und die Hände auf die Knie gestützt. Er hatte den Ausbruch seines Opfers amüsiert beobachtet.
„Hast du wirklich gedacht, ich würde dich irgendwohin bringen, wo man dich hören kann? Den Knebel hab‘ ich dir nur verpasst, damit ich dein Gejammer nicht die ganze Zeit anhören muss.“
Er richtete sich wieder auf.
„Also, ich muss deine Reaktion auf mein Angebot leider als ein Nein auffassen.
Vielleicht brauchst du etwas Zeit, um darüber nachzudenken? Vielleicht habe ich dich mit meiner Frage etwas überrumpelt, oder du bist noch nicht genügend motiviert?“ Er griff nach einem Gegenstand und kam zum Stuhl zurück.
„Ich denke, wir fangen mit etwas Einfacherem an.“
Er hielt ihm eine Zange vor das Gesicht.
„Möchtest du mir vielleicht erzählen, was man damit machen kann?“ Die einzige Reaktion war ein Grunzen.
„Nein? Auch gut. Ich weiß es auch so.“
Mit drei Schritten war er um den Stuhl herum und ohne ein Zögern trennte er seinem Opfer einen kleinen Finger ab.
Selbst der Knebel konnte den Schrei nicht mildern.
Mit einem erstaunten Blick kam der Mann wieder nach vorn.
„Was ist los? Ich dachte du magst Schmerzen? Aber wahrscheinlich nur, wenn du sie anderen zufügen kannst, hab‘ ich Recht?“
Er hielt ihm den Finger vors Gesicht. Der Fettsack heulte wie ein Wahnsinniger, rollte mit den Augen und fiel in Ohnmacht.
Ein Schwall kaltes Wasser brachte ihn schnell wieder zur Besinnung.
Jetzt zitterte er unkontrolliert und machte unter sich.
Der Mann sah angewidert auf sein Opfer herab.
Vielleicht war es besser, wenn er mit den Späßchen aufhörte. Nicht, dass der Fettsack ihm krepierte, bevor er ein paar Namen genannt hatte.
In der einen Hand die Zange und in der anderen das Rasiermesser, baute er sich vor dem Fettsack auf und zischte ihn an.
„Genug mit der Spielerei, entweder du redest oder ich mache weiter. Du kannst es dir aussuchen. Soll ich mit der Zange oder dem Rasiermesser deinen Schwanz bearbeiten.“
Instinktiv wollte der Fettsack die Beine zusammenkneifen, aber das ging natürlich nicht. Aber das war noch nicht alles. Jetzt erkannte er, dass der Stuhl keinen Sitz hatte und seine Geschlechtsteile ungeschützt nach unten hingen.
Der Fettsack heulte im wahrsten Sinne des Wortes Rotz und Wasser. Zange und Rasiermesser kamen ihm immer näher. Alles hin und her werfen half nichts. Als der Mann zum ersten Schnitt ansetzte, gab der Fettsack auf.
Scheiß auf den Schwur!
Scheiß auf den Club!
Er wollte nur, dass es aufhörte. Also nickte er heftig und versuchte zu sprechen.
Als ihm der Knebel erneut entfernt worden war, sprudelte der einzige Name, den er kannte, aus ihm heraus, immer und immer wieder.
Als es vorbei war, weinte er nur noch hemmungslos.
Sein Peiniger tätschelte ihm die Wange und wischte mit einem Tuch sein Gesicht ab.
„Na siehst du, war doch gar nicht so schlimm. Wenn du gleich geredet hättest, wäre das alles nicht nötig gewesen. Glaubst du, es macht mir Spaß, jemandem den Finger abzukneifen? Natürlich nicht! Aber du hast mich auch ganz schön wütend gemacht.“
Mit seiner Geste und den Worten strahlte der Mann beinahe etwas Mütterliches aus.
Hoffnung keimte in dem Fettsack auf.
Doch dann kippte seine Stimmung. Beide Hände in die Hüften gestemmt stand er vor ihm und sah vorwurfsvoll auf ihn herab.
„Allerdings muss ich dir sagen, dass ich enttäuscht bin. Ich soll mich mit nur einem Namen zufriedengeben?“
Der Fettsack begann zu jammern. „Ich weiß nur diesen Namen. Ich schwöre es.
Es wird alles geheim gehalten, keiner kennt die richtigen Namen der anderen.“ Das stimmte zwar nicht, denn er kannte noch zwei weitere Namen, den seines Befürworters und den vom Reverend. Seine Hoffnung war, wenn er die nicht preisgab, dann würde er mit einem blauen Auge davonkommen.
Ängstlich beobachtete er die Miene seines Peinigers.
Der dachte angestrengt nach. Das, was der Fettsack gesagt hatte, entsprach dem, was er wusste. Wenn der also nichts mehr wusste, waren sie fertig und er konnte es beenden.
„Also gut, ich glaube dir. Aber eine Sache musst du mir noch verraten, jetzt wo wir anfangen, uns so gut zu verstehen.“ Sein Lachen ließ dem Opfer das Blut in den Adern gefrieren. „Wann wollt ihr euch das nächste Mal treffen? Sag es mir und wir können das beenden.“
Resignierend fiel der Kopf des Opfers nach vorn und seine Antwort war kaum zu verstehen. Es war der Name eines Monats und eine Zahl.
Der Mann sah trotzdem nicht zufrieden aus. Bis dahin würden noch Monate vergehen. Eine lange Zeit, gut für die Vorbereitung, schlecht für seine Geduld.
Musste er eben abwarten.
Er sah auf das Häufchen Elend hinab und Ekel überkam ihn.
Worauf wartest du? Bring es endlich zu Ende.
Mit diesen Gedanken wandte er sich wieder seinem Opfer zu.
„Also, was soll ich denn jetzt mit dir anfangen? Nach alldem kann ich dich doch nicht einfach laufen lassen. Das musst du verstehen. Du würdest doch sofort zu deinen Kumpanen laufen und ihnen von mir erzählen. Ich bezweifele, dass sie mich dafür zu einem Ehrenmitglied machen werden.“ Die Hoffnung schwand dahin, was konnte er nur tun, damit der Mann ihn gehen ließ?
„Wenn Sie mich gehen lassen, werde ich keinem hiervon erzählen, das schwöre ich. Zu den anderen kann ich ja auch gar nicht gehen. Ich habe sie doch verraten und dafür würden die mich eiskalt umbringen. Bitte lassen Sie mich gehen, ich habe viel Geld. Ich gebe es ihnen, wenn Sie wollen. Noch heute werde ich aus der Stadt verschwinden. Niemand wird mich je wiedersehen. Ich werde Sie niemals verraten.“
Als der Mann hinter seinen Stuhl trat, war der Fettsack fast sicher, dass er ihm die Fesseln durchtrennen wollte. Dann hörte er wieder die Stimme an seinem Ohr.
„Natürlich wirst du das nicht, du perverser Feigling.“
Mit einer Hand beugte der Mann den Kopf des Fettsacks nach hinten und mit der anderen schnitt er dessen Kehle von Ohr zu Ohr auf.
Das Blut sprudelte aus der durchtrennten Halsschlagader und mit ihm der letzte Rest eines erbärmlichen Lebens.
Welche Ironie, dass der Fettsack durch sein eigenes Rasiermesser umgekommen war. Ein Rasiermesser, mit dem er sich nie selber rasiert hatte. Nie hätte er den Mut gehabt, das Werkzeug seiner abartigen Gelüste an sein Gesicht zu lassen.
Perverser Feigling!
Er war viel zu gut weggekommen, wie der Mann im Nachhinein fand. Ein Kreuz auf der Brust und ein Finger waren nichts im Verhältnis zu dem, was er anderen Menschen angetan hatte.
Die Wut stieg in ihm hoch. Er hatte es viel zu schnell beendet. Die Bestrafung war zu milde gewesen.
Wozu hatte er denn alles so perfekt vorbereitet? Da lagen die Instrumente, bereit, sie zu benutzen.
Aber er hatte es nicht getan. Und wieso? Darauf fand er keine Antwort.
*
Niemand beachtete die schlanke Gestalt, die vor Sonnenaufgang mit einem Sack auf einem Karren zum Fluss unterwegs war. Den Sack verfrachtete er in ein Ruderboot, den Karren ließ er bis zu seiner Rückkehr stehen.
Auch das Ruderboot, das auf den Hudson River hinausfuhr, wurde nicht weiter beachtet.
In der Strömung angelangt, hievte die Gestalt unter großer Anstrengung den Sack über den Bootsrand. Das Gewicht hätte das kleine Boot dabei fast zum Kentern gebracht. Dass der Sack so schwer war, lag nicht an dem Körper darin, sondern an den Steinen, die ein Wiederauftauchen des Sacks verhindern sollten.
Die Spuren der Nacht im Keller waren schon beseitigt worden, das hier war der letzte Akt.
Der Mann schaute noch eine Weile aufs Wasser.
Würde man den Fettsack vermissen? Eine Familie gab es nicht und er war nicht aus New York.
Nein, es gab keinen Grund zur Sorge.
Jetzt, wo er die Information hatte, konnte er in aller Ruhe den nächsten Schritt planen.
Kapitel 2
Freitag, 31. Mai 1912 - New York
Die gedämpften Geräusche, die aus der kleinen Bar direkt gegenüber dem Green-Wood Cemetery drangen, erreichten auch den Mann im Automobil auf der anderen Straßenseite, doch sie konnten ihn nicht locken.
Ihm stand der Sinn nicht nach Alkohol und Gesellschaft.
Der einzige Grund für sein Hiersein, war der irrigen Annahme entsprungen, es würde ihm den Abschied leichter machen.
Als könnte ein letzter Blick auf sein altes Leben etwas an dem Schmerz ändern, den er empfand, wenn er die traurigen Gesichter seiner Freunde sah.
Eine zierliche Hand schob sich behutsam auf seinen Arm und mit leiser Stimme raunte ihm die Frau zu: „Es wird Zeit Abschied zu nehmen, Mr. Knuckle. Man erwartet uns dringend in Chicago.“
Der Angesprochene sah immer noch durch die regennasse Scheibe des Marmons, ohne eine Miene zu verziehen. Doch der Klang seiner Stimme strafte die Teilnahmslosigkeit in seinem Blick Lügen.
„Es fühlt sich falsch an. Das haben sie nicht verdient.“
Ein leises Zischen verriet ihm, dass seine Begleiterin sich eine Zigarette angezündet hatte. Nach ein paar tiefen Zügen erwiderte sie endlich: „Wir haben doch darüber gesprochen, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine andere Möglichkeit gibt. Muss ich dich daran erinnern, dass du damit einverstanden warst?“
„Das wird nicht nötig sein, Marla“ und zum Fahrer gewandt, „fahren Sie schon los, Benson.“
Die Fahrt verlief ruhig.
An diesem nasskalten Freitag waren kaum Fußgänger unterwegs. Dafür waren die Straßen und Hochbahnen übervoll. Auch die Kutschen und Taxis machten gute Geschäfte.
Manhattan ließ sich nicht durch etwas Regen und Wind von seinen Geschäften abhalten.
Mr. Knuckle hatte für das alles keinen Blick. Er war tief in Gedanken versunken.
In den letzten Wochen hatte es nur wenig Gelegenheit für ihn gegeben, das Erlebte zu verarbeiten, was nicht bedeutete, dass er nicht ständig ins Grübeln kam.
Seine Grübelei führte ihn immer wieder zurück zu jenen Tagen, in denen sie auf den Jagd nach dem Mörder Corwin gewesen waren. Damals hatten die Ereignisse sich plötzlich überstürzt und nichts war so verlaufen, wie es geplant worden war.
Das erste Mal, dass er merkte, wie ihm die Sache aus den Händen glitt, war in der Nacht gewesen, als Arties Mutter, Mrs. Kingsley ermordet worden war.
Seine Gedanken kreisten immer wieder um diesen einen Punkt.
Hätte er den Mord verhindern können, wenn er zu Haus gewesen wäre? Doch so oft er auch darüber nachdachte, er kam immer zum selben Ergebnis.
Vielleicht wäre in dieser Nacht nichts passiert, aber dafür in der nächsten, oder es hätte Artie getroffen, oder Coulson, oder ihn selbst oder, oder, oder.
Er war es wirklich leid, darüber zu grübeln.
Wie auch immer, in jener Nacht, auf dem Weg in den Boxclub, war er in dieses Automobil gestiegen. Eine winzige Entscheidung, die sein Leben total auf den Kopf gestellt hatte.
*
Damals endete die Fahrt im Bürohaus eines kleinen Verlages, von dem er bisher noch nie gehört hatte.
Er war in ein Büro geführt worden, wo er von einem Mann erwartet worden war.
Knox sah alles wieder vor sich.
In der spärlichen Beleuchtung konnte er nicht viel von seinem Gastgeber erkennen.
Er saß hinter einem großen Schreibtisch und blätterte in einem Buch.
Ohne aufzusehen sagte er fast beiläufig: „Guten Abend Mr. Knox. Bitte treten Sie doch näher und nehmen Sie Platz.“
Knox blieb stehen.
Was sollte das hier werden? Warum war er hier?
Es war, als hätte der Mann seine Gedanken gelesen.
„Sie fragen sich sicher, warum man Sie hierhergebracht hat. Nun, wir möchten, dass Sie in Zukunft für uns arbeiten.“
Das Gesicht des Mannes zeigte keinerlei Regung. Knox kannte solche Typen noch aus der Zeit bei Pinkerton. Taten ungeheuer geheimnisvoll und redeten stets um den heißen Brei. Geheimdienstler!
Na, die hatten ihm gerade noch gefehlt.
„Und wer sind Sie?“ war seine Erwiderung, die er ebenso gleichgültig wie sein Gegenüber vorbrachte.
„Oh, tut mir leid. Ich sollte mich zunächst einmal vorstellen. Mein Name ist Smith.“
„Na sicher.“
Wollte der ihn auf den Arm nehmen?
„Ich wollte eigentlich wissen, wen Sie mit WIR gemeint haben.“
„Wir sind die Leute, die Ihre besonderen Fähigkeiten erkannt haben.“
„Sie haben mich beobachtet?“
„Sagen wir lieber, wir haben ein Auge auf Sie gehabt und ein paar Erkundigungen eingezogen.“
„Na, dann müssten Sie doch wissen, dass ich noch nie den Wunsch hatte, für den Geheimdienst zu arbeiten.“
Zugegeben, es war ein Schuss ins Blaue gewesen, aber diese Art von Versteckspiel lag ihm nun mal nicht.
Der Mann lächelte nur müde und entgegnete: „Ich versichere Ihnen, wir haben nicht das Geringste mit dem Geheimdienst zu tun“ und nach einem kurzen Zögern fügte er hinzu, „vielmehr ist Ihre Abneigung gegenüber diesen Leuten der Grund dafür, weshalb wir uns so für Sie interessieren.“
„Tja, danke für das Kompliment, aber wenn Sie sich über mich erkundigt haben, dann wissen Sie doch auch, dass ich zurzeit einen Fall bearbeite und bevor ich den nicht erfolgreich abgeschlossen habe, nehme ich keinen neuen Auftrag an.“
Mr. Smith war langsam hinter dem Schreibtisch hervorgekommen und in den Lichtkreis der einzigen Lampe getreten. Dadurch war Knox in der Lage, sein Gegenüber genauer zu betrachten.
Der Mann sah älter aus, als Knox nach dem Klang seiner Stimme vermutet hätte.
Durchschnittliche Größe, normale Figur, fester Gang, gepflegtes Äußeres. In seiner Aussprache konnte Knox keinerlei Akzent erkennen. Auf den ersten Blick wirkte der Mann absolut durchschnittlich, fast ein bisschen langweilig. Doch Knox ließ sich davon nicht täuschen. Hinter dieser Fassade steckte ein sehr wacher Geist, da war er sich sicher. Mr. Smith war gewiss alles andere als durchschnittlich.
Knox kleine Ansprache war sehr aufmerksam verfolgt worden. Die ganze Zeit über hatte der Blick von Mr. Smith auf ihm geruht und ihn förmlich durchdrungen. Nicht, dass es ihm was ausmachte, gemustert zu werden. Er konnte diesem Blick mühelos standhalten.
Mit dem Hauch eines Schmunzelns wurde das Blickduell schließlich von Smith beendet und das Gespräch ging weiter.
„Natürlich, der Auftrag des Bürgermeisters. Wir sind darüber im Bilde.
Allerdings sieht es im Moment so aus, als hätten Sie und Ihre kleine Ermittlertruppe bisher nichts erreicht. Und korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, aber ist der Auftrag nicht zurückgezogen worden.“
Knox hatte eigentlich nicht vorgehabt, sich vor diesem Mann zu rechtfertigen.
Trotzdem, diese abwertende Bemerkung hatte spürbar an seiner Ehre gekratzt.
„Sie haben Recht. Von offizieller Seite wurde die Ermittlung beendet, nachdem klar war, dass es nicht um politisch motivierte Morde ging. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Mörder immer noch frei herumläuft. Wir haben immerhin herausgefunden, dass er schon seit Jahren seinem tödlichen Geschäft nachgeht, ohne dass die Polizei etwas bemerkt hat. Man kann also NICHT sagen, dass wir NICHTS erreicht haben.“
Mr. Smith, der ohne eine erkennbare Reaktion zugehört hatte, hob daraufhin die Hände.
„Ich wollte nicht den Eindruck vermitteln, dass ich ihre Fähigkeiten in Zweifel ziehe. Ganz im Gegenteil. Was Sie, mit den bescheidenen Mitteln und Möglichkeiten einer inoffiziellen Ermittlung, herausgefunden haben, ist bemerkenswert. Würde ich anders darüber denken, wären Sie nicht hier.“
„Entschuldigung angenommen. Trotzdem werde ich Ihr Angebot nicht annehmen können. Ganz davon abgesehen, dass ich hinter einem Mörder her bin und dies meine ganze Zeit in Anspruch nimmt, arbeite ich nicht für jemanden, von dem ich nichts weiß als einen Namen, der nicht mal der richtige Name ist.“
Smith hob bedauernd die Schultern.
„Ich verstehe. Nun bedauerlicherweise würde mein richtiger Name Ihnen auch nicht weiterhelfen.“
Knox hatte sich ein verächtliches Schnauben nicht verkneifen können. Doch bevor er etwas sagen konnte, ergriff Smith noch einmal das Wort.
„Ich vermute, es würde nichts ändern, wenn ich Ihnen versichere, dass wir eine Gruppe von Leuten sind, denen unser Land sehr am Herzen liegt und die einen beträchtlichen Aufwand zum Schutz der Interessen dieses Landes betreiben.“
Ein leichtes Kopfschütteln war seine Antwort.
Smith nickte und schwieg. Das gab Knox das Gefühl, dass ihr Gespräch beendet war. Er hatte die Klinke schon in die Hand genommen, als Smith‘ Stimme ihn zurückhielt.
„Sie haben gar nicht gefragt, was wir von Ihnen wollen?“
Daran hatte Knox wirklich nicht gedacht. Obwohl es eigentlich keine Rolle mehr spielte, wollte er eine Antwort nicht schuldig bleiben.
„Mr. Smith, da Sie nicht bereit waren, mir zu sagen, wer Sie und Ihre Freunde wirklich sind, wäre Ihre Antwort auf diese Frage sicher auch nichtssagend ausgefallen. Na, wenigstens haben Sie nicht versucht, mich mit ein paar Lügen abzuspeisen.“
„Ich sagte ja bereits, dass wir nichts mit dem Geheimdienst zu tun haben.“
„Schon möglich, aber würde der Geheimdienst nicht genau das behaupten?“
Mit einem tiefen Seufzer antwortete Smith.
„Da könnten Sie Recht haben, Mr. Knox. Vielleicht ändern Sie ja eines Tages noch Ihre Meinung, was unser Angebot betrifft. Was halten Sie davon: Sie fangen Ihren Mörder und wir werden unser Angebot bis dahin aufrechterhalten?
Vielleicht können wir Ihnen ja mit der einen oder anderen Information bei Ihrer Suche helfen?“
Knox war wie von einer Tarantel gestochen herumgefahren und bedrohlich auf Smith zugegangen.
„Soll das heißen, Sie wissen wer der Mörder ist?“
Smith hatte keine Miene verzogen und war erstaunlich ruhig geblieben.
„Nein. Mit solchen Dingen befassen wir uns nicht. Das überlassen wir der Polizei. Was ich damit sagen wollte, ist, dass wir über einige Kontakte verfügen, die Ihnen vielleicht nützlich sein könnten. Ich glaube zum gegenwärtigen Zeitpunkt können Sie jede Hilfe gebrauchen.“
„Natürlich würde ich Ihnen dafür einen Gefallen schulden, was darauf hinauslaufen würde, dass ich doch für Sie arbeite. Das hatten Sie wohl vergessen zu erwähnen.“
Smith war wieder hinter seinem Schreibtisch hervorgekommen und dicht vor Knox stehengeblieben.
Auch wenn Smith dadurch gezwungen war, zu Knox empor zu blicken, hatte Knox nicht das Gefühl, im Vorteil zu sein.
„Alles was ich von Ihnen erwarte, ist, dass Sie es sich überlegen. Treffen Sie heute noch keine Entscheidung. Ich versichere Ihnen, egal wie Sie sich letztendlich entscheiden, ich werde es akzeptieren.“
Er hatte Knox die Hand gereicht und der hatte eingeschlagen.
„Ich muss Sie noch um einen letzten Gefallen bitten, Mr. Knox.“
Knox grinste in sich hinein. Da er wusste, was nun kommen würde, sprach er es noch vor Smith aus.
„Sie wollen, dass ich mit niemandem über unser kleines Treffen rede, denn dieses Gespräch hat nie stattgefunden!“
Ein Lächeln war über Smith‘ Gesicht gehuscht, verbunden mit einem Nicken.
„Ein Wagen wird Sie zurückbringen. Gute Nacht, Mr. Knox.“
Vor der Tür wartete dann jemand, mit dem Knox nicht gerechnet hatte.
„Benson? Ich dachte Sie arbeiten für den Bürgermeister? Was machen Sie denn hier?“
Benson stieß sich von der Wand ab und setzte sich, ohne zu antworten, in Richtung Ausgang in Bewegung.
„Also wirklich, erst werde ich vor dem Boxclub von zwei Kleiderschränken abgefangen. Die überreden mich freundlich, aber bestimmt, in ein Automobil zu steigen, das mich nicht, wie gehofft, zu einer atemberaubend schönen Frau bringt, sondern zu einem Mann, der ein merkwürdiges Angebot für mich hat.
Und jetzt Sie?“
„Haben Sie es angenommen?“
„Nein.“
„Ich hab‘ ihm gleich gesagt, dass es dafür noch zu früh ist.“
„Wem?“
„Netter Versuch, Knox.“
„Einen Versuch war’s wert. Für wen arbeiten Sie denn nun wirklich?“
Benson war stehen geblieben und hatte mit einem verschmitzten Blick geantwortet.
„Ich könnt ’s Ihnen ja sagen, aber dann müsste ich Sie töten.“
„Was ist das denn für ein blöder Spruch?“
„Ach kommen Sie, Knox, der ist doch witzig“, erwiderte Benson mit todernster Miene.
„Wenn Sie’s sagen. Wenigstens hab‘ ich jetzt den Beweis dafür, dass Sie nicht beim Geheimdienst sind.“
„Ach ja und wieso?“
„Ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass die keinen Humor haben.“
Benson lachte zwar nicht, aber für einen augenblich schummelten sich ein paar Lachfältchen auf sein Gesicht.
Knox konnte sich an jedes Detail dieses Treffens noch genau erinnern und auch an das, was dann geschehen war.
Er hatte sich zwar am Boxclub absetzen lassen, war aber nicht hineingegangen.
Stattdessen war er den Rest der Nacht ziellos herumgelaufen, um nachdenken zu können.
Zu dieser Zeit war Olivia Kingsley schon tot gewesen.
Doch das hatte Knox nicht geahnt, genauso wenig, wie er eine Ahnung hatte, was da gerade passiert gewesen war. Aber er war ins Grübeln gekommen.
Wenn Benson damit zu tun hatte, dann gehörte Beetroot vielleicht auch dazu?
Der hatte ja von Anfang an ziemlich geheimnisvoll getan. Kam der Auftrag des Bürgermeisters überhaupt von ihm selbst oder steckte Smith dahinter? Wer war der Kerl und wer stand hinter ihm? Knox hatte schon viel über den Geheimdienst gehört, Wahrheiten, Lügen oder Gerüchte. Nie konnte man mit Sicherheit sagen, welche Information wozu gehörte. Ob die Typen das eigentlich selber wussten?
Knox bezweifelte es fast.
Nach drei Stunden hatte er das Grübeln aufgegeben und akzeptiert, dass er auf diese Weise keine Antworten auf seine Fragen finden würde.
Ungefähr um diese Zeit hatte Artie seine ermordete Mutter gefunden.
*
Eine sanfte Berührung holte Knox aus seinen Gedanken zurück in die Realität.
Es war Marla.
„Wir sind da. Komm, sonst verpassen wir noch die Abfahrt.“
Als sie ausstiegen, realisierte Knox wo sie waren, an der Penn Station.
Natürlich, der Zug nach Chicago.
Marla trug mit ihrer eleganten Erscheinung dazu bei, dass niemand auf ihn achtete. Aus diesem Grund ging sie ein paar Schritte vor ihm und lenkte alle Blicke auf sich.
Ihren Gang konnte man durchaus als lasziv bezeichnen. Selbst wenn sie den Blick auf einen ihrer Bewunderer lenkte, schien sie nur durch ihn hindurch zu sehen. Sie trug ein zimtfarbenes Kostüm, das ihre schlanke, wohlgeformte Figur so richtig zur Geltung brachte. Der lange Rock lag eng an den Hüften an und ging nach unten in eine weit fließende Form über. Darüber trug sie eine kurze, taillierte Jacke, deren große Ärmelaufschläge und der tiefreichende Kragen aufwendig bestickt waren. Im Ausschnitt und den Ärmeln sah man cremefarbene Rüschen hervorblitzen. Dazu passte der voluminöse Hut mit breiter Krempe und einer riesigen Schleife in der Farbe des Kostüms.
Kurz vor dem Eingang zum Bahnhof blieb Marla stehen und drehte sich zu Knox und Benson um. So hatte jeder Mann in der Nähe noch einmal die Gelegenheit, sie zu betrachten, was auch ausgiebig getan wurde.
Keinem außer Knox fiel auf, dass Marla es genau darauf angelegt hatte.
Mit ihrem Flanierschirm zeigte sie in Richtung Benson und rief mit ärgerlicher Stimme: „Nehmen Sie doch in Gottes Namen einen Träger, wenn sie die paar Koffer nicht allein bewältigen können. Ihretwegen verpassen wir noch unseren Zug.“
Was für eine Inszenierung!
Niemand achtete auf ihm, den Mann an ihrer Seite, der nun als erster die Halle betrat.
Kein Wunder, Knox war auffallend unauffällig gekleidet, mit brauner Hose, grauem Jackett und einem Strohhut, wie Männer ihn zu hunderten vor und im Bahnhof trugen. Dazu hielt Knox den Blick gesenkt und war bemüht, jeglichen Augenkontakt zu vermeiden.
Auch wenn New York eine große Stadt war, konnte man zu keiner Zeit eine zufällige Begegnung mit einem Freund oder Bekannten ausschließen. Und das könnte, jetzt wo Knox offiziell tot war, äußerst fatale Auswirkungen haben.
Sie verpassten den Zug natürlich nicht und nachdem Marla auf dem Bahnsteig nochmals alle Register gezogen hatte, war Knox auch hier ziemlich unbemerkt in den Zug gelangt.
Der Zugschaffner hatte den Tickets weitaus weniger Aufmerksamkeit gewidmet, als der reizenden Lady, die sie ihm graziös entgegenhielt.
Benson hatte die Koffer noch in ihr Abteil getragen und sich dann wortlos verabschiedet.
Schon wenig später waren Mr. Jefferson D. Knuckle und seine reizende Begleiterin unterwegs.
*
Sonnabend, 01. Juni 1912 - Chicago
In Chicago wartete schon ein Wagen mit Chauffeur vor dem Bahnhof.
Die Fahrt ging allerdings nicht, wie Knox erwartet hatte, zu einem Treffen mit Mr. Smith, sondern in sein neues Zuhause, einer alten, zweistöckigen Villa.
Sie stand in einer beschaulichen Gegend, in der Hickory Street im Nordosten von Chicago.
Verborgen hinter einem dichten Bewuchs aus Büschen und Bäumen war das Haus von der Straße aus kaum zu sehen. Ein großer schmiedeeiserner Zaum umgab das Grundstück, dessen wahres Ausmaß sich Knox von vorn noch nicht erschloss.
Der Zaun erstreckte sich zu beiden Seiten des Tores auf eine geschätzte Länge von mehr als dreihundert Metern. Das ließ zumindest auf eine beträchtliche Größe schließen.
Das Tor zur Einfahrt stand weit offen, so als würden sie schon erwartet werden.
Als der Wagen auf das Grundstück fuhr, sah Knox eine Gestalt von der Seite kommen, männlich und etwa so groß wie Knox. Gekleidet war er wie ein Gärtner. Die viel zu große Kleidung konnte nicht über seine kräftige Statur hinwegtäuschen. Der breitkrempige Hut dagegen verbarg das Gesicht des Mannes so gut, dass Knox sein Alter nicht mal erahnen konnte. Nachdem er das Tor geschlossen hatte, verschwand er sofort wieder zwischen den Bäumen.
Der Wagen nahm eine leichte Rechtskurve, umrundete dabei einen Teich und hielt schließlich vor dem Haus.
Jetzt konnte Knox endlich einen Blick darauf werfen, während Marla das Ausladen des Gepäcks überwachte.
Zu seinen besten Zeiten mochte das Haus seine Besucher sicher sehr beeindruckt haben, doch das war lange her. Jetzt machte es einen etwas heruntergekommenen Eindruck.
Der ehemals weiße Anstrich war längst verblichen und blätterte an vielen Stellen ab. Von den kunstvoll gearbeiteten Fensterläden waren nur noch wenige intakt.
Das Haus hatte zwei Etagen und an der Vorderseite an beiden Ecken Erker, die bis in die zweite Etage reichten. Aus dem Dachgeschoss ragte eine kleine Gaube hervor, deren Fensterscheibe kaputt war.
Knox war sicher, dass der Dachboden von zahlreichen tierischen Untermietern bevölkert wurde. Der Rest des Hauses dagegen schien weniger bewohnt zu sein.
Doch das war ein Irrtum, denn kaum war das Gepäck ausgeladen, öffnete sich die Tür und ein Mann erschien. Seine Kleidung sah nicht aus, wie die eines Butlers oder Hausburschen und er benahm sich auch nicht wie einer.
Vielleicht der Hausherr?
Er trug einen braunen Anzug und ein weißes Hemd und begrüßte Marla mit einem freundlichen Nicken.
„Miss Marla, herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns wieder einmal besuchen.“ Dann wandte er sich an Knox.
„Willkommen in der Hickory Street 13, Mr. Knox. Ich bin Gregory Barnett, Ihr Gastgeber. Wenn Sie etwas brauchen, wenden Sie sich an mich und ich kümmere mich darum.“
Marla lachte und umarmte Barnett herzlich. Ein weiterer Punkt, der gegen den Butler sprach.
Nun trat ein junges Mädchen aus der Tür und wieder kam Knox ins Rätseln über ihre Stellung hier im Haus. War sie die Tochter des Hauses oder doch ein Dienstmädchen? Ihre Kleidung, ein blaues Kattunkleid, deutete eher auf Ersteres hin. Die weiße Schürze konnte auch als Schutz gedacht sein, um das Kleid nicht zu beschmutzen. Sie war höchstens zwanzig Jahre, also viel jünger als Barnett, den Knox inzwischen auf Anfang fünfzig schätzte. Das Mädchen lächelte scheu, als Marla sie begrüßte.
„Beth, wie schön dich wiederzusehen. Darf ich euch bekanntmachen? Beth, das ist Mr. Knox. Knox, das ist meine Freundin Beth.“ Bei der Bezeichnung Freundin errötete Beth und das brachte Marla zum Lachen.
„Ach komm Beth, wir kennen uns schon so lange und haben schon so viel erlebt, da darf ich dich doch Freundin nennen“ und zu Knox gewandt, „Ich denke hier im Haus können wir bei deinem richtigen Namen bleiben.“
Sie sah Barnett an und meinte: „Ansonsten ist er natürlich Mr. Knuckle.“
Als wäre damit alles gesagt, klatschte Marla in die Hände und rief:
„Jetzt lasst uns endlich ins Haus gehen. Ich will raus aus diesen Klamotten und ein Bad nehmen. Beth, hilfst du mir beim Auspacken? Barnett, bitte sein Sie so freundlich und führen Sie Knox ein bisschen herum. Denken Sie daran, ihn Leon vorzustellen, Sie wissen ja wie er ist.“
Mit diesen Worten verschwand sie im Haus, dicht gefolgt von Beth.
Seine Koffer selber tragend, folgte Knox Barnett in eine große Eingangshalle.
Mehrere Türen säumten die Halle zur Seite und nach hinten. Da alle geschlossen waren, konnte Knox nur mutmaßen, was sich dahinter befand. Über eine breite Treppe in der Mitte der Halle gelangte man in die obere Etage.
Das Haus erwies sich als groß genug, um eine Gesellschaft von sechs bis acht Leuten zu beherbergen. Etwa so viele Zimmer zählte Knox in der oberen Etage.
Marla und er bezogen jeder ein großes Zimmer mit eigenem Bad auf der Rückseite des Hauses. Die restlichen Zimmer befanden sich an den Seiten des Hauses.
„Das sind ja reichlich Zimmer. Sieht aus, als hätten Sie oft Gäste“, versuchte Knox mit Barnett ins Gespräch zu kommen, als der ihn in sein Zimmer begleitete. Eine Antwort bekam er nicht.
Während Knox die Koffer abstellte, öffnete Barnett die Tür zum Bad und zog die Vorhänge an den Fenstern zurück.
Im Rausgehen wandte es sich an Knox mit der Bemerkung:
„Wenn Sie so weit sind, führe ich Sie gern herum. Sie finden mich unten im Salon.“
Damit ließ Barnett seinen Gast allein.
Eine halbe Stunde später schritt Knox die Treppe wieder herab und sah sich um.
Eine geöffnete Tür sollte ihm wohl den Weg weisen und Knox nahm die Einladung an.