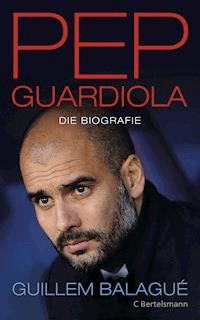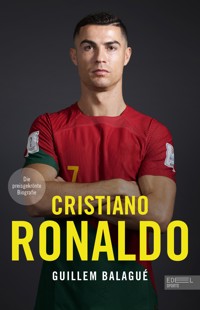19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Diego Armando Maradona wird bis heute überall auf der Welt als Genie gefeiert. Er war einer der größten, vielleicht sogar der größte Fußballer aller Zeiten und elektrisierte wie kein Zweiter die gesamte Fußballwelt. Legendär seine Spielintelligenz, die unfassbare Ballkontrolle unter höchstem Druck und seine atemberaubenden Dribblings. Unvergessen sein Jahrhundert-Tor und sein irregulärer Treffer mit der "Hand Gottes" gegen England im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 1986. Permanent und unerbittlich von den Medien verfolgt, war Maradona aber auch einer, der heftigst kritisiert und angefeindet wurde. Sein Leben war immer wieder überschattet von Geschichten über private Affären, Drogenmissbrauch und Gesundheitsprobleme. Die Biografie des Bestseller-Autors Guillem Balagués basiert auf ausführlichen Interviews mit Weggefährten und zahlreichen Erzählungen aus erster Hand. Er liefert eine brillante Annäherung mit hochspannenden psychologischen und soziologischen Aspekten an ein Leben im permanenten Rampenlicht, das im November 2020 auf tragische Weise endete.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Teil IEl Pelusa
Kapitel 1Der Vater – Don Diego
Kapitel 2Die Mutter – Doña Tota
Kapitel 3Goyo Carrizo, ein Freund, der heute noch in Villa Fiorito lebt
Kapitel 4Francis Cornejo und die Cebollitas
Kapitel 5Debüt in der ersten Liga
Teil IIDiego
Kapitel 6Stärkster Spieler bei Argentinos Juniors
Kapitel 7Treffen mit Pelé
Kapitel 8Die Junioren-Weltmeisterschaft 1979
Kapitel 9Jorge Cyterszpiler
Kapitel 10Wechsel zu Boca Juniors
Teil IIIMaradona
Kapitel 11Die Zeit bei Boca Juniors
Kapitel 12Die WM in Spanien 1982
Kapitel 13FC Barcelona: Die Mannschaftskameraden und die Medien
Kapitel 14Seine Freunde in Barcelona – der »Clan«
Kapitel 15Claudia Villafañe
Kapitel 16César Luis Menotti und Andoni Goikoetxea
Kapitel 17Adiós Barcelona, ciao Napoli!
Kapitel 18Corrado Ferlaino und das Stadio San Paolo
Kapitel 19Von Cyterszpiler zu Cóppola
Kapitel 20Guillermo Cóppola
Kapitel 21Carlos Salvador Bilardo
Kapitel 22Die WM 86 in Mexiko – Aberglaube und Rituale
Kapitel 23England – Argentinien: Erste Halbzeit
Kapitel 24England – Argentinien: Zweite Halbzeit
Kapitel 25England – Argentinien: Nachspiel
Kapitel 26Das Halbfinale gegen Belgien und das Finale gegen die BRD
Teil IVDiego Armando Maradona
Kapitel 27Cristiana Sinagra und der erste Scudetto
Kapitel 28Maradona und Neapel
Kapitel 29Vom zweiten Scudetto zur WM 1990
Kapitel 30WM 1990 in Italien
Kapitel 31Das Ende bei Napoli
Kapitel 32FC Sevilla
Kapitel 33Newell’s Old Boys und der Weg zur WM 1994 in den USA
Kapitel 34Der Dopingfall der WM 1994
Kapitel 35Auf dem Weg nach unten: Ein Wiedersehen mit den Boca Juniors
Kapitel 36Auf dem Weg zur Gottwerdung
Epilog
Dramatis Personae
Danksagung
Prolog
Francis Cornejo, Trainer der Cebollitas (Zwiebelchen),der Nachwuchsmannschaft der Argentinos Juniors, fuhr mit nach Villa Fiorito, um sich das Alter des Jungen bestätigen zu lassen. Goyo Carrizo hatte einen Freund zu einem Testspiel in den Parque Saavedra mitgebracht. Als der Trainer Diego Maradona spielen sah, dachte er: Er ist so klein, er kann unmöglich schon acht sein.
Fiorito ist ein Elendsviertel am Stadtrand von Buenos Aires, das im Zusammenhang mit Schlägereien, Schießereien und Mordfällen regelmäßig in Polizeiberichten auftauchte. Mehrere seiner Schützlinge lebten dort.
In José Trottas orangerotem Pick-up, einem argentinischen Rastrojero, lieferten sie zunächst ein paar Jungs zu Hause ab und fuhren dann weiter nach Fiorito. Trotta wusste ungefähr, wie er dorthin gelangte, die Straße, in der Diego wohnte, kannte er indes nicht. Diego – El Pelusa – musste ihm den Weg zeigen.
Sie überquerten Bahnschienen, kamen an mehreren Brunnen vorbei und fuhren schließlich auf hauptsächlich von Pferdekarren genutzten Sandpisten entlang eines Abwasserrinnsals, das unter verrottenden Müllbergen kaum zu erkennen war. »Da ist es«, sagte Diego endlich. Cornejo stieg aus, ging über die Straße und klopfte an die Tür. Diegos Mutter, Doña Tota, öffnete, eine ihrer Töchter stand hinter ihr. Die beiden schauten Cornejo fragend an. »Wir stellen ein neues Team bei den Argentinos Juniors zusammen«, erklärte er, »und brauchen eine Bestätigung des Alters Ihres Sohnes …« Inzwischen hatten sich ein paar andere Jungs um Cornejo geschart.
»Treten Sie ein«, entgegnete Doña Tota freundlich. Dann suchte sie die vom Evita-Hospital ausgestellte Geburtsurkunde Diegos. Sie besagte, dass er am 30. Oktober 1960 zur Welt gekommen war. Der Junge war also tatsächlich schon acht Jahre alt.
Francis hatte einen Rohdiamanten entdeckt, den er zum Glänzen bringen konnte. Und Diego glänzte nicht nur, er strahlte förmlich. Mit seiner Hilfe blieben die Cebollitas ab März 1969 für 136 Spiele in Folge ungeschlagen.
In seinem Buch Cebollita Maradona – in dem er die Geschichte seiner Beziehung zu dem Jungen mit dem dichten Haarschopf, dem runden Gesicht und den schnellen Beinen erzählt, dem »Zwiebelchen«, das kleiner war als alle anderen – erinnert sich Cornejo an viele besondere Momente. »Er bekam den Ball rechts vom Sechzehner auf den linken Fuß, lupfte ihn kurz an und drang – den Zuschauern blieb die Spucke weg – mit dem Ball am Kopf in einem irrwitzigen Tempo in den Strafraum ein. In Höhe des Tores stoppte er, ließ den Ball auf den linken Fuß tropfen und donnerte ihn nach kurzer Drehung gegen den rechten Pfosten. Der Torwart klebte regungslos, wie hypnotisiert, auf der Linie. Der Ball prallte vom Pfosten zurück aufs Feld, Polvorita Delgado reagierte als Erster und drosch ihn in die Maschen. Es war der Wahnsinn!« Das ganze Stadion jubelte, auch die Fans der gegnerischen Mannschaft.
Eines Tages, während eines Trainings im Parque Saavedra, schenkte ein alter Mann, der sein bocce-Spiel unterbrochen hatte, um beim Training zuzusehen, Diego ein Fahrrad. »Aber nein, vielen Dank, Señor, das kann ich nicht annehmen«, sagte Diego. »Nimm es, mein Sohn, es ist deins. Ich möchte, dass es dir gehört. Du bist ein wahrer Teufelsdribbler. Denk an mich, wenn du in der Nationalmannschaft spielst.« Und da der Trainer zustimmend nickte, nahm Diego das Geschenk an. Noch Jahre später, als er international bekannt war, erinnerte er sich an den Mann mit dem Fahrrad. Mit 15 gab das Zwiebelchen sein Debüt in der ersten Mannschaft der Argentinos Juniors und wurde im Handumdrehen der Liebling der Fans. Derweil half der Verein der Familie aus dem Slum von Fiorito heraus und mietete eine Wohnung in Villa del Parque, ganz in der Nähe des Trainingsgeländes, für sie an, in der Hausnummer 2750. In Nummer 2046 lebte ein Mädchen namens Claudia. Sie trug eine gelbe Hose, und Diego verliebte sich schlagartig in sie. Claudia wusste nicht, wer er war. Maradona erzählte die Geschichte später allerdings etwas anders.
Don Diego und Doña Tota verdienten nicht genug Geld für die Miete, immer wieder drohte die Zwangsräumung. Wieder kam der Verein zu Hilfe und finanzierte Diego sein erstes Haus, da war er 18. Es handelte sich um ein schlichtes zweigeschossiges Gebäude mit Innenhof in La Paternal, einem Wohnviertel drei Blocks entfernt vom Argentinos-Stadion. Maradona wohnte dort mit seinen Eltern und Geschwistern, Schwager und Schwägerinnen. Er verfügte über ein eigenes Zimmer, die Toilette befand sich allerdings ein Stockwerk höher auf der nächsten Etage, auf derselben Ebene wie die Dachterrasse.
Mit 19, lange bevor er zu dem »schmutzigen Gott und Sünder« wurde, als den der Journalist Eduardo Galeano ihn drei Jahrzehnte später bezeichnete, gewann Maradona mit der argentinischen U20-Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft in Japan. Der Rastrojero-Pick-up war inzwischen Geschichte. Maradona war jetzt ein Autofreak, der seine Fahrzeuge als Visitenkarte betrachtete. (Als seine Fans El Pelusa für die Freude danken wollten, die er ihnen bereitete, sammelten sie Geld, um ihm, was sonst, ein Auto zu schenken, einen roten Mercedes 500 SLC mit stolzen 237 PS.)
Nach und nach konnte Diego von seinem Gehalt etwas zur Seite legen. Zu Weihnachten beschenkte er sich mit einem Fiat Europa 128 CLS, einem Wagen wie eine Kinderzeichnung: quadratisch, praktisch, gut. Heute befindet sich das Fahrzeug im Besitz eines Sammlers aus der Nähe von Buenos Aires, der alle Angebote italienischer Museen, die das gute Stück ausstellen wollen, ausschlägt.
Da ein echter Star, der Maradona schon mit 20 war, nicht allen Ernstes in einem Fiat 128 durch die Gegend gurken kann, legte er sich bald seinen ersten Sportwagen zu, einen dunkelgrauen Porsche 924 mit braunen Ledersitzen, direkt aus Deutschland importiert. Von diesem Schmuckstück trennte er sich, als er die Boca Juniors verließ, um nach Barcelona zu gehen. 30 Jahre später, als er als Chef der argentinischen Nationalmannschaft bei der WM in Südafrika antrat, wurde der Wagen für eine halbe Million Dollar angeboten. Zwei Jahre darauf war der Preis dann wieder drastisch gefallen – ebenso wie der Marktwert des Trainers: der Maradona-Porsche kostete jetzt nur mehr 77 500 Dollar.
Beim FC Barcelona wurde Maradona vertraglich unter anderem ein roter VW Golf zur Verfügung gestellt. In diesem Wagen fuhr der Fußballstar an einem Nachmittag im Jahr 1983 zum Training am Camp Nou. Der Eingang zum Trainingsbereich war allerdings verschlossen. »Sieh an, Diego! Da heißt es doch, nur der frühe Vogel fängt den Wurm, und jetzt kommst du zum ersten Mal früh, und es ist abgesperrt.« Der junge Fitnesstrainer Fernando Signorini fragte sich, ob er mit dem süffisanten Kommentar nicht vielleicht ins Fettnäpfchen getreten war. Das etwas gequälte Lächeln, mit dem Diego die Bemerkung quittierte, ließ jedenfalls Raum für Zweifel.
Maradona kannte Signorini, da er einer der wenigen war, die bei den Trainingseinheiten von Cheftrainer César Luis Menotti dabei sein durften. »Sie sind also der Trainer? Na gut, wir spielen morgen, danach mache ich Urlaub in Argentinien, aber wenn wir zum Vorsaisontraining wieder in Andorra sind, müssen wir uns unterhalten. Mein Agent Jorge Cyterszpiler und ich überlegen, eine Fußballschule in Barcelona zu eröffnen.« Später bat Diego El Profe (dt. Professor), sein Privattrainer zu werden, etwas, das es im Bereich des Mannschaftssports bis dahin noch nicht gegeben hatte. Mit einigen Unterbrechungen arbeiteten die beiden fast zehn Jahre lang zusammen.
Den ersten Tiefpunkt durchlebte Maradona nach dem Sieg Argentiniens bei der WM in Mexiko 1986. Nachdem er endlich den Ruhm errungen hatte, von dem er als Kind immer geträumt hatte, rutschte er in eine Depression ab. Sein Leben in Neapels Nobelviertel Posillipo als millionenschwerer Gefangener des eigenen Ruhms lastete schwer auf ihm. Just in dem Augenblick traf er jemanden, der ihm ein magisches Pulver anbot, und Diego, der längst zum Helden aufgestiegen und ein Mythos geworden war, zögerte nicht zuzugreifen. Als seine depressiven Schübe daraufhin nachließen, schwoll seine Brust wieder so an, wie sie es immer beim Klang der argentinischen Nationalhymne getan hatte, und Diego fühlte sich zu allem bereit.
Nachdem er 1987 mit dem SSC Neapel den ersten von zwei italienischen Meisterschaftstiteln geholt hatte und in den Rang eines Heiligen erhoben worden war, entschied Maradona, dass es an der Zeit sei, sich einen Ferrari zuzulegen. Seinem damaligen Agenten Guillermo Cóppola erklärte er, dass er sich statt eines markentypischen Rosso Corsa einen schwarzen Testarossa wünsche. Cóppola kümmerte sich um Diegos Geschäfte, seitdem dieser nach Italien gekommen war. Außerdem stand er – selbst dem weißen Pulver zugeneigt – seinem Klienten zur Seite, als dieser durch die Kokainhölle ging. Die beiden Männer verband eine große Zuneigung. Guillermo tat alles für seinen Freund, wie er erzählt. Schließlich war er da, der schwarze Testarossa: »Wir stiegen beide ein, und Diego sah sich suchend um. Ich fragte ihn, ob es ein Problem gebe. ›Wo ist die Stereoanlage?‹, wollte er wissen. ›Was für eine Stereoanlage denn?‹, entgegnete ich. ›Der Wagen hat keine.‹ – ›Ja, das ist ein Rennwagen, der hat weder Stereo- noch Klimaanlage.‹ – ›Na, wenn das so ist‹, sagte Diego, ›dann schieb ihn dir in den Arsch.‹«
Letzten Endes behielt Maradona den schwarzen Ferrari dann doch. Er flüchtete darin vor den Vespas, die ihn auf dem Weg von seinem Haus zum Trainingsgelände verfolgten. Nach dem Training blieb er normalerweise noch, um Autogramme zu geben, vorausgesetzt, niemand kreischte oder versuchte seine Haare oder seine Schulter zu berühren.
Diego, der Junge aus Fiorito, der sich die Nase an der gläsernen Wand plattgedrückt hatte, die seine Welt von der restlichen trennte, und stets von einem anderen Leben geträumt hatte, verliebte sich in den erwachsenen Maradona, weil der all das besaß, was er einst haben wollte: Autos, Frauen, Schmuck. Und ständige Bewunderung.
Wie schon in Barcelona gingen in Maradonas Haus in Neapel rund um die Uhr Gäste ein und aus. Diejenigen, die ins Innere der hermetisch abgeriegelten Maradona-Welt vordringen konnten, profitierten uneingeschränkt von Diegos Großzügigkeit. Immer stand irgendwo etwas zu essen bereit. Auch Journalisten zählten zu Maradonas Freunden. Einer davon war der Ghostwriter seiner beiden Autobiographien, Daniel Arcucci. Er traf Maradona zum ersten Mal an Heiligabend und durfte auch den ersten Weihnachtstag mit ihm verbringen. Ihre Freundschaft hielt ein Leben lang.
Einige Jahre später, Ende Mai 1990 – Neapel stand kurz davor, sich zum zweiten Mal den Meistertitel zu sichern –, erhielt Arcucci von der El Gráfico den Auftrag, die Vorbereitungen zum Spiel gegen den Titelkonkurrenten Lazio Rom zu begleiten. In Neapel angekommen, beschloss er, einen Spaziergang durch Forcella zu machen, einen vom Giuliano-Clan kontrollierten Bezirk. Dem Journalisten und seinem Fotografen, Gerardo »Zoilo« Horovitz, war Fitnesstrainer Signorini als Stadtführer zur Seite gestellt worden. Sobald sie in Forcella waren, wurden sie von einer Gruppe bedrohlich wirkender Typen umringt. »Ich werde mit ihnen sprechen«, sagte der Fitnesstrainer.
»Alles in Ordnung«, meinte er, als er zurückkam. Er hatte den Männern erklärt, dass sie Freunde von Diego waren. »Aber wir müssen uns auf einen Drink mit jemandem treffen.« Von der belebten Straße bogen sie in eine schmale Gasse ein, verfolgt von zwei dubiosen Gestalten, einem etwas kleineren und einem recht finster wirkenden größeren Kerl. Die Geräusche der Großstadt wurden leiser und die Stimmen, die von den Hauswänden widerhallten, lauter. Schließlich kamen sie zu einem Café, und als sie eintraten, waren sie gleichermaßen fasziniert und verängstigt. Schlagartig erhoben sich die anwesenden Gäste und verschwanden. Das Geräusch von Stuhlbeinen, die über den Boden schleifen, wich plötzlicher Stille. Am anderen Ende des Ladens entdeckten sie einen Mann. Arcucci erkannte ihn sofort, es war Carmine Giuliano.
»Vuoi caffè?«
»Ja, gerne. Vielen Dank.«
»Brauchen Sie irgendetwas?«, fragte Carmine. Wie die El Gráfico verfügte auch der argentinische TV-Sender Telefe nicht über einen eigenen Korrespondenten in Italien, daher hatten sie Arcucci gebeten, ihnen ein paar Filmbeiträge aus Neapel zu schicken. Equipment hatten sie ihm zu diesem Zweck allerdings nicht zur Verfügung gestellt.
»Na, wenn Sie schon fragen, eine Kamera wäre nicht schlecht«, entgegnete der Journalist scherzhaft.
Carmine schnippte mit den Fingern: »Eine Kamera für den Herrn.«
Am selben Abend war Arcucci mit Maradona in dessen Haus zum Abendessen verabredet. Das Personal hatte frei, und Doña Tota bereitete ein Pastagericht zu. Arcucci und Maradona saßen im Wohnzimmer, sahen fern und diskutierten über Neapels Chancen auf den Meistertitel beim Spiel am kommenden Tag. Don Diego saß ein wenig abseits, und Maradonas Lebensgefährtin Claudia warf in unregelmäßigen Abständen einen Blick zu ihnen herein. Kurz vor Mitternacht läutete es an der Tür. Diego bat Claudia nachzusehen, wer geklingelt hatte, und als sie zurückkam, flüsterte sie ihm etwas ins Ohr.
Maradona, der die ganze Zeit über Flip-Flops getragen hatte, zog sich ein ordentliches Paar Schuhe an und sagte. »Komm mit, Dani, jetzt zeige ich dir das echte Neapel.« Der Journalist folgte Doña Tota, Claudia und Diego in die Tiefgarage. Dort standen zwei Ferrari, die Gruppe nahm jedoch einen VW Bus, eines der klassischen Modelle aus den 60er Jahren, das bei den Hippies so beliebt gewesen war. Diego saß wie immer am Steuer. Am Ende der Auffahrt bot sich ihnen ein wundervoller Blick auf die Bucht von Neapel – und auf einen roten Lancia-Sportwagen. Heraus stieg Carmine Giuliano in einem maßgeschneiderten Anzug. Er kam herüber zu Maradona und drückte ihm einen Kuss auf beide Wangen. Dann ging er zu seinem Lancia zurück, und die beiden Wagen machten sich auf in Richtung Stadt.
Der Lancia fuhr vorweg, der VW Bus folgte. Als sie ans Meer kamen, sahen sie sich plötzlich von einem Schwarm Vespas umringt. Darauf lauter junge Männer, die stundenlang darauf gewartet hatten, dass etwas passiert. »Maradona, Maradona«, riefen sie, als sie ihrem Idol durch die ausgestorbenen Straßen der Stadt hinterherfuhren. »Was für ein Leben«, seufzte Doña Tota. »Mit meinem Sohn kann man nirgendwohin fahren.«
Dalma Salvadora Franco, genannt Tota, hatte acht Kinder zur Welt gebracht und war eine Mutter, wie sie im Buche steht. Vor allem aber war sie Diegos Beschützerin, sie wurde von ihrem Sohn auf Händen getragen und mit Zuneigung überhäuft; in Maradonas extrem öffentlichem, gut dokumentiertem Leben nahm sie eine Schlüsselrolle ein. Diegos Vater, Don Diego – oder Chitoro, wie seine Freunde ihn nannten –, war 1927 in Esquina in der Provinz Corrientes im Nordosten Argentiniens zur Welt gekommen, zumindest wurde das so erzählt. Als junger Mann hatte er auf einem Schiff gearbeitet, mit dem Vieh von Dorf zu Dorf transportiert wurde. Nachdem er mit der Familie nach Buenos Aires gezogen war, hatte er eine Stelle in einer Chemiefabrik angenommen, die allerdings so schlecht bezahlt war, dass er die Familie kaum über die Runden bringen konnte. Irgendwann bat Diego ihn, zu kündigen und zu ihm zu ziehen. Seine Barbecues und seine Schweigsamkeit waren legendär. Don Diego, der vermutlich indigene Vorfahren hatte, blieb am liebsten im Hintergrund.
Auf dem Höhepunkt seiner Profikarriere heiratete Diego seine langjährige Lebenspartnerin Claudia Villafañe. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Paar bereits zwei Töchter: Dalma, zwei Jahre alt, und Gianinna, sechs Monate. Im Estadio Luna Park in Buenos Aires wurde ein rauschendes Fest gefeiert. Zu den geladenen Gästen zählten unter anderem Fidel Castro, der argentinische Präsident Carlos Menem, Silvio Berlusconi und Fiat-Chef Gianni Agnelli. Nicht alle konnten oder wollten kommen, dafür gaben sich etliche andere Politiker, Sänger, Schauspieler, Models und andere berühmte Persönlichkeiten die Ehre. Darunter auch das gesamte Team des SSC Neapel. Die achtstöckige Hochzeitstorte war mit 100 Bändern verziert, an denen die Gastgeschenke befestigt waren: 99 Ringe aus reinem Gold und ein mit einem Diamanten verziertes Exemplar. Bevor das Fest steigen konnte, mussten die Gäste allerdings warten, denn Maradona kam wie üblich zu spät. Er hatte noch etwas zu erledigen.
Diegos Freund Néstor holte ihn, seine Braut und Guillermo Cóppola in einem eleganten grünen Rolls-Royce Phantom vom Sheraton-Hotel ab. Claudias Schleppe nahm fast die gesamte Rückbank ein. Vor dieser Wolke aus weißem Stoff hob sich Maradonas Gesicht deutlich ab. Auf dem Weg zum Luna Park bat Diego Néstor plötzlich, nach rechts in die Avenida Córdoba abzubiegen. »Warum?«, fragte Néstor, während das Walkie-Talkie, über das er mit den Organisatoren am Luna Park kommunizierte, langsam die Funkverbindung verlor. »Das ist der falsche Weg.«
»Bieg hier ein, in die Sanabria. Dann drei Blocks weiter links in die Castañares. Da, die große Tür, Hausnummer 344, halt da an.« Zwanzig Minuten hatte es gedauert, bis Maradona sie dorthin manövriert hatte.
»Was machen wir denn hier? Wir kommen zu spät«, murrte Cóppola.
»Klopf an die Tür, Guille. Frag nach Don José.«
Eine etwa 70 Jahre alte Frau öffnete. »Madame, könnten Sie Don José ausrichten, dass Maradona hier ist?«
Zwölf Jahre zuvor war ein damals noch junger Diego zusammen mit seinem Agenten Jorge Cyterszpiler zur Puma-Zentrale nach Deutschland gereist, um seinen ersten Werbevertrag zu unterschreiben. Puma hatte ihnen für den Flug drei Erste-Klasse-Tickets zur Verfügung gestellt, und Diego hatte Claudia gebeten, ihn zu begleiten. Daraufhin hatte Don José, ein Eisenwarenhändler aus der Nachbarschaft, sinngemäß gewettert: »Die Villafañes sollten ihre Tochter nicht diesem Fußballer anvertrauen. Für wen hält sich dieser Kerl?«
Don José trug Hausschuhe und einen hellblauen Schlafanzug, als er in der Tür erschien. Als er Maradona erkannte, trat er überrascht einen Schritt zurück. »Buenas noches«, sagte er.
»Hola. Ich habe heute die Frau dabei, die ich Ihrer Meinung nach nicht mit nach Deutschland nehmen sollte, als ich 16 war. Wir sind inzwischen verheiratet und haben zwei Kinder, Don José. Schauen Sie sich die Feier im Fernsehen an. – Jetzt können wir fahren, Guille.«
Die ausklingenden 80er Jahre waren keine ruhige Zeit. Maradona glaubte, dass alle Menschen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum geboren werden und jeden Augenblick ihres Lebens genießen sollten, weil sie es nicht lebend verlassen werden. Hedonismus sollte allerdings Grenzen kennen. Aber Diego machte keine halben Sachen, er verkörperte Ausschweifung und Überfluss geradezu, sprach von sich selbst oft in der dritten Person – ein messianisches Wesen, das keine Grenzen kannte. Wir alle wurden Zeugen seiner Verfehlungen durch all die Kameras, die sein Leben begleiteten. Wir sahen, wie er Frauen und Männer küsste, wie er betrunken war oder high. Wie er mit seinen Töchtern flachste, herumalberte, verfolgt wurde, umzingelt wurde, ihm die Luft wegblieb, auch wie er pfiffig, clever, verloren oder frech war.
Einmal, als sie in London waren, schlug sein ewiger Schatten Cóppola vor, einen nahegelegenen Range-Rover-Händler zu besuchen, weil sich Maradona für ein Modell dieses Herstellers interessierte. Just als sie das Park Lane Hotel, in dem sie wohnten, verließen, fuhr so ein Wagen vor. »Zwei Männer stiegen aus«, erzählte Cóppola in der argentinischen TV-Sendung Pura Química. »›Maradona, Maradona! Können wir ein Foto von dir machen? Können wir ein Autogramm bekommen?‹ – ›Klar doch, fragt an der Rezeption nach Stift und Papier.‹« Und während die beiden auf die Rezeption zusteuerten, warfen sich Maradona und Cóppola schelmische Blicke zu. »Sollen wir …?«, fragte Diego grinsend.
»Wir sprangen in den Rover und fuhren los zu irgendeiner Sportsbar in der Nähe. Den Wagen stellten wir irgendwo ab«, erinnerte sich Cóppola. Etwa zwei Stunden blieben sie mit dem geliehenen Wagen weg. »Als wir zurückkamen, saßen die beiden Männer, die mit dem Auto gekommen waren, auf den Stufen vor dem Hotel, genau da, wo wir sie zurückgelassen hatten. Sie umarmten uns, schossen Fotos, schenkten uns ein paar Schuhe, Hemden und Pullover, die sie im Kofferraum dabeihatten, und holten uns am nächsten Tag ab, um uns zum Flughafen zu fahren.«
Als Maradona 1995 zu den Boca Juniors zurückkehrte, immer noch auf der Suche nach dem ultimativen Wagen, kaufte er sich zwei schnittige Ferrari F355 Spider, diesmal in Rot. Diego verfügte inzwischen über eine stattliche Autosammlung und fuhr jeden Tag einen anderen Wagen. Montags sah man ihn in einem Porsche. Dienstags beantwortete er Journalistenfragen durch das Fahrerfenster eines großen Mitsubishi-Pick-up. Und mittwochs fuhr er zum Training in einem echten Truck, einer blauen Scania-360-Sattelzugmaschine.
Seine Profikarriere beendete Maradona schließlich in La Bombonera. Der Abend des Abschieds, an dem er Diego, dem Fußballer, Lebewohl sagte, kam 2001, etliche Jahre nachdem er zum letzten Mal offiziell auf dem Platz gestanden hatte. »Der Ball bleibt unbefleckt«, erklärte er den Menschen im ausverkauften Stadion, unter denen sich auch viele seiner früheren Mannschaftskameraden befanden.
Aber Maradona ging nicht wirklich.
Er stellte sich einer neuen Herausforderung: Maradona zu bleiben und – wie Arcucci es einmal ausdrückte – weiterhin gegen England zu punkten. Seine narzisstische, manisch-depressive Persönlichkeit, im psychiatrischen Fachjargon auch bipolar genannt, beherrschte all seine Entscheidungen. Nach seinem Rücktritt wollte er dem Körper, in dem er lebte, kein gutes Leben gönnen. Stattdessen zog er es vor, der Mensch zu sein, den jeder in ihm sehen wollte. Auf Depressionen folgten Nahtoderfahrungen, Wiederauferstehungen und der erneute Sturz ins Bodenlose. Verstärkt und beschleunigt wurde diese Entwicklung durch den Tod seiner Eltern in den 2010er Jahren. Von da an begann der Boden unter seinen Füßen zu wackeln.
Sobald Maradona Stimulanzien in die Finger bekam, wurde seine Unfähigkeit, Nein zu sagen, zu einer Gefahr für sich selbst und sein Umfeld. Er manövrierte sich immer tiefer in eine Sackgasse hinein. Ein Drogensüchtiger auf Entzug ist extrem verletzlich und läuft leicht Gefahr, rückfällig zu werden. Der starke Drang, seine eigenen Regeln aufzustellen und diese auch selbst wieder zu brechen, ist laut Psychologen ein typisches Verhalten Süchtiger. Das erklärt die vielen Vorfälle, zu denen es kam, wenn Diego irgendwo eingeladen worden war und schließlich gebeten oder gar gezwungen werden musste zu gehen, was oft verbale oder auch körperliche Attacken des Herausgeworfenen nach sich zog.
Diegos argentinischer Teamkollege Jorge Valdano sagte einmal: »Viele glauben, Maradonas Problem seien seine Freunde, ich hingegen denke, dass das Problem seiner Freunde Maradona selbst ist.« Seine Freunde zollten ihm entweder gebührenden Respekt oder distanzierten sich von ihm. Zu Letzteren zählen zahlreiche Ex-Partner und ehemalige Lebensgefährten, die immer nur sein Bestes wollten, letztendlich jedoch vor die Tür gesetzt wurden. Maradona bekämpfte jeden, selbst diejenigen, die ihm am nächsten standen: Cyterszpiler, seine Frau Claudia, Cóppola. Und das in aller Öffentlichkeit. Die gerichtlichen Auseinandersetzungen waren endlos. Einige Forderungen sind noch heute offen.
Mit Maradonas Gesundheit ging es in den letzten zehn Jahren seines Lebens zunehmend bergab, den größten Schmerz bereitete es ihm allerdings, »sich nicht mehr wie Maradona zu fühlen«, so Arcucci. Und wenn man auf seine Zeit als Trainer bei Sinaola in Mexiko oder bei Gimnasia y Esgrima in Argentinien zurückblickt, wird schnell klar, dass es niemandem gelang, ihn davon zu überzeugen, dass es unnötig war, weiterhin der alte Maradona sein zu wollen. Diego war ein Leben lang auf der Suche nach Frieden gewesen, aber sobald er etwas fand, das dem nahekam, nahm er Reißaus.
Diego missbrauchte seinen Körper. Er entsagte dem Kokain und anderen Substanzen, die ihn glauben ließen, dass er über allem stand. Seine Sucht bezwang er aber nie. Er war süchtig nach Alkohol, nach Tabletten, nach Schmeicheleien, nach der Zerstörung seines eigenen Lebens.
Seine letzten Tage verbrachte er in dem schwach beleuchteten Haus, das er während der letzten dramatischen Verschlechterung seines Gesundheitszustands angemietet hatte. Sein Bett, das man in der Küche aufgestellt hatte, damit er keine Treppen gehen musste, wurde zu seiner Totenbahre.
Der Tod war die einzige Grenze, die Maradona nicht überschreiten konnte. Er starb kurz nach seinem 60. Geburtstag an einem akuten sekundären Lungenödem infolge einer schweren chronischen Herzinsuffizienz. Genauso gut hätte es auch vieles anderes sein können.
Diego lebte nur 19 Jahre ohne den Ball.
Sein Leichnam wurde mit einem Chevrolet-Pick-up der Polizei von Buenos Aires zur Autopsie ins Krankenhaus gebracht. Später wurde er in einem Krankenwagen, einem weißen Fiat Doblò, zur Casa Rosada transportiert, dem argentinischen Präsidentenpalast, wo eine gigantische Totenwache abgehalten wurde. Eine endlose Menschenschlange defilierte an Maradonas Sarg vorbei, Zigtausende Argentinier, von denen einige Hunderte von Kilometern weit angereist waren, um ihm zu huldigen. Sie nahmen nicht Abschied von Maradona, sie inthronisierten ihn. Claudia und die zuständigen Behörden beschlossen zu früh, die Tore zu schließen. Die Menge, die davon abgehalten worden war, ihrem Volkshelden zu huldigen, begann zu randalieren. Es kam zu gewalttätigen Übergriffen und Festnahmen.
Ein dunkelgrauer Peugeot-Leichenwagen überführte Maradonas sterbliche Überreste zum Jardín Bella Vista, dem Friedhof, wo er von denen, die ihm von Anfang an zur Seite gestanden hatten, und den wenigen, die zum Schluss noch übrig waren – Claudia, Dalma, Giannina, Cóppola –, neben seinen Eltern zur Ruhe gebettet wurde.
Endlich hatte er seinen Frieden gefunden.
Hätten wir ihn nur warnen können, vor dem, was ihm bevorstand, damals, als er für seine ersten Fotos posierte, schüchtern und clean mit einem Ball in der Hand. Hätten wir seinem Leben nur einen Schubs in eine andere Richtung geben können.
Wie lässt sich Diego Armando Maradona, der Fußballer, erklären? Die zwei Tore gegen England in Mexiko 1986 könnten ausreichen. Ein ganzes Buch ist wiederum zu wenig. Maradonas Geschichte kann in großen Schlagzeilen erzählt werden, besser verständlich wird sie jedoch, wenn man zwischen den Zeilen liest. Es ist eine Chronik der Heldentaten und Anekdoten, der Widersprüche und Fehler, der Ungereimtheiten und Revolten. Unstrittig sind die sportlichen Fakten, sein Weg, den er als Spieler zurücklegte, von den Anfängen bis zu dem Tag, an dem er sich in La Bombonera von seiner Profikarriere verabschiedete.
Um dieses Buch zu schreiben, musste ich mich dahin begeben, wo alles angefangen hatte, nach Buenos Aires in die Slums von Villa Fiorito. Es war der letzte Tag meines Aufenthalts in der argentinischen Hauptstadt Anfang 2020, und ich wollte mich dort unbedingt einmal umsehen, bevor ich vom Ezeiza-Flughafen aus den Heimweg antrat. Kein Taxi wollte mich in diese Gegend bringen. »Und Sie wollen ganz sicher dahin?«, fragte der Fahrer mehrfach nach, bevor er meinem Wunsch endlich und sichtlich unwillig nachkam.
Wir verließen die Autobahn und passierten ein paar Kreisverkehre. Keiner von uns sprach ein Wort. Ich wusste nicht, was mich erwartete, obschon ich eine gewisse Vorahnung hatte. Während die Straßen immer schmaler und rumpeliger wurden, schrumpften auch die Häuser, bis sie nur noch wie kleine Kisten aussahen, mit halbfertigen Zäunen und ein paar traurigen Pflanzen davor. Berge von Mülltüten verrotteten in halb verödeten Gärten. Wir fuhren an einem Mann vorbei, der einen mit Pappe beladenen Pferdekarren steuerte. Kinder kickten mit nackten Füßen einen Ball über die unebene Schotterpiste, über die wir fuhren, und Frauen trugen riesige Taschen umher, die mit Gott weiß was gefüllt waren. Ich vermutete, dass sich kaum etwas geändert hatte, seit Francis Cornejo zum ersten Mal hierhergekommen war.
Es gab kein Schild, das den Weg zu dem Ort wies, an dem die Weichen für Maradonas Karriere gestellt wurden, zu der Straße, wo er die Dinge gelernt hatte, die in keinem Lehrbuch stehen, zu jener potrero, jener Pferdekoppel, dem Stück Ödland, auf dem er tagein, tagaus Fußball gespielt hatte. Inzwischen stehen dort einfach weitere Wellblechhütten.
Wir verlangsamten unsere Fahrt hinter einem Mann in Shorts mit nacktem Oberkörper, der über die unbefestigte Straße marschierte. Ohne anzuhalten und mit nur leicht heruntergekurbeltem Fenster fragte der Fahrer zaghaft nach Diegos ehemaligem Haus. »Da hinten, nur 200 Meter weiter da runter.«
»Okay, da ist es. Können wir jetzt wieder fahren?«, fragte mein eingeschüchtert wirkender Chauffeur.
Endlich standen wir vor Maradonas erstem Haus. Den Motor stellte der Fahrer nicht ab. Der Garten war überwuchert, aber weiter hinten konnte man einen stark verschatteten Bungalow erkennen. Vor der Tür, die Doña Tota einst für Francis geöffnet hatte, saß ein Mann in einer weißen Weste, der flink aus seinem Schaukelstuhl sprang.
»Was suchen Sie?«
»Gar nichts, Señor. Mein Freund hier wollte nur …«, antwortete der Taxifahrer, legte flugs einen Gang ein und fuhr davon. Linker Hand kamen wir an einem matschigen Bolzplatz vorbei, ohne Markierungen, mit nur einem einzigen Tor.
Kurz nach Diegos 60. Geburtstag erklärte die Stadtverwaltung die erste Wohnstätte des Fußballstars zum »Kulturerbe«. Am Tag nach Maradonas Tod malte ein Künstler Diegos Konterfei offiziell auf eine der Wände der Baracke, umrahmt von einem goldenen Heiligenschein, darunter die Worte »Haus Gottes«.
Teil IEL PELUSA
KAPITEL 1Der Vater – Don Diego
»Don Diegos Vater ging barfuß«, sagten die Leute, um die bescheidenen Verhältnisse zu beschreiben, aus denen Diego Armando Maradonas Großvater stammte. Das sagten selbst die, die ihn nicht gekannt hatten. Und es war keineswegs abschätzig gemeint. Vielmehr brachten sie damit ihre Hochachtung vor einer einfacheren Lebensart zum Ausdruck, die sie mit den indigenen Völkern Argentiniens in Verbindung brachten, einem in Vergessenheit geratenen Teil der argentinischen Geschichte. Don Diego Maradona hielt sich aus solcherlei Spekulationen heraus – vielleicht ging sein Vater einst barfuß, vielleicht aber auch nicht.
Tatsächlich weiß man kaum etwas über Don Diegos Vater. Gewiss ist nur: Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und setzte zahlreiche Kinder in die Welt. Von einigen wusste er, von anderen nicht. Sein Leben verlief unkonventionell. Er war zwar Katholik, hatte aber eine ganz eigene Vorstellung vom Leben.
»Anscheinend hatte er indigene Wurzeln«, schrieb Fernando Signorini via WhatsApp. »Das zumindest erzählte mir ein Freund von Diegos Vater aus Esquina, einer Stadt in der Provinz Corrientes.« Das Personenstandsregister von Esquina lässt allerdings keine Rückschlüsse auf diese Spekulation zu. Recherchen in diese Richtung werden zudem dadurch erschwert, dass Don Diego den Nachnamen seiner Mutter, Maradona, annahm, da sein Vater die Familie sehr früh verließ.
Fest steht, dass Don Diego – von seinen Freunden Chitoro genannt – am 12. November 1927 das Licht der Welt erblickte. Sein Nachname ist nicht italienischen Ursprungs – auch wenn er so klingt, vor allem, wenn Neapolitaner ihn mit der Betonung auf dem »n« aussprechen: Mara-do-na. Der Ursprung des Namens scheint in Galicien zu liegen, einer Region im Nordwesten Spaniens, möglicherweise stammen Maradonas Vorfahren aus einem Ort südlich von Ribadeo oder Barreiros, aus Arante, Vilamartín Grande oder Vilamartín Pequeño, wo noch heute viele Maradonas leben.
Ein Francisco Fernández de Maradona, geboren im nordspanischen San Pedro de Arante, wanderte unterschiedlichen Quellen zufolge 1745 oder 1748 nach Nordwestargentinien aus und ließ sich in San Juan de Cuyo nieder. Nach heutigem Kenntnisstand war er der erste Maradona in Argentinien. In den 1920er Jahren war ein Nachfahre von Francisco Fernández, der Ingenieur Santiago Maradona, Gouverneur der Provinz Santiago del Estero. Er war der einzige Maradona, der in Santiago lebte. Verheiratet war er nicht, aber er hatte Kinder, die seinen Namen trugen, darunter auch Chitoros Mutter, Diego Armando Maradonas Großmutter. Einem alten Foto nach zu urteilen, war Don Diego seinem Urgroßvater mütterlicherseits, dem Ingenieur Santiago, wie aus dem Gesicht geschnitten, und auch sein Sohn Diego trug ähnliche Züge. Markante Merkmale sind das runde Gesicht, das hervorstehende Kinn und die Pausbacken.
Ein weiterer Nachfahre des ersten in Argentinien lebenden Maradona schloss kürzlich ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität von Buenos Aires ab. José Ignacio Maradona verriet der Website Enganche mehr über die familiären Hintergründe des Fußballstars:
»Da es nur wenige von uns Maradonas gibt, wissen wir über unsere Herkunft gut Bescheid. Als Diego seinen Durchbruch feierte, wusste allerdings niemand genau, welchem Zweig der Familie er angehörte. Also sprach mein Vater Don Diego einmal während eines Spiels an und fragte ihn danach. Don Diego kannte seinen Vater nicht, seinen Familiennamen hatte er von der Mutter übernommen, die aus Santiago del Estero stammte. Und die war mit ihm nach Esquina in die Provinz Corrientes gezogen, als er noch klein war.«
Es hatte immer geheißen, Don Diego sei in Esquina geboren worden, nun aber ist anzunehmen, dass sein Geburtsort elf Autostunden entfernt lag. Damals dauerte eine Reise von Santiago del Estero nach Esquina freilich um einiges länger, möglicherweise waren Don Diego und seine Mutter tagelang unterwegs gewesen, bevor sie ihr Ziel erreicht hatten. Warum hatten sie diese Tortur auf sich genommen? Waren sie vor irgendwas davongelaufen?
Don Diego wurde also in Santiago del Estero geboren, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz am Ufer des Río Dulce im Norden Argentiniens. Maradonas Großvater väterlicherseits hinterließ nur eine undeutliche Spur, und Chitoro konnte nicht helfen, sie zurückzuverfolgen.
Vielleicht, nur vielleicht zählte er zu den Nachfahren eines der indigenen Völker, die schon seit Jahrhunderten auf argentinischem Boden lebten. Die von den Spaniern unterdrückt und christianisiert worden waren. Ausgebeutet. In die Armut getrieben. Missachtet. Und im Zuge der Kolonialisierung nahezu ausgerottet. Ihr natürlicher Lebensraum war von den Siedlern, die über die neu gelegten Bahntrassen einreisten, zunehmend zerstört worden.
Mitglieder indigener Volksgruppen konnten als Holzfäller oder Abbrucharbeiter in den Bergen von Santiago arbeiten, andere Möglichkeiten gab es für sie kaum. Sie hatten ihre eigenen Gesetze. Sie legten keinen Wert darauf, ihre Kinder amtlich erfassen zu lassen, und zogen oft um. Während sie genau wussten, woher sie kamen, war ihnen ihr Ziel ungewiss.
Als Jugendlicher lernte Don Diego in Esquina Doña Tota kennen, die er schließlich heiratete. Das ist der Moment, an dem für ihn alles begann. Über die Zeit vor diesem Ereignis sprach er kaum.
Weit entfernt von Esquina trugen sich Dinge zu, die Don Diegos Welt bald völlig auf den Kopf stellten. 1946 gewann Juan Domingo Perón die Präsidentschaftswahlen in Argentinien. Seinen Machtgewinn verdankte er einer populistisch geprägten Politik. Er beschwor den Beginn eines neuen industriellen Zeitalters herauf und versprach Arbeit für alle. Tatsächlich verbesserte seine Wirtschafts- und Sozialpolitik das Leben vieler Arbeiter und verschaffte dem Staat mehr Einfluss auf die Ökonomie des Landes. Perón und seine Frau Evita setzten sich auch für die Rechte von Aussiedlern ein.
Infolge des aufkeimenden Peronismus wurde Buenos Aires in den 1950er Jahren zu einem Anziehungspunkt für die verarmte Landbevölkerung, insbesondere für Menschen aus dem Norden Argentiniens, die motiviert von Pérons Versprechungen in die Hauptstadt strömten. Unter ihnen auch die Eltern von Diego Armando Maradona. Doña Tota hatte als Jugendliche schon einmal in Buenos Aires gelebt und bei Verwandten gearbeitet. Sie hatte sich dort jedoch einsam gefühlt und war nach einiger Zeit nach Esquina zurückgekehrt, um wieder bei Don Diego zu sein. Als ihre Schwester später nach Villa Fiorito zog, überzeugte sie ihren Gatten, dass sie von changa (Saisonarbeit) und dem kleinen Boot, mit dem Chitoro Vieh und Baumaterial transportierte, auf Dauer nicht würden leben können. Sie beschlossen, sich in Buenos Aires ein neues Leben aufzubauen. Doña Tota reiste zunächst jedoch ohne ihren Mann in die Hauptstadt, um die Lage zu sondieren. Sie nahm ihre Tochter María und ihre Mutter Salvadora Cariolicci mit. Als sie eine Bleibe gefunden hatte, holte sie Don Diego nach.
Don Diego verkaufte sein Boot und kehrte seinem alten Leben den Rücken, jedoch nicht ohne innerlich ein paar Tränen zu vergießen. Mit seiner und Doña Totas zweiter Tochter Rita legte er die über 1000 Kilometer lange Reise nach Buenos Aires auf einem Boot auf dem Rio Paraná zurück. Sein Gepäck bestand aus zwei Koffern und einer übergroßen Decke, in die er ein paar Kleidungsstücke, Töpfe und Pfannen eingewickelt hatte. Alles andere ließ er zurück.
Chitoro musste schnell erkennen, wie heruntergekommen Villa Fiorito war. Die Straßen waren dreckig und unbefestigt. Die Häuser bestanden aus Pappe, Holz und Wellblechdächern. Es war eine Gegend für Migranten, ein Ghetto für Benachteiligte und Außenseiter. Buenos Aires lag nicht weit entfernt, doch zwischen der Hauptstadt und dem Elendsviertel floss das trübe Wasser des am stärksten verschmutzten Flusses des Landes.
Eigentlich hatten sich die Maradonas ein leerstehendes Haus vormerken lassen, doch als sie ankamen, war es schon an jemand anderen vermietet worden. Nicht weit entfernt, an der Azamor 523, fanden sie ein anderes Haus. Wie die übrigen verfügte es weder über Strom noch über einen Gasanschluss. Es war nicht das, was Don Diego sich vorgestellt hatte, aber er nahm es stoisch hin. Es war nicht der richtige Moment, um »seinen inneren Indianer herauszulassen«, wie seine Freunde es nannten, wenn er gelegentlich wild herumfluchte.
Kurz nach seiner Ankunft in Villa Fiorito fand Chitoro eine Stelle bei Tritumol, einem Chemiebetrieb, in dem Knochenmehl produziert wurde. Um fünf Uhr früh ging er zur Arbeit und kehrte völlig erschöpft nachts um zehn heim. Dennoch reichte sein Gehalt nicht aus, um die Familie zu ernähren. Aber es gab Menschen, die sie unterstützten, wie Doña Totas Schwester oder der geliebte Onkel Cirilo. Don Diegos Bruder wurde aufgrund seiner eher geringen Körpergröße auch Tapón (dt. Stöpsel) genannt. Er war Amateurtorwart und lebte ganz in der Nähe der Maradonas. Jeder teilte hier mit jedem.
Doña Tota und Don Diego haben bereits vier Töchter – Ana, Rita, María Rosa und Lili –, als ihr erster Sohn Diego Armando am 30. Oktober 1960 in der Evita-Poliklinik in Lanús das Licht der Welt erblickt. Die erste Erinnerung, die Diego an seine Kindheit hat, ist, wie er sich in den Feldern am Rande von Villa Fiorito vor seiner Mutter versteckt, als sie ihn zur Schule bringen will.
Das Haus hatte eine Küche, aber kein fließendes Wasser. Es gab ein Schlafzimmer für die Eltern und die Großmutter und eines für die Kinder, die zum Schluss zu acht waren. Wenn es draußen in Strömen goss, tropfte der Regen durch das Wellblechdach, sodass sich auf dem Lehmboden dunkle Flecken bildeten, die wie kleine Käfer aussahen. Diego erzählt: »Mutter rief dann: ›Holt die Eimer!‹, und wir rannten durchs Haus und stellten die Eimer unter die Lecks, bis sie vollgelaufen waren, dann leerten wir sie durch die Fenster aus.«
An manchen Abenden tranken die Eltern nur Tee, überließen die Mahlzeit den Kindern und gaben vor, nicht sonderlich hungrig zu sein.
Diego spielte Fußball, manchmal bis zu zehn Stunden täglich, wenn es sein musste, auch allein. Dann kickte er den Ball gegen den Bordstein oder einen Pflanzenkübel, was auch immer. »Wir spielten von morgens bis abends auf dem potrero, einem Platz ganz ohne Markierungen, wo einem der Dreck nur so um die Ohren flog. Wenn ich nach Hause kam, war ich völlig eingesaut. Ich sah schrecklich aus! Natürlich wollte mir mein Vater ein paar hinter die Löffel geben, so was machte man einfach nicht mit seinen guten Sachen. Dann flüchtete ich vor ihm und schlug Haken – wodurch sich mein Dribbling verbesserte!«
Diego erinnerte sich, dass er mit dem Ball mühelos Dinge veranstaltete, die anderen schwerfielen. »Ich konnte den Ball etwa mit meiner Ferse kontrollieren. Wenn jemand anderes aus der Mannschaft das versuchte, landete er auf den Knien. Mein Vater hat mir das nicht beigebracht, der war ein lausiger Spieler. Mein Onkel sagte immer: ›Sein Fußballtalent hat Pelu gewiss nicht von dir.‹« Pelu ist eine Kurzform für Pelusa, zu Deutsch Fluse, in Anspielung auf das volle Haar, das Maradona reichlich hatte.
An dem Tag, an dem Francis Cornejo bei den Maradonas vorsprach, um Diegos Alter zu überprüfen, war der Vater auf der Arbeit. Es war ein Samstag, aber er sagte nie Nein, wenn er etwas dazuverdienen konnte. Cornejo lernte Don Diego erst kennen, als der mit seinem Sohn zum Training kam – die beiden hatten den Zug und mehrere Busse nehmen müssen, um dorthin zu kommen. »Mein Vater brachte mich mit dem Bus zum Zug und war völlig erschöpft«, beschrieb Diego die Szene. »Er hielt sich am Handlauf fest, und ich stand unter seinem Arm und stützte ihn auf Zehenspitzen stehend, weil er im Stehen einschlief. So kamen wir gemeinsam voran, indem wir einander stützten.«
Cornejo schildert Don Diego als einen Mann, der nicht viel Worte machte, aber starke Überzeugungen hatte. Er und auch Doña Tota begleiteten Diego zu all seinen Spielen. José Trotta holte sie mit seinem Pick-up ab. Die Eltern saßen bei ihm in der Fahrerkabine, während Trainer Francis bei den Jungs auf der Ladefläche mitfuhr. Es waren willkommene Ausflüge für die Familie. Sie überquerten die Alsina-Brücke, wenige hundert Meter von ihrem Haus entfernt – durch die hölzernen Planken sah Diego das schlammige Wasser –, und befanden sich auf der anderen Seite auf dem Markt von Pompeya mit seinen Verkaufsständen für Spielwaren und Schuhe und T-Shirts (»Da gab es Shirts, die meine Schwester haben wollte, und Shirts, die ich haben wollte«, erinnert er sich).
Die Maradonas gingen selten shoppen, und wenn, waren die einzelnen Familienmitglieder reihum an der Reihe. »Heute kann sich María ein Paar Schuhe kaufen, das nächste Mal bist du dran, Pelu. Was hättest du gerne?«
»Ein kleines Holzpferd.«
»Mach dich nicht lächerlich, du brauchst etwas zum Anziehen.«
»Oh, papi, dann ein T-Shirt.«
»In Ordnung.« Dasjenige, das sie dann auswählten, blieb für immer in der Familie, ein Kind vererbte es dem nächsten, bis es schließlich als Putzlappen diente.
Gelegentlich musste sich Diego auch eine Unterhose vom Vater leihen. Der Journalist Diego Borinsky wollte einmal von ihm wissen, ob er nie versucht gewesen wäre zu stehlen, wie es so viele seiner Altersgenossen taten. »Oh nein, mein Vater hätte mich grün und blau geschlagen. Er hat mir die für seine Verhältnisse bestmögliche Erziehung zukommen lassen. Ganz gleich, welche Fehler ich später begangen habe –, mein Vater trägt keine Schuld daran.«
Als Diego noch bei den Cebollitas spielte, bevor er mit 15 zur Jugendmannschaft der Argentinos kam, putzte und polierte sein Vater seine Fußballschuhe so lange, bis sie wie neu aussahen. Selbst als Diego mit 18 zum Hauptversorger der Familie wurde und seinen Vater bat, nicht mehr arbeiten zu gehen, blieben seine Eltern für ihn tonangebend. Diego brauchte das, er benötigte seit jeher Führung und einen festen Bezugspunkt, an dem er sich klar orientieren konnte.
Mit seiner eher schweigsamen Art überließ Don Diego normalerweise seiner Frau das Reden, bis er keine Lust mehr hatte zuzuhören oder ihm etwas auf der Seele brannte. Obschon klein von Statur, konnte er zu einem wahren Riesen anwachsen, wenn er sich Gehör verschaffen wollte. Oder er Doña Tota zum Schweigen bringen musste. Manchmal reichte dazu auch nur ein Blick. Wenn Diegos Fitnesstrainer Fernando Signorini seinen Schützling zur Ordnung rufen musste, holte er oft Don Diego zu Hilfe. In seiner Gegenwart hatten die Albernheiten seines Sohnes schnell ein Ende.
Er ging ihm nicht darum, Angst zu verbreiten, sondern Respekt einzufordern. Die Furchtlosigkeit, die er im späteren Leben an den Tag legte, wenn er die Reichen und Mächtigen hinterfragte oder sich über sie lustig machte, gründete nicht in einer grundsätzlichen Abneigung gegenüber Autoritäten, vielmehr protestierte er damit gegen alle, die ihre Macht missbrauchten und ihre Augen vor den Nöten jener Menschen verschlossen, die – wie einst er und seine Familie – eng zusammengepfercht in Villa Fiorito und den etwa 800 ähnlichen Siedlungen rund um Buenos Aires lebten.
Als Kind war Maradona einfühlsam, höflich und aufmerksam, wenn auch ein bisschen frech. Einmal fand Doña Tota heraus, dass sich seine Schulnoten nur deshalb wie von Zauberhand verbessert hatten, weil er einen Lehrer bezirzt hatte. Sie sprach mit ihrem Mann darüber, und Don Diego verbot seinem Sohn fast zwei Wochen lang, zum Training zu gehen. Chitoro ärgerte sich über jeden, der sich nicht an die Regeln hielt. Er war sehr gewissenhaft und pedantisch. Wenn er sagte: »Morgen früh um fünf fahren wir nach Corrientes zum Fischen«, saß er Punkt fünf im Wagen und wartete auf niemanden. Es war die einzige Möglichkeit, in eine chaotische Welt aus Wellblechdächern und Pappkartonwänden wenigstens den Anschein von Ordnung zu bringen.
Nachdem sie zwischenzeitlich in einem Haus nahe der Heimspielstätte der Argentinos Juniors gewohnt hatten, zogen Don Diego und Doña Tota in eine Wohnung, die ihr Sohn ihnen gekauft hatte. Sie lag in Villa Devoto, einem der besseren Wohnviertel von Buenos Aires, und verfügte über einen großen Innenhof, einen Fernseher, der fast immer lief, und natürlich einen Grill, über den Don Diego herrschte, stets mit einer Zigarette im Mund. Es war leichter, Diego vom Fußballfeld zu locken, als seinen Vater von seinem Grill loszueisen.
Auch in späteren Jahren, lange nach seiner Zeit bei den Cebollitas, kamen die Eltern zu Diegos Spielen, ob er nun für die erste Mannschaft der Argentinos auflief, für die Boca Juniors oder auch den FC Barcelona. Das Haus der Maradonas in der katalanischen Hauptstadt lag hoch oben auf einem der Stadthügel. Es verfügte über eine riesige Küche, in der Doña Tota stundenlang Speisen für die vielen Gäste zubereitete, die oft spontan bei ihnen vorbeikamen. Don Diego beobachtete dieses Treiben aus der Ferne, er blieb unsichtbar, war aber dennoch omnipräsent. Die Zuneigung, die die Eltern für ihren Sohn empfanden, war grenzenlos. Je länger sie mitansahen, wie er sich in sein künstliches Paradies zurückzog, und je bewusster ihnen seine Schwächen wurden, desto tiefer wurde die Loyalität, die sie ihm gegenüber empfanden. Aber sicherlich lasteten der Druck der Verantwortung, die fehlende Kontrolle und das Zusammenleben mit einem Menschen, der so anders war als alle anderen, sehr auf ihnen.
Immer, wenn Chitoro gefragt wurde, wie es war, Diegos Vater zu sein, rang er um Fassung. »Wenn ich über die Straße gehe, werde ich von allen angesprochen: ›Glückwunsch zu ihrem Sohn‹, sagen sie. Und ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll«, hier begann seine Stimme zu brechen. »Ich weiß, dass er der Beste ist, aber ich kann Ihnen versichern, dass er als Sohn noch weit besser ist denn als Fußballer.« Danach kamen ihm die Tränen.
»Er ist eine Heulsuse«, sagte Diego oft, kämpfte dabei aber selbst gegen seine Tränen der Rührung an. »Ich hätte gerne nur ein Prozent von dem, was er ist. Er ist großmütig und würdevoll. Ein ganzes Leben lang hat er darum gekämpft, uns durchzubringen. Als ich klein war, wollte ich so werden wie er, und jetzt als Erwachsener will ich das immer noch. Nur eine Stunde lang möchte ich die Ruhe erleben, die ihm zu eigen ist. Dann kann ich glücklich sterben.«
Es ist der Lauf der Dinge, dass unsere Väter eines Tages aus unserem Leben scheiden. Don Diego, der lange unter Atemwegs- und Herzproblemen litt, fand seine letzte Ruhe mit 87 Jahren nach einem einmonatigen Aufenthalt im Hospital Los Arcos in Buenos Aires.
Guillermo Blanco, der Maradona noch aus Teenagertagen kannte, reiste nach Buenos Aires, wo er sich mit Fernando Signorini verabredet hatte. Zusammen machten sie sich auf den Weg zu Don Diegos Totenwache. Um den Medien aus dem Weg zu gehen, wählten sie dafür bewusst die frühen Morgenstunden, aber es waren trotzdem eine Menge Menschen vor Ort. Der extrem übergewichtige Diego hatte sich hingesetzt, er war gerade aus Dubai gekommen, wo er zu jener Zeit wohnte.
»Diego, El Profe und Guille sind hier«, verriet ihm seine Sekretärin. Guillermo blickte dem gealterten Fußballer tief in die Augen und suchte darin nach dem wahren Maradona. Blanco fiel sofort auf, wie müde Diego nach fünf Jahrzehnten voller Abenteuer wirkte.
Es waren Jahre vergangen, seit sich die Männer zum letzten Mal gesehen hatten. Diego erhob sich langsam von seinem Stuhl. Seine Leibesfülle war ihm im Weg, der traurige Ausdruck in seinem Gesicht sagte alles. Wiederholt schlug er Signorini gegen die Brust. Zwischen jedem Klaps schien eine Ewigkeit zu vergehen, man hatte das Gefühl, der Szene eines Theaterstücks beizuwohnen. Hier agierte Maradona, die Kunstfigur, nicht Diego, der Junge. Er versuchte seine Trauer mit großen Gesten unter den Teppich zu kehren. Erst wenn er allein war, würde Diego sich daran erinnern, wie sein Vater seine Fußballschuhe gewienert hatte, wie er in dem Bus, mit dem sie zum Training gefahren waren, eingeschlafen war. Die Trauer und der Verlust würden ihn übermannen. Aber hier, bei der Totenwache, spielte Maradona eine Rolle und zögerte den Zeitpunkt, an dem ihn der Schmerz mit voller Wucht überwältigen würde, hinaus.
»Ich habe heute an dich gedacht, du Hurensohn«, sagte er zu Signorini. »Erinnerst du dich noch an den Tag, als wir gegen Rom spielten, damals, in unserem ersten Jahr in Neapel? Ich konnte nicht schlafen und bat dich, zu mir aufs Zimmer zu kommen. Wir setzten uns auf den Boden. Ich erzählte dir, dass ich lieber selbst sterben würde, als meine Mutter oder meinen Vater sterben zu sehen. Weißt du noch, was du mir geantwortet hast?«
Signorini versuchte zu lächeln: »Ich sagte, du seist ein Waschlappen, da das nun mal der natürliche Lauf der Dinge ist. Du solltest dir niemals wünschen, das Leid deiner Eltern gegen dein eigenes eintauschen zu können.«
Don Diegos Totenwache dauerte die ganze Nacht, und gegen Mittag machten sich die Männer auf zu der Trauerfeier auf dem Friedhof Jardín Bella Vista am Stadtrand von Buenos Aires.
Diego Armando Maradona war im Alter von 55 Jahren eine Waise geworden.
KAPITEL 2Die Mutter – Doña Tota
»Er kommt!« Das Publikum im ausverkauften Stadion skandierte erneut seinen Namen.
Dieeeegooooooooooo, Dieeegoooooooo …
Hoch oben von der Tribüne aus konnte man hinter dem riesigen aufblasbaren Wolfskopf mit dem offenen Maul, durch das er ins Stadion gelangen sollte, eine Hand erkennen, die ein weißes Käppi mit einer 10 darauf schwenkte. »Er ist hier!«
Wie ein römischer Gladiator betrat er die Arena, langsam, weil das kürzlich operierte Knie unter seinem hohen Gewicht litt. Wie ein Kämpfer, der schon bessere Tage gesehen hat. Maradona, 57 Jahre alt, war der neue Trainer von Gimnasia y Esgrima La Plata. Das hier war seine neue Bühne, auf der er, dessen Karriere abgebrochen war, noch einmal im Rampenlicht stehen wollte. Es sollte seine letzte Bühne sein. Er hatte angekündigt, Gimnasia y Esgrima La Plata zum Erfolg zu führen. Der Verein wusste, welches Abenteuer ihm mit Maradona bevorstand. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit war garantiert, und das war es, was für den Verein zählte.
Nach Beendigung seiner Spielerkarriere hatte Maradona als Trainer für verschiedene Klubs gearbeitet, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Mexiko für Sinola, für die argentinische Nationalmannschaft. Seine Teams bekamen die Häme der Gegner, die den ehemaligen Weltstar nur zu gerne scheitern sehen wollten, in der Regel besonders zu spüren. Aber was soll’s? Das war immer noch besser, als in der Versenkung zu verschwinden.
Dieeeegooooooooooo, Dieeegoooooooo … Die Jubelrufe schwollen immer weiter an.
Jeder Schritt in Richtung Spielfeld weckte schmerzhafte Erinnerungen. Als Spieler hatte er viele brutale Attacken einstecken müssen, in Spanien wie in Italien. Sie hatten deutliche Spuren an seinem Körper hinterlassen. Sein künstliches Knie schmerzte, ebenso wie seine Schulter. Die Beruhigungsmittel, die er gegen seine Angstzustände nahm, bewirkten eine andauernde Müdigkeit, und der langjährige Kokainmissbrauch hatte seinem schwachen Herzen, das inzwischen häufig verrücktspielte, schwer zugesetzt.
Maradona war es nicht peinlich einzugestehen, dass er verschiedene kosmetische Operationen hinter sich hatte. Die Oberlippe hatte er sich richten lassen, nachdem er von seinem Hund gebissen worden war. Auch das Anlegen von Magenbändern, Leistenbrüche und Nierensteine hatten ihn gezeichnet. All das war nicht zu übersehen. Hinzu kam eine Menge persönlicher Probleme, die ihm Verdruss bereiteten: Er hatte die Vaterschaft von mindestens fünf Kindern anerkannt, sechs weitere Vaterschaftsprozesse waren anhängig. Außerdem stritt er mit Claudia – vor Gericht, im Fernsehen und privat. Er war in Dutzende laufende Verfahren involviert.
Und er hatte seine Eltern verloren.
»Diego, mein Sohn, meine Augen, mein Junge.«
Er glaubte diese Worte zu hören, während er durch den Wolfstunnel schritt, und ein Kloß formte sich in seinem Hals. Dann betrat er das aus allen Nähten platzende Stadion und blinzelte verwirrt in die Sonne.
Dieeegoooooooo!
Als Vereinspräsident Gabriel Pellegrino ihn in den Arm nahm, versuchte Diego, sich zusammenzureißen. Doch es gelang ihm nicht, die Tränen brachen sich Bahn.
»Als ich aus dem Tunnel kam, sah ich plötzlich meine Mutter«, erklärte er später. »Ich glaube, dass es für alles einen Grund gibt.«
Emotional völlig am Boden, aber den Jubel auch irgendwie genießend, tat er einen weiteren schmerzhaften Schritt nach vorn. Er sah aus, als trüge er das Gewicht des gesamten Universums auf seinen Schultern. Erleichtert ließ er sich in ein Golfmobil fallen, dessen Fahrer ihm entgegen dem Protokoll ein Trikot der argentinischen Nationalmannschaft reichte, um sich darauf ein Autogramm geben zu lassen.
»Ich glaube nicht, dass ich je aufgehört habe, glücklich zu sein«, hatte Maradona einmal gesagt. »Die Sache ist nur … meine Eltern sind beide gestorben, das ist mein einziges Problem. Ich würde alles geben, um meine Mutter durch diese Tür kommen zu sehen.«
Und an diesem Tag im Stadion kehrte sie zurück.
La Tota, die Mutter der Nation, war acht Jahre zuvor mit 81 Jahren verstorben.
Die Nachricht war in ganz Argentinien durch die Presse gegangen. Vor jeder Begegnung an jenem Spieltag der Tornero Apertura, der dem Tod folgte, es war der fünfzehnte, wurde eine Schweigeminute abgehalten. So etwas hatte es für die Mutter eines Fußballers noch nie gegeben. Die Spieler der Boca Juniors trugen Trauerbinden, die Fans des SSC Napoli skandierten Doña Totas Namen und schwenkten eine Flagge mit der Aufschrift: »Ruhe in Frieden, Mama«. Eine Zeitung ließ sich zu der Schlagzeile hinreißen: »Die Mutter des Fußballs ist tot«.
Maradona hatte eine 28-stündige Reise von Dubai auf sich genommen, um ihr Lebewohl zu sagen. »Kommen Sie sofort«, hatte die Nachricht von Alfredo Cahe, dem Hausarzt der Familie, gelautet. Doña Tota lag auf der Intensivstation des Los-Arcos-Krankenhauses in Buenos Aires. In den letzten Monaten ihres Lebens war sie aufgrund von Herz- und Nierenproblemen immer wieder intensivmedizinisch behandelt worden. Während eines seiner Besuche in Buenos Aires hatte Maradona ihr das neue Tattoo auf seinem Rücken gezeigt: eine türkisfarbene Rose mit einem in verschlungenen Lettern geschriebenen »Tota te amo« (dt. Tota, ich liebe dich) darunter.
Aber Diego schaffte es nicht mehr rechtzeitig. Noch im Flugzeug erhielt er von Dr. Cahe die Nachricht, dass seine Mutter verstorben sei. Benommen vor Schmerz fuhr er nach Tres Arroyos, zu dem Haus, in dem die Totenwache gehalten wurde. In weißem Hemd, dunkler Krawatte, schwarzem Jackett und einer Sonnenbrille, die seine verquollenen Augen verdeckte, verbrachte er die kommenden Stunden weinend neben ihrem Sarg, an seiner Seite seine neue Partnerin Verónica Ojeda. Trost spendeten ihm auch die anderen Anwesenden: Claudia Villafañe, Dalma, Gianinna, seine sieben Geschwister und sein Vater Don Diego.
»Meine Freundin, meine Königin, mein alles ist gegangen«, sagte Diego, als La Tota an einem heißen Novembertag 2011 auf dem Friedhof Jardín Bella Vista beigesetzt wurde.
Als Sohn einer von Immigranten aus Süditalien und Spanien beherrschten, stark religiös geprägten Kultur, die das Bild der selbstaufopfernden, einzigartigen Mutter verherrlicht, die ihren abtrünnigen Söhnen stets verzeiht, hatte er die Frau verloren, die nie einen Fehler machte, die eine, die ihn vor allen »Windmühlen beschützte«. Maradona, der seinen Ödipuskomplex mit ins Grab nehmen sollte, sagte einmal scherzhaft, dass seine Mutter seinen Vater nur deshalb geheiratet habe, weil sie ihm begegnet war, bevor sie Diego kennengelernt hatte.
La Tota gab etwas zu, das normalerweise ein Tabu ist, nämlich dass Diego ihr Lieblingssohn war. »Sie hat ein Faible für mich«, wusste Maradona. »An meinem 46. Geburtstag sah ich sie an und sagte: ›Du bist die erste Frau in meinem Leben, meine ewige Freundin. Ich habe dir alles zu verdanken, Tota, und ich werde dich immer lieben, mehr und mehr.‹«
Sie war die Mutter, die in Hunderten argentinischen Volksliedern besungen wird, in Tangos, Milongas und Chacareras, die sich alle aus echten Empfindungen speisen, aber zugleich ihre eigene Wirklichkeit konstruieren. Im beliebten »Cómo se hace un tango« (dt. Wie man einen Tango tanzt) wird ihr Folgendes gesungen: »Sei ganz Ohr, der Mensch, der dich verehrt, wird sprechen / heute, morgen, jederzeit, denn für mich / bist du nicht nur meine Mutter, sondern meine Freundin.«
»Der Sänger Joan Manuel Serrat sagte einmal, dass man nicht aufhört, Kind zu sein, um ein Elternteil zu werden, wenn die eigenen Eltern gestorben sind«, erzählt Guillermo Blanco, Pressesprecher Maradonas während seiner Zeit in Barcelona und seinen ersten Jahren in Italien. »Diego hat der Tod seiner Eltern, insbesondere der seiner Mutter, sehr mitgenommen. Die Verbindung zwischen diesen beiden Menschen war eine ganz besondere.«
Die Geschwister akzeptierten den Sonderstatus, den Diego in den Augen ihrer Mutter und der Welt innehatte. Einige von ihnen leben noch heute in der Nähe des Argentinos-Juniors-Stadions – vom Schicksal übergangene, einfache Sterbliche, Verwandte eines Halbgottes. Dieses Schicksal wird man nicht mehr los, ganz gleich, was man tut. Lalo und Hugo stellten sich der Herausforderung, die Erwartungen zu erfüllen, die in sie gesetzt wurden, und versuchten es mit einer Fußballkarriere, aber der zündende Funke sprang nicht über, und sie blieben nichts als »die Brüder von«.
Doña Tota fühlte sich wohl in ihrer Rolle als Mutter, nicht nur der von Maradona, sondern der einer ganzen Nation. Sie war die Sonne, um die alles kreiste, die Anführerin des Rudels. »Wenn Doña Tota etwas sagte, war es beschlossene Sache, und niemand, nicht einmal Diego, traute sich, etwas dagegen einzuwenden«, erinnerte sich Fernando Signorini. Sie war weitaus redseliger als Don Diego, es sei denn, sie sah fern oder huschte geschäftig hin und her, um Teller und Tabletts von und zu einem immer gedeckten Tisch zu tragen.
Obschon sie lange Zeit mit ihrem Sohn in Europa lebte, suchte die allzeit fürsorgliche Mutter stets nach einer Bestätigung dafür, dass sie zurückgeliebt wurde. Sie war eifersüchtig auf Claudia und all die anderen Freundinnen, was deren Leben nicht einfach machte. Diegos Abwesenheit frustrierte sie. Sie beklagte sich oft bei ihm, er habe sie in Buenos Aires »zurückgelassen«. Diego erinnerte sich, wie Doña Tota ihm am Telefon vorjammerte, wie einsam sie sei. Im Hintergrund waren deutlich die Geräusche von Freunden und Familie zu hören, denn sie war ständig von Menschen umgeben.
La Tota dachte, sie habe sich ausreichend gewappnet für das Unvermeidliche: dass ihr die Alte Welt den Sohn nehmen würde, sobald er erwachsen geworden war, und man sein Talent wie einen wertvollen Rohstoff handelte. Nicolau Casaus, Vizepräsident des FC Barcelona, erwähnt sie in seinem Bericht über die Vertragsvorverhandlungen mit Maradona: »Ich vermute, sie ist ungefähr so alt wie ihr Mann, aber angesichts ihres zerknitterten Äußeren ist das schwer zu sagen. Wenn ich mit ihr über den potenziellen Wechsel ihres Sohnes nach Barcelona spreche, sagt sie nur: ›So Gott will.‹«
Fußball bereitete Doña Tota ebenso viel Freude wie Schmerz. Er war die Fahrkarte, die sie aus Villa Fiorito herausbrachte und ihr Leben in ungeahnter Weise beschleunigte. Allerdings erhöhte sich damit auch die Unfallgefahr. »Bei der U-20-Weltmeisterschaft in Japan, die wir im Fernsehen verfolgten, kassierte Argentinien zunächst eine 0:1-Niederlage gegen die Sowjetunion«, erinnert sich Guillermo Blanco. »Und was tat La Tota? Sie war plötzlich nicht mehr bei uns in der Küche, sondern legte sich ins Bett, sie konnte die Anspannung nicht ertragen. Dann kam sie zurück, und Alves verwandelte einen Elfmeter für Argentinien. Davon gibt es sogar ein Foto in der El Gráfico. Danach legte sie sich wieder hin. Sie kam zurück, und Argentinien ging durch ein Tor von Ramón Díaz in Führung. Wieder legte sie sich hin, nur um rechtzeitig wieder dabei zu sein, als Diego ein Freistoßtor erzielte. Es war die totale Euphorie. Alle brüllten und lagen sich in den Armen.«
Maradonas Eltern liebten den Fußball, diese Leidenschaft war ihnen nicht aufgezwungen worden. Don Diego hatte früher sogar selbst für einige Amateurmannschaften in Esquina als Rechtsaußen gespielt. »Fußball war eines der wenigen Dinge, über das die Armen verfügen konnten«, sagt Blanco. Schon als El Pelusa bei den Cebollitas spielte, verpassten seine Eltern nur selten eines seiner Spiele. Chitoro wechselte häufig seine Arbeitsschichten, um dabei sein zu können. Dank José Trottas Pick-up-Taxiservice konnten sie oft zu Grillfesten fahren, wo sie mit anderen Familien aus der Mittelschicht in Kontakt kamen, deren Söhne das Gros der Cebollitas-Spieler stellten. Die meisten von ihnen wohnten ganz in der Nähe des Argentinos-Juniors-Stadions, eine Fahrtstunde, ja eine ganze Welt entfernt vom Haus der Maradonas.
Nachdem er seinen ersten Gehaltsscheck als Profifußballer erhalten hatte, lud Maradona seine Mutter in eine Pizzeria in Pompeya ein. »Nur wir zwei, wie ein Paar. Das ganze Geld ging dafür drauf«, erzählte Diego Jahre später.
Zu Hause gaben Doña Tota und Don Diego den Takt an. Er, der strenge Vater, der durchaus Funken sprühen konnte, sie, die versöhnliche Mutter. Einmal ignorierte Diego ihre Aufforderung, das Haus nicht zu verlassen, und ging zum Fußballspielen nach draußen. Dabei ruinierte er die Flecha-Sneaker, die er vor kurzem erst bekommen hatte. Seine Eltern hatten Wochen darauf gespart. Don Diego schäumte vor Wut und verpasste seinem Sohn eine Abreibung. Als Doña Tota hörte, was geschah, kam sie angerannt, zeigte mit dem Finger auf ihren Mann und drohte: »Wenn du meinem Sohn auch nur ein Haar krümmst, bringe ich dich um, wenn du heute Nacht schlafend im Bett liegst.«