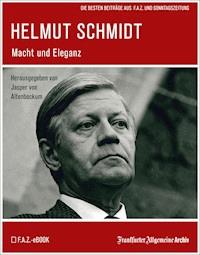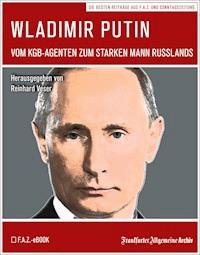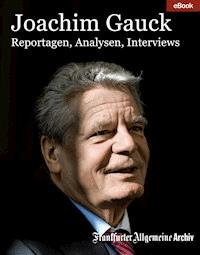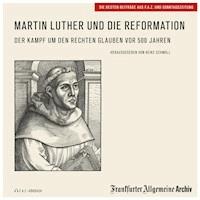Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Marcel Reich-Ranicki ist tot. Alle seine Anekdoten, Leidenschaften, Kritiken sind jetzt nur noch Bestandteile unserer Erinnerung. Erst dadurch spürt man, was dieser große Mann für ein Geschenk war; kein "öffentliches Unglück", wie es in Thomas Manns "Lotte in Weimar" über Größe heißt, sondern ein Glück. In diesem eBook finden sich F.A.Z.-Beiträge von und über Marcel Reich-Ranicki. Sie vermitteln ein lebendiges Bild vom außergewöhnlichen Leben des großen Kritikers und dokumentieren sein Wirken in vier Jahrzehnten. Das eBook enthält exklusives Bildmaterial der F.A.Z.-Fotografen Barbara Klemm, Frank Röth und Daniel Pilar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcel Reich-Ranicki
und die Frankfurter Allgemeine Zeitung
Herausgegeben von Hubert Spiegel
F.A.Z.-eBook 21
Frankfurter Allgemeine Archiv
Projektleitung: Franz-Josef Gasterich
Produktionssteuerung: Christine Pfeiffer-Piechotta
Redaktion und Gestaltung: Hans Peter Trötscher
eBook-Produktion: rombach digitale manufaktur, Freiburg
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb: [email protected]
© 2013 F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main.
Titelgestaltung: Hans Peter Trötscher. Foto: F.A.Z.-Foto / Barbara Klemm
ISBN: 978-3-89843-231-1
Ein sehr großer Mann
Marcel Reich-Ranicki ist tot.
Der größte Literaturkritiker unserer Zeit verkörperte, in Verfolgung und Ruhm, das zwanzigste Jahrhundert. Er war ein permanenter Protest gegen Langeweile und Mittelmaß. Niemand vermochte einer ganzen Gesellschaft die Bedeutung von Literatur so zu vermitteln wie er.
Von Frank Schirrmacher
Um 14 Uhr hatte ich ihn noch besucht. Sein Sohn Andrew war an seinem Bett im Pflegeheim, wo er seit Tagen, ja, seit Wochen war. Marcel Reich-Ranicki erkannte einen. Und es war keine Einbildung, sondern, nach einhelligem Zeugnis aller Umstehenden, unverkennbare Tatsache, dass er sich mit interessiertem Blick aufzurichten versuchte, als ich ihm sagte, ich hätte sensationelle Nachrichten aus dem literarischen Betrieb. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag. Doch zwei Stunden später kam die Nachricht, dass Marcel Reich-Ranicki, der große Kritiker in der Geschichte der deutschen Literatur und der größte unter seinen Zeitgenossen und Nachgeborenen, gestorben war.
Es ist unmöglich, so zu tun, als könnte man ihm trauernd abgeklärt nachrufen. Wie oft haben wir mit ihm nicht über Nachrufe, die anderen galten, geredet! Ich weiß genau, was er von Nachrufen erwartet. In dem Augenblick, da ich dies schreibe, höre ich seine Stimme: »Herrgott, Sie müssen zeigen, was der Kerl taugte, nicht, wo er zur Schule ging!« Überhaupt machte er sich geradezu operative Gedanken über das Verhältnis von Tod und Kritik. Bücher von über Achtzigjährigen wurden grundsätzlich nicht verrissen. »Ich will nicht, dass wir einen Tag später den Nachruf bringen müssen«, lautete die meistens recht fröhlich vorgebrachte Begründung.
Freude des Kritikers: Marcel Reich-Ranicki 2008 gut gelaunt in seinem Büro. F.A.Z.-Foto / Helmut Fricke
Ich weiß, was er erwarten würde. Natürlich würden ihn Superlative in diesem Nachruf nicht stören: der Größte, Wichtigste, Witzigste, Gefährlichste – und der Witz ist ja, das würde auch alles stimmen. Vielleicht hätte er gefordert, dass man einen Nachruf auf ihn vorbereitet hätte, wie er das selbst als Literaturchef zu tun pflegte. »Ich will keinen Nervenkrieg«, sagte er dann. Aber bei denen, die ihm wichtig waren und die ihm ans Herz gewachsen waren, tat er das nicht. Er schloss sich dann ein und schrieb seine emphatischsten Stücke. Wir alle merkten, dass die rhetorische Floskel in diesen Fällen wirklich stimmte: die Toten, Wolfgang Koeppen oder Siegfried Unseld, fehlten ihm von da an unablässig. Noch Jahre später kam er auf sie zurück, wie einer, der immer noch auf eine Verabredung wartet, die niemals eintreffen wird.
Und so geschieht es uns nun mit ihm. Dass er nicht mehr da ist, nie wieder nach Neuigkeiten fragen wird, nie wieder seine Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreiben wird, nie wieder poltert oder rühmt oder – ja, auch das war eine Essenz seines Wesens – liebt: All das ist jetzt nur als eine Abwesenheit und Verwaisung zu verbuchen.
Wir werden lesen, und zu Recht lesen, dass mit ihm eine Epoche zu Ende geht. Richtig deuten können wird man lange nicht, was das für eine Epoche war. Mehr jedenfalls als das »Literarische Quartett« und F.A.Z. und Gruppe 47 und deutsche Nachkriegsliteratur. Dieser Mann war in Verfolgung und Ruhm die Personifikation des zwanzigsten Jahrhunderts. Da lebte eben noch in Frankfurt am Main ein Mensch, der sich als blutjunger Mann voller Lust und Lebensfreude in die Literatur des Landes und die Kultur der Weimarer Republik vergrub; einer, der das alles wirklich liebte und zum Leben brauchte. Doch gleichzeitig ein Junge, der als Jude mit jedem Geburtstag ein Jahr tiefer in die Epoche des Nationalsozialismus hineinwuchs. Und während er, wie er oft erzählte, jedes Jahr in sich immer nur mehr Begeisterung und Liebe für Thomas Mann und Brecht und Gründgens und Goethe entdeckte, wuchs mit jedem Jahr auf der anderen Seite der Hass: der Hass wohlgemerkt eines ganzen Staates und all seiner Bürokratien auf den jungen Juden, der nichts anderes wollte, als ins Deutsche Theater zu gehen. Zwei seiner lakonischen Sätze in den Erinnerungen: »Ich hatte noch eine Eintrittskarte für die Premiere am Abend. Die konnte ich nun nicht mehr verwenden.« Warum nicht? Weil er an diesem Tag deportiert wurde.
Einmal zeigte er mir das Polizeirevier, wo man ihm 1938 die Deportation nach Polen eröffnete. Es ist auch heute noch ein Polizeirevier. Über dem Eingang ein Adler, der einen leeren Kreis in seinen Fängen trägt. Das Hakenkreuz, das da einst zu sehen war, hat man herausgeschlagen. Unsinnig, ihn nach seinen Gefühlen zu fragen. Er leugnete sie. Anders als Tosia, seine vor ihm verstorbene, unvergessliche Frau, hat er die Traumatisierung gewissermaßen ausquartiert. Das hieß nicht, dass sie verschwunden war. Sie wartete draußen vor der Tür, immer begierig, es sich wieder bei ihm bequem zu machen. Er schaute ständig nach, ob noch abgeschlossen war. Er setzte sich niemals mit dem Rücken zur Tür. Er rasierte sich mehrmals täglich, weil unrasierte Menschen im Warschauer Ghetto aufgegriffen wurden. Es traumatisierten ihn die Dinge, die kommen könnten und die sich als böse Vorahnungen in der bürgerlichen Sozietät zu verpuppen schienen: die Fassbinder-Kontroverse und der Historiker-Streit, beides hat er bis zuletzt nicht wirklich überwunden.
Teofila und Marcel Reich-Ranicki. F.A.Z.-Foto / Barbara Klemm.
So viele Schriftsteller haben mir im Laufe der Jahre erzählt – und viele haben auch darüber geschrieben –, wie es war, als Marcel Reich-Ranicki im Alter von 38 Jahren aus dem kommunistischen Polen nach Deutschland kam. Ein Mann, der Chopin-Klavierauszüge und -Aufnahmen (weil die in Polen billiger waren) in der Tasche hatte. Ich weiß nicht, wie man das Berührende dieses Ereignisses anders ins Bild bringen kann als durch pures chronologisches Referat: ein junger Jude, der genau zwanzig Jahre nach seiner Deportation mit seiner Frau nach Deutschland zurückkehrt, die Familie unterdessen ermordet, die Familie der Frau unterdessen ermordet – und er bringt Chopin-Partituren mit als Gastgeschenk. Günter Grass, den Reich-Ranicki in Polen für einen bulgarischen Spion hielt, hat einiges davon im »Tagebuch einer Schnecke« erzählt.
Wir alle haben ihn erst kennengelernt, als er auf der Höhe seines Ruhms und seiner Macht war. Sein Humor und seine Schlagfertigkeit waren atemberaubend, auch seine Respektlosigkeit. Sehr berühmte Politiker drangen darauf, in der »Frankfurter Anthologie« Gedichte zu rezensieren. Sie alle, ohne Ausnahme, bekamen Variationen der gleichen Antwort: »Es muss in diesem Land möglich sein, dass es etwas gibt, woran sich die Politik nicht vergreift.« Den Literaturteil der F.A.Z. hat er erfunden und, wie es ein Schriftsteller einst sagte, aus einem Fünfzehn-Quadratmeter-Zimmer die literarische Welt regiert. Seine Forderungen an eine hochtheoretisch, von den 68er-Jahren adornitisch geprägte Redaktion waren eindeutig: Klarheit, keine Fremdworte, leidenschaftliches Urteil. »Als ich hierherkam«, sagte er einmal, »haben die Redakteure die Gedichte ihrer Tanten gedruckt.«
Es ist ihm, in der zweiten Lebenshälfte, in diesem Land kein Unrecht geschehen, wie er selbst einmal sagte; aber der Betrieb mit seiner Eifersucht und seiner Kleinlichkeit hat ihm manches versagt. Natürlich hätte er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verdient: Wenn einer Frieden gestiftet hat, in der verwundeten oder korrumpierten deutschen Literatur der Nachkriegszeit, dann war es Marcel Reich-Ranicki.
Ich habe achtundzwanzig Jahre mit ihm zusammengearbeitet, lange Zeit in allerengster Nähe. Er liebte das Telefon und hätte, wäre er jünger gewesen, das Internet als ideales Instrument seiner Eigenschaften – Neugierde, Freude am Klatsch und permanentes Informiertsein – geliebt. In Ermangelung von E-Mails nutzte er das Telefon. Und wie einst im polnischen Versteck glaubte er stets, er müsse Spannung selbst in den alltäglichsten Gesprächen erzeugen, um den Gesprächspartner in Aufregung und Laune zu bringen. Grundsätzlich begann ein Telefonat mit Sätzen wie »Sie wissen, nicht, was sich abspielt.« Oder: »Ganz Deutschland diskutiert nur eine Sache, und Sie haben noch immer nichts gemerkt.« Ach, es war herrlich, denn es war der permanente Protest gegen Langeweile und Mittelmaß.
Einen wie ihn werden wir nicht wiedersehen. Es stimmt nicht, dass jeder ersetzbar ist. Manche werden im Tod zur dauernden Abwesenheit, und er ist nun eine solche. Ob die deutschen Autoren, die unter ihm litten, wissen, dass dieser Schmerz eine Art Existenzbestätigung war? Es ist nicht schön, verrissen zu werden. Aber es bedeutet unendlich viel, wenn eine Gesellschaft der Meinung ist, nichts sei gerade wichtiger als das neue Buch von Günter Grass, Martin Walser oder Wolfgang Koeppen. Das hat er geschafft und eine Prominenz erreicht, in der er, noch auf der Ebene des Supermarkteinkaufs, als Literaturkritiker mit dem Begriff der Popularität selbst verschmolz. »Ich kenne Sie, ich kenne Sie«, begrüßte ihn einmal ein Verkäufer oder Tankwart, so ganz genau ist die Geschichte nicht zu rekonstruieren, »ich kenne Sie aus dem Fernsehen. Sie sind doch der Robert Lembke.«
Marcel Reich-Ranicki ist tot. Alle seine Anekdoten, Leidenschaften, Kritiken sind jetzt nur noch Bestandteile unserer Erinnerung. Erst dadurch spürt man, was dieser große Mann für ein Geschenk war; kein »öffentliches Unglück«, wie es in Thomas Manns »Lotte in Weimar« über Größe heißt, sondern ein Glück. Man wüsste so gerne, dass er das jetzt liest. Und, wie er es bei unserem letzten Geburtstagsartikel tat, in leicht gedehnter und sachlicher Weise sagt: »Jaaaa, ich halte es für möglich, dass ich nach meinem Tode eine Legende werde.« Das ist er geworden. Mehr als das: eine reine Freude darüber, dass er war, noch in der Trauer, dass er nicht mehr ist.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 19.9.2013
Ein Leben
Goethe, Heine oder Thomas Mann – das waren Reich-Ranickis Zeitgenossen.
Von Claudius Seidl
Es sind die Menschen, nicht die Werke, die von uns gehen – aber wahrscheinlich gab es in jenem Deutschland, zu dem Marcel Reich-Ranicki sich so selbstbewusst bekannte, niemanden, bei dem sich das eine vom anderen schwerer trennen ließ. Sein Leben war sein Werk, sein Werk war sein Leben: Das war die Provokation des Marcel Reich-Ranicki. Und das bleibt, wenn alle Trauerreden gehalten sind, die Herausforderung: an uns Deutsche, die wir uns jetzt ohne ihn zurechtfinden müssen in der eigenen Kultur. An uns politische Wesen, Meinungsproduzenten, Teilhaber an der demokratischen Öffentlichkeit, die wir glauben, dass Kritik nicht bloß ein schönes griechisches Fremdwort ist für Nörgelei und schlechte Laune. Sondern eine produktive Kraft und die Pflicht jedes freien Menschen.
Denn einerseits hat ja Reich-Ranicki ein Werk hinterlassen, das ganz sicher und ungefährdet im Kanon steht. Ausgerechnet er, der, als er jünger war, die Rolle des Kritikers mit Lust und Temperament genau so spielte, wie das ein deutsches Originalgenie nicht leiden kann, nämlich scharf, manchmal böse und immer selbstgewiss; ausgerechnet er, der mit seiner unmissverständlichen Kritik so manchen kritisierten Autor zu der Frage provozierte, was denn, außer Meinungen und Urteilen, dieser Kritiker noch vorzuweisen habe, ausgerechnet dieser Marcel Reich-Ranicki hat 1999 auf all diese Fragen eine unwiderlegbare Antwort gegeben. Sein Buch hieß schlicht »Mein Leben«, und weil das eben dieses Leben war, das Leben eines Mannes, den die Deutschen ermorden wollten; und der sich rettete, durch seinen Mut, die Liebe zu seiner Frau und die Liebe zur deutschen Literatur, deshalb verneigten sich die Leser: vor diesem Leben. Auf die respektlose Frage, die Marcel Reich-Ranicki nicht dem ehrbarsten Autor und nicht dem ernstesten Thema ersparte, die Frage, ob das denn gute Literatur sei, gab es nun eine Antwort. Reich-Ranicki hatte es allen gezeigt.
Dabei hatte er, andererseits, diese Legitimation gar nicht nötig – und vielleicht offenbart sich erst jetzt, da er uns zu fehlen beginnt, wie modern, wie zeitgemäß, wie richtig jene Form der Kritik war, die Reich-Ranicki immer praktiziert hat. Er schrieb nur über Bücher und sprach dabei doch immer von der menschlichen Bedingung, und genau das hat die Kritiker dieses Kritikers so oft zum Widerspruch gereizt. Er vereinfache zu stark, er spitze immer nur zu, was dem Autor gelungen sei und was nicht. Es fehle ihm das Gespür, die Texte gegen die Intentionen des Autors zu lesen, er sei nicht auf dem Stand der Theorie. Und überhaupt, sein Lieblingssatz: »Es gibt gute Bücher, und es gibt schlechte Bücher« werde dem Reichtum und der Vielfalt des literarischen Diskurses nicht gerecht.
Reich-Ranicki ließ sich von solchen Einwänden nicht verunsichern. Er hatte ein existentielles Verhältnis zu Büchern, für ihn war die Literatur eine Frage von Leben und Tod gewesen. Und wie interessant auch immer die Ergebnisse anderer Lektüren waren – Reich-Ranicki hatte mit den Fragen, die er an die Bücher stellte, doch immer recht: Er fragte nach dem Leben in der Literatur; er wollte wissen, ob da zwischen zwei Buchdeckeln die Schönheit sei, die Wahrheit, die Kritik des schlechten Lebens und, am wichtigsten, der Vorschein eines besseren. Darunter machte er es nicht – und in den Kritiken von Marcel Reich-Ranicki kann man lesen, dass man nicht nur als Autor, sondern auch als Kritiker groß sein muss, um solchen Fragen gewachsen zu sein.
Wer solche Fragen an die Bücher hat, wird sich mit den Antworten des Kanons und der Festreden nicht zufriedengeben. Die deutsche Literatur hatte ihm das Leben gerettet, er revanchierte sich, indem er die deutsche Literatur am Leben hielt. Goethe, Heine, Thomas Mann – wer Reich-Ranicki vorwarf, dass er konservativ sei, hatte das Wichtigste nicht verstanden: Das waren seine Zeitgenossen, seine Gesprächspartner. Gerade als Leser seiner Kolumne in den vergangenen zehn Jahren konnte man erfahren, wie fremd ihm aller Kulturpessimismus war und wie unverständlich die Sehnsucht nach irgendeiner guten alten Zeit. Ohne Bedauern schrieb er von Autoren, welche überholt, vergessen, dementiert waren vom Lauf der Zeit. Und umso heftiger beharrte er darauf, dass Goethe nichts sei, wenn wir Heutigen uns nicht in seinen Figuren erkennten. Und wenn seine Sätze nicht auch dazu taugten, zum Beispiel das deutsche Fernsehen zu kritisieren.
Denn darum ging es, als Reich-Ranicki damit anfing, auch in die Fernsehkameras hineinzusprechen. Nicht er biederte sich dem Medium an. Das Fernsehen lag ihm zu Füßen und gab sich ihm hin. Reich-Ranicki blieb auch dort Kritiker, in einem emphatischen Sinn: Er musste nicht einmal über Bücher sprechen – schon wenn er nur auftrat, war das die Kritik der falschen Verhältnisse. Und wenn er sprach, war das schon der Vorschein des Besseren.
Und das ist die Zumutung, die uns Reich-Ranicki hinterlassen hat: Kritik ist kein Luxus, den man sich leistet, wenn alles andere getan ist. Kritik ist eine Lebenspraxis. Und Kritik ist nichts, wenn sie sich nicht aus aufrichtiger Liebe speist.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 20.9.2013
Trauerfeier für Reich-Ranicki
Wo Literatur ist, wird seine Stimme hörbar bleiben
Von Hubert Spiegel
Die literarische Welt hat Abschied von Marcel Reich-Ranicki genommen. Nur die literarische Welt? Nein, denn wie die Reaktionen auf den Tod des Literaturkritikers am Mittwoch letzter Woche gezeigt haben, ist Marcel Reich-Ranicki bis an sein Lebensende eine Figur des öffentlichen Lebens geblieben, die weit über literarische Zirkel hinaus gewirkt hat.
Dass viele hundert Trauergäste zusammen mit Reich-Ranickis Sohn Andrew Ranicki und der Enkelin Carla an der Feier in der Halle des Frankfurter Hauptfriedhofs teilnehmen wollten, hätte ihm gefallen, sagte Rachel Salamander, die in ihrer Rede nicht nur Abschied von einem langjährigen Freund und Vertrauten nahm, sondern auch bündig feststellte, Deutschland habe Marcel Reich-Ranicki viel zu verdanken. In dem Land, aus dem die Mörder seiner Eltern und seines Bruders stammten, habe er stets das Gute herausgestellt: Er sei weder Mahner noch Rächer gewesen, »nicht Kritiker der Deutschen, sondern Literaturkritiker«. Als Idealist habe er Literaturkritik auch als eine Art »ästhetischer Erziehung« der Deutschen betrieben.
Frank Schirrmacher, für das Feuilleton zuständiger Herausgeber und Reich-Ranickis unmittelbarer Nachfolger im Amt des Literaturchefs, hatte keinen Zweifel, dass Reich-Ranicki auch seine eigene Trauerfeier in bewährter Manier rezensiert hätte: unbestechlich und nach Kriterien ganz eigener Art. Eine Beerdigung ohne Polizeiwagen vor dem Friedhof tauge nichts, habe Reich-Ranicki ihm einmal gesagt. Wo die Polizei fehle, fehlten nämlich auch die hohen Repräsentanten des Staates.
Die empfindsame Seite des Kritikers
An Polizeiwagen herrschte in Frankfurt kein Mangel. Bundespräsident Joachim Gauck war gekommen, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier dachte über das eigene Bundesland hinaus, als er sagte, ganz Deutschland trauere um eine außergewöhnliche Persönlichkeit, Petra Roth dankte für manchen Rat in kulturpolitisch schweren Zeiten, und Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann würdigte Reich-Ranicki als einen Menschen, der die Abgründe wie die Höhen des 20. Jahrhunderts durchmessen habe wie wenige sonst.
Zu Klängen von Bach, Schumann und Puccini war an diesem Nachmittag immer wieder auch von der Musik die Rede. Zusammen mit der Literatur bildete sie, wie seine Freunde wussten, jenes legendäre, oft zitierte »portative Vaterland«, das er, der 1920 in Polen geboren wurde, im Berlin der dreißiger Jahre aufwuchs und von den Nazis 1938 deportiert wurde, sich in der Literatur inszenieren musste, wie Rachel Salamander sagte. Rüdiger Volhard, einer der engsten Freunde Reich-Ranickis, wies daraufhin, dass die geradezu besessene Liebe des oft polternden Kritikers aber nicht nur der Literatur und der Musik, sondern allen schlechten Erfahrungen zum Trotz immer auch den Menschen gegolten habe.
»Nicht Kritiker der Deutschen, sondern Literaturkritiker.« F.A.Z.-Foto / Frank Röth
Salomon Korn, den eine fast dreißigjährige Freundschaft mit Reich-Ranicki verband, erinnerte in seiner berührenden Ansprache an die Schreckenszeit, die Marcel Reich-Ranicki und seine vor zwei Jahren verstorbene Ehefrau Tosia nach der Deportation zuerst im Warschauer Getto und danach im stets gefährdeten Kellerversteck des polnischen Bauern Bolek Gawein verbringen mussten. Die liebevolle, empfindsame Seite, die Korn und seine Frau Maruscha so oft im kleinsten Kreis an Reich-Ranicki beo-bachtet hätten, habe er in der Öffentlichkeit kaum einmal gezeigt: »Um zu überleben, hatte er eine Palisade um sein Innerstes errichtet – und diesen Überlebensschutzwall nie wieder gänzlich abgebaut.«
Held des Vergebens
Dass Marcel Reich-Ranicki dennoch viele Menschen nicht nur erreicht, belehrt und unterhalten, sondern auch berührt hat, machte Thomas Gottschalk deutlich. Der Entertainer würdigte den Fernsehunterhalter Reich-Ranicki und bekannte, dass er in der 1999 erschienen Autobiographie »Mein Leben« nicht nur seine eigene Jugend im Bild des Berliner Gymnasiasten Marcel Reich wiedergefunden habe, sondern in dem gereiften Überlebenden der Judenverfolgung einen Helden des Vergebens, aber Gott sei dank eben nicht des Vergessens« entdeckt habe. In den Internetforen, in denen sonst vor allem gelästert und genörgelt werde, gehe es nun oft geradezu nachdenklich und feierlich zu: »Dieser streitbare Mann hat erreicht, dass in diesem streitlustigen Medium kurzfristig Friede einzog.«
Marcel Reich-Ranicki ist tot. Aber seine Stimme werde auch in Zukunft überall dort zu hören sein, wo Literatur sei, sagte Frank Schirrmacher. Schüler im klassischen Sinne habe sein Vorgänger als Literaturchef nie gehabt, aber er habe in Rachel Salamander, die künftig als Juryvorsitzende den Marcel-Reich-Ranicki-Preis der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vergeben wird, eine Repräsentantin seines Geistes. Dass er sich von denjenigen, die sich angemaßt hatten, Deutschland verkörpern zu wollen, die Liebe zur deutschen Kultur nie hat nehmen lassen, das ist wohl Marcel Reich-Ranickis größter Triumph über den Tod hinaus.
Aus FAZ.Net vom 26.9.2013
Persönlichkeitsbildung
Ein Tag in meinem Leben
Am 22. Juli 1942 begann die Deportation der Juden aus dem Warschauer Getto. Ich musste den Befehl übersetzen. Dann heiratete ich Teofila: Eine Bundestagsrede zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus.
Von Marcel Reich-Ranicki
Ich soll heute hier die Rede halten zum jährlichen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Doch nicht als Historiker spreche ich, sondern als ein Zeitzeuge, genauer: als Überlebender des Warschauer Gettos. 1938 war ich aus Berlin nach Polen deportiert worden. Bis 1940 machten die Nationalsozialisten aus einem Warschauer Stadtteil den von ihnen später sogenannten »jüdischen Wohnbezirk«. Dort lebten meine Eltern, mein Bruder und schließlich ich selbst. Dort habe ich meine Frau kennengelernt.
Seit dem Frühjahr 1942 hatten sich Vorfälle, Maßnahmen und Gerüchte gehäuft, die von einer geplanten generellen Veränderung der Verhältnisse im Getto zeugten. Am 20. und 21. Juli war dann für jedermann klar, dass dem Getto Schlimmstes bevorstand: Zahlreiche Menschen wurden auf der Straße erschossen, viele als Geiseln verhaftet, darunter mehrere Mitglieder und Abteilungsleiter des »Judenrates«. Beliebt waren die Mitglieder des »Judenrates«, also die höchsten Amtspersonen im Getto, keineswegs. Gleichwohl war die Bevölkerung erschüttert: Die brutale Verhaftung hat man als ein düsteres Zeichen verstanden, das für alle galt, die hinter den Mauern lebten.
Am 22. Juli fuhren vor das Hauptgebäude des »Judenrates« einige Personenautos vor und zwei Lastwagen mit Soldaten. Das Haus wurde umstellt. Den Personenwagen entstiegen etwa fünfzehn SS-Männer, darunter einige höhere Offiziere. Einige blieben unten, die anderen begaben sich forsch und zügig ins erste Stockwerk zum Amtszimmer des Obmanns, Adam Czerniaków.
Im ganzen Gebäude wurde es schlagartig still, beklemmend still. Es sollten wohl, vermuteten wir, weitere Geiseln verhaftet werden. In der Tat erschien auch gleich Czerniakóws Adjutant, der von Zimmer zu Zimmer lief und dessen Anordnung mitteilte: Alle anwesenden Mitglieder des »Judenrates« hätten sofort zum Obmann zu kommen. Wenig später kehrte der Adjutant wieder: Auch alle Abteilungsleiter sollten sich im Amtszimmer des Obmanns melden. Wir nahmen an, dass für die offenbar geforderte Zahl von Geiseln nicht mehr genug Mitglieder des »Judenrates« (die meisten waren ja schon am Vortag verhaftet worden) im Haus waren.
Kurz darauf kam der Adjutant zum dritten Mal: Jetzt wurde ich zum Obmann gerufen, jetzt bin wohl ich an der Reihe, dachte ich mir, die Zahl der Geiseln zu vervollständigen. Aber ich hatte mich geirrt. Auf jeden Fall nahm ich, wie üblich, wenn ich zu Czerniaków ging, einen Schreibblock mit und zwei Bleistifte. In den Korridoren sah ich starkbewaffnete Posten. Die Tür zum Amtszimmer Czerniakóws war, anders als sonst, offen.
Er stand, umgeben von einigen höheren SS-Offizieren, hinter seinem Schreibtisch. War er etwa verhaftet? Als er mich sah, wandte er sich an einen der SS-Offiziere, einen wohlbeleibten, glatzköpfigen Mann – es war der Leiter der allgemein »Ausrottungskommando« genannten Hauptabteilung Reinhard beim SS- und Polizeiführer, der SS-Sturmbannführer Höfle. Ihm wurde ich von Czerniaków vorgestellt, und zwar mit den Worten: »Das ist mein bester Korrespondent, mein bester Übersetzer.« Also war ich nicht als Geisel gerufen.
Höfle wollte wissen, ob ich stenographieren könne. Da ich verneinte, fragte er mich, ob ich imstande sei, schnell genug zu schreiben, um die Sitzung, die gleich stattfinden werde, zu protokollieren. Ich bejahte knapp. Daraufhin befahl er, das benachbarte Konferenzzimmer vorzubereiten. Auf der einen Seite des langen, rechteckigen Tisches nahmen acht SS-Offiziere Platz, unter ihnen Höfle, der den Vorsitz hatte. Auf der anderen saßen die Juden: neben Czerniaków die noch nicht verhafteten fünf oder sechs Mitglieder des »Judenrates«, ferner der Kommandant des Jüdischen Ordnungsdienstes, der Generalsekretär des »Judenrates« und ich als Protokollant.
An den beiden zum Konferenzraum führenden Türen waren Wachtposten aufgestellt. Sie hatten, glaube ich, nur eine einzige Aufgabe: Furcht und Schrecken zu verbreiten. Die auf die Straße hinausgehenden Fenster standen an diesem warmen und besonders schönen Tag weit offen.
»1938 war ich aus Berlin nach Polen deportiert worden.« Marcel Reich- Ranicki am Rednerpult des Deutschen Bundestages bei seiner Rede zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. F.A.Z.-Foto / Jens Gyarmaty
So konnte ich genau hören, womit sich die vor dem Haus in ihren Autos wartenden SS-Männer die Zeit vertrieben: Sie hatten wohl ein Grammophon im Wagen, einen Kofferapparat wahrscheinlich, und hörten Musik und nicht einmal schlechte. Es waren Walzer von Johann Strauß, der freilich auch kein richtiger Arier war. Das konnten die SS-Leute nicht wissen, weil Goebbels die nicht ganz rassereine Herkunft des von ihm geschätzten Komponisten verheimlichen ließ.
Höfle eröffnete die Sitzung mit den Worten: »Am heutigen Tag beginnt die Umsiedlung der Juden aus Warschau. Es ist euch ja bekannt, dass es hier zu viel Juden gibt. Euch, den ,Judenrat‘, beauftrage ich mit dieser Aktion. Wird sie genau durchgeführt, dann werden auch die Geiseln wieder freigelassen, andernfalls werdet ihr alle aufgeknüpft, dort drüben.« Er zeigte mit der Hand auf den Kinderspielplatz auf der gegenüberliegenden Seite der Straße. Es war eine für die Verhältnisse im Getto recht hübsche Anlage, die erst vor wenigen Wochen feierlich eingeweiht worden war: Eine Kapelle hatte aufgespielt, Kinder hatten getanzt und geturnt, es waren, wie üblich, Reden gehalten worden.
Jetzt also drohte Höfle, den ganzen »Judenrat« und die im Konferenzraum anwesenden Juden auf diesem Kinderspielplatz aufzuhängen. Wir spürten, dass der vierschrötige Mann, dessen Alter ich auf mindestens vierzig schätzte – in Wirklichkeit war er erst 31 Jahre alt –, nicht die geringsten Bedenken hätte, uns sofort erschießen oder eben »aufknüpfen« zu lassen.
Schon das (übrigens unverkennbar österreichisch gefärbte) Deutsch zeugte von der Primitivität und Vulgarität dieses SS-Offiziers.
So schnoddrig und sadistisch Höfle die Sitzung eingeleitet hatte, so sachlich diktierte er einen mitgebrachten Text, betitelt »Eröffnungen und Auflagen für den ,Judenrat‘«. Freilich verlas er ihn etwas mühselig und schwerfällig, mitunter stockend: Er hatte dieses Dokument weder geschrieben noch redigiert, er kannte es nur flüchtig. Die Stille im Raum war unheimlich, und sie wurde noch intensiver durch die fortwährenden Geräusche: das Klappern meiner alten Schreibmaschine, das Klicken der Kameras einiger SS-Führer, die immer wieder fotografierten, und die aus der Ferne kommende, leise und sanfte Weise von der schönen, blauen Donau. Haben diese eifrig fotografierenden SS-Führer gewusst, dass sie an einem historischen Vorgang teilnahmen?
Von Zeit zu Zeit warf mir Höfle einen Blick zu, um sich zu vergewissern, dass ich auch mitkäme. Ja, ich kam schon mit, ich schrieb, dass »alle jüdischen Personen«, die in Warschau wohnten, »gleichgültig welchen Alters und Geschlechts«, nach Osten umgesiedelt würden. Was bedeutete hier das Wort »Umsiedlung«? Was war mit dem Wort »Osten« gemeint, zu welchem Zweck sollten die Warschauer Juden dorthin gebracht werden? Darüber war in Höfles »Eröffnungen und Auflagen für den ,Judenrat‘« nichts gesagt.
Wohl aber wurden sechs Personenkreise aufgezählt, die von der Umsiedlung ausgenommen seien – darunter alle arbeitsfähigen Juden, die kaserniert werden sollten, alle Personen, die bei deutschen Behörden oder Betriebsstellen beschäftigt waren oder die zum Personal des »Judenrats« und der jüdischen Krankenhäuser gehörten. Ein Satz ließ mich plötzlich aufhorchen: Die Ehefrauen und Kinder dieser Personen würden ebenfalls nicht »umgesiedelt«.
Unten hatte man inzwischen eine andere Platte aufgelegt: Nicht laut zwar, doch ganz deutlich konnte man den frohen Walzer hören, der von »Wein, Weib und Gesang« erzählte. Ich dachte mir: Das Leben geht weiter, das Leben der Nichtjuden. Und ich dachte an sie, die jetzt in der kleinen Wohnung mit einer graphischen Arbeit beschäftigt war, ich dachte an Tosia, die nirgends angestellt und also von der »Umsiedlung« nicht ausgenommen war.
Die Präsidenten des Bundestags und des Bundesverfassungsgerichts, der Bundespräsident und die Kanzlerin begleiten Marcel Reich-Ranicki zum Rednerpult. F.A.Z.-Foto / Jens Gyarmaty
Höfle diktierte weiter. Jetzt war davon die Rede, dass die »Umsiedler« fünfzehn Kilogramm als Reisegepäck mitnehmen dürften sowie »sämtliche Wertsachen, Geld, Schmuck, Gold usw.«. Mitnehmen durften oder mitnehmen sollten? – fiel mir ein. Noch am selben Tag, am 22. Juli 1942, sollte der Jüdische Ordnungsdienst, der die Umsiedlungsaktion unter Aufsicht des »Judenrates« durchführen musste, sechstausend Juden zu einem an einer Bahnlinie gelegenen Platz bringen, dem Umschlagplatz. Von dort fuhren die Züge in Richtung Osten ab. Aber noch wusste niemand, wohin die Transporte gingen, was den »Umsiedlern« bevorstand.
Im letzten Abschnitt der »Eröffnungen und Auflagen« wurde mitgeteilt, was jenen drohte, die etwa versuchen sollten, »die Umsiedlungsmaßnahmen zu umgehen oder zu stören«. Nur eine einzige Strafe gab es, sie wurde am Ende eines jeden Satzes refrainartig wiederholt: »... wird erschossen«.
Wenige Augenblicke später verließen die SS-Führer mit ihren Begleitern das Haus. Kaum waren sie verschwunden, da verwandelte sich die tödliche Stille nahezu blitzartig in Lärm und Tumult: Noch kannten die vielen Angestellten des »Judenrates« und die zahlreichen wartenden Bittsteller die neuen Anordnungen nicht. Doch schien es, als wüssten oder spürten sie schon, was sich eben ereignet hatte – dass über die größte jüdische Stadt Europas das Urteil gefällt worden war, das Todesurteil.
Ich begab mich schleunigst in mein Büro, denn ein Teil der von Höfle diktierten »Eröffnungen und Auflagen« sollte innerhalb von wenigen Stunden im ganzen Getto plakatiert werden. Ich musste mich sofort um die polnische Übersetzung kümmern. Langsam diktierte ich den deutschen Text, den meine Mitarbeiterin Gustawa Jarecka sofort polnisch in die Maschine schrieb.
Ihr also, Gustawa Jarecka, diktierte ich am 22. Juli 1942 das Todesurteil, das die SS über die Juden von Warschau gefällt hatte.
Als ich bei der Aufzählung der Personengruppen angelangt war, die von der »Umsiedlung« ausgenommen sein sollten, und dann der Satz folgte, dass sich diese Regelung auch auf die Ehefrauen beziehe, unterbrach Gustawa das Tippen des polnischen Textes und sagte, ohne von der Maschine aufzusehen, schnell und leise: »Du solltest Tosia noch heute heiraten.«
Sofort nach diesem Diktat schickte ich einen Boten zu Tosia: Ich bat sie, gleich zu mir zu kommen und ihr Geburtszeugnis mitzubringen. Sie kam auch sofort und war ziemlich aufgeregt, denn die Panik in den Straßen wirkte ansteckend. Ich ging mit ihr schnell ins Erdgeschoss, wo in der Historischen Abteilung des »Judenrates« ein Theologe arbeitete, mit dem ich die Sache schon besprochen hatte. Als ich Tosia sagte, wir würden jetzt heiraten, war sie nur mäßig überrascht und nickte zustimmend.
Der Theologe, der berechtigt war, die Pflichten eines Rabbiners auszuüben, machte keine Schwierigkeiten, zwei Beamte, die im benachbarten Zimmer tätig waren, fungierten als Zeugen, die Zeremonie dauerte nur kurz, und bald hatten wir eine Bescheinigung in Händen, der zufolge wir bereits am 7. März getraut worden waren. Ob ich in der Eile und Aufregung Tosia geküsst habe, ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß sehr wohl, welches Gefühl uns überkam: Angst – Angst vor dem, was sich in den nächsten Tagen ereignen werde. Und ich kann mich noch an das Shakespeare-Wort erinnern, das mir damals einfiel: »Ward je in dieser Laun’ ein Weib gefreit?«
Am selben Tag, am 22. Juli, habe ich Adam Czerniaków zum letzten Mal gesehen: Ich war in sein Arbeitszimmer gekommen, um ihm den polnischen Text der Bekanntmachung vorzulegen, die im Sinne der deutschen Anordnung die Bevölkerung des Gettos über die vor wenigen Stunden begonnene »Umsiedlung« informieren sollte. Auch jetzt war er ernst und beherrscht wie immer.
Nachdem er den Text überflogen hatte, tat er etwas ganz Ungewöhnliches: Er korrigierte die Unterschrift. Wie üblich hatte sie gelautet: »Der Obmann des Judenrates in Warschau – Dipl.Ing. A. Czerniaków«. Er strich sie durch und schrieb statt dessen: »Der Judenrat in Warschau«. Er wollte nicht allein die Verantwortung für das auf dem Plakat übermittelte Todesurteil tragen.
Schon am ersten Tag der »Umsiedlung«war es für Czerniaków klar, dass er buchstäblich nichts mehr zu sagen hatte. In den frühen Nachmittagsstunden sah man, dass die Miliz, so eifrig sie sich darum bemühte, nicht imstande war, die von der SS für diesen Tag geforderte Zahl von Juden zum »Umschlagplatz« zu bringen. Daher drangen ins Getto schwerbewaffnete Kampfgruppen in SS-Uniformen – keine Deutschen, vielmehr Letten, Litauer und Ukrainer. Sie eröffneten sogleich das Feuer aus Maschinengewehren und trieben ausnahmslos alle Bewohner der in der Nähe des »Umschlagplatzes« gelegenen Mietskasernen zusammen.
In den späteren Nachmittagsstunden des 23. Juli war die Zahl der für diesen Tag vom Stab »Einsatz Reinhard« für den »Umschlagplatz« angeforderten 6.000 Juden erreicht. Gleichwohl erschienen kurz nach 18 Uhr im Haus des »Judenrates« zwei Offiziere von diesem »Einsatz Reinhard«. Sie wollten Czerniaków sprechen. Er war nicht anwesend, er war schon in seiner Wohnung. Enttäuscht schlugen sie den diensttuenden Angestellten des »Judenrates« mit einer Reitpeitsche, die sie stets zur Hand hatten. Sie brüllten, der Obmann habe sofort zu kommen. Czerniaków war bald zur Stelle.
Das Gespräch mit den beiden SS-Offizieren war kurz, es dauerte nur einige Minuten. Sein Inhalt ist einer Notiz zu entnehmen, die auf Czerniakóws Schreibtisch gefunden wurde: Die SS verlangte von ihm, dass die Zahl der zum »Umschlagplatz« zu bringenden Juden für den nächsten Tag auf 10.000 erhöht werde – und dann auf 7.000 täglich. Es handelte sich hierbei keineswegs um willkürlich genannte Ziffern. Vielmehr hingen sie allem Anschein nach von der Anzahl der jeweils zur Verfügung stehenden Viehwaggons ab; sie sollten unbedingt ganz gefüllt werden.
Kurz nachdem die beiden SS-Offiziere sein Zimmer verlassen hatten, rief Czerniaków eine Bürodienerin: Er bat sie, ihm ein Glas Wasser zu bringen.
Wenig später hörte der Kassierer des »Judenrates«, der sich zufällig in der Nähe von Czerniakóws Amtszimmer aufhielt, dass dort wiederholt das Telefon läutete und niemand den Hörer abnahm. Er öffnete die Tür und sah die Leiche des Obmanns des »Judenrates« in Warschau. Auf seinem Schreibtisch standen: ein leeres Zyankali-Fläschchen und ein halbvolles Glas Wasser.
Auf dem Tisch fanden sich auch zwei kurze Briefe. Der eine, für Czerniakóws Frau bestimmt, lautet: »Sie verlangen von mir, mit eigenen Händen die Kinder meines Volkes umzubringen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sterben.« Der andere Brief ist an den Judenrat in Warschau gerichtet. In ihm heißt es: »Ich habe beschlossen abzutreten. Betrachtet dies nicht als einen Akt der Feigheit oder eine Flucht. Ich bin machtlos, mir bricht das Herz vor Trauer und Mitleid, länger kann ich das nicht ertragen. Meine Tat wird alle die Wahrheit erkennen lassen und vielleicht auf den rechten Weg des Handelns bringen ...«.
Von Czerniakóws Selbstmord erfuhr das Getto am nächsten Tag – schon am frühen Morgen. Alle waren erschüttert, auch seine Kritiker, seine Gegner und Feinde. Man verstand seine Tat, wie sie von ihm gemeint war: als Zeichen, als Signal, dass die Lage der Juden Warschaus hoffnungslos sei.
Still und schlicht war er abgetreten. Nicht imstande, gegen die Deutschen zu kämpfen, weigerte er sich, ihr Werkzeug zu sein. Er war ein Mann mit Grundsätzen, ein Intellektueller, der an hohe Ideale glaubte. Diesen Grundsätzen und Idealen wollte er auch noch in unmenschlicher Zeit und unter kaum vorstellbaren Umständen treu bleiben.
Die in den Vormittagsstunden des 22. Juli 1942 begonnene Deportation der Juden aus Warschau nach Treblinka dauerte bis Mitte September. Was die »Umsiedlung« der Juden genannt wurde, war bloß eine Aussiedlung – die Aussiedlung aus Warschau. Sie hatte nur ein Ziel, sie hatte nur einen Zweck: den Tod.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 28.1.2012
Wie ein kleiner Setzer in Polen über Adolf Hitler triumphierte
Die Flucht aus dem Ghetto war nicht schwer, aber draußen auch nur einen Tag zu überleben, war fast unmöglich: Marcel Reich-Ranicki erinnert sich an die Kunst des Überlebens
Das Gespräch führten Stefan Aust und Frank Schirrmacher.
Wie kein zweiter Literaturkritiker der Gegenwart hat Marcel Reich-Ranicki seinem Publikum Enthusiasmus für die deutsche Sprache vorgelebt und vermittelt. Dabei ist es die Sprache jener, die den Tod über fast alle seine Angehörigen gebracht haben. Und es war ein in deutscher Sprache ausgestellter Ausweis, der seine Frau um Haaresbreite ins Vernichtungslager geführt hätte. Für Marcel Reich-Ranicki aber, der dem Warschauer Ghetto entfloh und zusammen mit seiner Frau in einem Versteck überlebte, stellte sich im Hinblick auf die Nationalsozialisten die Frage der deutschen Kultur und der deutschen Sprache nicht. Im Gegenteil: Je größer Gefahr und Elend wurden, desto mehr war die Literatur letzte Rettung. Im Unterschlupf bot die Erinnerung an Romane, Dramen und Theaterabende Trost und Hilfe. In dem Gespräch, das wir dokumentieren, berichtet Reich-Ranicki, wie er und seine Frau der Vernichtung entkamen, wie viel Mut und wie viel Glück sie brauchten, um überleben und weiterleben zu können.
Herr Reich-Ranicki, was haben Sie am 8. Mai 1945 gemacht?
Ich war in Warschau. Was ich gemacht habe, weiß ich nicht. Denn gefeiert hat man am 9. Mai. Das war der Tag in Karlshorst, wo die Kapitulation unterschrieben wurde. Einer unserer Kollegen sagte, wir müssen in den Hof runtergehen und einen Salut gen Himmel abfeuern. Wir gingen in den Hof, jeder zückte seine Pistole, ich auch, alle schossen gleichzeitig, ich eine Sekunde später. Ich kam zu spät mit dem Schuss. Es war übrigens mein erster im Zweiten Weltkrieg – und mein letzter Schuss.
Was war das für ein Gefühl? Das Ende des Zweiten Weltkrieges, das Ende Ihrer Verfolgung und eine ungewisse Zukunft?
Das letzte trifft wohl die Lage. Es war völlig unklar, wie das weitere Leben ausschauen würde. Man fragt mich immer: Was haben Sie in den ersten Wochen nach der Befreiung gemacht? Nichts Pathetisches, etwas zu essen habe ich gesucht, was anzuziehen haben wir gesucht, wir waren in elendem Zustand, und man bekam nichts.
Was hat Ihnen die Nachricht bedeutet oder auch nicht bedeutet, dass Hitler tot ist?
Die Nachricht hat mir schon sehr viel bedeutet. Es war die Frage, ob sie denn stimme. Bei dem Herrn war man nie so ganz sicher.
Wo haben Sie die letzten Jahre vor Ende des Zweiten Weltkrieges zugebracht?
Am Anfang in Warschau, ab 1940 im Warschauer Ghetto, seit der Flucht im Herbst 1942 aus dem Warschauer Ghetto im Untergrund. Wir wurden befreit, meine Frau und ich, als wir noch im Untergrund waren, im September 1944.
Es war also für Sie der Moment der Befreiung von einer großen Angst?
Ja, ganz sicher. Aber die Angst war noch da: Was wird weiter mit uns geschehen?
Wussten Sie am 9. Mai 1945, dass fast Ihre ganze Familie umgebracht worden war?
Nein. Wir wussten, dass meine Eltern und die Eltern meiner Frau umgebracht worden waren. Auch von meinem Bruder wusste ich, dass er nicht mehr lebt. Aber die vielen anderen Familienmitglieder, die umgebracht wurden, Tanten, Onkel, Cousinen, das konnte man nicht so überblicken.
Sie wurden geboren in Polen, Sie hatten gutbürgerliche Eltern mit Wurzeln in Deutschland und im religiösen Judentum. Wo sehen Sie Ihre Wurzeln aus heutiger Sicht?
Aus heutiger Sicht sehe ich meine Wurzeln nur in der deutschen Literatur. Ja, in der deutschen Literatur, ungefähr von Lessing bis Gerhart Hauptmann und Brecht und, vor allem, Thomas Mann.
SiehabeninIhrenErinnerungenberichtet,wasvieleLeserüberraschthat,dassSie,einGymnasiastimBerlinAdolfHitlers,inderSchulenichtdasGefühlhatten,verfolgtoderdiskriminiertzusein.
Ja, das ist richtig, aber ich habe betont, so war es in der Schule, in der ich die letzten Jahre absolvierte, im Fichte-Gymnasium in Berlin-Wilmersdorf. Und auch das stimmt nicht ganz. So war es in meiner Klasse. Es ist möglich, dass in anderen Klassen derselben Schule die Sache ganz anders aussah.
Wenn wir Marcel Reich-Ranicki 1936 oder 1935 nach seinen Wurzeln gefragt hätten, hätten Sie auch schon geantwortet, »in der Literatur«, oder wurde die Literatur zum Fluchtpunkt?
Die Literatur wurde zum Fluchtpunkt. Ich fürchte, ich hätte 1936/37 gesagt, die Wurzeln seien im Theater, im deutschen Theater. Ich war damals ein großer Theaterenthusiast.
Sie haben am Berliner Theater- und Kulturleben der dreißiger Jahre teilgenommen und, zumindest im Theater, Gerhart Hauptmann einmal in eindeutiger Pose gesehen, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, das war 1937 bei der Premiere seines Stückes, eines schwachen, frühen Stücks von Hauptmann: »Die Jungfern von Bischofsberg«. Eine schöne Aufführung mit Käthe Gold und Marianne Hoppe. Beide sehr jung in den Hauptrollen. Er war in der Aufführung in einer Loge zusammen mit Göring, und am Ende wurde heftig geklatscht. Hauptmann hob die Hand zum Hitlergruß, und alles war schön in Butter. Göring war ja Reichsmarschall, der hob seinen Stab hoch.
Wann haben Sie gemerkt, dass das Ganze auf Krieg und auf Massenmord hinauslaufen würde?