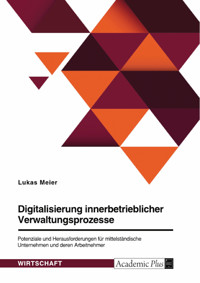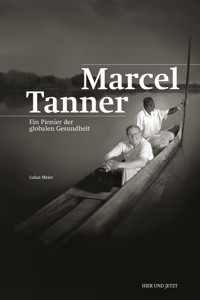
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hier und Jetzt
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Marcel Tanner, 1952 in Basel geboren, zählt zu den profiliertesten Epidemiologen und Public-Health-Spezialisten der Gegenwart. Nach seinem Studium siedelt er mit seiner Frau 1981 nach Tansania um und übernimmt die Leitung eines Feldlabors in Ifakara. Rasch richtet er seinen Fokus von einzelnen Bakterien, Viren und Parasiten auf den Menschen in seiner politischen und sozialen Umwelt. Er widmet sein Berufsleben intensiv dem Kampf tödlichster Krankheiten wie Malaria, HIV/Aids oder der Bilharziose. Von 1997 bis 2015 ist er Direktor des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts. Die Biografie beschreibt das Leben eines herausragenden Wissenschaftlers und einer aussergewöhnlichen Persönlichkeit, die es versteht, Menschen und Interessen für die globale Gesundheit zusammenzubringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcel Tanner
Ein Pionier der globalen Gesundheit
Lukas Meier
Inhalt
Roots
«No Roots, no Fruits»
Ein Leben im Zeitraffer
Fruits
Keine Gesundheit ohne funktionierende Gesundheitssysteme
Die «widerspenstigen» Studierenden aus Raum M14
Direktor des Swiss TPH 1997–2015
Dezentralisierung der Gesundheitssysteme in Tansania
Ein neues Paradigma: Die Reduktion der Krankheitslast
Weshalb Gesundheit nicht immer eine Frage des Geldes ist
Der Traum von einer malariafreien Welt
Neue Partnerschaften, neue Akteure, neue Hoffnungen
Erfolge im Pazifik: Vanuatu und die Solomon Islands
Die wirksamste Massnahme: Insektizid-behandelte Mückennetze
Lückenlose Lieferkette von der Fabrik bis zur Türschwelle
Die Massenverteilung als Gebot der Stunde
Booster für das Immunsystem: Alte und neue Impf- und Wirkstoffe
Ein Ausflug in die Geschichte
Die erste, aber kaum wirksame Malaria-Impfung für Afrika
Investitionen in die molekulare Mikrobiologie und Biostatistik in Basel
Ein neuer Impfstoff für Kinder in Malaria-Regionen
Artemisinin: Gegen Malaria ist ein Kraut gewachsen
Partnerschaft und Eigennutz
Der Kampf gegen die Bilharziose in China
Ein Parasit als Stolperstein auf Chinas Weg in die «Moderne»
Marcel Tanner im Reich der Mitte
Die Rückkehr der «Göttin aller Seuchen»
Kambodscha und Laos: Epidemiologie in Krisenzeiten
Die Aus- und Weiterbildung lokaler Experten
Opisthorchis viverrini: Infektionsgefahr beim Essen
Neue Medikamente gegen die Afrikanische Schlafkrankheit
Melarsoprol: Eine Standardtherapie mit Risiken und Nebenwirkungen
Enthaarungscrème gefährdet die Glaubwürdigkeit der Pharmaindustrie
Der Hoffnungsschimmer namens Fexinidazol
Oxaborol: Linderung Dank einer einzigen Tablette
One Health: Gesundheit für Menschen, Tiere und die Umwelt
Gelbfieber: The Making of a Tropical Disease
Enge Zusammenarbeit von Human- und Veterinärmedizin im Tschad
Der Tod auf leisen Sohlen: HIV / Aids
Des wissenschaftlichen Rätsels Lösung
Juliana und Slim: Das HI-Virus in Tansania
Der lange Weg zu einer erschwinglichen Therapie
Die Chronic Disease Clinic in Ifakara
HIV-Eliminierung in der Schweiz
Eine Frage der nationalen Sicherheit
SARS-CoV-2 und die Herausforderung der gesellschaftlichen Solidarität
Die Geschichte als schlechte Lehrmeisterin
Der Elefant im Raum: Mangelhafte Kommunikation vonseiten der Wissenschaft
Back to the Future: Daniel Bernoulli und die Pocken
Leben in einer geeinten Welt?
Was vom Leben übrig bleibt
Marcel Tanners persönliche Hausapotheke
Von Marcel Tanner betreute Doktorandinnen und Doktoranden 1989–2023
Alle in einem Boot
Roots
Marcel Tanner, 2008.
«No Roots, no Fruits»
«Es geht nicht darum, etwas Grossartiges zu leisten, sondern die gewöhnlichen Dinge in Anerkennung ihres inneren Wertes zu tun.»
Nach Pierre Teilhard de Chardin, 1881–1955
Kollegiengebäude der Universität Basel.
Die Aula der Universität Basel am Petersplatz ist rappelvoll, Zuschauende sitzen in den Gängen, stehen entlang der grossen Fenster. Kurzfristig wird in einem der Hörsäle im oberen Stockwerk eine Live-Schaltung organisiert, um den Publikumsandrang abzufedern. Es ist der 15. Dezember 2017. Auf der Bühne steht Marcel Tanner. Er rudert mit den Armen, als wolle er den Äther in Wallung versetzen. Der Titel seiner Abschiedsvorlesung als Professor der Universität Basel lautet: «No Roots, no Fruits». Er spricht von den Erfolgen und den Misserfolgen seiner vierzigjährigen Karriere als Public-Health-Spezialist. Von Partnerschaften. Von der Notwendigkeit, in Systemen zu denken. Davon, wissenschaftliche Innovationen zu den von Krankheiten ausgezehrten Menschen zu bringen – während den Zuhörenden zuweilen Angst und Bange wird, der auf der Bühne umherwirbelnde Derwisch könnte, einem überhitzten Dampfkessel gleich, mit lautem Knall explodieren.
Als Professor für Epidemiologie und medizinische Parasitologie der Universität Basel, als Direktor des Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH), als Gesundheitsexperte in zahlreichen internationalen Gremien prägte Tanner Generationen von Studierenden in der Schweiz wie in zahlreichen Ländern des Globalen Südens.
«No roots, no fruits»: Marcel Tanner während seiner Abschiedsvorlesung an der Universität Basel, 2017.
Auch aus sicherer Entfernung zur Bühne ist Bwana Saa (Herr Zeit), wie er von seinen Freunden in Tansania genannt wird, eine imposante Erscheinung. Gross und – im fortgeschrittenen Alter – stattlich gebaut. Seine Energie, sein Arbeitseifer, seine Reaktionsgeschwindigkeit beim Beantworten von E-Mails sind legendär. Sein Hirn arbeitet vernetzt und hochtourig, sein Gedächtnis lässt Wikipedia vor Neid erblassen. Er ist ein Meister im Sich-in-jemand-anderen-Hineinversetzen. In Verhandlungen versteht er die Intentionen seines Gegenübers. Und er liebt die markerschütternde Fachdebatte genauso wie die leichtfüssige Causerie über den letzten Bordeaux-Jahrgang.
Trotz tadellosem Aufzug, schwarzer Hose, weissem Hemd mit obligater Füllfeder in der Brusttasche muss man sich Marcel Tanner mit Dreck an den Schuhen vorstellen. Diesen imaginären Dreck trägt er mit Stolz. Er bedeutet für ihn das, was für andere die Krawatte ist: eigentliche Daseinsberechtigung. Tanner wollte nie als ein Experte gelten, der die Probleme der Länder des Globalen Südens nur vom Hörensagen oder von kurzen Stippvisiten her kennt, er wollte sie sich gleichsam verinnerlichen. So lebte er mehrere Jahre in Tansania, spricht fliessend Kisuaheli. Er weiss, was es heisst, wenn Dauerregen die Strassen flutet, wenn sich die Leselampe und die Internetverbindung für mehrere Tage eine Auszeit nehmen, wenn die Regale der Spitalapotheken gähnend leer sind.
Marcel Tanner ist ein Macher, oder besser: ein Handelnder. Der Wille zur Veränderung ist ihm moralische Verpflichtung. Er verkörpert das von der politischen Theoretikerin Hannah Arendt formulierte Prinzip der Vita activa. Mit der Geburt habe der Mensch – laut Arendt – die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit anderen Individuen die Welt aktiv zu gestalten. Dabei unterscheidet sie die drei Handlungsmaximen Arbeit, Herstellen und Handeln: «Die Arbeit sichert das Am-Leben-Bleiben des Individuums und das Weiterleben der Gattung; das Herstellen errichtet eine künstliche Welt, die von der Sterblichkeit der sie Bewohnenden in gewissem Masse unabhängig ist und so ihrem flüchtigen Dasein so etwas wie Bestand und Dauer entgegenhält; das Handeln schliesslich, soweit es der Gründung und Erhaltung politischer Gemeinwesen dient, schafft die Bedingungen für eine Kontinuität der Generationen, für Erinnerung und damit für Geschichte.»1
Die Stichworte «Kontinuität», «Erinnerung» und «Geschichte» führen uns ins Herz der hier vorliegenden Erzählung. Wie der Titel «Marcel Tanner. Ein Pionier der globalen Gesundheit» andeutet, fokussiert das Buch auf das Leben und Wirken des Epidemiologen und seine Leistungen auf dem Gebiet der globalen Gesundheit. Gleichzeitig beabsichtigt es, durch die Person Marcel Tanner einen Blick auf eine ganze Generation zu erhaschen.
Der Protagonist, um den sich diese Zeilen spinnen, ist ein Kind seiner Zeit. 1952 in Basel geboren, gehört er zu den Babyboomern, einer Generation, die im wachsenden Wohlstand der Nachkriegszeit gross geworden ist. Es war die Blütezeit der gesellschaftlichen Öffnung. Bildung wurde für breite Schichten zugänglich. Frauen verlangten und bekamen mehr Rechte. Die Medien, insbesondere das Fernsehen, und das Reisen sorgten für die nötige Zerstreuung und Horizonterweiterung. Es war eine privilegierte Zeit mit – aus heutiger Perspektive – unbeschränkten Möglichkeiten. Wörter wie «Chancengleichheit» und «globale Gerechtigkeit» gingen der Generation leicht, wenn auch nicht leichtfertig über die Lippen. Die Welt sollte nicht durch gesellschaftliche Revolutionen, sondern durch den «Gang durch die Institutionen» verändert werden: Gesellschaftliche Missstände versuchte man innerhalb der gegebenen Strukturen zu verbessern.
Andrea Schenker-Wicki, die Rektorin der Universität Basel, verabschiedet Marcel Tanner, 2017.
Marcel Tanner stiess sich früh an der globalen Ungleichheit. «Wir leben nicht in der ersten, zweiten oder dritten Welt. Wir leben in einer Welt», pflegt er bei verschiedenen Gelegenheiten zu wiederholen. Er setzte viele Hebel in Bewegung, um die Gesundheit vernachlässigter Bevölkerungsgruppen zu verbessern, nicht mit kleinen Entwicklungsprojekten, deren rasche Erfolge zumeist als gesichert gelten, sondern durch Interventionen im grossen Massstab: Er und seine Mitstreiterinnen und Mistreiter versuchten das Gesundheitswesen der Länder des Globalen Südens zu verbessern und die internationale Gesundheitspolitik zu beeinflussen.
Die tragische Ironie dieser Bestrebungen liegt in der fortschreitenden Fragmentierung der Welt: Der Mensch hat seine heimische Feuerstelle verlassen, steht einsam im Strom der Daten und Ereignisse, unfähig, nur einen Bruchteil des komplexen Weltgeschehens zu überblicken oder die Konsequenzen des eigenen Handelns abzuschätzen. Das Schrauben an einem Rädchen im Gefüge, das für einige vielleicht der Weg aus der Armut bedeutet, mag einen negativen Einfluss auf andere gesellschaftliche Bereiche haben. So kann die verbesserte Gesundheit die Lebenserwartung steigern, was wiederum höhere Gesundheitsausgaben zur Folge hat. Oder sie führt zu Überbevölkerung und dem Abbau natürlicher Lebensgrundlagen. Es versteht sich von selbst, dass Marcel Tanner diese Position nicht gelten lassen würde. Dazu ist er zu sehr Menschenfreund und Optimist. Er würde logisch entgegenhalten, dass wenn wir durch eine gezielte Handlung Probleme generierten, es schlicht weiterer Aktivitäten bedürfe, um diese neuen Probleme aus der Welt zu schaffen.
Das vorliegende Buch nimmt Tanners Faszination für reibungslos funktionierende Gesundheitssysteme und seinen Kampf gegen Viren, Parasiten und Bakterien zum Ausgangspunkt, um einen Blick auf die oben beschriebene Generation und ihre Erfolge und Misserfolge in einer globalen Weltordnung herauszuschälen. Der erste Teil mit dem Titel «Roots», in dem wir uns befinden, geht auf Tuchfühlung mit dem Menschen Marcel Tanner, seiner Herkunft, seinen Prägungen. Ein zweiter Teil, «Fruits», widmet sich den weltweiten Arbeiten auf dem Gebiet der Bekämpfung von Malaria, Wurmerkrankungen oder alten und neuen Infektionskrankheiten wie HIV / Aids sowie SARS-CoV-2. Das Kapitel «Was vom Leben übrig bleibt» versucht das Beschriebene schliesslich zu verallgemeinern und die Erkenntnisse vor dem Hintergrund ihrer Zeit zu bewerten.
Im Prozess des Schreibens hatte ich eine am Leben von Marcel Tanner und am Thema Gesundheit interessierte Leserschaft vor Augen. Trotzdem ist das Buch nicht arm an wissenschaftlichen Ausführungen. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass das Leben des Protagonisten eng mit der Wissenschaft und ihren Erkenntnissen verquickt ist. Tanner hatte Leben und Arbeit nie trennen können oder wollen. Eine Work-Life-Balance ist ihm zutiefst suspekt. Und so fallen Wissenschaft und Biografie in eins. Wer sich also scheut, Zahlen zur Eliminierung von Malaria oder zur Impfstoffentwicklung zu lesen, dem sei eine andere Lektüre empfohlen.
Noch etwas: Ich denke, die Leserin, der Leser hat das Recht zu erfahren, aus welcher Position ich selbst spreche. Ich bin nicht unbefangen. Weit gefehlt. Ich traf Marcel Tanner im Jahr 2008 zum ersten Mal. Damals hatte ich eine kleine historische Lizentiatsarbeit an der Universität Basel zur Geschichte des Tropeninstituts abgeschlossen und rollte auf den Gleisen in Richtung einer unbestimmten Zukunft. Da erreichte mich ein Schreiben des Direktors des Tropeninstituts – und nur wenige Tage später sass ich Tanner in seinem Büro an der Socinstrasse gegenüber: «Das ist sehr interessant, was Sie schreiben! Wir müssen das Projekt weitertreiben in Richtung einer Doktorarbeit, welche die Perspektive der Afrikanerinnen und Afrikaner mit einschliesst!», drang es an mein erstauntes Ohr. Der vielbeschäftigte Professor hatte diese Abschlussarbeit nicht nur gelesen, sondern sprach mit einer Begeisterung von der Historie und ihrer Bedeutung, die man selbst an einem Historischen Seminar nur selten antrifft. Die Weichen waren also gestellt: Die R. Geigy-Stiftung finanzierte in der Folge nicht nur meine Dissertation. Ich bin heute dank Marcel Tanner als Geschäftsführer der Stiftung tätig, die er während 25 Jahren präsidiert hatte. Hätte eines seiner Kinder oder eine andere Person dieses Buch geschrieben, es wäre ein anderes Buch geworden.
Aus meiner Nähe und Sympathie zum hier dargestellten Protagonisten sei also kein Hehl gemacht. Und dennoch bin ich gewissermassen ein Aussenseiter, lediglich ein kleiner Planet, der im grossen Universum von Tanner seine Runden zieht. Ich stehe zudem stellvertretend für all die vielen Stimmen und Weggefährten, die auch problemlos zum Griffel hätten greifen können. Wenn sie es denn für nötig oder lohnenswert erachtet hätten. «Marcel Tanner. Ein Pionier der globalen Gesundheit» möchte nicht nur die Sonnenseiten des Protagonisten beleuchten, sondern historisch abwägen, welche Erkenntnisse aus einer lebenslangen interkulturellen Forschungstätigkeit für künftige Generationen von Bedeutung sein könnten. Die Grundlage für das vorliegende Buch waren Gespräche, die ich über die Jahre mit Marcel Tanner geführt habe sowie spezifische Interviews mit seiner Frau, seiner Familie und engen Weggefährten.
Die Treppe zu Marcels Fischergalgen ist nichts für schwache Nerven. Steil fällt sie das Rheinbord ab, die Stufen sind uneben, man ist dankbar für das rostige Geländer, das einem etwas Halt bietet. Ein vor Jahrzehnten gepflanzter, nun mächtiger Rosmarin verströmt einen aromatischen Duft. Das Eisentor zur Nr. 31 ist verwittert, aber daran stört sich niemand. Schliesslich ist man heil angekommen. Marcel erwarb das Fischerhaus bei der «Solitude» vor fünf Jahren. Er sei jetzt «retired» (pensioniert), wenn auch noch lange nicht «tired» (müde), pflegt er zu sagen. Wir setzen uns auf die aus dem Stein gehauenen Sitzbänke beim Vorplatz und stellen uns auf einen langen Abend ein. Von der Plattform vor dem Fischerhaus aus hat man einen wunderbaren Blick auf den gemächlich dahinströmenden Fluss, auf die wilde Uferseite mit den Ulmen, die mit ihren mächtigen Armen nach dem Wasser greifen. Auf der anderen Seite des Rheins ist schemenhaft das Rheinbadhüsli Breite erkennbar. Dort, im Arbeiterquartier Breite, ist Marcel aufgewachsen. Erinnerungen an Sonntagsspaziergänge. An seinen Vater Moritz Tanner, der die Nasen mit geschickter Hand aus dem Wasser zog.
Die Eltern Moritz und Gertrud Tanner in Seelisberg, 1960.
Der kleine Marcel auf dem Bauernhof der Grosseltern in Diegten.
Marcel Tanners Vater kam aus Aarwangen, dem Bernbiet. «Der Rote» hat man ihn gerufen, wegen seines feuerroten Haars. Als man in der Zwischenkriegszeit in der Schule das Telefonieren lernte, hiess es: «Der Rote muss das nicht können.» Und er wurde vom Unterricht ausgeschlossen. Tanners Grosseltern, Gottlieb und Emma Tanner-Bühlmann, waren beide Verdingkinder. Sie wurden ihren leiblichen Eltern weggenommen, mussten sich auf Bauernhöfen «verdingen». Sie teilten dieses Schicksal mit Zehntausenden schulpflichtigen Kindern, die weit über die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Schweiz als billige Arbeitskräfte auf Landwirtschaftsbetrieben eingesetzt wurden. Verdingkinder gehörten zum sogenannten Gesinde, zur untersten sozialen Schicht. Die Gefahr von Machtmissbrauch und Ausbeutung war für sie besonders gross. Doch Gottlieb und Emma Tanner-Bühlmann hatten Glück im Unglück. Sie mussten kein Unrecht erdulden und übernahmen auf ihren Betrieben mit der Zeit mehr und mehr Verantwortung. Am Ende seiner Lauf bahn organisierte Gottlieb Tanner den Landwirtschaftsbetrieb der Knabenerziehungsanstalt des Schlosses Aarwangen. Er unterstützte die ausgesteuerten Knaben fürsorglich, weil er selbst die Erfahrung als Knecht und Verdingkind in sich trug. Und beobachtete, wie die Jungen dank seiner Unterstützung den Weg ins Leben fanden. «Mein Grossvater lernte seinen Kindern, dass man einem Staat, einer Institution oder einer Idee gegenüber loyal sein muss, damit sich die Dinge zum Besseren wenden», erinnert sich Tanner.
Menschen – Tiere – Umwelt: erste Erfahrungen in Diegten, um 1958.
Moritz Tanner, gelernter Sattler-Tapezierer, zog 1949 nach Basel. Seine Frau Gertrud folgte ihm ein Jahr später nach. Moritz fand Arbeit beim Sattler Schenker an der Elsässerstrasse, verbesserte dort Rosshaarmatratzen. Dann wechselte er zum Coop Basel ACV, zuerst als Bodenleger, dann als Leiter der Teppichabteilung. Die Orientteppiche und der in ihnen verwobene Traum vom Leben fremder Kulturen übten eine besondere Faszination auf ihn aus. Moritz Tanner war ein neugieriger Mensch. «Gwunderig», wie sein Sohn sagt. Afrika habe es ihm besonders angetan, obwohl er den Kontinent selbst nie bereist hatte. Im Bücherregal sei ein Buch über die Mau-Mau, die kenianische Freiheitsbewegung, gestanden. Und Moritz Tanner habe vom Widerstand gegen die englische Kolonialmacht erzählt, als sei er selbst dabei gewesen.
Der Weg ins «Seevögeli», die Primarschule, führte Marcel Tanner den Sägeberg hoch ins Gellert-Quartier. Dort wohnte, wer viel Geld in der Tasche hatte und etwas auf sich hielt. Die Fassaden ausladender Villen säumten den Schulweg. Manch eine schien unbewohnt, was den Primarschüler zu einem Abstecher verleitete. Nach Abschluss der vierten Klasse absolvierten die Schülerinnen und Schüler eine Prüfung, die darüber entschied, ob man die Schulkarriere in einem Gymnasium, der Realschule oder in der Sekundarschule fortsetzte. Seiner Noten musste sich der aufgeweckte Schüler Marcel nicht schämen. Doch der Lehrer war überzeugt: Ein guter Sekundarschüler sei allemal besser als ein überforderter Realschüler. Und zu Marcel Tanner sagte er: «Dein Vater war doch auch nur ein Sattler.» Diese Aussage habe er bis heute nicht verdaut. «Ich war doch stolz, dass mein Vater Sattler-Tapezierer gelernt hatte und seinem Handwerk ein Leben lang treu blieb.» Seine Mutter Gertrud fand ebenfalls, ihr Sohn sei in der Realschule besser aufgehoben. Gertrud war eine Frau mit starkem Charakter, breitem Wissen und einem Rucksack voll unerfüllter Träume. Wie gerne wäre sie Lehrerin geworden! Hätte ihr Wissen an eine Schar Schülerinnen und Schüler vermittelt. Doch die Kriegsjahre standen ihrer Lehrerausbildung im Weg. Sie wurde Verkäuferin im Kolonialwarenladen und der Kaffeerösterei Buser an der Hauptstrasse in Binningen.
Marcel Tanner besuchte also die Realschule beim Münsterplatz. Der Schulstoff fiel ihm leicht. Die Lehrer empfahlen einen Sprung ins Gymnasium. Doch das Einzelkind Marcel wollte sein soziales Umfeld in der Realschule nicht einem Schulwechsel opfern. Nach erfolgreichem Abschluss der Realschule landete er via Übergangsklasse in der kantonalen Handelsschule, dem heutigen Wirtschaftsgymnasium. Neben den klassischen Maturafächern büffelte er Buchhaltung sowie Volks- und Betriebswirtschaft. 1972 hatte der Zwanzigjährige die Handelsmatur in der Tasche. Eine kinderlose Cousine seiner Mutter hätte es gerne gesehen, wenn der junge Wirtschaftsabsolvent ihre Feinmechanik-Fabrik in Oberdorf übernommen hätte. Tanner aber wollte sich nicht binden. Nicht in diesem Alter. Die Zukunft lag vor ihm wie eine ausgebreitete Landkarte mit Orten, auf die man mit dem Finger frei zeigen konnte. Sein Finger deutete auf eine Farm in Kanada, wo er und sein zu früh verstorbener Freund Urs Huber für drei Monate gearbeitet hatten. Sie hatten dort stundenlang mit Traktoren gepflügt, das Vieh gemelkt, Bäume gefällt. Und sie machten sich auf nach Alaska, bis zur Beringstrasse, weil der Klang des blossen Namens Bilder grosser Entdeckungsfahrten weckte. Nach seiner Reise kehrte Marcel Tanner im Oktober 1972 zurück nach Basel. Eingeschrieben hatte er sich für das Fach Medizinische Biologie an der hiesigen Universität.
Grossvater Gottlieb Tanner in Aarwangen.
Grossvater Hans Meier mit Marcel und Grossmutter Lina Meier mit ihren Töchtern Gertrud (*1924, rechts) und Ruth (*1937, links).
Marcel (rechts) mit seiner Cousine Regine Tanner (*1954) und seinem Cousin Karl Tanner (*1952) auf einem Sonntagsspaziergang beim Kraftwerk Birsfelden.
Der 21. Mai 1973 sollte seinem Leben eine entscheidende Wendung geben. Marcel war Pfadi-Führer. Die Pfadfinder waren ihm eine wichtige Ersatzfamilie. Jedes Jahr im Mai trafen sich alle Gruppen zum traditionellen Mai-Bummel. Gemeinsam gings in die Natur, mit prall gefülltem Rucksack, Zelt und hochgezogenen Wandersocken. Sein Pfadi-Freund Peter Lenhard hatte dieses Jahr seine Schwester Suzanne im Schlepptau. Soeben aus Paris zurück, hatte sich die angehende Intensiv-Krankenschwester entschieden, ihren Bruder auf den Bummel zu begleiten. Und dann sah sie Marcel. «Er war jung und dynamisch», erinnert sie sich an die erste Begegnung. Es dauerte keine drei Wochen und die beiden waren ein Paar. Suzanne Lenhards Eltern stammten ursprünglich aus Bern. Ihre Mutter war Schneiderin. Ihr Vater wuchs im Fischermätteli, einem bescheidenen Quartier an der Aare, auf. Als einziger der Familie besuchte er das Gymnasium, wurde Jurist und Anwalt sowie Generalsekretär der Konzernleitung der Haefely AG in Basel, einer Firma für Hochspannungstechnologie und Isoliertechnik. Sozial und bodenständig sei ihr Vater gewesen, erinnert sich Suzanne Tanner. Jemand, der sich für die Arbeiterinnen und Arbeiter der Haefely AG einsetzte. Der überhaupt viel arbeitete. Und an den Wochenenden als begeisterter Bergsteiger die Alpen durchwanderte.
Wenn man hier inmitten des Naturschutzgebiets am Rheinufer nicht auf der Hut ist, dann schlägt einem die Wahrnehmung ein Schnippchen. Man braucht nicht einmal die Augen zusammenzukneifen oder zu tief ins Weinglas zu schauen, um eine subtile Veränderung der Wirklichkeit zu bemerken. Hat man nicht gerade den Ruf eines weissköpfigen Kibitz oder eines Reihers vernommen? Ist dort im nahen Schilf nicht ein Krokodil verschwunden? Auch Marcel verschwindet. Nicht im Schilf, aber im Fischerhaus. Als er wieder auftaucht, trägt er ein Buch unter dem Arm: «Grosswildjagd im alten Afrika», herausgegeben von Rolf D. Baldus und Brian Nicholson, dem bekannten Wildhüter des Selous Game Reserve, dem grössten Wildschutzgebiet Afrikas. «Wenn ich nochmals ein Leben hätte, dann wäre ich gerne Wildhüter im Selous», sagt er. Das Selous-Reservat ist anders als die berühmte Serengeti oder andere Touristenmagnete Tansanias. Bis vor Kurzem noch hatte es sich seine Wildheit bewahrt.
Bei der Solitude am Basler Rheinbord.
In den 1980er-Jahren ist Marcel Tanner mit geschulterter Büchse wochenlang auf den Spuren Brian Nicholsons durch das Wildreservat Selous in Tansania gestreift. Er las die Fährten von Antilopen und Löwen und zielte den Büffeln zwischen die Augen. Er lag auf der Lauer und nachts am Lagerfeuer. «Am Lagerfeuer zu liegen, die fremden Geräusche zu hören, während am dunklen Nachthimmel die Sterne um die Wette funkeln. Das ist wie eine Meditation, wie ein religiöser Moment. Und wenn dann noch ein Freund wie Ambros Mganda da ist und alte Geschichten zum Besten gibt, dann überkommt einen ein Gefühl der Verwurzelung, eine Gewissheit – oder eher eine Ahnung –, bei sich selbst angekommen zu sein.» Beim Jagen ging es nicht darum, den Helden zu spielen oder Trophäen mit nach Hause zu schleppen. Es ging auf eine existenzielle Weise darum, zu verstehen, wo man ist. «So wie man die Lebensweise und Vorstellungen der Menschen in ihren Dörfern verstehen muss, muss man die Wildnis verstehen», so Tanner, einen alten kolonialen Topos wiederholend. Man muss die Wildnis durchwandert haben. Man muss wissen, wann es gefährlich wird. Wann einem der Geruch eines Löwen oder einer Hyäne in die Nase sticht. «In der afrikanischen Steppe habe ich sehen gelernt», sagt Tanner. Die meisten Europäer richten ihren Blick auf den Horizont. Und sehen nichts. Das ist, wie wenn die eigenen Gedanken ständig um eine ferne Zukunft kreisen. Man muss auf die halbe Distanz blicken. Dann sieht man und kann auch reagieren. Das Lagerfeuer, die Gespräche, die Fragen über das «Wo» und das «Weshalb» befeuerten ein soziales Bewusstsein, das bei Tanner unweigerlich in einer Pflicht zum Handeln mündete. Nicht als politischer Aktivist, sondern in der Verantwortung als Wissenschaftler. «Nichts ärgert mich mehr als all diese endlosen Diskussionen darüber, weshalb man Dinge nicht tun kann, anstatt sich zu fragen, was und wie man etwas verbessern, verändern kann.»
Folgt man dem Rhein flussaufwärts in Richtung Kaiseraugst, dem Flusslauf der Ergolz in Richtung Sissach und dem kleinen Diegterbach, so endet die Reise unverzüglich im Dorf Diegten. Hier liegen die Ursprünge von Marcel Tanners politischem Engagement. Fleisch geworden in der mächtigen Gestalt vom «Meier Hans», seinem Grossvater mütterlicherseits. Hans Meier war eine «Institution», wie die Leute sagen würden. Er war Landrat und Gemeinderat. Und vor allem verantwortlich für das Sozialwesen. Die Bauern klopften an seine Tür, wenn sie Sorgen hatten, wenn Ende Monat kein Geld in der Kasse war oder wenn es galt, einen Streit zu schlichten. Und er schreckte nicht davor zurück, radikale Mittel zu ergreifen, wenn der politische Dialog versagte. Hans Meier war einer der Organisatoren des Arbeiterstreiks in der Uhrenfabrik Oris im benachbarten Hölstein, als es in der Zwischenkriegszeit galt, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für die Arbeiter zu erkämpfen. Bis zum frühen Tod des Grossvaters im Jahr 1960 war Marcel Tanner an vielen Wochenenden in Diegten. Gemeinsam gingen sie in die Natur. «Lumpi», der Rauhaardackel, sprang vorne weg, sein Grossvater lehrte Marcel die Namen von Pflanzen, er bestimmte die Vögel, die am Himmel über Diegten kreisten. Und er erzählte von seiner politischen Arbeit, von den schwierigen Lebensbedingungen der Bauern auf ihren Höfen, darüber, dass es manchmal darum gehe, der sozialen Gerechtigkeit auf die Sprünge zu helfen. «Mein Grossvater öffnete mir die Augen für die ökologischen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge, die das Leben der Menschen prägten», sagt Marcel Tanner.
Was hätte Hans Meier wohl gesagt, wenn er eine Ausgabe des Anapaz (Anarchismus-Pazifismus) in die Finger gekriegt hätte? Dieses typische Schriftgut aus der Zeit, als die Hosen sich knapp unter den Knien etwas weiteten und die Mädchen sich Blumen ins Haar flochten. Der Handelsschüler Marcel Tanner diskutierte eifrig über Artikel in dieser Zeitschrift, die Hanspeter Meisel und sein Klassenkamerad und spätere Soziologieprofessor Ueli Mäder gründeten. Die Inhalte brannten damals einer ganzen Generation unter den Nägeln: kritische Theorie, dialektischer Materialismus, Erörterungen über die Fähigkeit einer anarchistischen Organisation, so etwas wie soziale Gerechtigkeit herzustellen. «Wir wollten damit den Anliegen der 68er-Generation breites Gehör verschaffen», sagt Tanner, «bis wir den Glauben daran, man könne die Welt mit intellektueller Akrobatik allein verändern, als Naivität entlarvten.» Die Maturaklasse war ein Saatbeet politischer Meinungsbildung und ein Lehrstück für Toleranz. Es gab junge Freigeister, die am linken Rand des politischen Spektrums politisierten, aber auch Mitschüler, die mit 25 Jahren bereits in Anzug und Krawatte in Richtung New York auf brachen, um eine Karriere als Banker einzuschlagen. 1968 sassen sie alle auf den Tramschienen in Basels Innenstadt und skandierten Parolen gegen den Vietnamkrieg. «Ich bin in einer Miteinander-Generation aufgewachsen», erinnert sich Tanner. Der soziale Zusammenhalt war wichtiger als die Kohärenz der politischen Meinungen und der danach ausgerichteten Lebensführung. Nur drei Monate nach den Vietnamprotesten in Basel brach Marcel Tanner nach England ins Pfadi-Lager auf. In Pfadi-Uniform lauschten die Schweizer im legendären Marquee Club in Soho der kehligen Stimme Mick Jaggers und der Rolling Stones.
Mit Hans Meier und Hund Lumpi in der Natur bei Diegten.
Die intellektuelle Akrobatik war eine Triebfeder, um aktiv Fragen an die Welt zu richten. Noch bevor Tanner die Matura in der Tasche hatte, besuchte er mit seinem Freund und Klassenkameraden Freddy Bloch Vorlesungen an der Universität Basel. Dabei übten Mathematik, Philosophie und Theologie – die «Big Three» des wissenschaftlichen Kanons – eine besondere Anziehungskraft auf die beiden aus. Basel mit seiner humanistischen Tradition bildete einen dichten geistigen Nährboden. Die Geschichte der Stadt geizt nicht mit klangvollen Namen, innerhalb der dicken Stadtmauern geboren oder als Glaubensflüchtlinge zugewandert, welche das Geistesleben aufmischten: Karl Barth, Jacob Burckhardt, Margaretha Merian, Meret Oppenheim, Daniel Bernoulli, Karl Jaspers, Friedrich Nietzsche …
Als Teenager beschäftigte sich Tanner intensiv mit dem absurden Theater eines Jean Anouilh, Samuel Beckett oder Eugène Ionesco. Besonders prägend wirkte das Stück «Amedee oder wie wird man ihn los» von Ionesco über die moralische Pflicht zu handeln beziehungsweise das Gegenteil, die Unmöglichkeit, etwas zu tun. Grundfragen, die auch Tanner bewegten. Der Inhalt des Stücks ist schnell erzählt: Amedee Buccinioni, ein «Herr mittleren Alters und wenn möglich kahlköpfig» ist Schriftsteller. Oder er wäre es gern. Denn in den letzten 15 Jahren hatte er nur zwei Zeilen zu Papier gebracht. Daran konnte auch seine resolute Frau Madeleine nichts ändern. Der Grund für Amedees Handlungsunfähigkeit lag halb tot im Nebenzimmer: ein Moribunder, der an nichts Geringerem als an «geometrischer Progression» litt. Trotz seines deplorablen Zustands wuchs und wuchs dieser ständig. Seine Beine hatten bereits die Tür zu Amedees Schreibstube durchstossen, sein Kopf war riesenhaft angeschwollen und seine kometenhaften Augen musste man abends schliessen wie Fensterläden. Die Identität des riesenhaften Toten ist nicht leicht zu ermitteln: Ist es Madeleines verflossene Liebe, dessen Herz aufgehört hatte zu schlagen? Oder ein Baby, von einer kaltherzigen Nachbarin eines Nachts zurückgelassen? Es ist vor allem die Last der Vergangenheit, die in die Gegenwart hineinreicht und Amedee wie in Schreckstarre zurücklässt. Bis es ihm schliesslich mit letzter Kraft gelingt, den Ballast abzuschütteln und sich in die Lüfte zu erheben. «Amedee ist für mich ein Symbol des Stillstands beim Verstehen der Welt», sagt Marcel Tanner, «aber auch ein Ausblick und eine Aufforderung, das Gewicht abzuschütteln und durchzustarten!»
Richten wir unseren Fokus wieder auf die Wissenschaft und blicken auf die Basler Altstadt, den Münsterhügel, den Rheinsprung mit den schwindsüchtigen Altstadthäusern. Hier im Gebäude der Alten Universität war einst das Zoologische Institut untergebracht. Ein kleines Labor, einige dunkle Zimmer. Und am Mikroskop Rudolf Geigy (1902–1995), der Zoologe, dem eigentlich eine Karriere in der J. R. Geigy AG vorbestimmt gewesen wäre. Doch sein Interesse an Evolutions- und Infektionsbiologie sowie kleinsten Krankheitserregern und ihre Überträger war stärker. Geigy betrat in den 1930er-Jahren wissenschaftliches Neuland, als er sich verstärkt entwicklungsbiologischen und experimentellen Fragestellungen zuwandte: nicht der «Gestaltlehre» eines Adolf Portmann, der Referenz in der Zoologie in Basel, sondern der experimentellen Erforschung kleinster Organismen und der Möglichkeit ihrer Manipulation. Die Gründung des Schweizerischen Tropeninstituts 1943, dessen erster Direktor Geigy wurde, bot dafür einen idealen institutionellen Rahmen. Der Zweite Weltkrieg wütete, doch Geigy charterte ein Flugzeug und reiste nach Zentralafrika. Er knüpfte Kontakte zu belgischen und französischen Kolonialwissenschaftlern, studierte die Lebensweise der Afrikanerinnen und Afrikaner und machte sich ein Bild von den unzähligen von tropischen Erregern verursachten Leiden. Wie zum Beispiel die durch den Stich einer Tsetsefliege übertragene Afrikanische Schlafkrankheit. Geigy und seinem Team gelang das Bravourstück, lebende Tsetsefliegen aus Belgisch-Kongo nach Europa zu importieren. Für die ungewöhnlichen Passagiere scheute man keinen Aufwand: Sie labten sich während des Rückflugs in die Schweiz an Meerschweinchenblut. Geigys Zuneigung für die Fliegen ging sogar so weit, dass er das heisse Wasser im Badezimmer des 5-Sterne-Hotels Ritz im besetzten Paris aufdrehte, um den Tieren im feuchtheissen Klima das Überleben zu sichern. Die Tsetsefliegen revanchierten sich für diese Sonderbehandlung: Sie vermehrten sich in den Labors des Tropeninstituts in Basel zu einer in Europa über Jahrzehnte einzigartigen Zucht, welche den Erfolg Geigys und seiner Nachfolger auf dem Gebiet der Erforschung und Bekämpfung der Afrikanischen Schlafkrankheit begründete.
Rudolf Geigy, der Gründer des Schweizerischen Tropeninstituts (Mitte), auf dem Weg nach Westafrika, 1945.
Geigy war ein Macher. Einer, dessen Geld es ihm ermöglichte, seinen Willen durchzusetzen. Marcel Tanner macht kein Geheimnis aus seiner Bewunderung für die Entschlossenheit seines Patrons. «Geigy veranstaltete keine langen Seminare ohne Resultate», erinnert er sich. Als ihm der Kanton Basel-Stadt 1964 den Kredit für ein Elektronenmikroskop für das Tropeninstitut verweigerte, zog er die Million kurzerhand aus der eigenen Tasche.
Forschungsarbeiten im Feldlabor des Schweizerischen Tropeninstituts in Ifakara, Tansania, 1957.
1949 verschlug es Geigy wieder nach Afrika. Diesmal ins ostafrikanische Tanganjika, genauer: in die kleine Stadt Ifakara im Südwesten des Landes. Er war Gast der Schweizer Kapuzinermission. Der Name «Ifakara» verheisst nichts Gutes. In der Sprache der Einheimischen bedeutet es «der Ort, an dem man stirbt». Und gestorben wurde zahlreich. Insbesondere Malaria forderte damals zahlreiche Menschenleben. Geigy interessierte sich für die Menschen und ihre Lebensweise. Und für alles, was ihre Gesundheit gefährdete. Wie für das von einer Lederzecke (Ornithodoros moubata) übertragene Afrikanische Rückfallfieber. Er machte Jagd auf Warzenschweine, trieb sie unter den verwunderten Blicken der Einheimischen aus ihren Löchern. Er glaubte, dass die Schweine als Reservoirtiere bei der Übertragung des Rückfallfiebers eine wichtige Rolle spielten. Diese Annahme liess sich nicht erhärten. Doch fortan wurde der umtriebige Geigy von der Bevölkerung «Bwana Ngiri» (Herr Warzenschwein) genannt.
Der zweite Besuch in Ifakara 1954 war insofern ein Erfolg, als dass der Erzbischof Edgar Maranta und die Kapuzinermission Rudolf Geigy anboten, ein eigenes Labor in einem Flügel des Saint Francis Referral Hospital (SFRH) in Ifakara einzurichten. «Sie bleiben hier und bauen das Labor auf», sagte Geigy zu seinem Assistenten Thierry Freyvogel. Widerspruch zwecklos. Während drei Jahren koordinierte und überwachte der Doktorand und Malaria-Spezialist Ndege Huru (Frei-Vogel) den Bau. Er liess Baumaterial aus dem fernen Daressalam nach Ifakara kommen, verhandelte mit den Schreinermeistern der Mission und versuchte sich in der Zucht von Malaria-Mücken, solange ihn das tückische Fieber nicht selbst ans Bett fesselte. 1957 war es dann so weit: Das Swiss Tropical Institute Field Laboratory (seit 1996: Ifakara Health Institute) konnte feierlich eingeweiht werden.
Basel hatte seine neuen Parasitologen: Wissenschaftler, die nicht nur theoretisches Wissen predigten, sondern nach Afrika reisten, ihre Hosenbeine hochkrempelten und sich selbst von den Mücken stechen liessen. Sie standen dafür ein, das Studium der Parasiten, Würmer und Bakterien im Labor mit dem Studium ihrer Übertragungsmechanismen bei den Menschen vor Ort zu kombinieren. Unmöglich, dass ein solcher Zugang zur Welt nicht eine ungehörige Faszination auf Marcel Tanner ausübte. Noch während seines Aufenthalts in Kanada war er unschlüssig gewesen, grübelte darüber, ob er sich einem Studium der Medizin, der Landwirtschaft oder der Biologie widmen sollte. Doch die Ringvorlesungen des Tropeninstituts in Basel, allen voran die Vorlesungen des witzigen Freyvogels und die zahlreichen Exkursionen mit Geigy in die Wildnis der Nordwestschweiz liessen das Pendel der Entscheidung in Richtung Medizinische Biologie / Infektionsbiologie umschlagen.
Auch in Basel pflegte Rudolf Geigy einen engen Austausch zwischen Laborarbeit und dem Studium in der freien Natur: Am Montag gings in die Petite Camargue Alsacienne, ein Naturschutzgebiet im benachbarten Elsass. Mit einem «Tatzelwurm», dem damals gängigen Grosstaxi, wurden die Studierenden am Zoologischen Institut in Basel abgeholt und ins Grüne chauffiert. Dort machte man sich an die Arbeit: Eine Gruppe sammelte Zecken, eine andere Mücken und Pflanzen, eine dritte fischte im Altenrhein nach Plankton. «An diesen Nachmittagen lernten wir alles auf einmal: Biologie, Epidemiologie und wie man überhaupt Proben entnimmt, um daraus allgemeingültige Aussagen zu machen», erinnert sich Tanner. Die Petite Camargue hielt auch eine Lektion in Sachen Trinkfestigkeit bereit. Kaum hatte sich die Sonne hinter dem vom Schilf bewachsenen Ufer schlafen gelegt, wurde Apéro aufgetragen, dann ging man ins nahe gelegene Elsässer Beizli zum Abendessen. Später gab es Whiskey, man zog an grossen Zigarren, blies den Rauch in den Nachthimmel, bis man schliesslich – benebelten Sinnes – wieder in die weichen Polster der Tatzelwürmer versank und in Richtung Basel zurückschaukelte, als wäre man auf dem offenen Ozean.
Niklaus Weiss, der spätere Vizedirektor des Tropeninstituts.
Marcel Tanner widmete sich in seiner frühen akademischen Laufbahn den sogenannten Trypanosomen, den Erregern der Afrikanischen Schlafkrankheit. Diese virtuosen Krankmacher haben eine für den Menschen äusserst unangenehme Eigenschaft. Nach dem Stich einer infektiösen Tsetsefliege wandern sie in die Blutgefässe und vermehren sich rasant. Nach wenigen Jahren durchbrechen sie die Blut-Hirn-Schranke, bahnen sich ihren Weg ins Nervensystem und verursachen Schlaf- und neurologische Störungen. Die Infektion endet in den meisten Fällen tödlich. Mit einem Impfstoff ist der Schlafkrankheit nicht beizukommen. Die Parasiten sind Verwandlungskünstler. Durch eine sogenannte Antigenvarianz ändern sie ihre Oberflächenstruktur und umgehen so die Abwehrkräfte des menschlichen Immunsystems. Marcel Tanner konnte in seiner Diplomarbeit als Erster zeigen, dass die Antigenvarianten, die man später im Blut nachweisen konnte, zuerst und direkt nach einem infektiösen Stich im Lymphsystem sichtbar sind.2 Ein für die Wissenschaft wichtiges Resultat.
Dann setzte Tanner das erste Mal die Füsse auf afrikanische Erde: Kamerun 1979. Ein hölzerner Labortisch, ein Mikroskop und auf dem Stuhl gegenüber sein Chef und Laborleiter Niklaus Weiss. Vergrösserte Fadenwürmer (Onchocerca volvulus) wanden sich unter dem Mikroskop. Sie sind verantwortlich für die Afrikanische Flussblindheit, eine heute weitgehend vernachlässigte Krankheit. Die Parasiten werden von der Kriebelmücke tagsüber auf den Menschen übertragen, nisten im Bindegewebe und leben in einem Knäuel unter der Haut. Die Larven dieser Würmer, die sogenannten Mikrofilarien, wandern zu Tausenden dicht unter der Haut über den Körper. Gelangen sie schliesslich in die Hornhaut, so lassen sie ihre Opfer erblinden. Jeden Morgen fuhren Marcel Tanner und Niklaus Weiss mit einem mobilen Operationsteam in die Dörfer, das lokale Team operierte die kleinen Knoten aus der Haut der Patientinnen und Patienten und behandelten diese gegen die Mikrofilarien. Der tägliche Austausch mit den Menschen in den entlegensten Dörfern führte zu einer grundlegenden Erkenntnis: «Mir wurde schlagartig bewusst, dass die Menschen noch andere Probleme hatten als Knoten unter der Haut, die sich mit scharfen Klingen entfernen liessen», erinnert er sich. Die Dorf bevölkerung litt an Malaria, Atemwegserkrankungen, Durchfall und faulen Zähnen. Die Häuser waren ohne Strom, die Frauen schöpften das Trinkwasser aus einem abgelegenen Fluss. Diese Erkenntnis der grundlegenden Bedeutung des Gesundheitssystems führte Marcel Tanner weg von der Infektionsbiologie im Labor zur Epidemiologie, dem öffentlichen Gesundheitswesen.
Ifakara, Tansania: Das Städtchen wirkt wie von einem anderen Stern und wurde für Marcel Tanner eine neue Heimat auf Zeit. Es liegt 350 Kilometer südwestlich der Hafenstadt Daressalam. Eine Tagesreise mit dem Auto über holprige Strassen. Das Tal ist fruchtbar. Während der Regenzeit verwandelt der Fluss Kilombero die Umgebung in eine Seenlandschaft. Die Menschen leben von Fisch, Reis und Mais. Die Ernte zwingt die Frauen auf die Felder. Ein Fussmarsch von mehreren Tagen. Mit gekrümmten Rücken und geschulterten Kindern stehen sie knöcheltief im Wasser. Ihre Behausung sind auf Stelzen gezimmerte Hütten mit Strohdach. Die Kinder bewachen die Ernte und werfen mit Steinen nach den Vögeln. Die Schulbank befindet sich jenseits ihres Horizonts.