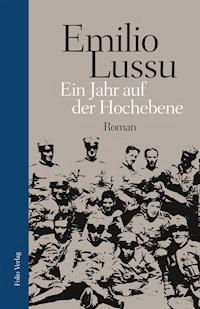Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Transfer Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Lussus brillante Darstellung des frühen italienischen Faschismus ist ein hochaktuelles Lehrstück für jede Demokratie. Mussolinis Marsch auf Rom verlief als Farce und sollte dennoch eine verhängnisvolle Auswirkung auf die italienische und europäische Geschichte haben. Emilio Lussu, der seinen literarischen Bericht bereits zehn Jahre danach, 1932, im Pariser Exil schrieb, erlebte diese Schmierenkomödie der Macht als Oppositionspolitiker auf Sardinien. Er zeigt, wie eine improvisierte Aktion durch das Versagen der demokratischen Institutionen, durch Opportunismus und das Stillhalten des Königs Vittorio Emanuele III. schließlich Mussolinis Griff nach der absoluten Macht begünstigte. Die Tragikomödie mutierte endgültig zur Katastrophe. Lussus satirischer Witz und seine Kompetenz als Augenzeuge machen sein Buch in höchstem Maß authentisch und – bei aller Ernsthaftigkeit des Themas – zu einer äußerst unterhaltsamen Lektüre. Eine eindringliche Warnung vor Terror, Dummheit und Despotie. • Mit einem Nachwort von Claus Gatterer • Mit zahlreichen Abbildungen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foto: © I.S.S.R.A. (Cagliari)
Emilio Lussu, geboren 1890 auf Sardinien, 1915–1918 hochdekorierter Offizier, 1919 Mitbegründer der Sardischen Aktionspartei, 1921–1925 Parlamentsabgeordneter. 1927 Verbannung nach Lipari, 1929 spektakuläre Flucht nach Frankreich. Mitbegründer der antifaschistischen Bewegung Giustizia e Libertà, führender Politiker der Resistenza. 1945–1948 Minister, bis 1968 Senator. 1975 in Rom gestorben. Bei Folio erschienen: Ein Jahr auf der Hochebene (2017).
Claus Gatterer, geboren 1924 in Südtirol. Studium in Padua. 1945-1947 publizistisch und politisch tätig in Südtirol, ab 1948 Journalist in Österreich. Er verstarb 1984 in Wien.
Bei Folio erschienen: Schöne Welt, böse Leut (52022).
LUSSUS BRILLANTE DARSTELLUNG DES FRÜHEN ITALIENISCHEN FASCHISMUS IST EIN HOCHAKTUELLES LEHRSTÜCK FÜR JEDE DEMOKRATIE.
2022 jährt sich Mussolinis Marsch auf Rom zum 100. Mal. Er verlief als Farce und sollte dennoch eine verhängnisvolle Auswirkung auf die italienische und europäische Geschichte haben. Emilio Lussu, der seinen literarischen Bericht bereits zehn Jahre danach, 1932, im Pariser Exil schrieb, erlebte diese Schmierenkomödie der Macht als Oppositionspolitiker auf Sardinien. Er zeigt, wie eine improvisierte Aktion durch das Versagen der demokratischen Institutionen, durch Opportunismus und das Stillhalten des Königs Vittorio Emanuele III. schließlich Mussolinis Griff nach der absoluten Macht begünstigte. Die Tragikomödie mutierte endgültig zur Katastrophe. Lussus satirischer Witz und seine Kompetenz als Augenzeuge machen sein Buch in höchstem Maß authentisch und - bei aller Ernsthaftigkeit des Themas -zu einer äußerst unterhaltsamen Lektüre.
„Dramatik und Komik durchziehen den Text ebenso wie berührende Passagen und dokumentarisch knappe Schilderungen des Terrors.“ Die Presse
„Emilio Lussu erzählt mit der Kompetenz des Augenzeugen und mit dem Witz eines Satirikers.“ Neue Zürcher Zeitung
Eine eindringliche Warnung vor Terror, Dummheit und Despotie.
EMILIO LUSSU
MARSCHaufROM UND UMGEBUNG
EIN BERICHT
Aus dem Italienischen und mit einem Nachwort von Claus Gatterer
Inhalt
Vorwort zur Erstausgabe
Kapitel [ 1 ]
Kapitel [ 2 ]
Kapitel [ 3 ]
Kapitel [ 4 ]
Kapitel [ 5 ]
Kapitel [ 6 ]
Kapitel [ 7 ]
Kapitel [ 8 ]
Kapitel [ 9 ]
Kapitel [ 10 ]
Kapitel [ 11 ]
Kapitel [ 12 ]
Kapitel [ 13 ]
Kapitel [ 14 ]
Kapitel [ 15 ]
Kapitel [ 16 ]
Kapitel [ 17 ]
Kapitel [ 18 ]
Kapitel [ 19 ]
Kapitel [ 20 ]
Kapitel [ 21 ]
Kapitel [ 22 ]
Claus Gatterer [ Nachwort zur deutschen Erstausgabe 1971 ]
EMILIO LUSSU
Im Ersten Weltkrieg an der Dolomitenfront
In der Verbannung auf Lipari, 1927–1929
Nach dem Zweiten Weltkrieg
Publikationen (Erstausgaben)
Werke von Emilio Lussu in Übersetzung
Glossar
Vorwort zur Erstausgabe
Mit diesem Buch wollte ich die politischen Ereignisse meines Landes so festhalten, wie ich sie in den letzten Jahren erlebt habe.
Das Buch ist keine Geschichte des Faschismus: Ich erzähle nur einige Episoden, die mein Leben betreffen. Das Leben eines Italieners, der kurz vor der Generalmobilmachung sein Universitätsstudium abschloss, am Ersten Weltkrieg und an den politischen Kämpfen der Nachkriegszeit teilnahm und schließlich – ich bitte den antiparlamentarisch eingestellten Leser, nicht zu erschrecken – Abgeordneter zum Parlament war. Ich gehöre derselben Generation an wie die Faschisten der ersten Stunde: Viele ihrer Anführer waren in der Kindheit, in der Schulzeit oder im Krieg meine Freunde.
Im Hinblick auf die zu erwartenden heftigen Reaktionen der italienischen Leser war ich darauf bedacht, nicht eine einzige Episode einzufügen, die ich nicht belegen konnte. Die Substanz der hier erinnerten Ereignisse kann nicht bestritten werden, auch wenn die Beurteilung der Folgen manchmal unterschiedlich ausfallen mag. Wer einen Schwerthieb austeilt, wird anders fühlen als der, den er trifft. Trotzdem bleibt der Schwerthieb stets ein Schwerthieb.
Der Faschismus, den ich beschreibe, ist der Faschismus, den ich entstehen, sich entwickeln und sich behaupten sah. Viele Gesichtspunkte sind mir sicherlich entgangen, anderen habe ich vielleicht zu großes Gewicht beigemessen. Doch das ist für jeden, der Partei ergreift, unvermeidlich. Nur die Zeit wird eine objektivere Kritik ermöglichen, vielleicht; heute jedoch sind wir nicht allein von Ideen besessen, sondern vor allem von Leidenschaften. Wir können Zeugnis ablegen und unsere Eindrücke weitergeben: Zu urteilen haben andere.
Der ausländische Leser, der den Erlebnissen eines demokratischen Oppositionellen folgt, kann sich in groben Zügen ein Bild des Faschismus, des Antifaschismus, ja, der italienischen Verhältnisse machen.
Doch man soll nicht verallgemeinern. Weder kann ein Volk nach den Konflikten einer Stunde beurteilt werden, noch genügt ein Jahrzehnt, um die Kultur einer Nation zu begreifen.
Emilio Lussu, 1932
Alle bewaffneten Propheten haben gesiegt, alle unbewaffneten sind zugrunde gegangen.
Machiavelli, Il Principe
Stell dir vor, vier verprügeln mich,
zweihundert daneben empören sich,
doch bleiben tatenlos stehen.
Sag, wie solls mir da gehen,
wenn vier mich verhauen
und zweihundert dumm schauen?
Giuseppe Giusti
[ 1 ]
Als in Paris die Friedenskonferenz zusammentrat, lag unser Bataillon an der Waffenstillstandslinie an der jugoslawischen Grenze. Das Heer war demokratisch. Hatte man dem Volk und den Soldaten nicht fünf Jahre lang in allen möglichen Proklamationen eingehämmert, wir schlügen uns für Freiheit und Gerechtigkeit? Wilson und seine Ideen waren bei den Fronttruppen überaus populär. Als dann aber die europäischen Diplomaten die 14 Punkte des Amerikaners, einen nach dem anderen, zynisch demolierten, fühlten sich die Soldaten aufs Neue verraten: Zorn und Enttäuschung machten sich breit. Im Schützengraben hatte man nie besondere Sympathie für die Diplomatie empfunden; sie war ungefähr gleich unbeliebt wie der Generalstab.
Italien wurde in Paris durch Ministerpräsident Orlando und Außenminister Sonnino vertreten. Eines Tages wurden die beiden energisch und verlangten, dass Dalmatien – wie von den Diplomaten im Londoner Geheimpakt ausgehandelt – zu Italien komme. Unter den Offizieren unserer Brigade wurde dieses Problem leidenschaftlich diskutiert. Sogar der General, der unsere Brigade befehligte, ließ uns seine Meinung wissen. Er hatte eine gewisse Schwäche für die Außenpolitik; zudem war er mit dem sozialistischen Minister Bissolati befreundet und folglich Demokrat, soweit in Italien ein General überhaupt Demokrat sein konnte.
In einem großen Offiziersrapport offenbarte er uns seine Gedanken: „Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass wir den Krieg gewonnen haben, aber diese Herren“ – er meinte Orlando und Sonnino – „sind noch imstande, uns einzureden, wir hätten ihn verloren.“
Im Lande gärte es.
Mussolini spielte den imperialen Eroberer und schrieb leidenschaftliche Artikel für seine Zeitung. Trotzdem konnten ihn die Soldaten nicht leiden. Ende 1918 hatten die ersten Heimkehrer in Rom, auf dem Kapitol, ein Treffen abgehalten: Mussolini wollte eine Rede halten, aber die Frontkämpfer ließen ihn nicht zu Wort kommen. Man munkelte, dass das Geld für seine Zeitung, den Popolo d’Italia, aus trüben Quellen stammte, und man hielt ihm vor, dass er fanatisch für den Krieg, aber äußerst zurückhaltend im Krieg gekämpft habe. Gewiss, er war an der Front verwundet worden, aber in den Augen der Heimkehrer war dies kein Milderungsgrund. Wäre seine Kriegsbegeisterung echt gewesen, hätte er nach der Genesung an die Front zurückkehren müssen; ein Interventionist wie Mussolini durfte sich nicht wegen ein paar Schrammen vom Schützengrabendienst dispensieren. Alle Frontsoldaten teilten die Verachtung für jene Politiker, die den Krieg zwar gepredigt hatten, doch der Front ferngeblieben waren.
Die Demobilisierung erfolgte in Etappen. Millionen Frontkämpfer kehrten ins zivile Leben zurück, kriegsmüde und hungrig nach Frieden. Sie waren überzeugte Pazifisten, aber sie luden ihre Leidenschaft für den Frieden, wie es häufig geschieht, mit der Sprengkraft eines wahrhaft kriegerischen Geistes auf.
Die menschliche Seele ist voller Widersprüche. In den Jahren vorher war mit denjenigen, die – sei es aus romantischer, sei es aus militaristischer Begeisterung – den Eintritt Italiens in den Krieg verlangt hatten, das gerade Gegenteil passiert: Manche dieser Interventionisten hatten sehr sanftmütig am Krieg teilgenommen, andere waren nur pro forma eingerückt, und wieder andere hatten es sich so einzurichten gewusst, dass das sichere, zivile Hinterland auf sie nicht verzichten konnte.
Tausende Heimkehrer fanden nach der Demobilisierung keine Arbeit. Aber das Leben wurde von einem Tag zum anderen teurer. Enttäuschung und dumpfer Groll waren die Folge. So war das also! Die Frontkämpfer sollten vor Hunger krepieren, während die Kriegsgewinnler mit den Millionen protzten! Wenn der Friede so aussah, dann lieber Krieg. Gewiss, im Krieg war ein Leben nicht viel wert. Aber was war ein Leben schon wert?
Die Gärung im Volk wuchs.
Die Regierung hatte den Soldaten, um sie für den Krieg zu begeistern, eine Agrarreform versprochen. Ministerpräsident Salandra hatte 1915 damit begonnen: Grund und Boden für alle. Die folgenden Regierungen hatten diese Versprechungen wiederholt, und wir Offiziere hatten in den Schützengräben den Soldaten die Rundschreiben der Ministerien und des Oberkommandos erklärt: „Das Land den Bauern!“
Die Bauern hatten den Krieg gewonnen. Nun forderten sie von der Regierung und von den Großagrariern die Einlösung der Versprechen: Grund und Boden. Aber die Regierung hatte momentan andere Sorgen, und die Großgrundbesitzer erkannten, wenngleich mit vierjähriger Verspätung, dass sie mit allem Nachdruck gegen die Großzügigkeit der Regierung protestieren mussten. Hatten die Herren Minister nicht fremdes Hab und Gut verschenkt? Die Großgrundbesitzer waren der Meinung, man dürfe Landarbeitern und Pächtern erst dann Grund und Boden geben, wenn das Vaterland vom Untergang bedroht sei, anders gesagt: wenn man Gefahr laufe, einen Krieg zu verlieren, aber nicht, wenn man einen Krieg gewonnen hatte. Und sie verwiesen auf Russland. Soldaten, die einen Krieg gewonnen haben, erklärten sie, holen sich das Land, das sie brauchen, in den besiegten Ländern, sie vergreifen sich nicht an fremdem Besitz im eigenen Vaterland. Und da Großgrundbesitzer stets höchst praktisch denkende Leute sind, empfahlen sie der Regierung Beutezüge nach Kleinasien, Georgien, Dalmatien oder Unruhestiftung in Tunesien.
Es geschah, was geschehen musste. In vielen Gebieten Italiens taten sich die landlosen Heimkehrer mit den armen Bauern zusammen und besetzten die brachliegenden Latifundien. Mussolini stand damals auf der Seite der Bauern.
Verglichen mit den Städten war das unruhige Land eine wahre Insel des Friedens. Die Lebenshaltungskosten stiegen, aber die Löhne blieben gleich. In manchen Industriezweigen wurden sie sogar gesenkt. Die Kriegsgewinnler prassten und schwelgten in ihrem Reichtum: Die allgemeine Not kümmerte sie nicht. Die Großhändler, für die der Krieg zu rasch geendet hatte, hatten sich an große Gewinne gewöhnt. In vielen Städten herrschte Hunger. Läden wurden gestürmt, Lager geplündert. Es kam zu Zusammenstößen.
Mussolini schrieb: „Nieder mit den Blutsaugern, die das Volk aushungern! Revolte ist das oberste Gebot, um die Gier dieser Blutsauger zu treffen. Erhebt euch!“
Die organisierten Arbeitermassen verbanden ihre gewerkschaftlichen Forderungen mit politisch-ideologischen Zielen. Die Arbeiter sahen Russland als Vorbild, das ihnen die Revolution auch in Italien notwendig und möglich erscheinen ließ. Sooft die Arbeiter Lohnerhöhungen oder bessere Arbeitsbedingungen verlangten, musste gestreikt werden. Ein Teilstreik löste den anderen ab; die meisten betrachteten diese Streikaktionen als unerlässliches Training für den großen politischen Generalstreik, der früher oder später fällig werden würde. Die Sozialistische Partei, in der sich der Großteil der Arbeiterbewegung gesammelt hatte, war in etliche Richtungen gespalten: Ein Flügel predigte die sofortige gewaltsame Revolution, ein anderer erwartete das Heil von graduellen Reformen im Rahmen der Legalität, und ein dritter Flügel wusste überhaupt nicht, was er wollte. Dieser aber war der stärkste, lauteste und unruhigste. Die Parteiführung bemühte sich, die gegensätzlichen Strömungen miteinander zu versöhnen, doch sie vergrößerte nur das allgemeine Durcheinander.
Die Arbeiter der großen Industriebetriebe waren besonders heftige Gegner des Krieges; sie hatten nicht einzurücken brauchen, und sie setzten ihren Kampf gegen den Krieg fort, als wäre er nicht beendet, als stünde sein Ausbruch vielmehr noch bevor. In der Praxis schlug diese Ablehnung des Krieges um, in Verachtung gegen alle, die eingerückt waren: Die Arbeiter schienen zu meinen, die Frontsoldaten hätten vier Jahre lang auf Kosten der Arbeiterschaft vergnügte Feste gefeiert. Diese Haltung trug später wesentlich dazu bei, dass sich die Arbeiterbewegung die Sympathien der Heimkehrer und des Heeres verscherzte.
Ich nahm wiederholt an Kundgebungen gegen den Krieg teil. Sie waren zwar ziemlich chaotisch, aber gleichwohl eindrucksvoll. Kein anderes Land hat so viel nachträgliche Empörung über den Krieg bekundet wie Italien. Hätten die italienischen Arbeitermassen nur ein Zehntel der Antikriegsdemonstrationen, die sie nach dem Waffenstillstand veranstalteten, im Frühjahr 1915 auf die Beine gebracht, es wäre garantiert nie zum Krieg gekommen.
Die abgerüsteten Reserveoffiziere und die heimgekehrten arditi waren ein Fall für sich: Sie bildeten eine große Masse von Unzufriedenen. Die arditi waren eine Spezialtruppe, die in den letzten Kriegsjahren ausschließlich als Sturmabteilungen für Sonderaktionen eingesetzt worden waren. Sie brauchten keinen Schützengrabendienst zu machen. Sie führten in der Etappe ein sorgloses, sportliches Leben. Aber wenn dann die hohen Stäbe einmal meinten, an diesem oder jenem Frontabschnitt könne nur eine besonders wagemutige Aktion helfen, holte man die arditi nach vorne und warf sie ins Feuer. Nun, in die zivile Normalität zurückgekehrt, fanden sie sich nicht mehr zurecht. Arbeit und Frieden behagten ihnen nicht. Das war nicht ihr gewohntes Klima. Im Krieg hatte man sie geschätzt, gerühmt und bewundert, jetzt, im Frieden, verachtete man sie. Im Krieg hatten sie, die arditi, die Infanterie verhöhnt: Infanterie war für sie gleichbedeutend mit Schützengrabenfron, Trägheit, Disziplin; im Frieden verhöhnten sie die Demokratie; Demokratie hieß für sie: parlamentarische Mehrheitsregierung, Bürokratie, Legalität. Hätte man ihnen Grund und Boden angeboten, sie hätten nicht gewusst, was damit anfangen. Sie waren Nomaden geworden, untauglich für das sesshafte Leben, und in ihrer Unrast suchten sie immer nur die Aktion.
Viele Reserveoffiziere hatten sich die Rangabzeichen in wenig anspruchsvollen Schnellsiederkursen oder durch Verdienste vor dem Feind erworben. Vor dem Krieg waren sie Studenten, kleine Angestellte oder Handwerker gewesen; als Leutnants und Hauptleute hatten sie Züge, Kompanien, Bataillone kommandiert. Wer im Krieg eine Kompanie geführt hat, kann nicht ohne Weiteres an die Universität zurückkehren und wieder zu büffeln beginnen. Wer an der Spitze eines Bataillons gestanden hat, fühlt sich gedemütigt, wenn er wieder – für 500 Lire im Monat – als Archivbeamter oder Schreiberling dienen soll. Diesen Leuten wurde das zivile Leben unerträglich. Viele von ihnen hatten sich an das Leben in einer Etage gewöhnt, die hoch über jener ihrer Familie oder ihrer einstigen Anstellung lag. Der italienische Offizier hat im Übrigen viel vom Dünkel des Deutschen übernommen. Konnten und durften sie, die den Krieg gewonnen hatten, nun als Bankrotteure in die Normalität des zivilen Alltags eintauchen? Hatten sie nicht Tag für Tag ihr Leben riskiert? Sollten sie sich nun bescheiden in den Arbeitstrott fügen – unter Vorgesetzten, die als Drückeberger Karriere gemacht hatten? Das kam für sie nicht infrage. Wenn der Frieden so aussah, dann lieber Krieg.
Die zahllosen arditi und Reserveoffiziere, die sich nicht in den Friedensalltag fügen konnten, verschärften die politische Krise. Sie bildeten rastlose Haufen, die zunächst zwischen der extremen Linken und dem Nationalismus pendelten, die sich dann Gabriele D’Annunzio im Fiume-Abenteuer anschlossen und die schließlich, nach dem Bankrott D’Annunzios, bei Mussolini landeten.
In Fiume war gleich nach Kriegsende, noch 1918, ein Plebiszit arrangiert worden: Die Stadt wollte italienisch sein. Die Friedenskonferenz war anderer Ansicht. Gabriele D’Annunzio, Dichter und Held, erhob sich mit der Leier und dem Schwert gegen die Pariser Beschlüsse.
D’Annunzio hatte stets einen gewaltigen Einfluss auf die Hitzköpfe der nationalen Jugend ausgeübt. Ein Herr von erlesenem Geschmack und Lebensstil, pflegte der Dichter alles, was er tat, in ästhetische Formen zu kleiden. Vor dem Krieg steckte er bis über den Kopf in Schulden: Es gab im Himmel und auf Erden keinen Heiligen, den er um Rettung hätte anflehen können. Ein anderer hätte sich in dieser Lage – zumindest aus Ehrgefühl – eine Kugel in den Kopf gejagt. Aber D’Annunzio wusste seine Nerven zu zügeln. Er entsagte dem undankbaren Vaterland, flüchtete nach Frankreich und führte dort, in Arcachon, ein fürstliches Leben. Erst im Mai 1915 tauchte er – umgeben von einem fürstlichen Hofstaat – wieder in Italien auf und rief die Jugend zum Krieg auf. Die Meute der Gläubiger stürzte sich auf den Dichter. Die Herren konnten von Glück reden, dass sie nicht als Feinde des Vaterlandes und Söldlinge des Feindes gelyncht wurden.
D’Annunzio ließ sich vom Krieg verschlingen – mit Haut und Haaren; ab und zu rief er sich der Nation mit heroischen Gesten in Erinnerung.
Wohin hätte der Dichter-Held sich wenden sollen, als der Krieg beendet war? Auch er sah sich mit dem Problem der Demobilisierung und der Rückkehr ins zivile Leben konfrontiert. Doch war sein Fall ernster, denn er hatte sich an gewisse Ansprüche gewöhnt und konnte ohne prunkvollen Hofstaat nicht leben. Das Nachkriegs-Frankreich war nicht sehr einladend; Arcachon schied als mögliche Zuflucht aus. Andererseits lauerten in den italienischen Städten die alten Gläubiger auf ihn, die in ihrem grenzenlosen Zynismus nicht bereit schienen, die Schulden wegen Verjährung oder patriotischer Verdienste zu tilgen.
In dieser peinlich-kritischen Lage erfuhr D’Annunzio, dass die Friedenskonferenz in Paris den Italienern Fiume vorenthalten hatte. In heiligem Zorn bäumte er sich dagegen auf. Schuldner, Dichter und Krieger verschmolzen in eins: zum Retter des Vaterlandes. Am 12. September 1919 zog er an der Spitze einer Abteilung arditi und zweier Infanteriebataillone des Heeres in Fiume ein und besetzte es. Während des ganzen Unternehmens fiel kein einziger Schuss.
In Paris machte der Handstreich wenig Eindruck: Die Herren der Friedenskonferenz waren an derartige Operationen gewöhnt. Aber die öffentliche Meinung Italiens war tief beeindruckt. Ministerpräsident Nitti, der im Juni 1919 Orlando abgelöst hatte, wurde von D’Annunzios Abenteuer vollkommen überrascht. Das Volk war dadurch zwar von den innenpolitischen Schwierigkeiten abgelenkt, aber der Regierungschef befürchtete gefährliche außenpolitische Komplikationen. Der Dichter hatte nämlich – wohlgemerkt, im Namen des italienischen Volkes! – die Annexion Fiumes an Italien proklamiert. Die Regierung – unfähig, mehr zu tun – verhängte eine Blockade über die Stadt.
D’Annunzio herrschte in Fiume als moderner Kondottiere; er sprach viermal täglich zu seinem Volk, organisierte Streifzüge zu Lande und Piratenakte zur See. Er gab Fiume eine eigene korporative Verfassung. Er schloss geheimnisvolle Pakte mit Balkanmächten, mit Japan und sogar mit sowjetrussischen Stellen ab. Er sandte Italien, Europa und der Welt lange Botschaften, die bald in Prosa, bald in Versen abgefasst waren. Zuweilen drohte er auch mit einem Marsch auf Rom.
Bei uns in den alten Frontregimentern sagte man: „Das Ganze ist ein Narrenhaus!“
Mussolini kommentierte in seiner Zeitung: „Von nun an ist Fiume die Hauptstadt Italiens.“
Beschäftigungslose Offiziere, arditi, Nationalisten, Studenten, Kriegsfreiwillige, Arbeitslose, Futuristen und Dichter waren hingerissen vom Geschehen. „Das ist Politik!“, jubelten sie. Und sie eilten nach Fiume.
Ministerpräsident Nitti setzte für den November 1919 Parlamentswahlen an. D’Annunzio verhöhnte den Regierungschef. Mussolini sagte der Demokratie insgesamt, besonders aber den Sozialisten den Kampf an, er pries das kriegerische Fiume und empfahl seine faschistische Liste den Wählern durch ein radikalrevolutionäres Programm. Die Wahlen verliefen ohne Zwischenfall, und Mussolini brachte es auf lächerliche 4 000 Stimmen. Die großen Gewinner waren die Sozialisten und die demokratischen Katholiken. Die innenpolitische Lage wurde immer verworrener. Jeder neue Tag bedeutete mehr Arbeitslosigkeit, mehr Streiks, höhere Preise. Im Juni 1920 trat Nitti zurück, Giolitti, der alte Fuchs des Parlaments, wurde Ministerpräsident. Der Piemontese hatte sich 1915 dem Kriegseintritt Italiens widersetzt; nun hielten ihn viele für den einzigen Mann, der die politische Lage meistern konnte. Er war noch keine zwei Monate im Amt, als sich der Gegensatz zwischen Arbeitern und Industriellen dramatisch zuspitzte. Die Arbeiter verlangten eine mit den Lebenshaltungskosten gekoppelte Lohndynamik: Die Industriellen weigerten sich, über diese Forderung auch nur zu reden. Die Metallarbeiter reagierten mit Sitzstreik, die Industriellen mit Aussperrung. Das war eine Kriegserklärung. Die Arbeiter besetzten die Fabriken und nahmen – auf eigene Rechnung und unter eigener Leitung – die Produktion wieder auf.
Italien und Europa waren schockiert. Bereitete sich da die bolschewistische Machtergreifung vor? Mussolini meldete sich zu Wort: „Mir ist es einerlei, ob die Fabriken den Arbeitern oder den Industriellen gehören.“
Giolitti ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Er lehnte es ab, Truppen einzusetzen, und wartete. Als Arbeiter und Industrielle nicht mehr weiter wussten, trat er als Friedensstifter auf und legte den Streit bei. Die Arbeiter mussten sich mit der Produktionskontrolle bescheiden, die Industriellen erhielten ihre Fabriken wieder. Mit dem italienischen Bolschewismus war es vorbei.
Ein paar Wochen später schrieb Mussolini: „Wer glaubt, in Italien gäbe es noch eine kommunistische Gefahr, der verwechselt aus eigensüchtigen Interessen seine Ängste mit der Wirklichkeit. Der Bolschewismus ist tot.“
Aber die Angst davor war groß gewesen. Ich hatte einen Freund, damals Professor, später Rector magnificus an einer der berühmtesten italienischen Universitäten, der vor Kommunisten eine geradezu panische Angst hatte. In Augenblicken besonderer Besessenheit peinigte ihn die grausame Gewissheit, dass ihm die Bolschewiken die Frau wegnehmen würden. Damals las man in den europäischen Zeitungen immer wieder, die Kommunisten hätten in Russland die Frauen sozialisiert.
Ich entsinne mich auch der Ängste eines entfernten Verwandten, eines Großgrundbesitzers. Er lebte in der panischen Furcht, seinen Besitz zu verlieren. Ununterbrochen jammerte er: „Meine armen Kinder! Wovon sollen sie leben, die Ärmsten?“
Er hatte keine Kinder. Allerdings war seine Ehe damals noch jung. Indessen sind zehn Jahre vergangen und er wartet noch immer auf sein erstes Kind.
Aber der eine wie der andere, der Universitätsprofessor und der ferne Vetter, sind indessen in der faschistischen Partei zu Amt und Würden gelangt.
In politisch besonders erregten Zeiten spielt die Einbildung eine gewaltige Rolle. Man sprach damals in Italien viel von einer Luftflotte, die sich in der Hand von „Bolschewiken“ befinde. Ich hatte das unerhörte Glück, den Oberbefehlshaber zu kennen. Er war ein Mystiker: eine Art heiliger Aloisius von Gonzaga. Die Luftflotte bestand aus einer Farman-Maschine, die auf einem Militärflugplatz gestohlen worden war. Aus taktischen Gründen hatte man das Flugzeug vorsorglich geteilt: Der Motor war in einem Heustadel bei Rom versteckt worden, der Rest in einem Keller in Livorno.
Nach seinem Erfolg als Friedensstifter zwischen Arbeitern und Industriellen schickte Giolitti im Dezember 1920 ein Armeekorps und eine Marinedivision aus, um den „Fall Fiume“ zu erledigen. Versuche, die Sache gütlich beizulegen, waren gescheitert. D’Annunzio hatte geschworen, er wolle kämpfend fallen wie einst Leonidas bei den Thermopylen. In den vorgeschobenen Stellungen leisteten die „Legionäre“ des Dichters erbitterten Widerstand; obschon an Kräften und Bewaffnung unterlegen, unternahmen sie fast überall Gegenangriffe. Als aber die Andrea Doria mit zwei Kanonenschüssen den Palast des Kommandanten traf, besann sich der Dichter eines anderen und ließ die weiße Fahne hissen. Das Fiume-Abenteuer war beendet. Später wurde die Frage durch ein Übereinkommen zwischen Italien und Jugoslawien gelöst: Die Stadt kam zu Italien.
Die revolutionären Bewegungen machten also keine großen Fortschritte. Die kleine Minderheit der Kommunisten spaltete sich von der Sozialistischen Partei ab. D’Annunzio zog sich in seine Einsiedelei in Gardone zurück und umgab sich dort mit Frauen, Freunden und Prunk. Mussolini aber trotzte dem Schicksal. Er appellierte an alle Verstreuten und Versprengten, egal aus welchem Lager sie kamen; er erklärte, das Vaterland sei in Gefahr, und er bot den Industriellen und Großagrariern für den Kampf gegen den „Bolschewismus“ seine Schlägertrupps an. Die fasci, lokale Basisgruppen der mussolinischen Schwarzhemden, florierten. Sie gaben das anfängliche, leere Gezänk um Programme und Ideologien bald auf und gingen zu bewaffneten Strafexpeditionen, Plünderungen, Raubzügen und Brandstiftung über, die sich vornehmlich gegen die Einrichtungen der Gewerkschaften und Landarbeiterorganisationen richteten. Hauptangriffsziel der Faschisten war die Sozialistische Partei. Die Liberalen und die bürgerliche Linke sahen dem Treiben nicht ohne eine gewisse Befriedigung zu. Ministerpräsident Giolitti ließ die Faschisten nicht nur gewähren, er förderte sie sogar.
Da es Giolitti nicht gelungen war, die Sozialisten für seine Regierung zu gewinnen, hatte er einen neuen Plan ausgeheckt: In einer ersten Phase wollte er den Kampfgruppen des faschistischen squadrismo materielle Hilfe und politischen Schutz gewähren und damit Mussolinis Offensive gegen die Sozialisten unterstützen; in einer zweiten Phase würde er dann den Chef der Schwarzhemden dazu bewegen, mit ihm, Giolitti, auf einer gemeinsamen Liste des Nationalen Blocks zu kandidieren. Auf diese Weise meinte der Regierungschef, die siegreichen Banden des Faschismus bändigen und im Käfig der Macht einsperren zu können. Giolittis Rechnung ging nur teilweise auf: Die faschistischen squadre zerschlugen den Sozialismus, Mussolini ging mit Giolitti auf die Block-Liste, dann aber lehnte er sich gegen den alten Staatsmann auf und eroberte die Macht im Staat für sich selbst.
Dies ist in groben Zügen die Geschichte des Faschismus bis zum Marsch auf Rom.
Wenn der Faschismus heute – auf dem Höhepunkt seiner Macht – beschließen würde, dem piemontesischen Staatsmann Giolitti ein Denkmal von nie zuvor dagewesenen Ausmaßen zu errichten, einen modernen Koloss von Rhodos, dann wäre dies nur eine bescheidene Geste des Dankes für einen verdienten Gönner.
Als die faschistische Bewegung stark genug schien, löste Giolitti das Parlament auf und setzte Neuwahlen an. Auf seiner Liste des Nationalen Blocks kandidierten neben den meisten Liberalen und Demokraten auch Faschisten und Nationalisten. Die Wahlen fanden im Mai 1921 statt: Unruhen und Gewalttätigkeiten erreichten einen Höhepunkt.
Ich war Kandidat der Opposition auf Sardinien.
Auf der Insel – ähnlich wie in anderen Teilen Italiens – bestanden noch keine faschistischen Organisationen. Deshalb verlief auch der Wahlkampf relativ friedlich. Ich erinnere mich nur an einen einzigen Zwischenfall.
In Villacidro, dem Hauptort eines Wahlkreises in der Provinz Cagliari, hatte sich im letzten Augenblick eine faschistische Ortsgruppe aus Konservativen und Liberalen und einigen Gruppen von gekauften Arbeitern konstituiert. Ich sollte im Ort eine Wahlversammlung abhalten. Als ich nach Villacidro kam, wurde ich von feindseligen Demonstranten empfangen: „Hinaus mit ihm! Er darf nicht reden! Hinaus mit den Vaterlandsverrätern!“
Ich war verblüfft. Vergeblich versuchten meine Parteifreunde, die Freiheit des Wortes zu verteidigen. Sie wurden im Handumdrehen von Verteidigern zu Angeklagten. Ehe ich begriff, was geschah, waren die meisten von ihnen festgenommen und in den Arrest abgeführt. Ich blieb allein, um mich herum die drohende Menge. Der lokale Polizeichef setzte mir auseinander, dass er nur aus besonderer Rücksichtnahme für meine Person nicht auch meine Festnahme angeordnet habe.
Im allgemeinen Durcheinander gelang es einem besonders aufgeregten Gegner, mir die Brieftasche mit einigen tausend Lire zu stehlen. Ich bemerkte es sofort und machte den Polizeichef auf den Dieb aufmerksam. Doch sofort stellten sich einige Rädelsführer dazwischen und inszenierten eine lautstarke Demonstration:
„A chi l’Italia? Wem soll Italien gehören?“, brüllten die Koryphäen.
„A noi! Uns!“, brüllte die Menge zurück.
Ich bemühte mich, den Leuten auseinanderzusetzen, dass es nicht um Italien gehe, sondern um meine Brieftasche. Vergeblich.
Nicht einmal der Polizeichef war bereit, meine Proteste in Betracht zu ziehen. Er breitete die Arme aus, zuckte die Achseln und belehrte mich: „Betriebsunfall eines Politikers.“
Ich ging. Während ich mich vom Platz entfernte, dröhnte hinter mir die Stimme eines faschistischen Redners: „Die moralischen Werte …!“
Ich war glücklich, als der Demonstrationslärm nur noch als fernes Echo zu mir drang. Der Chauffeur, der mich fortbrachte, betrachtete die hoch am Himmel stehende Sonne und rief bewundernd aus: „Ein herrlicher Tag heute!“
[ 2 ]
Der Nationale Block gewann die Wahl mit knapper Mehrheit. Der Faschismus aber hatte beträchtliche Fortschritte gemacht. Mussolini war in seinem Wahlkreis mit 170 000 Stimmen gewählt worden. Er zog mit 36 Gesinnungsgenossen in die Kammer ein. Unter 500 Abgeordneten war das nicht viel. Doch lag die Stärke der Schwarzhemden nicht in parlamentarischen Finessen, sondern in der Aktion, und dies in einer Zeit, in der alle anderen sich an Reden berauschten.
„Wir werden kein Parlamentsklub sein, sondern ein Aktionsund Exekutionskommando!“, verkündete Mussolini gleich nach der Wahl.
Seine Neoparlamentarier gehorchten aufs Wort. Noch am Tag der Eröffnung der Legislaturperiode jagten sie den kommunistischen Abgeordneten Misiano aus der Kammer. Er hatte sich während des Krieges der Einberufung entzogen. Ganz Italien kannte ihn als Deserteur. In den Augen seiner Wähler war die Desertion ein Verdienst, das sie mit Stimmen honorierten. Den Faschisten erschien die Anwesenheit eines Deserteurs in der Kammer unvereinbar mit der nationalen Würde. Einige von ihnen waren vornehmlich deshalb gewählt worden, weil sie Sozialisten umgebracht hatten. Umso weniger durften sie den Skandal dulden. Onorevole Misiano wurde während einer Plenarsitzung angegriffen. Ich wurde Zeuge der unerwarteten, raschen Aktion.
Misiano saß in einem Fauteuil in den weitläufigen Gängen, im sogenannten Gang der verlorenen Schritte; zwei Kollegen standen bei ihm. Angeregt diskutierten sie die politische Lage. Die Faschisten handelten offenbar nach einem festgelegten Plan; in kleinen Gruppen umkreisten sie den kommunistischen Kollegen.
Nur Mussolini fehlte.
Er handelte stets nach der Art jener Physiker, die am Schreibtisch einen neuen Planeten entdecken und dann den Astronomen die Mühe überlassen, den Stern am Himmel aufzufinden. Mussolini verließ nie den Kommandoposten; nie nahm er an gefährlichen Unternehmen teil. Er erdachte die Aktionen, sagte, dass man dies oder jenes unternehmen könnte. Das war alles. Der moderne Kondottiere kann sich notfalls in seine Höhle zurückziehen und seine Weisungen per Telefon erteilen: Das Handwerk der blutigen Überfälle überlässt er dem Fußvolk.
Ein faschistischer Abgeordneter, ein ehemaliger Kriegskamerad, kam zu mir und fragte: „Hast du eine Pistole da?“
„Nein!“, antwortete ich. „Was hast du vor? Willst du dich umbringen?“
Ich hatte noch nicht fertig gesprochen, als ein anderer faschistischer Abgeordneter, onorevole Gay, die Pistole zog und schrie: „A noi!“
Das war das Signal, auf das die anderen gewartet hatten. Im Nu war Misiano von Faschisten umringt; einer setzte ihm die Pistole auf die Brust.
„Hände hoch!“, brüllten sie im Chor.
Ich habe immer jede moralisch begründete Überzeugung geachtet. Für mich stand auch fest, dass die ideellen Gründe, die Misiano zur Desertion bewogen hatten, nicht minder Achtung verdienten als die Ideale, um derentwillen ich in den Krieg gezogen war. Ja, ich hatte stets das Gefühl, dass für einen Ehrenmann mehr Mut dazu gehörte zu desertieren, als an der Front eine Heldentat zu vollbringen.
Ich dachte also: „Misiano ergibt sich nicht. Er lässt sich eher umbringen.“ Und ich stürzte mich auf die Faschisten, um einen Mord zu verhindern.
Aber Misiano rettete sich selbst. Sicher teilte er jene Rechtslehre, die mit Gewalt erpresste Akte für null und nichtig erklärt. Er war blass und hob rasch die Arme. Das Leben war gerettet. Ideale brauchen, um sich durchzusetzen, auch Lebende, nicht nur Tote.
Die Faschisten, noch immer die Pistolen gezückt, durchsuchten seine Taschen. Misiano trug einen Revolver bei sich – ein sinnloser Luxus. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Dann stieß und drängte man Misiano zum Ausgang.
Indessen waren viele Abgeordnete herbeigelaufen; selbst die Kammervorsitzenden tauchten auf. Aber die Faschisten ließen ihr Opfer nicht los. In einem kurzen, schmalen Seitengang, durch den Misiano hindurchmusste, erblickte ich hinter einer Säule den Abgeordneten Caradonna, einen Faschisten, der allgemein als der Mörder des sozialistischen Abgeordneten Di Vagno galt. Caradonna war also kein Anfänger. Blass, gespannt, wie in einem Hinterhalt, stand er hinter der Säule, den Revolver in der Hand.
„Was tust du? Was hast du vor?“, fragte ich beunruhigt.
Er rührte sich nicht. Zweifellos wartete er auf den kommunistischen Abgeordneten. Ich rannte zurück, und mithilfe einiger Kollegen gelang es mir, Misiano zu warnen; er verließ das Gebäude durch einen anderen Ausgang.
Der Vorfall hinterließ in der Kammer einen enormen Eindruck. Nie zuvor hatte sich in der Geschichte des italienischen Parlaments etwas Ähnliches ereignet.
Man begann bei den Kommunisten. Dann würden die Sozialisten, Katholiken, Demokraten und die Liberalen an die Reihe kommen. Die Liberalen, nicht ahnend, dass es auch sie noch treffen würde, spielten sich als unparteiische Richter auf und beurteilten den Vorfall äußerst nachsichtig.
In den Gängen und im Plenum herrschte Kriegsstimmung. Wir diskutierten heftig über die Generallinie der Oppositionsrepliken auf die Thronrede. Das Land wurde, wie vor der Wahl, von Streiks und von den Gewalttätigkeiten der Faschisten gegen Sozialisten und Katholiken erschüttert. Am 25. Juni hielt Mussolini seine Jungfernrede in der Kammer. Er hatte für sich den Sitz in der hintersten Reihe auf der äußersten Rechten gewählt; vor ihm hatte niemals ein Abgeordneter dort sitzen wollen. Wenn man Mussolini dort oben sitzen sah, dachte man unwillkürlich an einen Geier.
„Ich sage euch gleich“, begann Mussolini, „dass meine Rede eine Rede von rechts sein wird. Es wird eine reaktionäre Rede sein, denn ich bin gegen das Parlament, gegen die Demokratie, gegen den Sozialismus.“
Die Sozialisten erinnerten ihn daran, dass er immerhin zwanzig Jahre lang Sozialist gewesen sei. Mussolini sah sie verächtlich an.
„Und da ich gegen den Sozialismus bin“, fuhr er fort, „bin ich auch gegen Giolitti.“
Giolitti protestierte. Der alte Abgeordnete schaute Mussolini verblüfft an, als wollte er fragen: „Was wird da gespielt?“ Waren sie nicht bis gestern noch Verbündete auf derselben Liste gewesen?
Mussolini kritisierte die Außen- und die Innenpolitik Giolittis: „Der Staat muss auf seine wesentlichste, einfachste Form zurückgeführt werden. Er muss ein gutes Heer haben, eine gute Polizei, eine glatt funktionierende Justiz, und er muss eine den Erfordernissen der Nation gemäße Außenpolitik betreiben. Alles Übrige soll der Privatinitiative überlassen bleiben.“ Der Duce ging ganz offensichtlich noch nicht mit den Plänen für den künftigen korporativen Staat schwanger. Die Kommunisten störten Mussolini immer wieder durch Zwischenrufe. Der Chef der Faschisten hatte auch für sie ein paar Sätze parat.
„Die Kommunisten? Ich kenne sie, gut sogar, denn sie sind meine Söhne. Nur haben meine Freunde oder Feinde meine Gedanken schlecht verdaut. Meine Ideen sind zu groß für kleine Gehirne, sie sind wie die Austern: herrlich zum Essen, aber schwer zu verdauen.“
Jeder bekam sein Teil.
Mussolini proklamierte die Grundzüge seines Regierungsprogramms.
Es lag auf der Hand, dass die Faschisten ihren unbequem gewordenen Protektor Giolitti loswerden wollten, der daran dachte, im Land die Ordnung wiederherzustellen.
Giolitti wurde am 4. Juli gestürzt. Die Faschisten stimmten gemeinsam mit den übrigen Abgeordneten der Rechten und mit der Linken gegen ihn. Giolitti war gescheitert. Als er die Macht verlor, herrschte im größeren Teil Italiens Bürgerkrieg.
An der Spitze der neuen Regierung stand Bonomi, der Kriegsminister Giolittis; unter seiner Amtsführung hatten die militärischen Kommandostellen vielfach die Faschisten mit Waffen ausgestattet. Trotzdem erschien er vielen in der verworrenen parlamentarischen Lage als jener Mann der Linken, den Italien brauchte. Bonomi war in jüngeren Jahren Sozialist gewesen und gehörte nun dem Kreis der unabhängigen reformistischen Sozialisten an. Als er die Macht übernahm, gab er sich der Illusion hin, er werde den Faschisten die Waffen wieder abnehmen können. Aber nur mit Rundschreiben an die Präfekten und ähnlichen administrativen Maßnahmen ließ sich eine derartige Operation nicht mehr bewerkstelligen. Bonomi war von Natur aus kein Mann klarer Entscheidungen und energischer Schritte. Er konnte nicht verhindern, dass die letzten Stützen der staatlichen Autorität zusammenbrachen.
Während die Parteien an Moral und Gerechtigkeit appellierten und das Parlament diskutierte, gewannen die Faschisten täglich an Boden. Um ihre Macht zu demonstrieren, beriefen sie ihren Kongress nach Rom ein. Es war der dritte und wichtigste Kongress der jungen Partei. Er wurde im November im Saal des Augusteo-Theaters abgehalten. Den Vorsitz führte General Capello, ein Mann, der zugleich in den höchsten militärischen Cliquen und in der Freimaurerei beheimatet war. Ein paar Jahre später, als Antifaschist, wurde er wegen Beteiligung am Attentat des Offiziers Zaniboni gegen den Duce zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt.
Bis dahin waren die fasci eine Kampfbewegung gewesen; beim Kongress in Rom verwandelten sie sich offiziell in eine politische Partei. Mussolini verkündete und erläuterte das Grundsatzprogramm; er schloss seine Rede mit Anleihen bei Dante Alighieri und beim heiligen Franz von Assisi.
Ich saß im hintersten, finstersten Winkel einer Loge und beobachtete das Schauspiel. Ein faschistischer Universitätsstudent, der als Leutnant in meinem Bataillon gedient hatte, hatte mich eingeschleust. Er wusste zwar, dass ich für den Faschismus nichts übrighatte, blieb mir aber dennoch gewogen. Der Vater des Studenten war ein vermögender Agrarier in der Poebene, wo der Faschismus in ständigem Kriegszustand mit den sozialistischen und katholischen Landarbeiterorganisationen lebte. In meiner Heimat Sardinien bestand der Faschismus damals nur aus ein paar Grüppchen, die politisch völlig bedeutungslos waren. Ich trachtete also, von meinem ehemaligen Kriegskameraden möglichst viel über die Bewegung zu erfragen.
„Wir haben achtzig Genossenschaftsgebäude niedergebrannt“, erzählte der Student stolz. „Wir haben alle Büros und Lokale der Sozialistischen Partei zerstört. Jeden Samstagabend rücken wir zu unseren großen Strafexpeditionen aus. Wir kommandieren, und die anderen haben zu parieren.“
„Und die Behörden?“
„Die Behörden? Wir sind die Behörde.“
„Was heißt das, ihr seid die Behörde?“
„Das ist ganz logisch. Wir und die Behörde, das ist die gleiche Sache. Die Behörden hatten es ganz einfach satt – die Aufsässigkeit, die Rechthaberei, die roten Fahnen. Sie hatten nicht mehr das Sagen.“
„Aber heute haben sie demnach noch weniger zu sagen …“
„Wir stellen die Ordnung wieder her.“
„Mit Brandschatzung und Überfällen?“
„Es gibt kein anderes Mittel. Mit Propaganda und bloßen Reden hat man nichts erreicht. Waffen sind das einzige Mittel. Jetzt haben wir genug Waffen. Wir haben Autos, Gewehre, Maschinengewehre.“
„Woher habt ihr die?“
„Einiges von der Polizei, manches hat uns der Verband der Agrarier überlassen.“
„Und so könnt ihr jetzt tun, was euch Spaß und Freude macht, ohne etwas befürchten zu müssen?“
„Oh nein, ganz ohne Gefahr ist die Sache nicht. Da, sehen Sie!“ Er zeigte mir die rechte Hand. Am Handrücken sah ich eine noch nicht ganz vernarbte Wunde, die offensichtlich von einer Gewehrkugel stammte.
„Da haben sie mich erwischt, diese Banditen, bei einem Nachtangriff.“
„Welche Banditen?“
„Die Landarbeiter.“
„Und wer hat angegriffen, ihr oder die Landarbeiter?“
„Wir haben angegriffen, natürlich wir. Und wir haben sie fertiggemacht. Jetzt ist’s aus mit dem Schmarotzerleben. Stellen Sie sich vor, so ein Landarbeiter hat glatt vierzig Lire am Tag verdient.“
„Und was verdienen sie heute?“
„Oh, heute ist alles ganz anders.“
„Gut, aber wie viel verdienen sie jetzt?“
„Vierzehn Lire. Und auch die sind noch zu viel.“
Er sah mein erstauntes Gesicht und meinte wohl, mir die Zusammenhänge gründlicher erläutern zu müssen.
„Sie müssen bedenken, dass sie mich nach dem Krieg ausgelacht haben, auf offener Straße, wenn ich in Uniform mit meinen Auszeichnungen ausging.“
„Ist das der Grund, ihnen den Lohn auf vierzehn Lire zu kürzen und sie kurz und klein zu schlagen?“
„Kritisieren ist leicht. Man muss bei uns gelebt haben: Die Landarbeiter leisteten sich die gleichen Anzüge, wie ich sie trug, und die Töchter des ärgsten Bauernlümmels zogen sich eleganter an als meine Schwester.“
„Das ist wohl übertrieben! Aber selbst, wenn du recht hättest, wäre dies eine so schreckliche Provokation, dass sie mit Hunger und Tod bestraft werden muss?“
„Wir haben die Welt wieder ins Lot gebracht.“
Wir blieben lange beisammen. Durch die Straßen Roms zogen die faschistischen Kampfgruppen, die zum Kongress gekommen waren; besonders zahlreich waren die squadre aus der Toskana und der Romagna. Insgesamt hatten sich mehr als 20 000 Faschisten in der Hauptstadt versammelt. Ich kaufte an einem Kiosk eine antifaschistische Zeitung. Ich schlug sie auf und überflog die Schlagzeilen. Sofort stürzten einige Faschisten herbei.
„Weg mit der Zeitung!“, schrien sie.
„Schämen Sie sich, so eine Schweinerei zu lesen!“
„Nieder mit den Verrätern!“
Sie entrissen mir die Zeitung. Ich war derart verblüfft, dass ich nicht einmal daran dachte, mich zu wehren. Mein Freund schritt ein und befahl, mir die Zeitung wiederzugeben. Nachdem der Zwischenfall beigelegt war, fragte ich ihn: „Was hältst du von solchen Methoden?“
Er schien verärgert. Dann setzte er mir auseinander: „Sicher, bei uns ist es eine grobe Provokation, wenn einer eine antifaschistische Zeitung liest. Der Führer einer Landarbeiter-Liga ist deswegen umgebracht worden. Es war an einem Sonntag. Er wollte uns herausfordern. Mit der sozialistischen Zeitung in der Hand zeigte er sich in der Öffentlichkeit. Klar, dass die Faschisten den Kopf verloren.“
Durch ihr Benehmen provozierten die faschistischen squadre in Rom nicht wenige Zwischenfälle. Mussolini hatte auf dem Kongress gewarnt: „Der Römer ist weder Faschist noch Antifaschist. Er ist vor allem ein Mensch, der seine Ruhe haben will. Wird er in seiner Ruhe gestört, erwacht sein Kämpferherz. Dann werden Bürger und Pöbel gleicherweise angriffslustig. Nicht provozieren also! Doch wir werden uns verteidigen, wenn man uns angreift.“