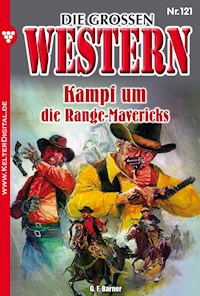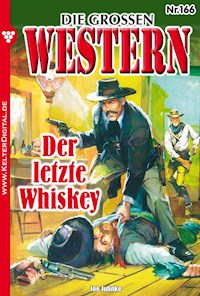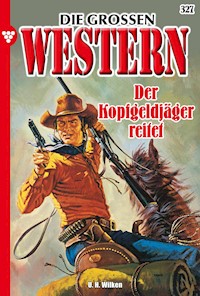Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western Classic
- Sprache: Deutsch
Nun gibt es eine exklusive Sonderausgabe – Die großen Western Classic Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Dieser Traditionstitel ist bis heute die "Heimat" erfolgreicher Westernautoren wie G.F. Barner, H.C. Nagel, U.H. Wilken, R.S. Stone und viele mehr. Pat Sharp nimmt den schäbigen Stetson vom Schädel, kratzt einen Augenblick lang in der rostfarbenen Wolle und senkt andächtig den Blick. Vorbei zieht eine kleine Kolonne Menschen, bestehend aus dem Bürgermeister, dem Townmarshal, einer vierräderigen Karre, die von zwei müden Gäulen gezogen wird, einer Frau in schwarzer Tracht und einem ebensolchen Schleier, der ihr Antlitz verhüllt. An ihrer Seite geht der Padre aus der Stadt. In geringem Abstand folgen dann noch ein Dutzend Bürger aus dieser kleinen Stadt. Der kleine Trauerzug, denn ein solcher ist es, nähert sich dem Ortsausgang. Die Spitze wandert durch die Öffnung in einer breiten Hecke, hinter der windschiefe Kreuze und einfache Grabsteine auf flachen Hügeln stehen. drauflos. Sharp zählt sechzig Lenze. Es gab eine Zeit, da verdiente er einen Haufen Geld. Er war Expreßreiter der »Prescott Northern Company« mit tausend Dollar Monatslohn. Ein schöner Batzen Geld zu jener Zeit. Aber ihm ging's dann wie schon so vielen seiner Vorgänger. Eines Tages lauerten ihm einige Satteltramps auf der Route auf, verpaßten ihm ein paar blaue Bohnen, nahmen den Geldsack und verschwanden spurlos. Cowboys fanden Sharp in einem recht erbärmlichen Zustand und brachten ihn nach Benton. Hier puhlte ihm Doc Johnson die Kugeln aus dem Körper, bis auf eine – und die steckte heute noch im Knie, direkt hinter der Kniescheibe. Sie war auch der Grund, weshalb Pat seinen feinen Job aufgeben mußte, denn einen Expreßreiter mit einem steifen Bein, den gibt es nicht. Pat Sharp blieb in Benton hängen. Er verdiente sich ein paar Dollar als Bote, reparierte auf den umliegenden Ranches ab und zu mal einen Wagen, half auch zeitweilig Watson, dem Blackshopman, in dessen Schmiede und wurde so mit der Zeit ein bekanntes Original in dem kleinen Städtchen. Sharps Blick wandert zu dem jungen Fremden hin, der unweit von ihm auf dem Bürgersteig steht und sich unschlüssig eine Zigarette dreht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western Classic – 5 –
Marshal Jesse Franky
Joe Juhnke
Pat Sharp nimmt den schäbigen Stetson vom Schädel, kratzt einen Augenblick lang in der rostfarbenen Wolle und senkt andächtig den Blick. Vorbei zieht eine kleine Kolonne Menschen, bestehend aus dem Bürgermeister, dem Townmarshal, einer vierräderigen Karre, die von zwei müden Gäulen gezogen wird, einer Frau in schwarzer Tracht und einem ebensolchen Schleier, der ihr Antlitz verhüllt. An ihrer Seite geht der Padre aus der Stadt. In geringem Abstand folgen dann noch ein Dutzend Bürger aus dieser kleinen Stadt.
Der kleine Trauerzug, denn ein solcher ist es, nähert sich dem Ortsausgang. Die Spitze wandert durch die Öffnung in einer breiten Hecke, hinter der windschiefe Kreuze und einfache Grabsteine auf flachen Hügeln stehen.
Pat Sharp stülpt seinen Stetson wieder auf den Schädel und kaut eifrig
drauflos.
Sharp zählt sechzig Lenze. Es gab eine Zeit, da verdiente er einen Haufen Geld. Er war Expreßreiter der »Prescott Northern Company« mit tausend Dollar Monatslohn. Ein schöner Batzen Geld zu jener Zeit. Aber ihm ging’s dann wie schon so vielen seiner Vorgänger. Eines Tages lauerten ihm einige Satteltramps auf der Route auf, verpaßten ihm ein paar blaue Bohnen, nahmen den Geldsack und verschwanden spurlos.
Cowboys fanden Sharp in einem recht erbärmlichen Zustand und brachten ihn nach Benton. Hier puhlte ihm Doc Johnson die Kugeln aus dem Körper, bis auf eine – und die steckte heute noch im Knie, direkt hinter der Kniescheibe. Sie war auch der Grund, weshalb Pat seinen feinen Job aufgeben mußte, denn einen Expreßreiter mit einem steifen Bein, den gibt es nicht.
Pat Sharp blieb in Benton hängen. Er verdiente sich ein paar Dollar als Bote, reparierte auf den umliegenden Ranches ab und zu mal einen Wagen, half auch zeitweilig Watson, dem Blackshopman, in dessen Schmiede und wurde so mit der Zeit ein bekanntes Original in dem kleinen Städtchen.
Sharps Blick wandert zu dem jungen Fremden hin, der unweit von ihm auf dem Bürgersteig steht und sich unschlüssig eine Zigarette dreht. Der Fremde ist ihm vorher schon aufgefallen, ehe der Leichenzug die Straße passierte.
Der Fremde ist nicht sonderlich groß. Er hat überhaupt nichts Auffälliges an sich. Er ist gekleidet wie jeder andere im Westen. Er trägt einen grauen, schon ziemlich abgenutzten Cordanzug, ein buntes Flanellhemd und ebensolches Halstuch. Er hat um die Hüfte einen breiten Gurt mit einer mächtigen Silberschnalle, und aus dem vorderen Rockausschnitt lugt der schwere Knauf einer Patterson.
Der Fremde scheint den prüfenden Blick Sharps zu spüren, denn ein freundliches Lächeln liegt in seinen braunen Augen; während er langsam näher tritt.
»Hallo, old Hands!« grüßt er und tippt leicht an die Krempe seines Sombreros. Seine Stimme ist dunkel und klangvoll, seine Hände sind schlank wie seine Gestalt. »Wen bringen sie denn da unter die Erde? Ist’s ein Bürger aus der Stadt?«
»’s war einer!« Pat kaut lächelnd weiter, während er vergebens irgend etwas Hervorstechendes oder Auffallendes an dem Fremden sucht. »Er nannte sich Dick Holmes und hieß wahrscheinlich auch so; denn er war ja verheiratet.«
»Eine Persönlichkeit der Stadt?«
»Wenn man schon einen Makler als solche bezeichnen kann, ja!«
»Zigarette?« Der Fremde hält Sharp seinen Tabaksbeutel hin.
Doch Sharp schüttelt den Kopf und zeigt durch eifriges Kauen an, daß er nur priemt. »War er alt?«
»Dreißig. Wo kommen Sie denn her?«
»Eigentlich kein Alter, um schon zu sterben.«
Pat Sharp lächelt leicht. »Der Tod fragt nicht nach dem Alter. Eines Tages klopft er an die Tür, und dann ist es zu spät. Ihrer Sprache nach kommen Sie aus Texas.«
»Stimmt!« Der jugendliche Fremde lächelt ebenfalls und nickt verbindlich. »Er starb sicher nicht an Altersschwäche, old Hands?«
»Nennen Sie mich doch einfach Pat, wie’s hier alle tun. Zum alten Eisen gehöre ich hoch lange nicht. No, Dick Holmes war gestern noch verdammt munter. Übrigens war er ein Geizkragen. Nicht, daß ich ihm das hier gewünscht habe, aber es mußte ja eines Tages kommen.«
»Was?«
»Daß sie an sein Geld wollten.«
»Er wurde überfallen?« Für einen Augenblick hat Pat Sharp den Eindruck, als läge ein waches Lauern in den Augen des Fremden. Doch er muß sich wohl getäuscht haben. Die Frage des Mannes klingt nur neugierig, neugierig, wie die Menschen nun eben einmal sind.
Sharp speit eine Ladung Tabaksaft auf die staubige Straße.
»Vom vielen Reden bekommt man nur eine trockene Kehle, Stranger«, verschmitzt und herausfordernd lächelt Sharp, und der andere versteht ihn auch sofort.
»Ist Ihnen die Inn dort recht?«
»Bob Horger hat den besten Schnaps auf tausend Meilen!«
»Dann wollen wir ihn mal versuchen!«
Sharps Schritte klingen hohl auf dem hölzernen Bürgersteig. Es klingt fast so, als habe er ein Holzbein. Auch der Fremde scheint das anzunehmen.
Aber Sharp, der den fragenden Blick des Fremden richtig deutet, lächelt verächtlich.
»Das ist noch mein eigen Fleisch und Blut, Stranger. Aber wäre Doc Johnson damals nicht gewesen, zounds, der Brand hätte es längst weggefressen.«
»Unfall?«
Sharp hebt leicht die Schultern. »Es war der gleiche Unfall, dem auch Holmes gestern zum Opfer fiel. Ich nenne es Schicksal und bin, Gott sei Dank, darüber weg. So, und hier geht es rein.«
Sharp stößt die Tür auf und läßt dem Fremden den Vortritt. Nur wenige Männer befinden sich im Schankraum. Sharp und sein junger Gastgeber treten zur Theke.
»Schenk ein, Bob. Zwei Lagen Doppelte. Der Gent hier zahlt. Also, die Sache war so: gestern, bei Sonnenuntergang, kamen Leute in die Stadt. Drei waren es. Sie stiegen vor Holmes’ Haus von ihren Gäulen. Zwei gingen nach drinnen, der dritte tränkte die Pferde. Sie müssen nämlich wissen, vor Holmes’ Haus ist die Tränke.« Er hebt sein Glas und setzt es an die Lippen.
Mit einem scharfen Ruck spritzt der ganze Inhalt in Sharps ausgetrocknete Kehle. Schmatzend fährt er sich dann über die Lippen. »Yeah, und dann gab’s plötzlich einen Knall, und der war nicht von Pappe. Holmes’ Fenster sprangen aus den Fugen, und heraus kletterten die beiden Burschen. Sie bestiegen in aller Ruhe ihre Pferde und verschwanden dann genauso wortkarg, wie sie gekommen waren. Ich war einer der ersten, der Holmes’ Haus betrat. Es war kein schöner Anblick. Holmes lag quer über seinem Schreibtisch und hatte ein Loch im Schädel. In der Wand gähnte ein schwarzes Loch, von dem jeder wußte, daß es einmal Holmes’ kleiner Tresor war. Später kam der Marshal dazu. Wir fanden auch noch Holmes’ Frau. Sie mußte der Schrecken umgeworfen haben.«
»Und was sagte der Marshal?«
»Tom Saller? Hombre, er kombinierte auf Raubmord.«
Die braunen Augen des Fremden ziehen sich zusammen.
»Hat er denn das Gesindel nicht verfolgt?«
Sharp lacht und schiebt dem Keeper sein Glas zu. »Saller ist in letzter Zeit ein wenig zu dick geworden. Ich fürchte, er paßt nicht mehr so recht in den Sattel. Außerdem fürchtet er das Gesindel mehr als dieses ihn.«
»Trauriger Zustand!«
Sharp betrachtet den Fremden herablassend. »Davon verstehen Sie nichts, Stranger, dafür sind Sie noch etwas zu jung.«
»Entschuldigen Sie.« Der Fremde lächelt leicht und weist den Keeper an, Sharps Glas noch einmal zu füllen. Sharp nimmt es mit zufriedenem Grunzen hin. Da hat er einen verflucht spendablen Boy aufgegabelt. Hoffentlich ist dessen Wissensdurst nicht eher gestillt als sein eigener Durst.
»Nichts zu entschuldigen, Stranger. Unser Marshal liebt nun mal sein
Leben. Die Trottel dieser Stadt haben ihn gewählt und bezahlen ihn ja auch.«
»Passiert denn hier so etwas öfter? Ich meine, solche gemeinen Überfälle.«
Sharp greift jetzt direkt nach der Flasche. Ihm scheint dies der einfachere und schnellere Weg zu sein, um zu dem geliebten Schnaps zu kommen. Der Fremde duldet es, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken.
»In Benton ist es das erste Mal«, weiß Sharp zu berichten, »aber wenn Sie über den Grand Paß in den Jefferson-Distrikt reiten, da sind derartige Überfälle an der Tagesordnung. Pine Bluffs hat in diesem Jahr seinen vierten Town-Marshal und wird, obwohl das Jahr erst halb zu Ende ist, bald einen fünften suchen müssen!«
»Warum?«
Sharps faltiges Gesicht zerfließt zu einem mitleidigen Lächeln.
»Tom Flachs legt sich zu scharf ins Zeug. Das ist äußerst ungesund für ihn, Sam!«
»Nicht Sam, ich heiße Jesse, Pat!«
»Ah, Jesse!« Sharp nickt befriedigt. Der Fremde ist ihm auf einmal gar nicht mehr so fremd. »Ich kannte auch mal einen Jesse, Jesse James. Aber zu dessen Zeit hast du noch die Windeln naß gemacht. Yeah, das ganze Jefferson County ist heute verseucht, verseucht von diesem elenden Gesindel. Das ist jetzt noch schlimmer als zu meiner Zeit, als ich jeden Tag hundert Meilen reiten mußte. Gehst du runter nach Texas?«
»No, da komme ich gerade her.«
»Also ziehst du rüber über den Arkansas?«
»Well, mich zieht’s in den Osten.«
»Die Schnauze wohl voll?«
»So ungefähr.«
Sharp feixt schon wieder. »Dabei möchte ich wetten, daß du noch gar nichts vom Westen gesehen hast!«
Jesse lächelt verbindlich. »Mag sein.«
»Yeah, dazu gehören harte Nerven. Aber lassen wir das. Warst du lange am Rio Grande?«
»’ne ganz hübsche Zeit.«
»Warst du auch schon in Paso?«
»Klar.«
Sharps Augen beginnen jetzt zu leuchten. »Da lebt ein alter Freund von mir. Jove«, er lächelt verklärt, »alt ist wohl etwas übertrieben. Er ist noch jung an Jahren, aber doch ein alter schlauer Fuchs. Schon mal was von ihm gehört?«
»Dann müßtest du mir erst seinen Namen nennen.«
»Benjamin.«
»Der Revolvermarshal!« Sharp klopft dem Jüngeren ganz begeistert auf die Schulter. »Nun weiß ich ganz bestimmt, daß du vom Rio Grande kommst. Und du kennst ihn?«
»Jeder dort unten kennt ihn.«
»Und er ist mein Freund!«
Jesse nickt. Ein unergründliches Lächeln liegt in seinen braunen Augen, während er der Stimme des Alten lauscht.
»Ich war einige Zeit in El Paso. Habe manches Ding mit ihm gedreht. Ich war dabei, als Benjamin Clark Calhoun erschoß. Ich hing an einem Ende des Strickes, als wir Perry Shell den Weg ins Jenseits erleichterten. Hast du schon mal was von Shell gehört?«
»Shell war einer der gefürchtetsten Revolvermänner im ganzen Grenzgebiet, ein Zweihandschütze. Er versorgte den Rebellen Quachita mit Waffen aus den Staaten. Dabei haben wir ihn erwischt.«
»Ich dachte, Shell wäre geschnappt worden, als er in Bianca die Bank ausrauben wollte?«
»Unsinn!« Entrüstet hebt Sharp die Hand zu einer verächtlichen Geste. »Ich war doch dabei, als wir ihn an der Furt stellten. Das andere ist nur dummes Geschwätz von den Leuten.«
»Na, dann wird’s wohl stimmen, Pat, wenn du doch selber dabeigewesen bist!« Sharp spürt nicht den ironischen Unterton in der Stimme des Fremden. Er hat schon zuviel Alkohol auf den nüchternen Magen getrunken.
»Kann man hier übernachten?«
»Ein Hotel gibt’s zwar nicht, Jesse, aber ich habe ein Bett in meiner Hütte. Du bist mein Gast. Well, du bist mein Gast, denn du gefällst mir, Sonny. Sonny! Hahaha! Das habe ich oft zu Benjamin gesagt, und es hat ihn fürchterlich geärgert.«
»Ich möchte dir unter keinen Umständen dein Bett nehmen, Pat«, sagt der andere schnell. »Gibt’s hier sonst keine Übernachtungsmöglichkeit?«
Sharps Lächeln bricht plötzlich ab. Ärgerlich und verkniffen starrt er in das Gesicht des Sprechers. »Bin ich dir vielleicht nicht fein genug?«
»Unsinn! Ich danke dir sogar für deine Gastfreundlichkeit. Habe viel schlechtere Quartiere gehabt, aber ich will dir wirklich nicht zur Last fallen.«
»Na, meinetwegen«, brummt der Alte mißtrauisch, »Madam Laurin hat Zimmer zu vermieten. Ihr Haus kannst du direkt neben dem Office finden.«
»Ich danke dir herzlich.« Jesse wirft eine Zehndollarnote auf die Theke. »Den Rest kann mein Freund noch verzehren«, sagt er zu dem Keeper und reicht Sharp die Hand.
»Sehen wir uns noch einmal wieder?« fragt der Alte ziemlich betrübt und schielt dabei zu dem Geldschein hin.
»Morgen, Freund, morgen!«
»All right!« Mit traurigen Augen blickt Sharp hinter dem jungen Mann her, bis die zuschlagende Tür die Gestalt des Fremden verdeckt.
»Feiner Junge, was?« wendet er sich mit stillem Seufzer an den Keeper. »Alter Freund von mir!«
Der Keeper grinst verständnisvoll vor sich hin. Er kennt nur zu gut
Sharps »alte Freunde«.
*
Der Moonlight-Canyon mündet direkt in den Grand Paß, der über die Saline Ranges zum Arkansasriver hinunterführt. Steile, seltsam geformte Kalksteingebilde bilden eine Passage, die ständig ansteigt und ganz zu unrecht den Namen »Paß« trägt. Der Boden ist loses, bröckelndes Gestein und Staub, ohne jede Vegetation, ohne Leben. Von einem Rancher am Fuße des Gebirges weiß Jesse, daß auf der Viertagereise durch die Saline Ranges keine einzige Wasserstelle zu finden ist. Müde stolpert sein zottiger Bronco durch diese gefährliche Einsamkeit. Unter den Hufen des Tieres wirbelt blaßgelber Staub auf. Am Sattelhorn hängend, schlagen klatschend zwei prallgefüllte Ziegenlederbeutel gegen das schweißnasse Fell des Pferdes.
Müde hockt der Reiter im Sattel. Die Sonne brennt heiß und sengend vom wolkenlosen Firmament herab. Kein noch so leises Lüftchen weht. Gegen Mittag, als die Hitze unerträglich wird, rastet Jesse im Schatten eines überhängenden, ausgewaschenen Felsens. Er sattelt den Bronco ab, füllt einen Behälter mit Wasser und läßt das Tier saufen. Dann reibt er das struppige, glanzlose Fell trocken und legt sich nachher in den kühlenden Schatten.
Er schiebt die Hände in den Nacken und starrt in den strahlendblauen Himmel. Eine Zigarette hängt erloschen in seinem rechten Mundwinkel.
Jesse denkt an die Begegnung mit dem steifbeinigen alten Expreßreiter Sharp in Benton. Er lächelt, denn dieser Alte ist ein unverschämter Lügenbold und Aufschneider.
»Benjamin.«
Seine Linke öffnet das Hemd bis zum letzten Knopf. Sie verschwindet im Einschnitt und nestelt dort eine Schnalle los. Ein schmaler, aber prallgefüllter Gurt kommt zum Vorschein. Ein Stück Vergangenheit, das eng mit dem Namen »Benjamin« verknüpft ist.
Jesse stützt sich auf die Armbeuge. Seine Hände spielen mit dem Gurt.
Er birgt ein Vermögen, genau fünfzehntausend Dollar. Für dieses Geld hat er bestimmt hundertmal sein Leben eingesetzt, nein, sogar tausendmal, jede Stunde, jede Minute.
Es gibt wohl kaum einen anderen Mann, der am ganzen Rio Grande mehr gehaßt wird als er. Aber auch keinen, der mehr verehrt wird.
»Benjamin!« – Jesse Franky.
Jesse lacht trocken auf. Wenn Pat Sharp wüßte, daß er mit dem Revolvermarshal vom Rio Grande zusammen an der Theke gestanden hat! Wenn er wüßte, wie ausgerechnet diesen Mann, dessen guter Freund er sein wollte, seine dick aufgetragenen Lügen amüsiert haben.
Jove, er, Jesse Franky, war noch nie einem Pat Sharp begegnet, zwischen ihnen hatte es also auch noch nie eine so dicke Freundschaft gegeben. Und daß man Shell nicht beim Waffenschmuggel erwischte, sondern in der Bank von Bianca, daß es keinen Sharp gibt, der den Strick hielt, an dem Shell aufgeknüpft wurde, dafür kann er seine Hand ins Feuer legen, er, Jesse Franky, der doch diese Episode besser kennen muß als jeder andere, er, den sie in der wildesten Ecke von Texas, zwischen Bianca und El Paso am Rio Grande, den »Revolvermarshal« nennen.
Jesse lacht noch immer, während er den Gurt wieder um den Leib schiebt.
Aber dort drüben gibt es heute keinen Revolvermarshal mehr, niemand mehr, von dem man sagt, daß er der härteste Fighter im ganzen Land sei. Benjamin ist tot – es lebe Jesse Franky, der auf dem Wege nach dem Osten ist, um dort alles zu vergessen.
Das Leben in der Wildnis, die einsamen Nächte, in denen die Kojoten an seinem Feuer lauerten, die Kugeln, die seinen sehnigen Körper zernarbt haben.
Er will wieder Mensch sein wie alle anderen und nicht einer, der stets mit dem Eisen unter dem Kopfkissen und einem Auge schläft, während er mit dem anderen auf seine blutgierigen Gegner wartet.
Er ist müde vom wilden Abenteuer.
Jesse Franky rollt die Zigarette über die Lippen.
Gosh, er vertrat das Gesetz. Er war ein Menschenjäger, ein sehr harter und gefürchteter.
Er tötete! Sein Leben schien dadurch einen Sinn zu haben. Er tötete, um den Siedlern ihr schweres Los zu erleichtern, um ihr Leben und Gut zu schützen. Aber es wurde mit jedem Mal schwerer. Und dann legte er plötzlich eines Tages einfach den Stern ab. Er verschwand vom Rio Grande, unbemerkt, unerkannt. Er kniff ganz einfach, weil er auf einmal klar und deutlich erkannte, daß sein Leben eigentlich nur ein Dahinvegetieren war. Einmal würde doch der Stärkere kommen, einmal würde sein Name als Kerbe im Colt eines anderen eingeschnitten sein. Das ist das Los eines jeden berühmten Revolvermannes. Und das Los wollte er einfach nicht mit diesen anderen teilen. O ja, man zahlte ihm einen sehr hohen Lohn, und er kassierte außerdem so manche Kopfprämie.
Fünfzehntausend Dollar sind ihm davon noch geblieben, fünfzehntausend Dollar, mit denen er sich von der harten, blutigen Vergangenheit freikaufen kann.
Er wird irgendwo irgendein Geschäft eröffnen, wird Kaufmann oder auch ein kleiner Rancher oder Farmer werden. Er wird vielleicht ein Weib finden, das ihm gefällt und das ihn will, wird mit ihr Kinder haben. Nachkommen, die einmal ruhiger und friedlicher als er leben sollen. Und er wird leben wie die große Masse, zufrieden und glücklich.
Franky richtet sich auf. Die jenseitigen Berghänge werfen bereits weite Schatten in die Schlucht. Er will jetzt weiterziehen, die Rast hat ihm schon zu lange gedauert. Er flieht, er flieht vor der eigenen Vergangenheit.
Jesse Franky sattelt seinen Gaul, klettert in den Sattel und klopft dem Tier den zottigen Hals.
Go on, Red, hier gibt’s doch nichts, was uns gefallen könnte. Gehorsam setzt sich der Bronco in einen leichten Trab.
*
Mit einer jähen Dissonanz verstummt das lustige Liedchen, das von Frankys Lippen kommt. Zwei Männer, wie aus der Erde gewachsen, versperren ihm den Weg. Die Colts, die ganz unmißverständlich in ihren Fäusten liegen, sprechen eine allzu deutliche Sprache. Jesse Franky erbleicht. Seine Haut wird welk und grau, seine braunen Augen zucken unruhig. Doch nur einen Augenblick, dann stiehlt sich ein kaltes Lächeln in die braune Iris. Leicht schiebt er den Kopf vor und mustert die beiden Männer, die ihre Gesichter hinter ihren Halstüchern verbergen.
Rasch und unbewußt registriert Franky alles: ihre Augen, den unbedeckten Teil ihrer Gesichter, ihre Kleidung, ihre Hände. Und er stellt fest, daß der größere der beiden Wegelagerer eine breite blutrote Narbe quer auf dem Handrücken hat.
»Hallo, mein Freund, weshalb steckst du dein Pfeifen auf?« fragt der mit der Narbe und kommt mit gleitenden Schritten näher. »Wir sind doch gar nicht so böse, wie wir vielleicht aussehen. Wir brauchen nur ein wenig Zehrgeld, das du uns geben wirst, dann kannst du ruhig weiterziehen!«
Franky hat sich schon wieder gefangen, er kann sogar wieder lächeln.