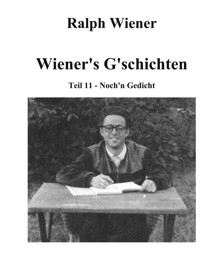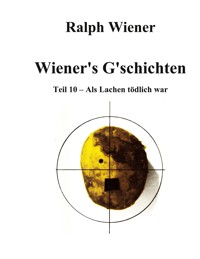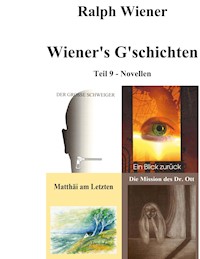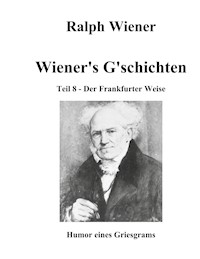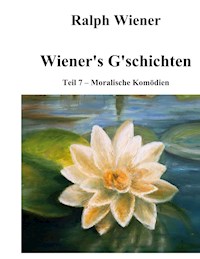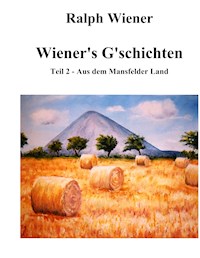Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der 35 Jahre alter Musikhistoriker Robert Burli macht Karriere.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCHICKSAL IST EIGENSCHAFT
Felix Parker
Man hätte ihm alles vorhersagen können, aber wahrscheinlich hätte er das nie geglaubt, und wenn ja, würde er es bestimmt nicht beherzigt haben. Dazu fehlte ihm ein gewisser persönlicher Abstand. In allem, was er tat, folgte er einem unbestimmten Gefühl, einem inneren Drang, ohne sich der Folgen bewusst zu sein. Einen „Wahrheitsfanatiker“ hatten ihn manche genannt, doch auch das stimmte nicht ganz; denn da hätte er eine Art Held sein müssen - und das war er ganz und gar nicht.
Ein „leichtsinniger Illusionist“, das kam seinem Charakter schon eher entgegen, und wenn man seine Nachbarn fragen würde, erhielte man so viele Antworten, wie es Nachbarn gab. Nur in einem waren sich alle einig: Dieser Robert Burli war ein Außenseiter, ein Sonderling - einer, bei dem man nicht wusste, was man von ihm halten sollte, weil er wenig Kontakt zu seinen Mitmenschen hatte. Mit einem Wort, hier lebte einer, der Rätsel aufgab, aber zu ihrer Lösung kaum etwas beitrug.
Dabei wäre es so leicht gewesen, ein bisschen hinter die Fassade zu blicken - nur hätte man sich da mit seinem Beruf vertraut machen müssen, was freilich den Leuten seiner Umgebung ziemlich schwergefallen wäre; denn welcher normale Bürger weiß um die Nöte und Sorgen eines Musikhistorikers! Einen Bäcker konnte man irgendwie einordnen, auch einen Finanzsachbearbeiter, sogar einen Elektroinstallateur - aber Musikhistoriker? Was macht der überhaupt? Wem nützt er? Ist das ein Hobby oder ein Brotberuf?
Natürlich brauchte Robert Burli keine dieser Fragen zu beantworten, weil sie ihm niemand stellte. Die Blicke seiner Nachbarn jedoch - und auch die seiner Wirtin -schienen immer wieder diese Fragen auszudrücken, wenngleich keiner wagte, sich direkt an ihn zu wenden: schließlich wollte man nicht in den Nimbus eines Unwissenden geraten.
Wir jedoch, die wir nicht nur Herrn Burlis Alter (nämlich 35) und seine schmale, etwas untersetzte Figur kennen, wissen um die Schwierigkeiten seiner Profession. Und wir kennen die Vorgeschichte, die zu jenem Ereignis führte, von dem im Folgenden zu berichten sein wird.
Seit Jahren war er festangestellter Mitarbeiter der weithin bekannten Wochenzeitschrift „Musik-Echo“. Das „Echo“, wie man es der Kürze halber nannte, galt unter Kennern als journalistisches Kleinod, weil es Themen behandelte - an die sich andere Zeitschriften selten heranwagten. So hatte es bei Besprechung von Vertonungen des Vaterunsers bemerkt, dass der Titel dieses Gebetes eigentlich eine sprachliche Abnormität darstelle.
Kein Mensch würde sagen: „Mutter meine“, sondern „meine Mutter“ Auch „Tante deine“ sei ungebräuchlich, vielmehr heiße es „deine Tante“. Warum aber plötzlich statt „unser Vater“ gesagt werden solle: „Vater unser“ - noch dazu in einem Gebet -, sei schlechterdings unbegreiflich. Das Musik-Echo druckte also die Vertonungen des „Vaterunser“ mit der sprachlich korrekten Version „Unser Vater“ ab - und erntete eine Flut von Protestbriefen. Man solle die Kirche im Dorf lassen - hieß es, „Mutter meine“ und „Tante deine“ sei schließlich etwas anderes als „Vater unser“, und außerdem sei man da so gewöhnt, und sogar Goethe habe den Vierzeiler gedichtet:
Das Unser Vater ein schön Gebet,
Es dient und hilft in allen Nöten;
Wenn einer auch Vater unser fleht,
In Gottes Namen, lass ihn beten!
Wie gesagt, der gute alte Goethe musste wieder einmal herhalten - aber aus der Welt war das Problem damit nicht. Robert Burli erblickte nämlich in der ganzen Kontroverse einen Anlass, sich einmal mit der Sprache im Volkslied auseinanderzusetzen und kam zu einem geradezu niederschmetternden Ergebnis. „Im deutschen Volkslied ist unsere Sprache systematisch verhunzt worden“, schrieb er und teilte seinen Lesern einige verblüffende Einzelheiten mit.
Danach wäre nämlich schon das alte Lied „Es ist ein Ros’ entsprungen“ mit Recht oft missverstanden worden. Keinem Kinde könne man übelnehmen, wenn es singen würde: „Es ist ein Ross entsprungen!“, weil der Text „ein Ros“ völlig falsch sei; vielmehr müsse es heißen: „Es ist eine Rose entsprungen.“
Noch strenger ging Robert Burli mit dem Lutherlied „Ein feste Burg“ ins Gericht. „Die Burg ist weiblich“, dozierte er, „der unbestimmte Artikel heißt also ‘eine Burg’, nicht ‘ein Burg’, was höchstens Babys sagen. Nun aber in dieser Babysprache fortzufahren und ‘Ein feste Burg’ zu singen, ist unter aller Würde.“ Logischerweise - so fuhr Burli fort - müsse man dann auch sagen „Ein helle Glocke“ oder „Ein kleine Frau“.
Da zu der Zeit - als das Musik-Echo diese Artikel abdruckte, im Fernsehen die Volksliedserie „Kein schöner Land“ lief, stürzte sich Robert Burli natürlich auch auf diesen Titel. „Jeder ABC-Schütze weiß, dass es „kein schöneres Land“ heißt und dass der Vers
Kein schöner Land in dieser Zeit
Als wie das unsre weit und breit
eine grammatikalische Schändlichkeit bedeutet. ‘Als wie’ sagt kein Mensch; er sollte es deshalb auch nicht singen.“ Wieder war eine Flut von Leserbriefen - diesmal von Freunden jener Fernsehsendung - auf das „Echo“ hereingebrochen, und Robert Burli hatteMühe, die Wogen zu glätten. Als er jedoch den Verteidigern des Liedes klargemacht hatte, dass der Satz „Kein schöner Gedicht als wie das von Schiller“ im Grunde derselbe Unsinn wäre wie „Kein schöner Land in dieser Zeit als wie das unsre weit und breit“, wurden die Konservativen unter den Sängern etwas nachdenklich und bestanden nicht mehr auf einer Maßregelung des exzentrischen Autors.
Schwierigkeiten erwuchsen ihm jedoch von ganz anderer Seite, nämlich vom Herausgeber Stolzenbach persönlich - und da sind wir endlich bei jenem Ereignis, von dem bereits die Rede war, das wir aber ohne die erwähnte Vorgeschichte in letzter Konsequenz nicht völlig verstehen würden.
Walter Stolzenbach hatte jahrelang ein Auge zugedrückt. Im Gegenteil, es war ihm sogar sehr lieb, dass dieser Burli allen möglichen Staub aufwirbelte: das förderte den Umsatz, und je hitziger die Diskussionen, umso besser fürs Geschäft. Nur musste dieser Mann seine Grenzen kennen und nicht der Zeitschrift selbst schaden! Und gerade hier war Robert Burli nicht achtsam genug.
Dabei war er ausreichend gewarnt worden. Es hatte bereits eine Auseinandersetzung mit seinem Chef gegeben, als er die Fernsehquoten satirisch beleuchtete. „Würde die Mehrheit der Fernsehzuschauer ein qualitatives Werturteil widerspiegeln“, lautete eine seiner Thesen, „stände die Kelly-Familie hoch über Beethoven, und Goethes ‘Iphigenie’ fände sich weit abgeschlagen hinter Otto Waalkes.“
„Iphigenie hin und Beethoven her“, hatte Herausgeber Stolzenbach gemurmelt, „aber unser Fernsehen ist auf hohe Einschaltquoten angewiesen. Denken Sie nur an die Werbung! Die bringen schließlich das Geld. Und da veranstalten Sie ein Kesseltreiben gegen die Quoten! Mehr Fingerspitzengefühl, Herr Burli!“
Fingerspitzengefühl. Das war es. Und das ließ der eifrige Mitarbeiter plötzlich vermissen. Weiß der Himmel, welcher Teufel ihn geritten hat, jedwede Vorsicht außer Acht zu lassen - und das auch noch, als der allmächtige Herr Stolzenbach im Urlaub gewesen war! Hatte er etwa sein Fernbleiben ausnützen wollen? Beinahe sah es so aus, und der Chef nahm deshalb kein Blatt vor den Mund, als er den Frevler zu sich beordert hatte.
„Ich denke, ich sehe nicht recht!“ schnalzte er, indem er Herrn Burlis letzten Artikel auf dem Schreibtisch ausbreitete. „Ein starkes Stück! Ein Affront sondergleichen!“ Robert Burli blickte verständnislos auf das Corpus delicti. Es war seine Abhandlung „Bizet und Carmen“. Er konnte sich nicht denken, wieso das Ganze den Chef derartig aufregte.
„Sind Sie damit nicht einverstanden?“ fragte er. Stolzenbach schlug auf den Tisch. „Das ist der Gipfel! Sie wagen noch, eine solche Frage zu stellen?“ Nun verstand Robert Burli überhaupt nichts mehr. Was hatte sein Artikel über Bizet mit dem Chef zu tun? In Gedanken ging er noch einmal seine Abhandlung durch:
In sachlich begründeter Form hatte er nachgewiesen, dass die allgemein bekannte Habanera aus der Oper „Carmen“ (mit dem Text „Die Liebe von Zigeunern stammet“) gar nicht von Bizet komponiert worden sei. Dies nehme man zwar an, aber in Wirklichkeit handle es sich um das Lied „El Arreglito“ von dem spanischen Komponisten Sebastian de Yradier. Bizet habe dieses Lied, da es ihm gut gefiel, einfach übernommen und in seine Oper eingebaut - allerdings nicht als Plagiat, sondern mit Quellenangabe. Nur sei das inzwischen in Vergessenheit geraten.
„Sie behaupten also“, sagte Herausgeber Stolzenbach und wies auf den Artikel, „dieses herrliche Auftrittslied der Carmen, das mit den Worten beginnt: ‘Ja, die Liebe hat bunte Flügel!’ und das alle Welt für die schönste Melodie der ganzen Oper hält, sei gar nicht von Georges Bizet?“ „So ist es“, nickte Robert Burli, „und zwar stammt es von Sebastian de Yradier.“
Der Herausgeber schüttelte den Kopf. „Es ist nicht zu fassen“, schnalzte er. „Und so etwas erscheint in meiner Zeitschrift!“ „Aber die Beweise sind eindeutig“, beeilte sich der arglose Forscher zu bekräftigen. „Als ob es darauf ankäme!“ winkte der Chef ab. „Sie wissen überhaupt nicht, was Sie angerichtet haben.“ Robert Burli wusste es wirklich nicht. Er konnte nicht ahnen, welch schwerwiegender Vorgang die Verstimmung des Chefs ausgelöst hatte. Und doch hätte er es wissen müssen, wenn er dessen Leitartikel regelmäßig gelesen hätte!
Ja, darin lag zweifellos eine große Schuld. Ein Untergebener, der die Leitartikel seines Chefs nicht liest, begeht eine sträfliche Unterlassung. Genauer gesagt: er steht außerhalb der Legalität. Letzten Endes kann ihm niemand helfen. Noch während sich Robert Burli dem zermürbenden Gedanken hingab, was er wohl falsch gemacht hätte, wurde er von einem Knall aufgeschreckt. Herr Stolzenbach hatte ihm die Nummer 8 des Echos hingeworfen. „Seite fünf!“ rief er mit schneidender Stimme.
Zitternd schlug Burli die Seite 5 auf. „Perlen der Musikgeschichte“, las er, „von Walter Stolzenbach“. Es war der Leitartikel seines Chefs. „Das haben Sie natürlich nicht gelesen“, stellte der Herausgeber fest, „ist ja auch selbstverständlich: Was ein Stolzenbach schreibt, kann einem Burli egal sein. Aber mir ist es nicht egal, verehrter Herr!“ Er war plötzlich rot angelaufen und blickte seinen Gegenüber an, dass dieser zusammenzuckte.
„Entschuldigen Sie, Herr Stolzenbach ...“ „Da gibt es nichts zu entschuldigen!“ beharrte der Herausgeber. „Das Ganze ist eine Unverfrorenheit, eine Infamie, eine ...“ Er suchte nach weiteren Worten, fand aber keine geeigneten und trommelte statt dessen mit den Fingern auf die Tischplatte.
Sein Ärger war freilich verständlich. In seinem Leitartikel „Perlen der Musikgeschichte“ hatte er ausführlich jenes Auftrittslied der Carmen besprochen und dabei erwähnt, dass vor allem dieses Lied die Genialität des Komponisten Georges Bizet dokumentiere. Die Wiedergabe des andalusischen Kolorits sei ihm so gelungen, dass man annehmen könne, dies müsse ein Spanier komponiert haben. Aber dass es ein Franzose, nämlich Bizet, geschaffen habe, sei ein besonders glanzvoller Stern am Himmel der Musikgeschichte.
Walter Stolzenbach war mit seinem Leitartikel äußerst zufrieden gewesen, zumal ihm viele Leser beistimmten. Da platzte mitten in seinen Urlaub das Pamphlet von diesem Robert Burli! Anders als ein Pamphlet konnte man es nicht nennen. Ein Artikel, der seinem Chef derartig in die Parade fuhr, hatte keinen Anspruch auf wissenschaftliche Beurteilung. Hier ging es um Grundsätzliches.
„Sie sind sich hoffentlich darüber im Klaren, was das bedeutet“, bemerkte der Herausgeber. Robert Burli, der inzwischen den Leitartikel überflogen hatte, begann zu stottern: „Wie ich sehe, Herr Stolzenbach, ist Ihnen hier - allerdings unbeabsichtigt - ein Fehler unterlaufen ...“ „Was faseln Sie da!?“ schrie Stolzenbach - und Herr Burli zuckte zusammen. „Ich meine ..., ich wollte ..., ich dachte ...“
„Sie haben überhaupt nichts zu denken!“ entschied der Herausgeber. „Vor allen Dingen haben Sie meine Leitartikel zu lesen, bevor Sie einen derartigen Unsinn verzapfen! Vor aller Welt haben Sie mich blamiert! Ich hätte den Komponisten Bizet umsonst gelobt, wird allenthalben gespottet, hätte mich nicht gründlich informiert, hätte meine Stallburschen erst fragen müssen, mit einem Wort: das Ei sei wieder mal klüger als die Henne!“ Er war in voller Größe aufgestanden und zitterte am ganzen Körper.
„Herr Burli, Sie kennen mich als einen Mann mit viel Geduld. Über viele Ihrer Eskapaden bin ich hinweggegangen. Aber jetzt ist das Maß voll! Diese Spitze gegen mich werden Sie zu verdauen haben. Ein für alle Mal: Jetzt ist Matthäi am Letzten!“ Geräuschvoll setzte er sich. Robert Burli blickte ängstlich auf. „Wie soll ich das verstehen?“ „Dass Sie zum Monatsende entlassen sind“, erklärte Stolzenbach. „Ich will auch großzügig sein: Sie erhalten noch drei Monate Ihr volles Gehalt. Aber trennen müssen wir uns. Da beißt die Maus keinen Faden ab.“
Robert Burli erhob sich langsam. „Herr Stolzenbach“, stammelte er, „ich bin Musikhistoriker. Sie denken doch nicht, dass ich in der heutigen Zeit anderswo eine Beschäftigung finde.“ „Das ist Ihr Problem“, stellte der Herausgeber fest. „Schließlich haben Sie sich das selbst zuzuschreiben. Außerdem glaube ich kaum, dass es groß auffällt, wenn das Heer der arbeitslosen Intellektuellen um einen erweitert wird.“ „Ihren Zynismus können Sie sich sparen“ - wollte Herr Burli sagen, aber wie üblich schwieg er, machte eine Verbeugung und ging hinaus. Frische Luft tat ihm not.
Er ging durch die Parkanlagen der Stadt, um „zu sich selbst zu finden“, wie er sich einredete, aber das gelang ihm nicht. Bäume und Sträucher - im Allgemeinen keine schlechten Ratgeber - versagten ihren Dienst. Was sollten sie auch einem frischgebackenen Arbeitslosen raten? Etwa sich an ihnen ein Beispiel zu nehmen, auf Sonne und Regen zu warten und sich gelegentlich dem Wind anzuvertrauen? Ein bisschen wenig für einen Musikhistoriker. Nein, hier waren andere Dinge gefragt.
Mit einem Menschen musste er sich aussprechen! Aber mit wem? Von seinen Eltern hatte er sich seit vielen Jahren getrennt. Sie waren geschieden. Der Vater hatte eine junge Schweizerin kennengelernt und war mit ihr nach St. Gallen gezogen, die Mutter zu ihrer Schwester ins Salzkammergut gereist; beide schrieben ihm regelmäßig zu Weihnachten einen Gruß, das war alles. Sie wussten nicht einmal, dass er beim Musik-Echo beschäftigt war - gewesen war, musste er jetzt sagen, und da fand er es ganz gut, seinen Eltern die Hiobsbotschaft nicht übermitteln zu müssen.
Lediglich Frau Golombek musste er ins Vertrauen ziehen. Das war seine Wirtin, bei der er ein möbliertes Zimmer innehatte. Eine rüstige Sechzigerin, Lehrerswitwe, die selbst einmal Lehrerin gewesen sein soll -aber das musste schon lange her sein - und die seiner Meinung nach das Herz auf dem rechten Fleck hatte. Jedenfalls hatte er von ihr so manchen interessanten Ratschlag vernommen, wenn er bei ihr auf der Couch lag, und just in dieser Situation, da sich sein Leben schlagartig verändert hatte, fiel ihm die Couch der Frau Golombek ein.
Wie oft hatte er davon gehört, dass Menschen, die einen Ausweg aus dem Irrgarten des Lebens suchten, zu einem Psychoanalytiker gingen, der sie „auf der Couch“ anhörte und sie entsprechend behandelte. So einen Weg konnte er sich sparen: Er hatte die Couch bei Frau Golombek, und da würde er - dessen war er sich ganz sicher - mit seinen Problemen bestimmt ins Reine kommen.
„Da haben Sie sich was eingerührt“, sagte die erfahrene Wirtin und blickte mitfühlend auf ihren Untermieter, der nun tatsächlich auf ihrer Couch lag und soeben von dem Gespräch mit Herrn Stolzenbach berichtet hatte.