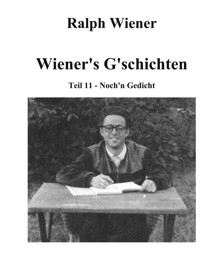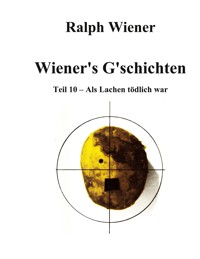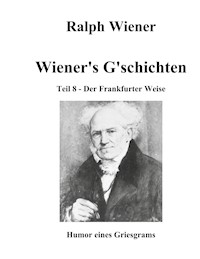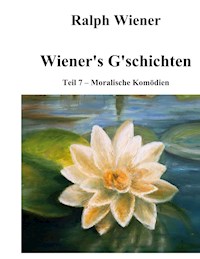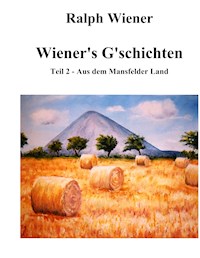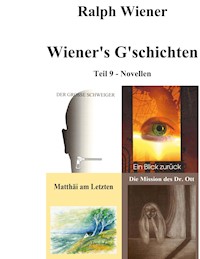
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Wiener's G'schichten
- Sprache: Deutsch
In diesem Band werden 4 Novellen zusammengefasst, die schon bereits veröffentlicht sind. Sie stammen aus den Jahren 1958 bis 2018. Die Titel: "Der große Schweiger", "Ein Blick zurück", "Matthäi am Letzten" und "Die Mission des Dr. Ott". Dabei sind ein Krimi, eine Geschichtsstunde und zwei unterhaltsame Geschichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Der große Schweiger
Wie Herr Biberti seine Stimme verlor
Ein Anstoß mit Folgen
Blauer Dunst
Ein Engel namens Gwendolyn
Herrn Bibertis Einstieg in die Politik
Ein heikles Thema
Das Ende vom Anfang
Ein Blick zurück
Bruno
Jessica
Bruno
Jessica
Bruno
Jessica
Bruno
Jessica
Bruno
Jessica
Matthäi am Letzten
Die Mission des Dr. Ott
Professor Mull hat einen Plan
Das Spiel beginnt
Kommissar Rasch erhält einen Auftrag
Miss Bajuvaria
Ein Ausflug ins Grüne
Alex taut auf
Auf Befehl der Wirtin
Das Netz wird dichter
Kommissar Rasch schlägt zu
Hinter Gittern
Jagd nach Sensationen
Vor Gericht
Schlussakkord
Persö(h)nliches Nachwort
Der große Schweiger
„Wenn die Sterne reden könnten, ständen sie nicht mehr am Himmel!“ sagt ein chinesisches Sprichwort - und in der Tat: Würde Herr Biberti, der Titelheld dieses Romans, nur ein einziges Wort von sich geben, wäre sein ganzer Nimbus dahin.
So aber stürzt er seine Mitwelt von einer Turbulenz in die andere, und der Leser erkennt schmunzelnd, dass man nicht unbedingt reden muss, um von sich reden zu machen.
Wer nichts sagt, bietet allem die Stirn.
Victor Hugo
Wie Herr Biberti seine Stimme verlor
Er hatte diesen Ausdruck wohl schon öfter als hundertmal gehört - ja, man könnte sagen: unzählige Male. Seit seiner frühesten Kindheit war er ihm vertraut. Vater, Mutter, Großeltern, Nachbarn, Lehrer, Mitschüler, überhaupt alle Menschen, die er kannte, jeder einzelne von ihnen stieß bei bestimmten aufregenden Ereignissen den Seufzer aus: „Mir bleibt die Spucke weg!“
So nachhaltig waren diese Worte in sein Bewusstsein übergegangen, dass er sie sehr bald in zunehmender Weise selbst anwandte. „Mir bleibt die Spucke weg“, murmelte er vor sich hin, als er auf dem Gymnasium in Geografie eine 4 bekommen hatte. Dasselbe sagte er beim Bewundern einer Trapeznummer im Zirkus, beim Lesen der Zeitungsnachricht von der Wahl seiner Kindergespielin von einst zur Miss Germany, beim Hören der Rundfunkmeldung vom Einsturz des Hochhauses im benachbarten Heppendorf, bei Bekanntgabe der neuen Benzinpreise, bei der Vorstellung des Bürgermeisters seiner Heimatstadt Lungwitz, bei Eröffnung der Rosenfestspiele und bei unzähligen anderen Gelegenheiten.
Aber immer sagte er es nur. Nie blieb ihm die Spucke tatsächlich weg. Da ging es ihm wie all den anderen, die diesen Ausdruck mit beharrlicher Ausdauer von sich gaben. „Mir bleibt die Spucke weg“ schien einen Zustand anzudeuten, den man zwar künstlich herbeireden, aber niemals in der Realität erleben konnte. „Glücklicherweise“ könnte man hinzusetzen; denn wer vermochte sich allen Ernstes einen solchen Zustand vorzustellen! Ein trockener Mund kam dem ewigen Schweigen - und damit dem Tod ziemlich nahe. Nein, da war es schon besser, man sagte es mechanisch und ging ohne Gewissensbisse zur Tagesordnung über.
So hatte es auch Herr Biberti, um ihn endlich bei seinem Namen zu nennen, bisher immer gemacht. Er traf seine Feststellung, nahm dabei einen durchaus glaubhaften Gesichtsausdruck an und war im Übrigen froh, wenn er merkte, dass die vielzitierte Spucke gar nicht weggeblieben war. Wer aber beschreibt sein Erstaunen, als er jüngst eines Besseren belehrt wurde! Aber um das zu verstehen, muss über Herrn Biberti einiges gesagt werden.
Vor ungefähr zwanzig Jahren war er in das abseits gelegene, etwas verträumte Lungwitz gekommen. Hier war, wenn man es genau betrachtete, seine zweite Heimat. Woher er eigentlich stammte, wusste kein Mensch. Ältere Bürger erinnern sich, dass er damals Student war und ein Zimmer bei Fräulein Knauth bezogen hatte. Fräulein Knauth war 65 Jahre alt, legte jedoch auf die Anrede „Fräulein“ großen Wert. „Eine 'Frau' ist verheiratet“, pflegte sie zu sagen, „und damit möchte ich nichts zu tun haben.“ Offenbar galt ihr der Ehestand als etwas Schändliches.
Für alle Zeiten unauslöschlich hatte sich jedoch Herrn Biberti ein Ausspruch eingeprägt, den sie in einem Disput über das Verhältnis der Geschlechter zueinander von sich gegeben hatte: „Wenn ich schon die Anrede 'Meine Damen und Herren' höre! In heuchlerischer Weise werden wir Damen dauernd zuerst genannt. Wie aber ist es in Wirklichkeit? Aus dem Wort 'Herr' wurde 'herrlich' abgeleitet, also etwas Grandioses. Und was wurde aus 'Dame'? Daraus machte man 'dämlich'. So sieht sie aus, die Arroganz der Männerwelt!“
Heute weilt Fräulein Knauth nicht mehr unter den Lebenden, und Herr Biberti, der damals an einer zwölf Kilometer entfernten Hochschule das Fach Musikgeschichte belegt hatte, hat schon längst sein Examen hinter sich und fristet sein Leben als Musikhistoriker. Von den Lungwitzern kann sich kaum einer vorstellen, was das eigentlich ist. Die meisten wissen nur, dass er ein Buch mit dem vielversprechenden Titel „La Paloma - Roman eines Liedes“ geschrieben hat. Es liegt sogar heute noch in der Buchhandlung Beierlein aus, und jene Lungwitzer, die es gelesen haben, würden - wenn man sie nach dem Inhalt befragte - folgende Auskunft geben:
Da war einmal ein aus dem Baskenlande stammender spanischer Komponist namens Sebastian de Yradier, der sogar Gesangsmeister der französischen Kaiserin gewesen war. Er ging 1861 nach Kuba, um die kreolische Volksmusik zu studieren. Hier komponierte er „La Paloma“, und die Sängerin Concha Mendez, die mit der Truppe des spanischen Dichters Zorilla im Jahre 1863 von Kuba aus nach Mexiko gekommen war, hob es im Nationaltheater der mexikanischen Hauptstadt aus der Taufe. Die Wirkung war eine unbeschreibliche, und nachdem „La Paloma“ durch das österreichische Gefolge des Kaisers Maximilian nach Wien gelangt war, trat dieses Lied seinen Siegeszug durch alle Länder der Welt an.
Wie gesagt, so etwa würden die Lungwitzer den Roman ihres Mitbürgers beschreiben und vielleicht würde der eine oder andere hinzufügen, dass ihn am meisten interessiert habe, was Herr Biberti über die Habanera aus der Oper „Carmen“ zu berichten wusste: Nicht Bizet nämlich sei der Komponist des berühmten Liedes mit dem Text „Die Liebe von Zigeunern stammt“, sondern jener Sebastian de Yradier! Das war ein bisschen starker Tobak, aber dieser Biberti hatte die historischen Quellen lückenlos unterbreitet und insbesondere darauf hingewiesen, dass es sich hier nicht etwa um ein Plagiat handelte, sondern Bizet ausdrücklich die Urheberschaft Yradiers vermerkt habe.
Trotz dieser aufregenden Fakten und obwohl Herr Biberti sogar eine Liebesgeschichte in die Handlung eingebaut hatte, wurde sein Roman kein Bestseller, im Gegenteil: Die Buchhandlungen nahmen ihn sehr bald aus den Regalen, um für wesentlich wichtigere Neuerscheinungen Platz zu schaffen, beispielsweise für die Lebenserinnerungen der Schauspielerin Ada Rada aus der Fernsehserie „Gebrochene Herzen“ - und Herr Biberti, der bisher ohnehin ziemlich zurückgezogen gelebt hatte, verbarg sich nun endgültig in einer Wolke von Einsamkeit.
Ein etwas unerklärlicher Zustand für einen Vierzigjährigen, zumal dieser Eigenbrötler gar nicht schlecht aussah: Zwar war er von untersetzter Statur (wie die meisten musisch Gebildeten), aber eine gewisse Eleganz in seinen Bewegungen machte den Mangel an Körpergröße weitgehend quitt. Vor allem war es sein schwarzer Haarschopf, der in Verbindung mit seinen dunklen Augen auf besondere Vitalität schließen ließ, wenngleich seine Nachbarn bisher kaum etwas hiervon bemerkt hatten. Noch nie hatte man ihn beispielsweise in weiblicher Begleitung gesehen, und wenn er gelegentlich ein Fußballspiel der heimischen Mannschaft Matador Lungwitz besuchte, hielten sich seine verbalen Anfeuerungen in Grenzen.
Allmählich waren die Lungwitzer zu der Erkenntnis gelangt, dass es nicht lohnend sei, sich mit diesem Mitbürger eingehender als notwendig zu befassen. Herrn Biberti selbst war das ziemlich egal. Eigentlich empfand er die Ruhe, die sich um ihn ausgebreitet hatte, als geradezu wohltuend. Sollten sie sich um ihn den Kopf zerbrechen - er ging seinen Weg. Er hatte seine Studien, seine Ideale, seine Träume. Die Stadt Lungwitz war nichts als ein Gefäß, das sein Leben umspannte. Irgendwie war er zum Philosophen geworden. Und nun - mit einem Schlag - war alles in Frage gestellt. Das Gebäude, das er in zwanzig Jahren errichtet hatte, begann zu wanken. Von heute auf morgen geriet sein Leben in eine andere Richtung. Ohne Vorwarnung hatte das Schicksal zugeschlagen.
Was war geschehen? Zwei Herren, die sich als Kriminalbeamte auswiesen, hatten ihn in seiner Wohnung in der Kantstraße 17 aufgesucht und nach Feststellung seiner Identität aufs Kommissariat mitgenommen. Er werde beschuldigt, mit einem Terroristen namens Hoßbach in enger Verbindung zu stehen und mit diesem einen Anschlag auf den Ministerpräsidenten des Landes geplant zu haben.
Herr Biberti, der den Namen „Hoßbach“ noch nie gehört, geschweige denn irgendwelche terroristische Ambitionen hatte, erlitt einen Schock. Zwar fiel er nicht in Ohnmacht (dies Vorrecht gestand er nur Frauen zu), aber sein Mund wurde plötzlich trocken. Eine geheimnisvolle Reaktion der Drüsen hatte diesem jede Feuchtigkeit entzogen. Kein Wort brachte Herr Biberti heraus. Er konnte nicht einmal sagen: „Mir bleibt die Spucke weg!“ - weil sie ihm tatsächlich weggeblieben war. In diesem Zustand saß er dem Kriminalkommissar Brenner gegenüber.
Kommissar Brenner war der Schrecken aller Missetäter. Jedenfalls taten sie gut daran, ihre Untaten in anderen Revieren zu begehen; denn kamen sie unter Brenners Fittiche, war ihr Schicksal in den meisten Fällen besiegelt. Vielleicht lag es an seinem gefährlich aussehenden Schnauzbart, der jedem Delinquenten sofort Respekt einflößte, oder auch an seinem Vernehmungsstil. Er hatte nämlich die Angewohnheit, den ihm vorgeführten Verdächtigen ungeschminkt, ohne alle Umwege die „Wahrheit“ entgegenzuschleudern, die im Übrigen natürlich der Vorstellung entsprach, die der Herr Kommissar von ihr hatte.
Im Falle Biberti biss er jedoch auf Granit. Bereits die „Vernehmung zur Person“ hatte sich als äußerst problematisch erwiesen. Herr Biberti brachte keinen Ton heraus. Nicht einmal die Erklärung, dass er gern etwas sagen wolle, es jedoch leider nicht könne, war ihm möglich. Dazu war, wie gesagt, sein Mund zu trocken. Ihm blieb nichts anderes übrig, als den Kommissar entgeistert anzublicken.
Dieser wertete das Verhalten des Beschuldigten auf seine Weise: Ein ausgekochter, raffinierter Geselle war seinen Leuten ins Netz gegangen. Aber er sollte sich irren: Die Polizei hat Zeit. Steter Tropfen höhlt den Stein! „Ich frage Sie nochmals“, rief der Kommissar mit schneidender Stimme, „wie ist Ihr Name, Ihr Beruf, Ihre Wohnung?“
Herr Biberti blickte - fast schon ein bisschen treuherzig - auf. „Ach so“, stellte Kommissar Brenner fest, „Sie wollen mit uns spielen. Vielleicht haben Sie zu viele Kriminalfilme gesehen - vor allem solche, in denen der vermaledeite Satz vorkommt: 'Sie haben das Recht zu schweigen.' Das ist aber in Amerika, mein Lieber! Bei uns wird geredet! Wir machen reinen Tisch. Also bitte: Wie heißen Sie? Sind Sie Arnold Biberti?“ Für einen Moment sah es aus, als ob der Befragte antworten wollte. Er begann zu schlucken. Aber es wurde nichts.
„Schön“, sagte Kommissar Brenner, „ganz, wie Sie wollen.“ Er erhob sich, verschränkte die Hände hinter dem Rücken und begann im Zimmer, auf und abzugehen. „Sie denken also, durch hartnäckiges Schweigen Ihre Lage zu verbessern. Ein bedauerlicher Trugschluss! Gerade das Schweigen spricht gegen Sie. Es kommt letzten Endes einem Geständnis gleich. Fassen wir noch einmal zusammen: Sie haben sich im Mai vorigen Jahres mit dem Terroristen Hoßbach getroffen. Da liegt nicht nur ein Geständnis Hoßbachs vor, der seit zwei Monaten in München einsitzt, sondern auch die Zeugenaussage einer Frau Thalberger, die Sie noch aus ihrer Zeit in Dinkelsbühl kennt und Sie beide im Hotel Assauer in Groß-Kleina beobachtet hat.“
Herrn Biberti schwamm es vor den Augen. Was sollte er zu diesem Unsinn sagen, selbst wenn er es könnte? Noch nie im Leben war er in Dinkelsbühl gewesen und ein Hotel Assauer in Groß-Kleina kannte er auch nicht. „Wir könnten Sie auf Transport schicken und Frau Thalberger gegenüberstellen lassen“, drohte der Kommissar, „aber diese Prozedur können Sie sich und uns ersparen. Also wie ist es: Geben Sie ihren Kontakt mit Hoßbach zu?“
Inzwischen war der junge Kriminalassistent Finke eingetreten, der auf der Polizeischule ein bisschen Psychologie mitbekommen hatte und jede Gelegenheit, sein Wissen an den Mann zu bringen, mit Eifer beim Schopfe packte. „Darf ich?“ fragte er den Kommissar, und als dieser zustimmend nickte, nahm er einen Stuhl, stellte ihn mit der Lehne in Richtung Delinquenten, ließ sich - wie er es in einigen Filmen gesehen hatte - breitbeinig auf dem Sitz nieder, stützte die Ellbogen auf die Lehne und begann sein eingelerntes rhetorisches Werk:
„Sie sind doch ein intelligenter Mann, Herr Biberti. Da können Sie sich bestimmt denken, was Ihr Schweigen für Folgen hat. Man wird annehmen, dass Sie schuldig sind. Mehr noch: Ihr störrisches Verhalten erhöht den Grad Ihrer Schuld um ein Vielfaches.
Ein Täter jedoch, der die Polizei in ihrer gewiss nicht leichten Arbeit unterstützt, kann bei Gericht mit Verständnis, vielleicht sogar mit Milde rechnen. Aber wozu sage ich Ihnen das! So etwas weiß jeder Bürger. Und auch Sie sind ein Bürger, Herr Biberti, wenngleich ein auf Abwege geratener. Aber da müssen Sie durch! Legen Sie ein Geständnis ab; befreien Sie sich von den Fesseln, die Sie sich selbst angelegt haben; bringen Sie den Mut auf, einen Schlussstrich zu ziehen! Sie genießen doch in unserer Stadt einen beachtlichen Ruf. Zwar habe ich Ihr Buch nicht gelesen, aber so viel weiß ich: Sie sind ein vielseitig interessierter Mensch. Und die Sache mit diesem Hoßbach - na ja, da sind Sie hineingeschlittert. So etwas kommt vor. Aber nun heißt es Farbe bekennen. Machen Sie reinen Tisch! Sie brauchen nur…“
„Also ich kann das nicht mehr mit anhören!“ unterbrach Kommissar Brenner die kunstvolle Rede seines Assistenten. „Sehen Sie nicht, dass dieser Kerl Sie unentwegt anstarrt? Einen Jux macht er sich aus der ganzen Sache. Und Sie halten hier psychologische Vorträge!“ „Entschuldigen Sie, Herr Kommissar“, wandte Finke ein, „aber irgendwie müssen wir den Mann fassen. Und die Methode nach Professor Manzelmann, die ich hier anwende...“ „Mit Ihrer Schulweisheit!“ spottete Brenner. „Das ist noch lange nichts für die Praxis. Dafür haben die Ganoven von heute nur ein Lächeln übrig.“
„Im Gegenteil!“ trumpfte Finke auf. „Nach Professor Manzelmann liegt die Aufdeckungsquote bei Anwendung seines Verfahrens...“ „Verschonen Sie mich mit Ihrem Manzelmann!“ donnerte Brenner. Wie Kampfhähne standen sich die beiden Kriminalisten gegenüber und vertraten offenbar die Meinung, dass Herr Biberti nicht nur stumm, sondern auch taub sein müsse. Jedenfalls taten sie so, als sei er gar nicht anwesend. „Ich werde dem Direktor unserer Polizeischule Berichterstatten“, murmelte Finke. „Er soll wissen, wie unsere Kenntnisse in der Praxis in den Wind geschlagen werden.“ „Unterstehen Sie sich!“ fuhr Brenner auf.
„Was ist denn hier los?“ Diese Worte kamen vom Kriminalrat Zörner, der soeben eingetreten war, weil er den Disput vom Nebenzimmer aus gehört hatte. Brenner und Finke nahmen Haltung an. „Es geht um den Fall Biberti“, erklärte der Kommissar und zeigte auf den Delinquenten. „Kein Wort ist aus ihm herauszubringen.“ Kriminalrat Zörner streifte den Übeltäter mit einem kurzen Blick. Dann wandte er sich an Brenner: „Wozu brauchen Sie noch ein Geständnis? Die Aktenlage ist eindeutig. Nehmen Sie ihn vorläufig fest! Morgen früh wird er dem Haftrichter vorgeführt.“ „Geht in Ordnung“, bestätigte der Kommissar - und wenige Minuten später fand sich Herr Biberti in einer Zelle der Untersuchungshaftanstalt wieder.
Es war das erste Mal in seinem Leben, dass er eine solche Behausung bewohnte - aber entgegen seinen eigenen Befürchtungen wurde er ziemlich schnell mit der neuen Umgebung vertraut. „Der Mensch ist ein Wesen, das sich an alles gewöhnt!“ - diese Worte des russischen Dichters Dostojewski gingen ihm immer wieder durch den Sinn, und als er sich an das zurückliegende Verhör erinnerte, konnte er ein Lächeln nicht verbergen.
Unglaublich, was sein erzwungenes Schweigen für Folgen ausgelöst hatte! Einen geradezu putzigen Tanz hatten die Kriminalisten aufgeführt. Wie in einem primitiven Schwank hatten sie sich benommen. Es fehlte nur noch, dass sie die Wände emporgegangen wären oder sich auf den Kopf gestellt hätten! Nein, das war keine ernstzunehmende Vernehmung gewesen, höchstens eine Parodie darauf. Andererseits, was hätten sie tun sollen? Ein Mann, der beharrlich schweigt, setzt alle Verhaltungsmaßregeln außer Kraft. Ihm gegenüber wird der Gescheiteste fassungslos. Den Abgebrühtesten kann er zum Wahnsinn treiben. Auf alle Fälle war das auf dem Polizeirevier ein beachtliches Lehrstück.
Auch hier in der Zelle rief sein Schweigen die verschiedensten Reaktionen hervor. Einige Kalfaktoren, die sein Essen brachten und unbedingt ein paar Worte mit ihm wechseln wollten, hätten am liebsten alles wieder mitgenommen, und der Wachtmeister, der ihn nach der Freistunde auf dem Hof wieder einzuschließen hatte, dachte einen Augenblick daran, ihn einfach hinauszuwerfen - wenn ihm nicht im letzten Augenblick eingefallen wäre, dass es sich ja um einen Arrestanten handelte, bei dem ein Hinauswurf eigentlich nicht so richtig am Plätze war.
Alles in allem, das Leben um Herrn Biberti herum zeigte sich von einer ungewohnten, geradezu amüsanten Seite. „Ein tolles Ding!“ murmelte er vor sich hin - und erschrak im selben Augenblick. Was war das? Hatte er diese Worte nicht soeben deutlich gesprochen? Er machte einen neuen Versuch. „Ein tolles Ding!“ sagte er. Nein, es bestand kein Zweifel. Seine Stimme war wieder da. Die Trockenheit im Munde hatte sich verflüchtigt. Er spürte wieder die lang entbehrte Feuchtigkeit. Um völlige Gewissheit zu haben, sprach er einige zusammenhängende Sätze. „Ich heiße Arnold Biberti“, deklamierte er, „ich wohne in Lungwitz und bin Musikhistoriker. Man hat mich unschuldig eingesperrt.“ Tatsächlich, es ging!
Schon wollte er sich über die Wiederherstellung seines Sprechvermögens freuen, als ihm seltsame Bedenken kamen. Was würde werden, wenn alle erführen, dass sein Schweigen nur vorübergehender Natur gewesen sei? Wäre er dann nicht wieder „einer von vielen“? Und vor allem: Würde nicht der eigenartige Nimbus, den sein Schweigen hervorgerufen hatte, zum Teufel gehen? „Spaß muss sein!“ flüsterte er vor sich hin. „Am besten, ich bleibe stumm. Wir werden schon sehen, was daraus wird.“
Zum Glück hatte niemand sein Selbstgespräch gehört; denn er war in Einzelhaft, und kein Wachtmeister stand vor der Tür. Aber in Zukunft hieß es: Vorsichtig sein! Nur noch Sprechübungen, wenn er wirklich allein und unbeobachtet war! Mit einem Lächeln begab er sich zur Nachtruhe und konnte lange nicht einschlafen, weil er an den Untersuchungsrichter dachte, dem er morgen vorgeführt werden sollte.
Amtsgerichtsrat Dr. Wallner war mit seinen sechzig Jahren nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Immerhin näherte er sich mit Riesenschritten der ersehnten Pensionierung, und die Haftprüfungstermine, die er von Zeit zu Zeit zu erledigen hatte, nahm er mit sichtlicher Gelassenheit hin. Sie waren eine gewisse Abwechslung im Gang der ständigen Hauptverhandlungen und noch nie hatte jemand erlebt, dass sich Dr. Wallner über einen vorgeführten Beschuldigten sonderlich aufgeregt hätte. Auch angesichts des schweigenden Biberti bewahrte er seine sprichwörtliche Ruhe.
„Es ist völlig Ihre Sache, wenn Sie mir nicht antworten wollen“, stellte er fest, „aber an Ihrer aussichtslosen Lage ändert das nichts. Ich halte Ihnen nochmals die Fakten vor: Sie haben sich im Mai vorigen Jahres zu einem konspirativen Treffen mit dem Terroristen Hoßbach zusammengefunden. Da liegt ein Geständnis Hoßbachs vor. Sie sind weiterhin von der Zeugin Thalberger belastet worden, die Sie beide bei Ihrem Zusammentreffen einwandfrei rekognosziert hat. Es ist also völlig aussichtslos, das alles abstreiten zu wollen. Da Sie das offenbar wissen, verlegen Sie sich auf hartnäckiges Schweigen. Aber das nützt Ihnen nichts.“ Er blickte den Beschuldigten eindringlich an. „Herr Biberti, wollen Sie nicht lieber ein Geständnis ablegen?“
Und nun geschah etwas Unvermutetes, noch nicht Dagewesenes: Der Delinquent, der bisher mit unbeteiligter Miene geschwiegen hatte, verzog sein Gesicht zu einem Lächeln - man könnte sogar sagen: zu einem Grinsen! Dr. Wallner war wie vom Schlag gerührt. So war ihm noch kein Untersuchungshäftling entgegengetreten! Ein trotziges Schweigen hätte er ertragen, aber nicht diesen Spott. „Was erlauben Sie sich!“ fuhr er auf. „Wollen Sie sich über mich lustig machen'?“ Zitternd erhob er sich. „Antwort! Ich verlange Antwort!“ Herr Biberti blickte ihn treuherzig an. Aber sein Grinsen gab er nicht auf. „Wie Sie wollen!“ zischte der Amtsgerichtsrat und griff nach den roten Haftbefehlsformularen. „Die Folgen haben Sie sich selbst zuzuschreiben.“
In diesem Moment betrat der Justizinspektor Kohlhase den Raum. „Entschuldigen Sie, Herr Amtsgerichtsrat! Staatsanwalt Nörting bittet Sie ganz dringend zu einer Unterredung.“ Dr. Wallner sah wütend auf Biberti: „Wir sprechen uns noch!“ Dann ließ er sich von dem Justizinspektor zum Staatsanwalt Nörting führen, der ihm mit zitternden Händen eine Akte unterbreitete.
„Es geht um den Fall Biberti“, sagte er. „Sie haben doch nicht etwa schon einen Haftbefehl erlassen?“ „Noch nicht“, erwiderte Dr. Wallner, „aber das wird gleich geschehen.“ „Um Himmels willen!“ wehrte der Staatsanwalt ab. „Das wäre eine Katastrophe. Sehen Sie hier den Bericht aus München an! Das Ganze beruht auf einem Irrtum.“ Und während der Amtsgerichtsrat aufgeregt in der Akte blätterte, schilderte ihm Staatsanwalt Nörting, wie es zu der „peinlichen Panne“ kommen konnte.
Schuld war ein Computerfehler. Aus dem Wohnort Bibertis, der „Langwitz“ hieß, hatte der Computer ein „Lungwitz“ hervorgezaubert, was an sich nicht weiter schlimm gewesen wäre, wenn da nicht ein unberechenbarer Zufall mitgewirkt hätte: Auch in Lungwitz gab es einen Arnold Biberti - und beide hatten überhaupt nichts miteinander zu tun. „Schon, Biberti“ ist ein seltener Name“, stammelte der Staatsanwalt, „ich glaube, einer von den Comedian Harmonists hieß so. Aber dass diese beiden auch noch Arnold heißen - was ja auch nicht häufig vorkommt -, hat die Sache verzwickt gemacht. Wer konnte ahnen, dass so etwas möglich ist! Erst die Frau Thalberger hat uns auf die richtige Spur gebracht. Der Biberti in Langwitz ist jedenfalls verhaftet.“ „Und dieser Biberti?“ fragte der Amtsgerichtsrat und zeigte in Richtung Vernehmungszimmer. „Den müssen wir freilassen“, erwiderte der Staatsanwalt.
Dr. Wallner gab einen tiefen Seufzer von sich. „Jetzt gehe ich doch vorzeitig in Pension“, murmelte er und begab sich zu seinem Delinquenten. Dieser konnte sich das Verhalten des Untersuchungsrichters nicht erklären, der plötzlich lauter Entschuldigungen von sich gab, die roten Haftbefehlsformulare beiseiteschob und umständlich darlegte, dass sich wieder einmal ein bedauerlicher Justizirrtum ereignet hätte. Fassungslos blickte Biberti auf den alten Amtsgerichtsrat - so als wollte er sagen: „Ich verstehe überhaupt nichts. Sind hier alle verrückt geworden? Was ist eigentlich los?“ Dr. Wallner tat, als ob er die stummen Fragen verstanden hätte, baute sich väterlich vor ihm auf und sagte: „Sie sind frei!“
Ein Anstoß mit Folgen
Das Städtchen Lungwitz ist bei aller romantischen Schönheit im Republikmaßstab ziemlich unbekannt. Es besitzt zwar ein kleines Theater, das freilich an den meisten Abenden zu Tanzveranstaltungen dient, aber wenn man einen Passanten in der Landeshauptstadt fragen sollte, würde er verständnislos antworten: „Lungwitz? Wo liegt das?“
Und sollte er wirklich den Namen schon gehört haben, dann hat er ihn aus der Sportbeilage der Tageszeitung, wo „Matador Lungwitz“ in der ersten Kreisklasse ein gewichtiges Wort mitredet. Zurzeit stehen die „Matadore“ an drittletzter Stelle, aber das wird sich sehr bald ändern; denn vorigen Sonntag haben sie gewonnen und demnächst kommt „Vorwärts Hinterstedt“ zu ihnen, die sind das Schlusslicht, und da dürften die Lungwitzer - noch dazu bei Heimvorteil - einige Punkte so gut wie sicher haben.
Wie gesagt, den „Matadoren“ verdanken die Lungwitzer Bürger, dass der Name ihrer Stadt über die Kreisgrenzen hinausgetragen wurde - allerdings (und das muss gleich einschränkend vermerkt werden) auch in einem gewissen negativen Sinne. An sich sind die Lungwitzer brave Leute. Sie gehen ihrer Arbeit nach, schreiten, wenn es soweit ist, rüstig zur Wahl, bekennen sich zur Demokratie, üben Solidarität mit vom Schicksal Benachteiligten, unterscheiden sich also in diesen Dingen kaum von den anderen Bürgern des Landes.
Man kann es ihnen eigentlich gar nicht verdenken, dass sie auch etwas gelten wollen - und weil Lungwitz so eine unbekannte Stadt ist, hat sich im Laufe der Zeit ihr ganzes Interesse auf den Fußball konzentriert. Hier wird der Name ihrer Stadt genannt, wird auf die Nachbarorte übertragen, und eine Niederlage von „Matador Lungwitz“ kommt einem mittleren Erdbeben, zumindest einer lokal begrenzten Feuersbrunst gleich. Man merkt das am nächsten Tage: Die Menschen sind niedergeschlagen, kommen unlustig zur Arbeit, und die verantwortlichen Spieler sind gut beraten, wenn sie sich ein paar Tage nicht sehen lassen.
Das Besondere an diesem Lokalpatriotismus der Lungwitzer besteht darin, dass ihm die verschiedensten Berufsschichten verfallen sind. Der Maurerpolier und der Buchhalter, der Dekorationsmaler und der Geschichtslehrer, in letzter Zeit sogar Kindergärtnerinnen, die von ihren Schützlingen angesteckt wurden - sie alle bilden auf dem von hohen Pappeln umrankten Matador-Spielplatz eine verschworene Gemeinschaft. Und wenn man sie beobachtet, kann einem der Gedanke kommen, es handle sich um eine Zusammenkunft von Leuten, die ihren in der zurückliegenden Woche aufgestapelten Ärger nun auf einmal und möglichst lautstark loswerden wollen.
Anders ist es nicht zu erklären, dass beispielsweise Herr Jaroni, der im Bauordnungsamt seinen nicht gerade beneidenswerten Dienst versieht und von Fußballregeln so wenig Ahnung hat wie ein Känguru vom Minigolf, dort auf dem Spielplatz die sachkundigste Miene aufsetzt, nach Kräften dazwischen schreit und gelegentlich seinem Vordermann ins Genick schlägt.
Oder Herr Rittmaier: Er sitzt die ganze Woche über im Büro einer Versicherungsanstalt. Auf dem Fußballplatz schafft er sich die notwendige Bewegung. Bei jeder Entscheidung des Schiedsrichters springt er in die Höhe, ruft: „Schiebung!“ läuft sogar manchmal bis an die Barriere - und alles im Grunde nur, weil er einer sitzenden Berufstätigkeit nachgeht.
Der Fußballverstand als solcher ist bei den meisten überhaupt nicht vorhanden. Herr Bindseil stellt sich unter einem Eckball einen „eckigen“ Ball vor, und was Fräulein Rammler bei „abseits“ denkt, kann man nur ahnen. Alles in allem, die „Matador“-Anhänger von Lungwitz gehören nicht gerade zu den Taktvollen. Jedenfalls kann man mit ihnen keinen Staat machen, und fast hat es den Anschein, als ob sich an diesem Zustand nie etwas ändern würde.
Aber da war plötzlich dieser Herr Biberti aufgetaucht. Das heißt, zu den Zuschauern gehörte er schon lange, und es wurde bereits erwähnt, dass sich seine verbalen Anfeuerungen in Grenzen hielten. Nun jedoch schien er sogar auf diese verzichtet zu haben. Mit eisiger Miene betrachtete er den Spielverlauf, und wenn ein Tor geschossen wurde, quittierte er das lediglich mit einem beifälligen Nicken. Bei offensichtlichen Verstößen - den sogenannten „Fouls“ - schrie er nicht wie die anderen los, sondern schüttelte höchstens den Kopf.
Bürgermeister Wenzel, der in seiner Nähe stand, betrachtete diesen Schlachtenbummler mit wachsendem Interesse. Irgendwie brachte er ihn zum Nachdenken. Das hatte freilich einen ganz bestimmten Grund: Ein Fernsehteam wurde für die nächsten Tage in Lungwitz erwartet, und es war durchgesickert, dass man auch einem Spiel der Matador-Mannschaft beiwohnen werde. Dem Bürgermeister ließ diese Vorstellung einen Schauer über den Rücken laufen. Er kannte seine Lungwitzer, wusste, wie sie sich benehmen, wenn beispielsweise ein Elfmeter verschossen wurde. Manche kletterten da vor Wut auf die Bäume. Und die Schimpfkanonaden, die sie losließen, die Ausdrücke…
Alles das würde im Fernsehen kommen. Bürgermeister Wenzel befand sich in Alarmstimmung. In einem Gespräch, das er mit dem für den Sport zuständigen Stadtrat Röppke führte, versuchte er, eine Klärung herbeizuführen. „Wir können nicht verhindern, dass unsere Schlachtenbummler gefilmt werden“, stellte er fest, „also müssen wir handeln! Eine Umerziehung der Zuschauer wäre das Richtige. Haben Sie diesen Herrn Biberti beobachtet? Der Mami strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Von dem sollten sich alle eine Scheibe abschneiden.“
Achim Röppke, der sein Amt als Stadtrat noch nicht lange innehatte, wiegte den Kopf. „Mir hat der Mann auch gefallen“, erklärte er, „aber seinem Beispiel ganz zu folgen, wird nicht möglich sein. Das Einzige wäre…“ Er stockte. Bürgermeister Wenzel sah ihn fragend an. „Ich meine, das Einzige wäre“, verkündete Röppke zögernd, „wenn wir auf unsere Lungwitzer ein bisschen einwirken würden. Ich meine, man könnte versuchen, aus den Schreihälsen gesittete Menschen zu machen.“ Und abschwächend fügte er hinzu: „Die sie ja zu Hause ohnehin sind.“
Fritz Wenzel dachte nach. „Alle Zuschauer auf einmal können wir uns nicht vornehmen“, sagte er, „aber die größten Randalierer zu einem Kurzlehrgang zusammenfassen - das wäre eine Möglichkeit.“ „Einverstanden“, stimmte Röppke zu. „Die Einladungen gehen sofort heraus.“ Und so geschah es, dass bereits am nächsten Tage eine stattliche Anzahl von Lungwitzer Bürgen folgendes Schreiben erhielt:
Werter Fußballfreund! Seit vielen Jahren halten Sie unserer erfolgreichen Matador-Mannschaft die Treue. Nicht zuletzt Ihrem regen Zuspruch ist es zu verdanken, dass wir uns nach wie vor in der ersten Kreisklasse befinden. Für kommende Aufgaben benötigen wir Ihre Unterstützung. Bitte kommen Sie am Freitag, 20 Uhr, zu einer Aussprache in die Turnhalle des Gymnasiums. Sport frei! gez. Wenzel, Bürgermeister
Die Empfänger, die freilich noch nicht ahnen konnten, was ihnen bevorstand, fühlten sich geschmeichelt. Manche rechneten sogar mit einer Auszeichnung. Auf jeden Fall war hier etwas im Gange, was ihren fachkundigen Rat erforderte, und so fanden sich die Angeschriebenen fast vollzählig in der Turnhalle ein. Albert Fricke war da (diesmal ohne Trompete, aber wild gestikulierend wie immer), Lothar Patzschke (zweimaliger Platzverweis), Ernst Brösel (bester Fahnenschwenker), Kurt Zottmann (Spezialist für Pfeifkonzerte), und sogar Buh-Rufer Max Ramdohr hatte sich eingefunden, obwohl er vom letzten Sonntag her noch einen Katarrh hatte.
Die Bänke und Stühle, die man kurz zuvor herbeigeschafft hatte, waren bald besetzt, und die meisten Schlachtenbummler hockten auf den Turngeräten herum - für sie keine ungewohnte Situation, da es auf den Pappeln des Matador-Sportplatzes wesentlich unbequemer war. Nur insofern musste man sich umstellen, als jetzt anstelle des Schiedsrichters der Bürgermeister Wenzel die Arena betrat und nach umständlicher Begrüßung folgende überraschende Ausführungen machte:
„Ich habe Sie hergebeten, liebe Sportfreunde, weil uns ein besonderes Ereignis bevorsteht. Unsere Stadt wird von einem Fernsehteam im Rahmen der Sendereihe 'Städtebilder' besucht werden. Zweifellos werden dabei auch Ausschnitte vom Spiel gegen 'Vorwärts Hinterstedt' gedreht - und was das heißt, brauche ich wohl nicht besonders zu erwähnen.“
„Wir hätten es aber gern gewusst!“ rief Albert Fricke, der schon wieder zu gestikulieren anfing, und Max Ramdohr fügte mit heiserer Stimme hinzu: „Überhaupt - was hat das mit uns zu tun?“ „Eins nach dem andern“, erklärte Wenzel, indem er sich auf einem tief eingerasteten Bock niederließ und mit Verhaltener Ruhe in die Runde blickte. „Sie wissen, die im Fernsehen gesendeten 'Städtebilder' sind Widerspiegelungen unseres heutigen Lebens. Was hat es nun aber beispielsweise mit unserem wirklichen Leben zu tun, wenn Sie noch wie in alten Zeiten auf dem Platz herumrandalieren, den Schiedsrichter anpöbeln, die gegnerische Mannschaft auspfeifen oder gar - was schon vorgekommen ist - leere Bierflaschen aufs Spielfeld werfen?!“
Die Anwesenden blickten sich an. Alle Hoffnungen auf eine Auszeichnung oder dergleichen hatten sich gelegt. Allmählich ging ihnen ein Licht auf. „Nachtigall, ick hör dir trapsen!“ raunte Kurt Zottmann und stieß einen leisen Pfiff aus, indessen Ernst Brösel anstelle der Fahne sein Taschentuch schwenkte, sich hörbar schnäuzte und hämisch verkündete: „Das mit den leeren Bierflaschen verstehe ich nicht. Volle wären Ihnen wohl lieber?“
Dröhnendes Gelächter war die Antwort. In dieser Situation kam Achim Röppke seinem Vorredner zu Hilfe. „Die Sache ist überhaupt nicht lächerlich!“ rief er. „Wenn Sie in Ihrer altgewohnten Weise auf dem Bildschirm zu sehen sind, wird es heißen, in Lungwitz gäbe es nur Rowdys. Ganz zu schweigen, was Ihre Frauen und Kinder sagen. Aber das Schlimmste ist, dass dann ein ganz falsches Bild von unserer Stadt vermittelt wird.
Dort hinten sitzt zum Beispiel Lothar Patzschke: ein Fliesenleger, wie er im Buche steht; aber auf dem Fußballplatz benimmt er sich, als ob er nicht alle Tassen im Schrank hat!“
Die Schlachtenbummler begannen zu murmeln, einige nickten. Röppke fuhr fort: „Oder nehmen wir Walter Unverhau! Er verrichtet seit zwanzig Jahren vorbildlich seinen Dienst in der Grundstücksverwaltung. Bei jedem Weiterbildungslehrgang ist er dabei. Und was war vorigen Sonntag? Da hat er den Mannschaftskapitän von Germania Lochstedt 'Eierkopp' genannt und dem Linienrichter Dresche angeboten!“
„Weil er nicht gesehen hat, dass der Ball im Aus war!“ verteidigte sich Unverhau. „Darauf kommt's nicht an“, nahm der Bürgermeister wieder das Wort, „der Ton macht die Musik.“ „Sehr richtig“, bestätigte Albert Fricke und dachte an seine Trompete, ohne die er hier ziemlich hilflos war. Fritz Wenzel setzte eine väterliche Miene auf. „Bei aller Heimatliebe - Sie dürfen nie vergessen, dass unsere Gegner auch eine Heimat haben. Und die gehört ebenfalls zu Deutschland. Wo soll das hinführen, wenn überall so ein Krawall geschlagen wird! Unsere Spieler wollen in Lochstedt oder in Schwammleben auch höflich empfangen werden. Das ist einfach eine Frage des Anstands.“
„Jetzt spricht der Sittenrichter“, raunte Zottmann seinem Nachbar Ramdohr zu, aber da dieser zu heiser war, blieb seine Antwort im Dunkeln. So blieb dem Bürgermeister Zeit, seine letzten Trümpfe auszuspielen. „Zu uns kommt das Fernsehen“, sagte er noch einmal, „das heißt: Die Welt blickt auf Lungwitz! Einen solchen Schandfleck wie den geschilderten können wir uns jedenfalls nicht leisten. Aber damit Sie nicht etwa denken, ich hätte Angst, bin ich zu einem Kompromiss bereit. Ich verlange von Ihnen gar nichts. Verhalten Sie sich ruhig so, wie Sie es für richtig halten. Aber ich werde die Kameraleute bitten, Ihr Benehmen in Großaufnahme zu drehen, so deutlich, dass man die Gesichter erkennt, und die Namen werde ich nennen lassen, damit alle Kinder mit Fingern auf Sie zeigen, und jeder wird sagen…“
Der Rest seiner Rede ging im allgemeinen Geraune unter. Besonders der Kreis um Albert Fricke war spürbar getroffen; denn sie fingen an, emsig miteinander zu diskutieren, und einige machten sich bereits gegenseitig Vorwürfe. Achim Röppke blickte mit Bewunderung auf seinen Bürgermeister, dem hier offenbar ein psychologischer Meisterschuss gelungen war. Der erste, der die Fassung erlangte, war Lothar Patzschke. „Soll das eine Erpressung sein?“ fragte er. „Keineswegs“, erklärte der Bürgermeister, „ich stelle jedem frei, wie er sich verhalten will.“ „Und - wie sollen wir uns verhalten, Ihrer Meinung nach?“ fragte Walter Unverhau. „Wie zivilisierte Bürger.“
Nun wussten sie es ganz genau. Sie sahen sich an, überlegten, und bevor die nächste Einwendung kam, hatte sich Achim Röppke auf ein Podest geschwungen und war zum konkreten Teil der Aktion übergegangen. „Wir wollen uns zunächst bemühen, den Lokalpatriotismus ein bisschen zu dämpfen“, verkündete er. „Das beginnt bereits beim Erscheinen der Mannschaften. Spenden Sie ruhig auch den Gegnern Beifall!“ „Den Hinterwäldlern?“ unterbrach Ernst Brösel, aber Röppke fuhr bereits fort: „Gerechtigkeit ist das A und O für die Zuschauer. Sie müssen sich daran gewöhnen, eine gute Leistung anzuerkennen, auch wenn sie Lochstedt oder Schwammleben vollbracht hat. Wir werden das jetzt an einigen Beispielen erproben.“
Das war der Auftakt - und während der nächsten zwei Stunden waren die Versammelten damit beschäftigt, die verschiedensten für die Zuschauer bedeutsamen Vorfälle durchzuexerzieren. Es war bereits 22 Uhr vorüber, als Röppke in ungebrochenem Eifer sagte: „Besprechen wir nun eine weitere Standardsituation! Unsere Mannschaft hat einen indirekten Freistoß erhalten. Ein Gegenspieler hat versehentlich - ich betone: versehentlich - die Anlaufbahn unseres Mittelstürmers geschnitten. Wie würden Sie als korrekte Zuschauer reagieren? Ein Beispiel folgte dem andern, und als sich nach Mitternacht die letzten diskutierenden Gruppen auflösten, war klar, dass Wenzel und Röppke einen Sieg errungen hatten. Der nächste Tag würde es endgültig beweisen.
Es war dies ein Sonnabend, und irgendwie lag ein Schleier des Geheimnisses über Lungwitz. Es wurde gemunkelt, in allen Ecken, in allen Gassen. „Ajax Hainsdorf“ wurde zu einem Freundschaftsspiel erwartet - und das solle zu einer Art Generalprobe werden, hieß es, zu einem Test hinsichtlich der veränderten Zuschauerqualität. Die Gruppe um Albert Fricke hatte für Werbung gesorgt ohne Trompete, aber mit familiärer Mundpropaganda. Man wollte zeigen, zu welcher Selbstbeherrschung man fähig sei; und Walter Unverhau hatte - wenngleich mit einem gewissen Augenzwinkern - die Losung verbreitet: „Gentlemen an die Front!“
So kam es, dass das Spiel gegen „Ajax Hainsdorf“ einen Besucherrekord aufwies. Ein Drittel aller Einwohner war erschienen. Schiedsrichter Bernhardy hatte, als er mit den Mannschaften den Platz betrat, ein ungutes Gefühl. Er kannte die Lungwitzer und hatte sich - allerdings erfolglos - gegen seine Benennung gewehrt. Jeder Schiedsrichter wehrte sich, wenn es nach Lungwitz ging. Und jeder musste schließlich den Gang nach Canossa antreten. Aber schon beim Einlaufen der Mannschaften wurde Bernhardy stutzig. Die Hainsdorfer waren nicht mit den üblichen Schimpfworten bedacht worden, sondern man spendete ihnen Beifall, genauso wie den eigenen Leuten.
Das war noch nicht dagewesen. Vollends die Hainsdorfer Spieler waren so etwas nicht gewöhnt und vergewisserten sich, ob sie nicht etwa die falschen Trikots anhatten.
Schließlich vermuteten sie eine neue List und nahmen sich vor, besonders auf der Hut zu sein. Man konnte nie wissen…
Die Seitenwahl verlief zuungunsten der Lungwitzer: Gegen Sonne und Wind müssten sie spielen. Jedenfalls bis zur Halbzeit. Aber das besagte nichts; denn in fünfzig Minuten würde die Sonne untergehen und bei dem Missgeschick der Lungwitzer drehte sich dann auch bestimmt der Wind. Doch die Entscheidung der Münze war heilig, und alle trugen es mit Fassung. Dafür hatte Lungwitz den Anstoß. Das Leder rollte.
Im weiten Rund verfolgte eine sachkundige Menge das Spiel. Unter ihnen Herr Marzahl, Buchhalter im Eisenwarengeschäft Glocke. „Sie werden entschuldigen“, sagte er zu Kurt Zottmann, der beim Hochwerfen der Münze zwar gewohnheitsmäßig die Lippen gespitzt, aber dann keinen Pfiff von sich gegeben hatte, „ich bin zum ersten Mal hier auf dem Platz - einfach deshalb, weil alle hier sind, und da würde mich interessieren: Worum geht es bei so einem Spiel überhaupt?“
Kurt Zottmann sah seinen Nachbarn von der Seite an. Er kannte ihn. Es war das dürre Männchen, das jeden Abend pünktlich um fünf durch den Hinterausgang der Firma Glocke schlich - das heißt bis zu jenem Zeitpunkt, da die Firma aus steuerlichen Gründen als GmbH zu arbeiten begann. Von da ab ging er schon um vier. Auf alle Fälle trug er immer eine dünne Aktentasche bei sich und wurde weder in einer öffentlichen Versammlung noch in einer Gaststätte jemals gesehen. Nicht einmal seinen Namen wusste Zottmann; für ihn war er „das dürre Männchen bei Glocke“, nichts weiter.
Und nun wurde er plötzlich von ihm angesprochen. „Das ist gar nicht so leicht, lieber Herr“, sagte er. „Marzahl!“ bemerkte der Buchhalter mit einer kurzen Verbeugung. „Angenehm, Zottmann!“ erwiderte der Experte und zeigte gleich anschließend auf das Spielfeld. „Sehen Sie dort die zweiundzwanzig Spieler! Das sind die Leute, die uns herausfordern wollen.“ „Uns?“ fragte Marzahl. „Allerdings“, erklärte Kurt Zottmann. „Bisher ist es ihnen auch immer gelungen.“
Der Buchhalter blickte ungläubig. „Ich dachte, es geht um Fußball, um Tore und so.“ „Das ist die eine Seite“, meinte Zottmann, „aber das Wichtigste sind wir. Man will uns brüllen hören, mit raffinierten Fouls unsere gute Kinderstube testen. Und dann das Schwarzhemd mittendrin, sehen Sie, das ist der Schiedsrichter - er will mit seinen Fehlentscheidungen unser Benehmen auf die Probe stellen. Nicht umsonst guckt er jedes Mal ins Publikum, wenn er gepfiffen hat - er wartet auf unsere Reaktion. Ein rasendes Stadion, das ist die rechte Soße in ihrem Braten. Aber denen werden wir es geben! Wir lassen uns nicht reizen, wir nicht!“
Buchhalter Marzahl wurde es unheimlich. Vom Radio her kannte er die Sache anders. Ob er an den falschen Mann geraten war? Links neben ihm stand Lothar Patzschke. Just in dem Moment, als ein Spieler von Lungwitz „gelegt“ wurde, sprach er ihn an: „Würden Sie mir bitte erklären, was da vor sich geht?“ „Es sieht aus, als habe man unsern Mittelstürmer hart angegangen“, erwiderte Patzschke, „aber ich kann mich da selbstverständlich nicht festlegen. Schließlich bin ich kein Schiedsrichter, sondern Zuschauer.“
Der Buchhalter Marzahl bekam Hochachtung vor dieser Sportart, die er zum ersten Mal praktisch erlebte. Herrlich war es, diese Würde unter den Menschen! Wohin er blickte - überall verständnisvolle Gesichter. Sogar jetzt, als „Ajax Hainsdorf“ ein Tor geschossen hatte. „Ein prächtiger Schuss“, bemerkte Kurt Zottmann, und sämtliche Lungwitzer spendeten Beifall. „Nun verstehe ich gar nichts mehr“, sagte der Buchhalter, „ich denke, Hainsdorf ist unser Gegner?“ „Na und?“ erwiderte Patzschke von der anderen Seite. „Sind das nicht auch Menschen?“
Das war etwas Neues. Wenn man sich an die Spiele gegen Boxbach, Scherben oder Gnadikau erinnerte, dann war das jedes Mal, als habe man eine Delegation aus der Unterwelt zu Gast. Und heute? Heute stand Albert Fricke mit seinen Mannen brav hinter der Barriere (die er sonst immer übersprungen hatte), und statt der Trompete hielt er lediglich ein Fernglas in der Hand. Durch dieses sah er, wie ein Lungwitzer Verteidiger dem Hainsdorfer Rechtsaußen ein Bein gestellt hatte, was jedoch vom Schiedsrichter übersehen worden war.
„Darf ich Sie einen Augenblick sprechen?“ rief er dem in Hörweite stehenden Bernhardy zu. Schiedsrichter Bernhardy blickte ein bisschen verständnislos auf den Rufer. „Unser Mann hat nämlich ein Foul begangen“, fügte Albert Fricke hinzu, und Bernhardy glaubte zu träumen. Er gab den Spielern einen kurzen Wink und wandte sich an den Zwischenrufer: „Wie meinen?“ Albert Fricke setzte seine höfischste Miene auf. „Ich möchte mich keineswegs in Ihre Obliegenheiten einmischen“, sagte er, „das würden mir meine Freunde sehr übelnehmen.“ Hierbei blickte er auf Ernst Brösel, Max Ramdohr und Walter Unverhau, die beifällig nickten.
„Aber eins gestatten Sie mir bitte zu bemerken“, fuhr er fort, „dass nämlich unser Verteidiger Riedewald den Rechtsaußen von Hainsdorf etwas sehr kühn genommen hat. Er ist ihm - mit Verlaub zu sagen - in unziemlicher Weise entgegengetreten, wodurch dessen Aktionsradius gewissermaßen gehemmt wurde.“ Bernhardy blickte gläsern. „Was heißt das mit einem Wort?“ „Er hat ihm ein Bein gestellt“, erklärte Fricke und fügte entschuldigend hinzu: „Aber so hart wollte ich das natürlich nicht sagen.“ Der Schiedsrichter wandte sich wieder dem Spiel zu und zeigte dem Lungwitzer Verteidiger die gelbe Karte. Die Zuschauer applaudierten. Beim Stand von 1:0 für Hainsdorf ging es in die Pause.
Wer früher zwischen zwei Halbzeiten - noch dazu bei einem solchen Spielstand - den Platz betreten hatte, war unter Umständen seines Lebens nicht mehr sicher. Die „Matador“-Fanatiker liefen entrüstet von einem zum andern, wiegelten jeden gegen jeden auf, bezeichneten ihre Leute als Schlappschwänze, Versager und Nieten, boten den Gästen Prügel an, und wenn der Anpfiff zur zweiten Halbzeit ertönte, erhob sich ein Orkan disharmonisch klingender Instrumente - allen voran Frickes Trompete -, dass man glaubte, das Ende der Welt sei gekommen.
Ganz anders war es heute: Ein Hauch abgeklärter Gerechtigkeit lag über dem Stadion. Das Tor, welches Hainsdorf geschossen hatte, ging völlig in Ordnung; es hatte die Bewunderung aller erregt. Und dass Lungwitz zu nichts gekommen war, lag an ihnen selber. So kam es, dass beim Wiedererscheinen der Mannschaften die Hainsdorfer freundlicher begrüßt wurden als die Einheimischen, und Kurt Zottmann ließ es sich nicht nehmen, jenem unglückseligen Lungwitzer Verteidiger zuzurufen, er möge bitte, wenn es ihm nichts ausmache, künftig fairer spielen - wobei er sich anschließend beim Linienrichter wegen des Zurufs entschuldigte.
Buchhalter Marzahl studierte aufmerksam alle Gepflogenheiten und erkannte im Stillen, dass es gar nicht so einfach sei, einen ordentlichen Fußballzuschauer abzugeben. Man sollte Prüfungen durchführen, dachte er, ungefähr in der Art eines Führerscheins. Jedenfalls ist das hier wirklich kein Zuckerlecken. „Warum strahlen Sie auf einmal so?“ fragte er seinen Nachbarn. „Weil wir wahrscheinlich einem Tor entgegengehen“, antwortete Zottmann. „Sehen Sie, unser Linksaußen hat den gegnerischen Libero umspielt.“
„Libero?“ wiederholte Marzahl. „Was ist das?“ „Das finden Sie sogar im Duden“, erklärte Zottmann, „das gehört zur Fußballsprache. Es ist sozusagen der freie Mann. Und nun sehen Sie genau hin: Unser Linksaußen schießt!“ Der Ball landete im Netz der Hainsdorfer. Ein höfliches Händeklatschen folgte der Aktion. „Hat man früher nicht immer 'Tor!' gerufen?“ fragte Marzahl. „Und wie!“ entgegnete Zottmann abfällig. „Es klang wie das Gebrüll von Urmenschen. Manche sind sogar auf die Bäume gesprungen, zum Beispiel unser Sparkassenleiter. Ich habe dabei immer an mein Konto denken müssen, das diese Sprünge nicht mitmachen konnte.“
Der Buchhalter nickte mitfühlend. „Aber der Tor-Ruf war nicht das schlimmste“, belehrte ihn Zottmann, „viel deprimierender war es mit jenem verzweifelten Oh-Ruf, wenn ein Schuss über die Latte ging. Dann hatte man das Gefühl, als handle es sich um den letzten Seufzer einer von einem Erdbeben verschlungenen Menschenmenge.“ „Das müssen furchtbare Zeiten gewesen sein“, hauchte Marzahl, indessen sich die Spieler wieder zum Anstoß formiert hatten.
Etwas seitlich, von den übrigen Zuschauern unbemerkt, standen Bürgermeister Wenzel und Achim Röppke. Sie hatten die erste Halbzeit mit wachsendem Staunen verfolgt und hätten eigentlich zufrieden sein müssen. Aber irgendetwas machte Röppke zu schaffen. „Ich weiß nicht“, raunte er, „mir ist nicht ganz wohl.“ „Wieso?“ fragte Wenzel. Röppke neigte sich ihm vertraulich zu. „Die wollen uns auf den Arm nehmen!“ Der Bürgermeister war anderer Ansicht. „Das glaube ich nicht. Es ist alles ein Produkt unserer Überzeugungsarbeit. Und dann dürfen wir nicht vergessen...“
In diesem Augenblick war der Lungwitzer Halbrechte Zarnewanz durchgebrochen, hatte geschickt den Stopper umspielt und raste auf das Hainsdorfer Tor zu. Achim Röppke wurde rot vor Eifer, legte die Hände an den Mund und schrie aus Leibeskräften: „Zarnewanz! Zarnewanz!“ Die Männer seiner Umgebung blickten ihn an, schüttelten die Köpfe, und Bürgermeister Wenzel begriff, dass sein Fachmann für Bildung plötzlich alle Bildung vermissen ließ. Er stieß ihn heimlich in die Seite, aber es war zu spät. „So ein Flegel“, sagte einer der Umstehenden, und als sie nähertraten, erkannten sie ihren Übungsleiter vom Abend zuvor.
„Jetzt wird's verrückt“, brummte Klaus Honigmann, der eigentlich nur aufgrund einer Sondergenehmigung dem Spiel beiwohnen durfte (ein Opfer seiner Begeisterung lag noch im Krankenhaus), „unser Herr und Meister fällt aus der Rolle.“ „Ich muss mich sehr wundern“, fügte Franz Hecker hinzu. Achim Röppke holte tief Luft. „Ich habe nur zweimal 'Zarnewanz' gerufen“, verteidigte er sich. „Aber wie!“ bemerkte Honigmann. „Und überhaupt: Wo gibt's denn so was?“ erklärte Hecker. „Jeder Spieler weiß selber, wie er heißt. Das braucht er nicht von uns zu erfahren. Völlig überflüssig das. Nicht wahr, Chef?“
Fritz Wenzel, der allen verschämt den Rücken zugedreht hatte, wandte sich um. „Sie haben ganz recht. Ich werde mit Freund Röppke ein ernstes Wort reden.“ Hoffentlich!“ sagten die Mannen und gingen an ihren Standort zurück. Dass inzwischen Zarnewanz das Tor geschossen hatte, war ihnen entgangen; denn der freundliche Beifall war leiser gewesen als ihre Unterhaltung.
Lungwitz führte also mit einem Tor Vorsprung, und die Hainsdorfer mussten ihre Kräfte zusammennehmen. Sie machten das mit großem Einsatz. Eine Angriffswoge nach der andern rollte in Richtung Lungwitzer Tor. Neben der Gruppe um Albert Fricke standen die Schlachtenbummler aus Hainsdorf. Sie hatten sich zwar über das ungewohnte Benehmen der Lungwitzer gewundert, feuerten aber in alter Manier ihre Leute an. Als ein Hainsdorfer seinem Gegner im Strafraum mit aller Wucht ins Schienbein trat, stockte ihnen der Atem.
„Zigarette?“ sagte Albert Fricke und bot dem Wortführer der Hainsdorfer aus der Schachtel an. Der Angesprochene blickte entgeistert auf Albert. Früher wäre es im Anschluss an eine solche Aktion nicht ohne Anrempeleien abgegangen. „Wie, bitte?“ fragte er. „Sie rauchen doch, oder?“ Der Hainsdorfer zeigte auf das Spielfeld. „Haben Sie nicht beobachtet, was soeben geschehen ist?“ Albert winkte ab. „Dafür sind Sie nicht verantwortlich.“ „Aber unser Spieler hat einen von Ihnen getreten!“ beharrte der Hainsdorfer. „Na und?“ erwiderte Albert. „Gibt es etwa eine Sippenhaft für Zuschauer?“ Er streckte ihm die Schachtel vor. „Nehmen Sie schon!“ „Danke!“ sagte der Hainsdorfer und bediente sich.
„Die Sache ist die“, fuhr Albert fort, „wir Zuschauer müssen viel mehr zusammenhalten. Es ist lächerlich, wenn wir uns gegenseitig madigmachen. Das wirft kein schönes Bild auf unsere Gesellschaftsordnung. Schließlich ziehen wir alle an einem Strang. Übrigens: Ich war vorige Woche in Hainsdorf. Ein herrliches Stück Erde! Und die Menschen so freundlich! Ich wüsste nicht, warum ich gegen Sie sein sollte.“ Er blickte aufs Spielfeld. „Jetzt kriegen wir einen Elfmeter. Hoffentlich geht er vorbei! Ich wünsche es sehr für Sie.“
Der Elfmeter, welcher im Anschluss an Alberts Rede geschossen wurde, ging zwar nicht vorbei, aber der Hainsdorfer Tormann konnte ihn halten. „Bravo!“ jubelten die Lungwitzer; denn es war eine schöne Parade, und Albert Fricke fiel ein Stein vom Herzen. „Ich hätte es nicht überlebt“, sagte er - und seinem Gesprächspartner standen vor Rührung die Tränen in den Augen. „Wollen wir hoffen, dass Sie noch ein Tor schießen!“ seufzte Albert. „Ein Unentschieden ist immer am gerechtesten. Keiner gewonnen, keiner verloren - da nimmt jeder etwas mit.“
Allmählich übertrug sich die Geisteshaltung der Lungwitzer auch auf die Gäste aus Hainsdorf. Wo andere vornehm sind, kann man nicht herumschreien; es macht dann nicht den richtigen Spaß. Von Minute zu Minute wurden sie gesitteter, und als ihrer Mannschaft endlich der Ausgleich gelang, begleiteten sie den Treffer mit dem gleichen dezenten Beifall, wie ihn die Lungwitzer zu spenden pflegten. „Wir kriegen Konkurrenz“, sagte Bürgermeister Wenzel zu Achim Röppke, und beide waren im Grunde ein bisschen traurig. Was sie in schwerer nächtlicher Arbeit vorbereitet hatten, ernteten die Hainsdorfer ohne besondere Anstrengung mit. „So ist das bei uns“, tröstete Röppke. „Eine findige Idee kommt allen zugute.“
Und nicht ganz ohne Stolz blickte er auf seine Zöglinge, die im weiten Rund verteilt waren: Albert Fricke, Lothar Patzschke, Ernst Brösel, Kurt Zottmann, Max Ramdohr, Walter Unverhau und wie sie alle hießen, jene „Türme in der Schlacht“, die sich einst ohne Rücksicht auf Verluste hervortaten und nun ihrer Bildschirmpremiere entgegengingen. Das würde eine Sache werden: Lungwitz mit neuer Fußballqualität! Und das Fernsehen ist dabei „Sehen Sie mal, wer dort steht!“ sagte Bürgermeister Wenzel und zeigte in eine der hinteren, durch ein Podest erhöhten Reihen.
„Unser Herr Biberti“, gab Röppke lächelnd von sich. „Er ist die ganze Zeit stumm geblieben“, bemerkte Wenzel, „wie wir es von ihm erwartet haben. Das ist sportliche Contenance, mein Lieber!“ Achim Röppke nickte. „Ein Vorbild für uns alle! Und wir dürfen nicht vergessen, dass es dieser Herr Biberti war, der letztlich den Anstoß zu unserer Aktion gegeben hat.“ „Ein prächtiger Mensch“, stimmte der Bürgermeister zu.
In diesem Moment war der Schlusspfiff gekommen. Einträchtig verließen die Schlachtenbummler die Arena. Albert Fricke hatte den Hainsdorfer freundschaftlich eingehakt, und viele waren seinem Beispiel gefolgt. Auch die Spieler hatten von der Atmosphäre etwas mitbekommen. Arm in Arm mit den Gegnern liefen sie an den Zuschauern vorbei. Einer von ihnen blieb bei Röppke stehen. „Sie haben mich schwer enttäuscht“, flüsterte er, „so etwas dürfen Sie mit mir nicht machen! Hoffentlich fallen Sie nicht, wenn das Fernsehen da ist, aus der Rolle!“ „Bestimmt nicht, Herr Zarnewanz!“ sagte Röppke.
Blauer Dunst
Wie das Leben so spielt: Natürlich waren die Fernsehleute gar nicht gekommen. Die Serie „Städtebilder“ war eingestellt worden, und die hoffnungsvollen Lungwitzer hatten das Nachsehen. Immerhin verblieb ihnen der Trost, dass allein die Aussicht, auf die Bildschirme zu gelangen, merkliche positive Veränderungen in ihrem Städtchen herbeigeführt hatte.
Nicht nur die Randalierer auf dem Fußballplatz waren zu Gentlemen geworden, auch ansonsten hatte sich in kurzer Zeit viel getan. Man hatte sogar begonnen, die Hauptstraße zu betonieren, und einige Hausbesitzer hatten ihre Fassaden erneuert, ohne einen finanziellen Zuschuss bei der Stadtverwaltung zu beantragen.
Irgendwie war das Leben in Lungwitz in neue Gleise geraten und vor allem: Herr Biberti geriet immer mehr ins öffentliche Interesse. Es hatte sich allenthalben herumgesprochen, dass eigentlich er der Auslöser jenes seltsamen Spektakels auf dem „Matador“-Platz gewesen war, und besonders der in Lungwitz stadtbekannte Landarzt Dr. Schreck, ein rüstiger Sechziger, nahm den „Fall Biberti“ mit emsigem Eifer unter die Lupe.
Was musste das für ein Mann sein, der zu allem beharrlich schwieg? War er ein schizophrener Einzelgänger? Ein pathologischer Sonderling? Oder gar ein Philosoph? Dem rührigen Landarzt ließ die mysteriöse Angelegenheit keine Ruhe. Durch alle möglichen Kniffe erreichte er es, mit Herrn Biberti einigermaßen in Verbindung zu kommen, und jüngst war es ihm sogar gelungen, den „großen Schweiger“ an den Honoratiorenstammtisch im Lungwitzer Ratskeller zu lancieren.
Was sich hier abspielte, blieb den anwesenden Gästen (unter ihnen zwei Studienräte, ein Apotheker, ein Gerichtsvollzieher, drei Steuerbeamte, ein Konsistorialrat) auf ewig unvergessen: Herr Biberti hatte beim Eintreten in den mit Tabakqualm erfüllten Raum nicht nur verächtlich die Nase gerümpft, sondern ostentativ mit der Hand die Rauchschwaden abgewehrt, und er war - bevor er sich an den Stammtisch setzte - wortlos von Tisch zu Tisch gegangen, hatte die dort befindlichen Aschenbecher eingesammelt und zum Büfett gebracht.
Alles in allem, eine unmissverständliche Geste. Die betroffenen Gäste reagierten entsprechend. Sie begannen zu murren, einige erhoben sich und gingen bedrohlich auf Herrn Biberti zu, doch Dr. Schreck stellte sich ihnen in den Weg, versicherte, er werde das klären - und nun entwickelte sich am Stammtisch eine erregte Debatte über das Für und Wider der Handlungsweise dieses Sonderlings, der schweigsam dasaß und bei allem, was er hörte, entweder ablehnend den Kopf schüttelte oder zustimmend nickte.
So verschieden die Ansichten der Honoratioren auch waren - in einem Punkte war man sich einig: Die bürgerliche Gesellschaft von heute zerfällt nicht mehr in Linke und Rechte, in Arme und Reiche, in Unterdrückte und Herrscher, in Friedliche und Gewalttäter - nein, es gibt nur noch zwei sich unbarmherzig gegenüberstehende Gruppen, nämlich Raucher und Nichtraucher! Die gesamte Geschichte der Menschheit ist aus dieser Dissonanz zu erklären. Alles andere ist bloße Fassade.
Wie gesagt, das war die Meinung der Stammtischgäste, und der eifrigste Verfechter dieser neuen Theorie - um nicht zu sagen „Weltanschauung“ - war Dr. Schreck. Immer näher war er an Herrn Biberti herangerückt, hatte schließlich seinen Arm auf dessen Schultern gelegt und auf dem Höhepunkt der Diskussion das denkwürdige Versprechen abgegeben, er werde „das Werk, das dieser Mann hier begonnen hat, fortführen und zu einem siegreichen Ende bringen“.
Die Honoratioren trauten ihren Ohren nicht. War der alte Landarzt von allen guten Geistern verlassen? Sollte er das wirklich ernst meinen? Vielleicht wusste Dr. Schreck selbst nicht, was er sagte. Und sicherlich wäre alles anders gekommen, wenn sich da nicht eines Tages ein besonderer Vorfall ereignet hätte.
Es begann während einer Probe im Lungwitzer Stadttheater. Justus Kunze, ein junger Debütant, stand ängstlich vor dem Regisseur. „Ich soll mir eine Zigarette anzünden?“ stammelte er. „So steht es im Buch“, erwiderte Plaumann. „Es ist ein modernes Stück; da wird viel geraucht und telefoniert.“ „Aber ich bin Nichtraucher“, gestand Kunze. „Das ist Ihre Schuld“, bemerkte Regisseur Plaumann. „Jedenfalls müssen Sie sich die Zigarette anzünden. Und während des Dialogs müssen Sie ununterbrochen rauchen.“ „Das kann ich nicht“, seufzte Kunze. Der Regisseur wandte sich an seine Assistentin: „Was ich gesagt habe: Wir kriegen nur noch Ausschuss von der Schauspielschule!“
Dann drehte er sich zu Kunze um. „Also gut. Jetzt wird geübt.“ „Was soll ich?“ fragte der Debütant. „Rauchen!“ Die folgenden Proben wurden für Justus Kunze ein Martyrium. Er musste inhalieren, pustete, verschluckte sich und kam jedes Mal käseweiß in die Garderobe. „Ich halte das nicht durch“, wimmerte er kurz vor der Premiere, aber Regisseur Plaumann kannte kein Pardon. „Da hätten Sie sich einen anderen Beruf aussuchen müssen!“ stellte er mitfühlend fest und bestand auf seinem Auftritt.
Gegen Ende des ersten Aktes erlitt Kunze einen Schwächeanfall. Landarzt Dr. Schreck, der gerade in der Vorstellung war, eilte zu Hilfe. „Eine Rücksichtslosigkeit!“ fuhr er den Regisseur an. „Wie können Sie einem Nichtraucher solche Eskapaden zumuten! Fünf Zigaretten innerhalb einer Viertelstunde!“ „So steht es im Buch“, erwiderte Plaumann lakonisch. „Außerdem ist Rauchen bei uns eine Selbstverständlichkeit“ „Das allerdings“, raunte spöttisch der Landarzt. „Lungwitz liegt in der Statistik sogar mit an erster Stelle. Aber da werden wir einen Riegel vorschieben!“
Und noch ganz unter dem Eindruck des Zusammenbruchs jenes jungen Debütanten verkündete er am nächsten Tag in einer Ratssitzung seinen unwiderruflichen Entschluss: „Lungwitz muss die erste Nichtraucherstadt Deutschlands werden!“ Die Ratsmitglieder waren ein bisschen ratlos. Sie kannten diesen Dr. Schreck zur Genüge. Er war das Unikum unter den Ärzten, übertrieb gern, machte aus jeder Mücke einen Elefanten - und was er jetzt von sich gab, lag ganz auf dieser Linie. Nichtraucherstadt! Als ob er die Lungwitzer nicht kannte. Nicht einmal zu einer „Nichtraucherschule“ hatte man es gebracht (es scheiterte am Protest der Vierzehnjährigen). Und da sollte plötzlich die ganze Stadt...?
„Ich wende mich an die Verantwortlichen der Stadtreinigung!“ rief er aus und blickte dabei Hubert Westphal an. „Ist es nicht herrlich, wenn Sie keine Zigarettenkippen mehr zusammenfegen müssen? Und das Entleeren der Aschenbecher fällt weg!“ Hubert Westphal nickte. „Wir sind sowieso nur noch drei Mann“, stellte er fest. „Na bitte!“ bekräftigte der Landarzt. „Im Übrigen habe ich vorhin mit Verwaltungsdirektor Proschwitz gesprochen und ihn auf die gesundheitlichen Perspektiven aufmerksam gemacht. Er steht voll und ganz hinter mir.“
„Proschwitz raucht selber“, bemerkte schmunzelnd Stadtrat Martin, „er würde nie einem Rauchverbot zustimmen.“ „Wer spricht von Verbot!“ rief Dr. Schreck aus. „Davon kann nicht die Rede sein. Aber durch zielgerichtete Erziehung sollten wir versuchen, einiges zu erreichen.“ Eine halbe Stunde redete er noch auf die Ratsmitglieder ein, dann waren sie weich. „Wer gegen meinen Vorschlag ist, den bitte ich um das Handzeichen!“ Keine Hand hob sich. „Ich danke Ihnen, meine Herren. Packen wir das Übel gleich bei der Wurzel an!“
Eine dieser Wurzeln erblickte er in den euphorischen, schön klingenden Namen der Zigaretten. Schon der Name verführt, sagte er sich, man muss ihn umändern. Und da er mit dem Vorsitzenden des Gewerbevereins befreundet war, erreichte er es, dass die einschlägigen Geschäfte die Etiketten jener giftigen Genussmittel mit den ihnen zukommenden Bezeichnungen überklebten.
„Skorpion“ hieß jetzt eine Packung, „Giftspinne“ eine andere, hinzu kamen „Morast“, „Kloake“, „Tollwut“ - und jedes Mal war ein Totenkopf mit abgedruckt (als Warnung, wohin das Rauchen eines Tages führen könnte). Der rührige Landarzt hatte sogar vor, zwei über Kreuz liegende Skelettknochen als Abzeichen für Raucher einzuführen, wurde jedoch hierin von den Ratsmitgliedern überstimmt. Das käme einer übertriebenen Diffamierung gleich, wurde ihm entgegnet, Raucher seien immerhin auch Bürger, wenngleich irregeleitete, und man solle die Kirche im Dorf lassen.
So musste sich Dr. Schreck auf die Abschaffung des Rauchens beschränken. Aber auch das brachte genug Probleme. Da war vor allem der Widerstand der Zigarettenhandlungen, die schon von der Umbenennung ihrer Artikel nicht erbaut waren, nun aber gänzlich gegen die Aktion Sturm liefen. Sie machten eine Rechnung auf, nach welcher der Verlust an Tabaksteuern für den Staatshaushalt bedrohlich werden könnte, worauf Dr. Schreck seinerseits eine Rechnung präsentierte, nach welcher die Krankenhauskosten bei Bronchialkrebs, der durch das im Tabakteer der Zigarette enthaltene Benzpyren begünstigt würde, die Tabaksteuern um ein Vielfaches überträfen. Nachdem er noch dargelegt hatte, dass Rauchen die körperliche Widerstandskraft lähme, den Menschen für Infektionskrankheiten anfälliger mache, die Sauerstoffversorgung des Gehirns beeinträchtige, ja sogar die sexuelle Potenz mindere, gaben die einschlägigen Geschäfte ihren Widerstand auf und billigten die Aktion.
Sonderbar war sie; trotz allen Verständnisses. Immerhin hatte es noch keine Stadt gegeben, die sich zu so etwas aufgerafft hätte. Aber gerade diese Einmaligkeit war es, die Dr. Schreck ins Feld führte. Die Verwirklichung war nun allerdings weitaus schwieriger. Wenn nämlich erreicht werden sollte, dass nicht mehr geraucht würde, mussten jene direkten oder indirekten Animierungen wegfallen, die hier und dort festzustellen waren. Das fing schon bei der Tageszeitung an. Kaum ein Bildbericht, in dem nicht der Gefeierte oder Belobigte eine Zigarette im Mund, zumindest in der Hand hielt.
Dr. Schreck sprach mit Lokalredakteur Immerschied. Der Redakteur ging mit vollen Segeln in die Opposition. „Was Sie verlangen, ist unmöglich! Die Zigarette gehört in unseren Bildberichten zum guten Ton. Nicht nur bei uns. Nehmen Sie in irgendeiner Illustrierten ein Interview mit einem Wissenschaftler, Künstler oder Bauarbeiter Sie werden immer die Zigarette finden! Sie ist unerlässliches Requisit. Was sollen denn die Leute machen, wenn sie sich unterhalten?“
„Vor allem sollten sie kein schlechtes Beispiel geben“, betonte Dr. Schreck. „Unsere Jugend wird nämlich dadurch zum Rauchen geradezu aufgefordert.“ Redakteur Immerschied reckte sich behaglich. „Mein lieber Doktor, Sie sitzen - wie mir scheint - auf dem falschen Dampfer. Wenn die Zeitung schuld daran sein soll, dass geraucht wird, könnten Sie dasselbe aufs Trinken beziehen. Wir bringen nämlich auch Bilder, wo mit einem Glas Sekt angestoßen wird oder man sich mit Bier zuprostet.“
„Dagegen habe ich nichts“, erklärte der Landarzt, „hier geht es um unsere Lungen.“ „Ach“, entgegnete der Redakteur, „und die Leber?“ Dr. Schreck atmete tief durch. „Zwischen Trinken und Zigarettenrauchen ist ein gewisser Unterschied. Und Sie wissen ganz gut, dass ich recht habe, wollen das nur nicht eingestehen. Der Nimbus der Presse könnte darunter leiden. Dabei würde es diesem Nimbus nur dienlich sein, wenn Sie sich unserer Aktion anschlössen. Sie könnten sogar Berichte bringen über das Neue in unserem gesellschaftlichen Leben. Überschriften gäbe es genug: Eine Stadt auf dem Wege der Vernunft beispielsweise.“
Immerschied winkte ab. „Was Sie verlangen, ist unmöglich.“ „Wer spricht von 'verlangen'!“ entgegnete Dr. Schreck. „Ich komme mit einer Bitte.“ Seine Stimme klang sanft wie Äolsharfen. „Im Einvernehmen mit unserer Stadtverordnetenversammlung möchte ich Sie ersuchen, keine zigarettenrauchenden Personen mehr abzubilden und uns bei der Vorbereitung des ersten Nichtrauchertages, der am kommenden Sonntag sein wird, zu unterstützen.“
„Der erste... Nichtrauchertag?“ wiederholte Immerschied. Dr. Schreck nickte. Dem Redakteur lief es eiskalt über den Rücken. „Wie wollen Sie das zuwege bringen? Wissen Sie nicht, welche Mühe es gekostet hat, das Bahnhofsgelände von Rauchern freizuhalten? Und in den Gaststätten! Da hat man sich nicht einmal in der Mittagszeit durchsetzen können. Ganz zu schweigen von den Büros im Rathaus, wo seit jeher fröhlich drauflosgequalmt wird.“ „Das ist vorbei“, erklärte der Landarzt. „Bürgermeister Wenzel hat entsprechende Vorkehrungen getroffen. Mit den Gaststätten verhandelt Stadtrat Martin und den Bahnhof behält Bruno Roestel im Auge.“
„Ihr denkt an alles“, raunte Immerschied - und nach einer Pause fügte er hinzu: „Bloß an eins nicht.“ Dr. Schreck horchte auf. Das klang beunruhigend. Hatte das sorgfältig aufgestellte Register ein Loch? Kam die Aktion am Ende noch ins Wanken? „An was sollen wir nicht gedacht haben?“ fragte er. Der Redakteur lächelte. „Am kommenden Sonntag - Ihrem ersten 'Nichtrauchertag' - bringt das Lungwitzer Theater eine neue Premiere, und zwar ein Stück von Ibsen: 'Gespenster'.“