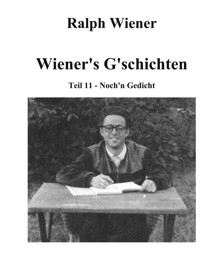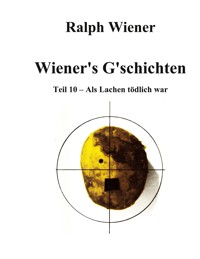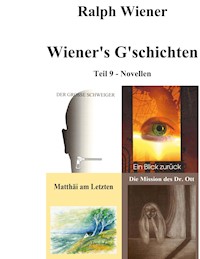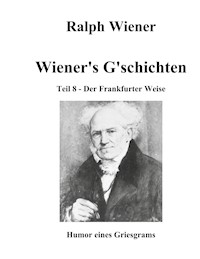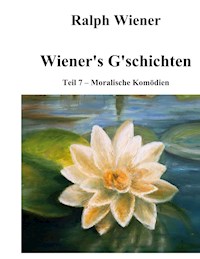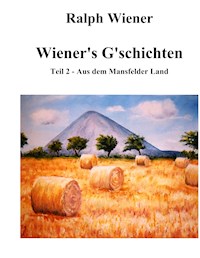
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem Band sind alle Satiren, die nicht im Eulenspiegel – also nur in anderen Zeitungen, Büchern oder bisher noch gar nicht veröffentlicht sind. Wiener fühlte sich immer seiner Mansfelder Heimat verbunden und schrieb unter anderem Reportagen über bekannte Eisleber Persönlichkeiten, die ein Kapitel dieses Buches bilden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Felix Ecke im Jahre 1954
Veröffentlichungen und Unveröffentlichtes ab 1955
einschließlich Reportagen über Eisleber Persönlichkeiten
Inhalt
Vorwort von Ralph Wiener aus dem April 1990
Einleitung
Die „Gänsefüßchen“ (4.2.1955)
Hat der Duden immer recht? (11.3.1955)
Verschmähte Liebe (31.3.1955)
Streit um Goethe (11.4.1955)
Weibliche Logik (10.10.1955)
Farbengeflüster (5.1.1956)
Faschings-Intermezzo (28.2.1957)
Das Modell (1.3.1957)
Der verhängnisvolle Koffer (7.3.1957)
April! April! (17.3.1957)
La Belle Yvonne (17.3.1957)
Die Spröde (21.3.1957)
Die kalte Dusche (31.3.1957)
Ein netter Film (9.4.1957)
Rapunzelöl (11.4.1957)
Sieben Tage hat die Woche (11.4.1957)
Brandmaier gegen Brandmaier (12.4.1957)
Freitag, der Dreizehnte (13.4.1957)
Gelegenheit macht Liebe (7.6.1957)
Glück muss man haben (12.7.1957)
Fliegende Hüte (28.7.1957)
Die Dame in Grau (31.7.1957)
Verzeihlicher Irrtum (8.8.1957)
Rundfunk-Freuden (1.12.1957)
Der Übersetzer (5.12.1957)
Die Freunde des Herrn Lichtenstein (6.12.1957)
Ein kühner Entschluss / Mein Skihase (29.12.1957)
Ferngespräch mit Gundula (26.1.1958)
Was eine Frau beim Küssen denkt… (31.1.1958)
Der erste Kuss (7.2.1958)
Tanz und Etikette (13.2.1958)
Elternsorgen (14.2.1958)
Wer zuletzt lacht… (14.2.1958)
Der Kenner (15.2.1958)
Haben Sie etwas für mich (26.2.1958)
Vom Jägerlatein zur Filmdiva mit 'apropos' (4.3.1958)
Über das Reden beim Schach (6.3.1958)
Reisebekanntschaft (9.3.1958)
Ballgeflüster (1.4.1958)
Autorentragödie (9.4.1958)
Titelhelden (9.4.1958)
Der Vorspann (14.4.1958)
Elf Takte 'Aufforderung zum Tanz' (12.5.1958)
Hoher Besuch (13.5.1958)
Die Ehrenerklärung (18.5.1958)
Die Krankenruhe (1958)
Ein Tag mit Mucki (20.7.1958)
Schwarzer Tag für Herrn Kistowski (1.11.1958)
Der Landspielplan (24.11.1958)
Das Jahr hört gut auf (1.12.1958)
Fotomodelle gesucht / Karriere (18.1.1959)
Kleine Formenlehre (8.2.1959)
Das waren Zeiten (1959)
Alle Jahre wieder (1959)
Sorgen von heute (19.7.1959)
Spuk in Krülpa (1.10.1959)
Verwaltungseinsatz (12.11.1959)
Kulturimport (1.1.1960)
Bravo! (15.1.1960)
Abenteuer mit Bianca (6.3.1960)
Die gute Lehre (6.3.1960)
Rhetorisches (24.4.1960)
Unglaubliches (25.6.1960)
Angelica (1960)
Falsch verstandene Mitbestimmung / Hände hoch! (29.7.1960)
Ein Abend mit Barbara (29.9.1960)
Die Klarinette (28.4.1961)
Schenken ist Glückssache (14.5.1961)
Der Fotograf (29.6.1961)
Die Zurückgebliebenen (19.7.1961)
Der Müller und sein Kind (15.1.1962)
Quangels missverstandene Osterwünsche (6.3.1962)
Ein idealer Gatte (27.3.1962)
Ovid in Warna (14.5.1962)
Flatterhemd für Ursula (26.6.1962)
Madame und ihr Auto (11.8.1962)
Es geht auch ohne Liebe (24.12.1962)
Rädchen für alles (27.4.1963)
Groteskes um einen Brief (13.7.1963)
Das zu kurze Bett (31.12.1963)
Das zu kurze Bett (31.12.1963)
April! April! - und Ursula (2.4.1964)
Die Bratsche (30.4.1964)
Babuschka (1964)
Die Fliege (23.12.1964)
Die Dame vis-á-vis (27.3.1965)
Liebe zu Johanna (1965)
Der Liebesautomat 'Erox' (22.11.1965)
Der Umschwung (22.11.1965)
Ein sehr dringender Brief (10.2.1966)
Verwünschter Ruhm (11.2.1966)
Die Quelle (7.5.1966)
Ein gefährlicher Beruf (17.8.1966)
Der Ziegenhirt (30.8.1966)
Das Bindemittel (31.8.1966)
Heinrichs Liebeslied (12.9.1966)
Hopf an der Basis (17.9.1966)
Sein bester Einfall (8.2.1967)
Der Sheriff (29.3.1967)
Rosenstöcke (7.4.1967)
Hypnose (10.4.1967)
Die Probe aufs Exempel (19.4.1967)
Mundek kann warten (20.4.1967)
Kühl bei Kopf (22.4.1967)
Licht muss sein (20.5.1967)
Ihr schwacher Tag (25.9.1967)
Stumme Szene (1969)
Gestatten - Hubalek (12.9.1969)
Computer ‘Pegasus‘ (15.12.1969)
Der richtige Mann (28.12.1969)
Edward blickt tiefer (16.1.1970)
Warum nicht? (18.3.1970)
Ihre Hoheit persönlich (5.3.1971)
Vatersorgen (1971)
Ballade vom Klecks (24.7.1971)
Irenes Lächeln (3.9.1971)
Die Klette (10.12.1971)
Erwachsene (27.5.1972)
Das schöne Perlebach (8.6.1973)
Solo für Streicher (1974)
Es grüne die Tanne (1974)
Auf einen Husch (26.12.1974)
Montag kommt Nägelein (21.4.1975)
Pause mit Wera (13.6.1975)
Meister von morgen (23.6.1975)
Zum Greifen nah (1975)
Es steht geschrieben... (4.7.1975)
Aktivist der zweiten Stunde (11.3.1977)
Die unsterbliche Geschichte (15.4.1977)
Eine vorbildliche Auswahl (22.5.1977)
Die Strandreportage
Der Tag
Die Blonden von Randsvill
Wie auf Kohlen
Die Klippe
Die Enttäuschung
Verwässerte Hymne
Ein verwegener Kunde
Ein Kleid für Gisela (1972 Gehört sich das?)
Der Boulevard (1972 Gehört sich das?)
Liebe, Herbst und Graphologen (1972 Gehört sich das)
Gestern war Vollmond (1979 Kein Wort über Himbeeren)
Aktion Stäbchentod (1979 Kein Wort über Himbeeren)
Eva im November (1979 Kein Wort über Himbeeren)
Antrittsbesuch (1979 Kein Wort über Himbeeren)
Die Karten lügen nie (1979 Kein Wort über Himbeeren)
Die Stadt ohne Tick
Lilos Bilder (1997)
Eisleber Geschichten
Eisleber Originale: Friedrich Rennert
Eisleber Originale: Hans Krawczyk
Eisleber Originale: Oskar Hense
Eisleber Originale: Reinhard Jud
20 Jahre DDR - Wir waren dabei - Bürger unseres Kreises berichten
Wir waren dabei - Günter Oppermann
Wir waren dabei - Helmar Naumann
Wir waren dabei - Käthe Käsemann
Wir waren dabei - Otto Friedrich
Wir waren dabei - Werner Kirsch
Ralph-Wiener-Bibliografie
Vorwort von Ralph Wiener aus dem April 1990
„Es war einmal“, wird es sicherlich in absehbarer Zeit heißen, „ein Land, das nannte sich 'DDR', und alle, die darin wohnten, waren 'Bürger der DDR', und sie hatten sogar eine eigene Verfassung, sangen ihre eigene Hymne - und wenn Olympische Spiele waren, holten sie sehr viele Medaillen.“
Ja, und nun wissen wir (und von Stefan Heym haben wir es schriftlich), dass diese DDR, von der es in einem satirischen Couplet so schön hieß: „Wir sind die größte DDR der Welt!“ - dass also diese DDR nichts weiter ist als eine „Fußnote der Weltgeschichte“. Eine Fußnote. Irgendwie mag das stimmen. Aber sind nicht vierzig Jahre manchmal ein ganzes Menschenleben? Und hat es nicht vorher einen Staat gegeben, der nur zwölf Jahre existierte und dem man die Bezeichnung „Fußnote“ kaum angedeihen lassen könnte?
Lassen wir die Sache mit der Fußnote also dahingestellt und nehmen wir die DDR so, wie sie war: als ein Land mit vielen Widersprüchen, historisch stiefmütterlich bedacht, aber im Innern gleichwohl lebendig, dabei von einer Hassliebe beseelt, wie sie schwerlich anderswo zu finden ist. Nur aus einer solchen Hassliebe heraus können die folgenden Satiren verstanden werden. Sie sind ohne Ausnahme in jenen Jahren publiziert worden (die meisten in der Tageszeitschrift „LDZ“), und es spricht für den Mut der seinerzeitigen Redakteure, dass die mitunter durchaus nicht zimperlichen Attacken einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden konnten.
Allerdings waren jedwedem Mut objektive Grenzen gesetzt: Die „Obersten“ durften nie angegriffen werden. Der Leser möge deshalb verzeihen, wenn ich ihn hauptsächlich in die gestatteten „niederen Gefilde“ führe - wobei freilich das, was „gestattet” war, oftmals wechselte, mitunter sogar ins Gegenteil umschlug.
Wie wurde seinerzeit gegen Lotto und Toto gewettert („Missbrauch des Sports für pekuniäre Interessen!“), bis man selbst das Fußballtoto einführte. Wie wurde der Mais propagiert („Da wächst die Wurst am Stengel!”), bis man ihn wieder abbaute. Wie wurden die Rinderoffenställe kampagneartig errichtet, bis man ihre Nachteile erkannte. wie wurde ...
Aber lassen wir das. Man könnte die gesamte Geschichte der DDR als Satire schreiben und würde nicht einmal übertreiben. Nehmen wir stattdessen die kleinen Satiren, die schier unglaublichen Begebenheiten des Alltags, die aneinandergereiht ein vielleicht besseres Bild vermitteln, als es die gründlichste Historiographie abgeben könnte.
Einleitung
Das war vielleicht eine Aufregung, kann ich euch sagen, als in unserem altehrwürdigen, durch viele Jahrhunderte geheiligten Schulbetrieb ein neues Pflichtfach eingeführt wurde: Zwerchfellkunde.
So etwas hatte es noch nicht gegeben, nicht einmal - wie eure Großeltern sicherlich zu berichten wissen - in den „goldenen Zwanzigerjahren“, und damals war allerhand möglich gewesen. Zum Beispiel war „Kunstpfeifen“ eine hochangesehene Fertigkeit, und wer die beliebten Schlager aus dem Film „Bomben auf Monte Carlo“ fehlerfrei pfeifen konnte, hatte in Musik die Note Eins so gut wie sicher.
Oder nehmen wir das „Handlaufen“. So nannten wir jene Kunst, die einen mittelmäßigen Schüler in die Lage versetzte, mit einem Schlag die höchsten Sprossen der Popularität zu erringen. Er brauchte nur auf den Händen die Schultreppe herunter zu hopsen - schon hatte er eine Eins im Turnen und genoss das Ansehen eines Supermanns, wie ihr heute sagen würdet.
Aber was sagt ihr zur Zwerchfellkunde? Wisst ihr überhaupt, was das ist: ein Zwerchfell?
Seht ihr, da beginnen schon die Schwierigkeiten. Alle Körperteile werden fleißig „getrimmt“: die Muskeln gespannt, der Rücken gekräftigt, die Schultern gedreht, die Beine beschleunigt, die Lungen geweitet, die Nase geformt, der Nacken gehärtet, der Magen geschont, die Stimme gestärkt, der Bauch eingezogen, die Ohren gespitzt - aber das Zwerchfell?
Frei heraus gesagt, es wird geradezu stiefmütterlich behandelt. Oder habt ihr schon in irgendeinem Ratgeber gelesen, wie das Zwerchfell trainiert werden müsse?
Dabei ist dieses Organ das wichtigste; es ist nämlich lebensnotwendig für eine Funktion, die uns grundlegend vom Tier unterscheidet. Ich spreche vom Lachen. Ein großer Spaß ist gleichzeitig „zwerchfellerschütternd“, und je mehr ein Mensch lacht, desto besser werden Herz und Lunge versorgt.
Ja, manche Forscher meinen sogar, dass Lachen gegen viele Krankheiten immun mache. Das Tier lacht nicht - deshalb wird es auch nicht so alt wie die Menschen. Elefanten und Schildkröten gehören zu den Ausnahmen (aber nur, weil sie sich heimlich eins ins Fäustchen lachen!).
Doch so einfach, wie viele es sich vorstellen, ist das Lachen gar nicht. Es will gelernt sein. Und wer über einen nichtssagenden, vielleicht sogar blöden Witz lacht, hat keine Aussicht, dass sein Zwerchfell gekräftigt wird. Das Zwerchfell ist nämlich eine kluge Haut: es registriert weniger, dass man lacht, als vielmehr, worüber man lacht. Und erst, wenn gewisse Ansprüche erfüllt werden, setzt es sich in Bewegung.
Beim bloßen Witz beginnt es nur kurz zu zucken, auch beim harmlosen Scherzwort. Wenn also jemand im strömenden Regen sagt: „Das ist ja ein herrliches Wetter!“, könnt ihr sicher sein, dass das Zwerchfell kaum reagiert. Wenn er jedoch feststellt: „Das sehe ich ja, dass es draußen regnet - warten wir aber erst mal ab, was die Mehrheit unserer Abgeordneten dazu sagt!“, dann fängt das Zwerchfell ganz schön an zu rumoren, der Kreislauf wird angeregt, und der Mensch fühlt sich wohl.
Aber wie gesagt, geschult muss dieses wichtige Organ werden - und weil es noch keine offiziellen Schulen hierfür gibt, soll dieses Buch euch ein bisschen helfen. Ihr werdet von Ereignissen hören, wie ihr sie nicht alle Tage erlebt und lustige Geschichten kennenlernen, die meist im Mansfelder Land spielen, aber in der Regel mit fiktiven Namen versehen sind.
Und vor allem: In unserer Zwerchfellkunde wird euch klarwerden, dass Ernstes und Heiteres im Leben dicht beieinanderliegen und dass es häufig nur auf die Betrachtungsweise ankommt. „Nicht die Dinge bringen die Menschen in Verwirrung“, hat der griechische Philosoph Epiktet gesagt, „sondern die Ansichten über die Dinge.“ Und deshalb wird oft geweint, wo eigentlich ein Grund zum Lachen wäre.
Aber das werdet ihr in dieser Schule, in der es nun schon zum dritten Mal geläutet hat, alles noch lernen - und da es keine Zensuren gibt, macht euch das Ganze vielleicht besonderen Spaß.
Ich wünsche es euch jedenfalls von Herzen - und wenn ihr euer Zwerchfell richtig getrimmt habt und wir uns einmal sehen sollten, bekommt ihr von mir als Reifezeugnis eine rosa Karte, wie sie seinerzeit der Wiener Kabarettist Maxi Böhm an seine Kollegen verteilt hat. Wisst ihr, was auf der Karte stand? Nur zwei Sätze: „Mit dieser Karte können Sie überall hingehen. Gleichzeitig verlieren die gelben Karten ihre Gültigkeit.“
Die „Gänsefüßchen“ (4.2.1955)
Neueste „Nachrichten“ über eine akute „Krankheit“. „Heureka!“ rief ich und sprang, wie weiland Archimedes, aus dem Bade. Zwar hatte ich nicht das „Gesetz vom Auftrieb“ erkannt, aber eine neue „Krankheit“ und zugleich ihren „Erreger“ entdeckt: Es ist die von mir benannte „Gänsefüßchen-Krankheit“
Diagnose: Das Erkennen der genannten „Krankheit“ ist nicht leicht, da man sich bereits an ihr epidemisches Auftreten „gewöhnt“ hat. Wo ist der „Autor“, welcher einen noch so kleinen „Artikel“ ohne Anführungszeichen oder - wie der „Volksmund“ sagt - „Gänsefüßchen“ veröffentlicht? Und doch - es lässt sich nicht länger verheimlichen: Unsere Sprache ist „krank“; sie ist befallen vom „Gänsefüßchen-Bazillus“! Die Diagnose der „Gänsefüßchen-Krankheit“ ist ohne weiteres positiv zu stellen, sobald alle zehn Worte mindestens ein in „Anführungsstriche“ gesetztes vorkommt, aller fünf Worte ist es ein „schwerer Fall“ und aller zwei Worte „unheilbar“.
Ursache: Das krankhaft, übermäßige „Anführen“ entspringt einem Mangel an Gedanken, der durch „Striche“ ersetzt werden soll. Wer nichts durch Gedanken hervorheben kann, benutzt „Gänsefüßchen“ - und schon ist alles „in Butter“. Oder er will besonders „ironisch“ wirken (dann ist es ein Zeichen einer „tief unglücklichen Seele“). Im letzten Stadium verfertigt er dann Sätze wie: „Ich“ „schreibe“ „nur“ „über“ „hohe“ „Dinge“! Dieser Zustand entspricht dem „Delirium tremens“. Die „Gänsefüßchen-Krankheit“ ist eine Art „literarischer Größenwahn“. Tiefere Ursache dürfte eine völlige „Ausdrucksunfähigkeit“ sein.
Prophylaxe: Alle „Einsichtigen“ fordern ein generelles „Gänsefüßchen-Verbot“ und die „Verbannung“ der „Anführungsstriche“ aus unserem „Sprachsystem“. Erst nach einer solchen „Reinigung“ sollte man sie „behutsam“, ihrer ursprünglichen Bedeutung gemäß, wieder „einführen“.
Therapie: In „leichten“ Fällen „vorübergehendes“, in „schweren“ ein „dauerndes“ Verbot jeder literarischen „Betätigung“! „Unheilbare“ Fälle bedürfen der „Unterbringung“ in einer „Heilanstalt“. Eine zu bildende „Gänsefüßchen-Kommission“ wird ab sofort in die „Seuchengebiete“ gesandt, um die weitere „Ausbreitung“ der „Gänsefüßchen- Krankheit“ zu verhindern.
Dies war die erste Veröffentlichung als Ralph Wiener am 4. Februar 1955 in der LDZ - der Tageszeitung der Liberal Demokratischen Partei Deutschlands im Bezirk Halle/Saale und Magdeburg! Viele Geschichten und Gedichte folgten hier.
Hat der Duden immer recht? (11.3.1955)
„Meine Herren!“ sprach der Vorsitzende des Linguisten-Verbandes, und man fühlte, dass er bereits drei Stunden lang ununterbrochen geredet hatte. „Ich komme nun zum Schluss meiner kurzen Ausführungen. Die Frage, welche unsere heutige Tagung zu beantworten hat, lautet: Hat der Duden immer recht? Und ich muss als Vorsitzender des Verbandes klar und deutlich sagen: Ja, er hat recht! Er hat immer recht, meine Herren!“
Beifall brandete auf. Nicht lange. Dann erhob sich eine dürre Gestalt. Sie räusperte sich: „Hem! Mein verehrter Herr Vorredner hat erklärt, die Kommission des Herrn Duden sei wissenschaftlich äußerst korrekt vorgegangen. Es sei mir gestattet, an dieser Stelle an die Worte Luthers zu erinnern: Auch die Konzile können irren!“ „Bravo!“ riefen einige Herren. „Wieso hat sich Duden geirrt?“ fragte der Vorsitzende. „Hem!“ sagte die dürre Gestalt. Dann war es einige Zeit still.
Plötzlich erhob sich Dr. Zwick, seines Zeichens Sachverständiger in philologischen Streitigkeiten. „Bitte, meine Herren, nehmen wir doch nur einmal das kleine Wörtchen 'Spaß': Warum schreibt man es nur mit einem a? Schließlich müsste man es doch dann wie 'Fass' oder 'nass' aussprechen. Also richtiger erscheint mir die Schreibweise 'Spaaß'!“ Die Sache hatte den Zuhörern augenscheinlich Spaß - Nein: Spaaß - gemacht. Der Dürre schmunzelte: „Ein herrlicher Einwand!“ - „Um Himmels willen!“ rief eine Stimme aus dem Hintergrund. „was hat dies denn mit einer Wand zu tun? Sie meinen wohl eine Einwendung?“ Es entstand ein Gelächter. „Bitte“, verteidigte sich der Dürre, „das spricht ja wieder gegen den Duden: Dort steht nämlich Einwand!“
„Betreiben wir doch keine Haarspalterei!“ ermahnte der Vorsitzende. „Schließlich haben Sie ja deshalb eine Ladung von mir erhalten, weil...“ Weiter kam er nicht. Ein dicker, kahlköpfiger Herr hatte ihm die Worte entgegengeschleudert: „Eine Ladung! Wenn ich das schon höre! Schiffe und Gewehre haben Ladungen, Herr Vorsitzender! Sie meinen Vorladung!“ Eine Lachsalve erschütterte den Raum. Der Vorsitzende gab sich noch nicht geschlagen. „Der Sachverhalt ist doch der, dass ...“ Wieder wurde er unterbrochen. „Sie meinen das Sachverhältnis!“ Er gab sich immer noch nicht geschlagen und wandte sich direkt an den Zwischenrufer: „Mein lieber Herr Krüger, noch gestern behaupteten Sie, als ich Sie am Nachmittag getroffen hatte...“ - „Er hat auf Krüger geschossen!“ brüllte jemand, und die Menge wälzte sich vor Lachen. „Ich meine: als ich ihm am Nachmittag begegnet war!“
Es hatte alles keinen Zweck. Die Stimmung strebte ihrem Höhepunkt zu. Um alles zu retten, griff der Saalschutz ein. Ein energischer Mann kündigte an: „Es werden zur Herstellung der Ordnung strenge Maßnahmen durchgeführt!“ Eine Piepsstimme von hinten gab ihm die Antwort: „Maßnahmen sind Angelegenheiten der Schneider, wenn sie einen Anzug anmessen - Sie meinen wohl Maßregeln?“ Jetzt war keiner mehr zu halten. Und als der Ordnungshüter auf seine Worte: „Ich erlasse in Bezug auf diesen Zwischenruf...“ die Antwort einstecken musste: „Kopfkissen und Stühle haben einen Bezug!“, konnte man von einer gelehrten Versammlung beim besten Willen nicht mehr sprechen.
Allmählich entstanden hier und dort diskutierende Gruppen. Einer behauptete, wenn man statt Beziehung Bezug sage, könne man auch aus einer Anziehung einen Anzug machen; wenn Unterkommen zur Unterkunft wird, rief ein anderer, könne auch das Auskommen zur Auskunft werden; ein Dritter warf ein, dass sich z.B. eine Hochschule auch tief im Tale befinden könne und man deshalb lieber Hohe Schule sagen sollte. Worauf ihm entgegnet wurde, dass doch nicht alle Schüler reiten lernen wollten; wieder einer verwahrte sich dagegen, dass die glücklicherweise beseitigten Grafen nunmehr als Fotografen oder Stenografen fröhliche Urständ feiern sollten - und als man nach mehr als siebenstündiger Debatte das Ergebnis der Tagung zusammenfasste, bestand dies aus einem einzigen Satze: „Der Duden hat zwar nicht immer recht, aber es schadet durchaus nicht, wenn man sich dann und wann nach ihm richtet!“
Verschmähte Liebe (31.3.1955)
Nun steh' ich hier schon acht Minuten -
und du bist immer noch nicht da.
Kannst du dich nicht ein wenig sputen?
Geht dir mein großes Leid nicht nah?
Ich glaub', du lässt mich heute sitzen,
obwohl ich nass im Regen steh'.
Die Leute, die vorüberflitzen,
sind glücklicher als ich - o weh!
Treuloses Ding! Hab' ich nicht immer
in bar bezahlt die kleinste Huld?
Und nun - nein, das vergess' ich nimmer!
Jetzt reißt mir aber die Geduld!
Doch plötzlich wird die Miene heiter:
Sie kommt! Wie glücklich bin ich jetzt!
Allein, die Eifersucht nagt weiter,
als du mir sagst: „Bin schon besetzt!“
Ein ganzes Rudel junger Herren
ist schon um deine Gunst bemüht.
Ich häng' mich an dich, doch sie zerren
mich von dir weg. Mein Glück verblüht...
Seh' in der Ferne dich verschwinden.
Was hab' ich dir nur angetan?
Könnt' ich doch Gegenliebe finden,
du gute, kleine Straßenbahn!
Streit um Goethe (11.4.1955)
Lydia war ein zauberhaftes Mädchen. Sie besaß alle Vorzüge, die im Allgemeinen das schöne Geschlecht auszeichnen, und hatte nur einen Fehler. Dieser eine Fehler sollte jedoch unserer Liebe zum Verhängnis werden. Und das kam so:
Ich hatte ihr im Verlaufe unseres Kennenlernens von meinem Steckenpferd, der Schriftstellerei, etwas vorgeschwärmt. Auch war ich so weit gegangen, einige Gedichte und Erzählungen, wie sie der geschätzte Leser bereits kennen wird, ihrer huldvollen Aufmerksamkeit zu unterbreiten. Ja, und hier offenbarte sich nun das, was ich vorhin Lydias einzigen Fehler nannte: Sie hielt nichts von den lebenden Dichtern.
„Wenn ich etwas Gutes lesen will, dann lese ich Goethe!“ sagte sie mit einem hoheitsvollen Blick, der dem Olympier alle Ehre gemacht hätte. „Liebes Kind“, versuchte ich sie zu belehren, „ich verehre diesen Dichter wie du - aber muss man denn gleich alle Veilchen ignorieren, nur weil es außer ihnen eine 'Königin der Nacht' gibt?“ - „Ein schönes Veilchen bist du!“ war ihre Antwort, und ich versank in düsteres Nachdenken...
Lydias Geburtstag stand vor der Tür. Da ich gerade verreist war, sandte ich ihr als sinniges Geschenk ein kleines Bändchen mit Gedichten von Goethe. Einige Tage später schrieb sie mir folgende Zeilen: „Lieber Ralph! Herzlichen Dank für den schönen Gedichtband! Natürlich hast Du mir damit eine große Freude gemacht - Du weißt ja, wie ich unseren Goethe verehre. Ich habe den Band schon mehrmals durchgelesen und bewundere immer wieder die Schönheit der Sprache, den herrlichen Fluss der Verse und die erstaunliche Tiefe der Gedanken. Ja, mein lieber Ralph, da kannst Du nicht mit. Lass das Dichten! Deine Lydia.“
Meine Antwort war sehr kurz: „Liebe Lydia! Da ich einmal wissen wollte, wie Du wirklich über meine literarischen Erzeugnisse denkst, habe ich Dir an Stelle des angekündigten Goethe-Bandes eine Sammlung meiner eigenen Gedichte gesandt und nur das Titelblatt ausgetauscht. Sei nicht böse! Dein Ralph.“
Merkwürdigerweise war Lydia furchtbar böse. Sie sagte zwar, sie habe mich nur necken wollen und selbstverständlich gleich gemerkt, dass die Gedichte nicht von Goethe sein konnten - aber irgendwie schämte sie sich doch. Schließlich konnte ich sie dadurch versöhnen, dass ich ihr einen neuen Roman von mir schenkte, der kürzlich erst im Druck erschienen war.
Gleichsam um sich für die frühere Schmach zu rächen, schrieb sie mir eine Woche später eine niederschmetternde Kritik: „Lieber Ralph! Dein Roman ist unmöglich! Wie kann man nur so taktlos sein, und dem Leser derartige Ehebrüche vor Augen führen! Dass solche Dinge sogar 'über Kreuz' gehen, finde ich geschmacklos. Und dann diese lächerlichen Tagebuchaufzeichnungen eines Backfisches! Das Ganze - besonders der Schluss, wo dieser Backfisch nebst dem 'reichen Baron im besten Mannesalter' in den Tod geht - erregt beim Leser ein mehr als peinliches Gefühl. Ich finde es kitschig. Das Beste, du verbrennst dieses Machwerk. Deine Lydia“.
Meine Antwort war wieder sehr kurz: „Liebe Lydia! Soeben merkte ich, dass ich Dir aus Versehen nicht meinen, sondern Goethes Roman 'Die Wahlverwandtschaften' gesandt habe. Das Titelblatt ist offenbar herausgefallen. Im Übrigen bin ich ganz Deiner Meinung. Dein Ralph.“
Von diesem Schlag hat sich meine Goethe-Kennerin nicht mehr erholt. Sie kündigte mir die Freundschaft, und ich sandte ihr als Abschiedsgruß ein Epigramm, welches tatsächlich von mir stammt:
Wer die lebenden Dichter nicht ehrt
Ist die toten zu lesen nicht wert!
Weibliche Logik (10.10.1955)
Eva lag im Paradiese,
hingestreckt auf grüner Wiese.
Adam war, wie er gesagt,
unterdessen auf der Jagd.
Eva harrte schon mit Bangen
seiner Rückkehr voll Verlangen.
Adam kam - welch tolles Stück -
erst um Mitternacht zurück.
Eva sprach: „Jetzt nicht gelogen:
schändlich hast du mich betrogen!“
Adam macht' es sich bequem
und fragt' schelmisch nur: „Mit wem???“
Eva wusste nichts zu sagen
und beendete das Fragen.
Adam schlief dann wie noch nie -
Seine Rippen zählte SIE (!).
Gertrud & Felix Ecke 1955
Farbengeflüster (5.1.1956)
Eine Schwarze nenn' ich mein:
So ein Mädel! Schick und fein!
Ihre Augen voller Glut,
machen meinem Herzen Mut.
Ach, und gar ihr Temp'rament
stürzt in Tollheit mich behend.
Lieb' ich je ein Mägdelein,
muss es eine Schwarze sein!
Eine Blonde ist mein Schwarm,
andre sind dagegen arm.
Das ist Leben! Das ist Licht!
Eine andre mag ich nicht.
So vertraulich, so diskret
ist die Kleine früh bis spät.
Wahres Glück - dies ist mein Schwur -
find' ich bei der Blonden nur!
Eine Braune lieb' ich sehr,
ach, wie keine andre mehr!
Sie stets such' ich weit und breit,
das ist wahre Seligkeit!
Ihre Blicke und ihr Kuss
sind für mich ein Hochgenuss.
Darum hört: Für meinen Sinn
ist die Braune Königin! -
So, jetzt denkt ihr: Dieser Wicht
nichts als lauter Lügen spricht!
Mal ist schwarz sein Typ, mal braun,
dann mal blond - hu, so viel Frau'n!
Dabei ist's - merkt es euch fein -
stets mein Frauchen nur allein:
Blond und braun und schwarz sogar
färbt sie manchmal sich das Haar...(!)
Faschings-Intermezzo (28.2.1957)
Hei, was war das für ein Jubel,
als mit maskenstarrer Miene
tanzten in dem Faschingstrubel
Pierrot und Colombine!
Sie - ein Engel, zierlich schwebend,
neckisch mit ihm kokettierend.
Er - den Reizen sich ergebend
und an Würde drum verlierend.
Pierrot hielt sie umschlungen
wie ein Trunk'ner die Laterne.
Colombine ward durchdrungen
von Gefühlen, die sonst ferne.
Und sie sangen, küssten, lachten,
ohne sich doch recht zu kennen.
Wie Herr Lohengrin sie dachten:
Wer wird seinen Namen nennen?
Aber ach: Die Masken fallen!
Die Beleuchtung wird ganz magisch.
„O mein Vater!“ hört man's lallen,
„Meine Tochter!“ klingt es tragisch.
„Wart, du halberwachs'ne Range,
werde dir schon Sitten lehren!“
Aber plötzlich wird ihm bange:
Wird sich „Mutter“ nicht beschweren?
Und so trennten sie sich fixe
mit verständnisvoller Miene.
Pierrot nahm eine Nixe,
einen Trapper Colombine...
Doch mit Fräulein Tochter zanken,
das kann Vater nicht mehr wagen.
Er verstummt bei dem Gedanken:
Wird sie es nicht „Muttern“ sagen?
Das Modell (1.3.1957)
Ein Frühlingserlebnis (aber nicht zum Nachahmen!)
Eigentlich wollte ich gar nicht darüber sprechen; denn ich riskiere, von zartfühlenden Leserinnen und seriösen Lesern als „frivoler Mensch“ betrachtet zu werden, obwohl ich das im Grunde ebenso wenig bin wie ein gewisser Grundmann, der lange Jahre mein Studienfreund war und völlig unschuldig ins Examen ging, wenn man sich auch nicht erinnern konnte, ihn jemals ohne Mädel gesehen zu haben. Der Schein trügt oft gewaltig und selbst in dem Falle, den der Welt zu berichten ich mich nunmehr entschlossen habe, ist es nicht anders.
Schuld war eigentlich der Frühling - genauer gesagt: der Frühlingsanfang! Am 21. März (das Jahr will ich verschweigen, denn ich möchte noch nicht für sooo alt gehalten werden) schlenderte ich durch die Parkanlagen in W. und war im Übrigen mit Wetter und Menschen sehr zufrieden. Mochte es nun am Frühlingsanfang gelegen haben oder daran, dass eben unbedingt etwas geschehen musste - jedenfalls ging plötzlich eine junge Dame an mir vorüber, die meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Banal empfindende Leute würden sagen, ich hatte mich auf den ersten Blick verliebt - aber das sind eben banal empfindende Leute. Ich war mehr als verliebt, ich war berauscht, in mir brannte ein Feuer auf - und vor allem: Ich hatte plötzlich einen ganz kühnen Unternehmungsgeist. Eine „tolle Sache“ wollte ich aufstellen. Und ich habe sie aufgestellt...
„Verzeihen Sie die Kühnheit, wenn ich Sie anspreche“, begann ich meine Komödie, „aber Sie sind das Ideal, das ich seit Langem suche.
Bitte, erschrecken Sie nicht! Ich bin nämlich Kunstmaler, und als ich soeben Ihre herrliche Figur sah - mit einem Wort, mein Fräulein: Möchten Sie mir Modell stehen?“
Es war wirklich von mir eine Kühnheit, so zu sprechen; denn meine Malfertigkeiten langten kaum hin, einen Gartenzaun anzustreichen, geschweige denn einen leibhaftigen Menschen auf Papier oder Leinwand zu bannen. Aber der Streich war begonnen, und als sich die entzückende junge Dame tatsächlich bereitfand, mir den erbetenen Dienst zu erweisen, habe ich leise - wie weiland Marcus Antonius - gemurmelt: „Unheil, du bist im Zuge, nimm welchen Lauf du willst!“
Mein Freund Leopold, ein leidenschaftlicher Amateur-Kunstmaler, machte erstaunte Augen, als ich ihm eröffnete, dass mich ein „Modell“ besuchen würde, und er solle mir doch seine Staffelei nebst Pinsel, Farben usw. überlassen. „Du kannst doch gar nicht malen!“ sagte er. „Das wird sich schon finden!“ gab ich zur Antwort und lief mit der Staffelei in meine Behausung.
Als mein Modell erschien, hatte ich etwas Lampenfieber. Was würde sie sagen, wenn der Schwindel herauskam? Es war mir unheimlich zumute, ich bekam Gewissensbisse, aber zu einem Geständnis fehlte mir der Mut. „Wollen Sie einen Akt malen?“ fragte mein Modell. „Um Himmels Willen!“ stieß ich hervor. „Also nur ein Porträt“, sagte sie kurz und setzte sich in Positur. Und nun geschah das Unglaubliche: Ich malte! Ich malte wie ein Besessener! Linien, Punkte, Striche - alles fügte sich zu einem bunten Gewirr zusammen. Nach einer Stunde beschaute meine Schöne das Bild, dann fiel ein Blick auf mich - zornsprühend und niederschmetternd. Ihre Stimme bebte:
„Sie! Sie wollen ein Maler sein? Sie...“ Da kam mir ein rettender Einfall: „Expressionismus, meine Dame! Reiner Expressionismus!“ „Oh, dann“, stotterte sie, „dann entschuldigen Sie bitte. Selbstverständlich komme ich morgen wieder!“
Und sie kam noch oft wieder. Aber als ich ihr dann eines Tages gestand, dass ich wirklich nicht malen könne, sagte sie nur: „Das habe ich gleich gewusst!“ Und noch heute frage ich mich, was sie wohl gemacht haben würde, wenn ich damals den Akt hätte malen wollen.
Der verhängnisvolle Koffer (7.3.1957)
Hand aufs Herz: Wenn Sie bei irgendeinem geselligen Beisammensein aufgefordert würden, die abenteuerlichste Begebenheit Ihres Lebens zu erzählen - würden Sie sofort, ohne die geringste Überlegung, beginnen können? Oder wäre es nicht vielmehr so, dass Sie lange darüber nachdenken müssten, was nun eigentlich „abenteuerlich“ war? Das Abenteuerliche ist in unserem Leben nämlich ganz, ganz selten, und auch ich würde jetzt nichts zu berichten haben, hätte ich damals das Buch Sirach gelesen, wo es im 9. Kapitel, Vers 4, bekanntlich heißt: „Gewöhne dich nicht zu der Sängerin, dass sie dich nicht fange mit ihren Reizen!“
Ja, und da bin ich schon mitten im Strudel der Ereignisse. In M. standen vor etwa 30 Jahren zwei Namen lange Zeit hindurch im Mittelpunkt jeglichen Interesses. Ich meine die gefeierte Opernsängerin Martina Beck und einen gewissen Hofrat Stössel, welche miteinander ein „Techtelmechtel“ hatten, über das sich seinerzeit ganz M. amüsierte. Nun wird man fragen, was die Beziehungen zwischen der ehrenwerten Opernsängerin Beck und dem noch ehrenwerteren Hofrat Stössel eigentlich mit dem Abenteuer, das ich hier erzählen möchte, zu tun haben. Zweifellos ist eine solche Frage verständlich; denn mit meinen neunzehn Lenzen, die ich damals zählte, hatte ich wohl keinen Anspruch darauf, mit Honoratioren der Stadt in einem Atemzug genannt zu werden.
Martina Beck war für die männlichen Backfische (und Neunzehnjährige fallen durchaus unter diesen Begriff) eine Art höheres Wesen. Wir vergötterten sie. Nun weiß ich nicht mehr, wie es kam - jedenfalls hatte ich den jugendlichen Vorsatz gefasst, sie persönlich kennenzulernen. Eine Menge Lieder, die ich geschrieben hatte (heute sind sie alle längst verbrannt!), packte ich in einen Koffer und ging zu ihr. Ich hatte Glück: Martina war zu Hause. Ohne mich lange bei der Vorrede aufzuhalten, kramte ich meine Noten, Texte usw. heraus, und die große Sängerin schien tatsächlich an meinem unbefangenen Gebaren einigen Gefallen zu finden.
Gerade wollte ich ihr voller Stolz mein erstes Lied vorspielen, als ihr ein anderer Besuch gemeldet wurde: Hofrat Stössel! Schnell komplimentierte sie mich zum Hinterausgang hinaus, sagte, meinen Koffer solle ich später abholen und murmelte etwas von krankhafter Eifersucht des Hofrats. Inzwischen trug sich bei Martina Beck jener Vorfall zu, welcher die Gemüter sehr lange in Aufregung gehalten hat: Hofrat Stössel erlitt bei dem Schäferstündchen einen Herzschlag! Martina, die angesichts der eindeutigen Situation mit Recht befürchten musste, dass nun die Ehegattin Stössels, ihre Freundin, das ganze ehebrecherische Verhältnis erkennen würde, fasste den Entschluss, den ihr so peinlichen Tod des Hofrats zu vertuschen. Ohne lange Überlegung packte sie den Verstorbenen in - meinen Koffer, und mit Hilfe einer verschwiegenen Kollegin wurde dieser im Fluss versenkt. (Dass sie hierbei eine Stelle aus „Rigoletto“ parodiert und geträllert haben soll: „Ein Fluss zu seinem Grabe, ein alter Koffer zu seinem Leichentuche!“, wie es später die Presse berichtete, halte ich für eine Übertreibung.)
Leider - oder vielmehr: Gott sei Dank - wurde der Koffer, welcher meine genaue Anschrift enthielt, mit seinem sonderbaren Inhalt bereits am anderen Morgen entdeckt, und unverzüglich erfolgte meine Verhaftung. „Sie stehen unter Mordverdacht!“ sagte mir der Kriminalbeamte. Ich glaubte, nicht recht gehört zu haben. Als ich Martina Beck als diejenige angab, bei welcher ich meinen Koffer gelassen hatte, wurde auch sie verhaftet - als meine „Komplizin“! Noch während ihrer Vernehmung traf der mit Spannung erwartete Sektionsbefund ein, welcher lautete: Natürlicher Tod durch Herzschlag. Martina Beck und ich wurden entlassen...
Die Zeitungen haben dann noch viel über den Fall geschrieben, man erging sich in allerlei Einzelheiten über das Verhältnis zwischen der großen Sängerin und dem Hofrat - mich hat man nicht für würdig befunden, auch nur einmal zu erwähnen. Ich war ein Staubkorn, das hinausgeblasen wurde, weil es das Buch Sirach nicht gelesen hatte.
April! April! (17.3.1957)
Es war nicht so einfach, ein Mädel wie Sabine in den April zu schicken. Sabine war nämlich trotz ihrer achtzehn Jahre so pfiffig wie ein Mann von Mitte Dreißig, und das will viel besagen. Noch nicht ein einziges Mal war es mir gelungen, sie mit irgendetwas zu foppen. Mein Unterfangen, am 1. April hierin einmal Wandlung zu schaffen, musste nach den bisherigen Erfahrungen als aussichtsloses Beginnen erscheinen. Und dennoch...
Also es war - wie gesagt - der 1. April. Ein schöner Frühlingstag ging zu Ende, die letzten Sonnenstrahlen breiteten eine wohlige Wärme aus, Sabine und ich saßen auf einer einsamen Bank am Teich, und wir verloren uns tiefsinnig in nichtssagende Gespräche. Etwas Abwechslung in das Ganze brachte eine Schar großer Stechmücken, die besonders Sabine (offenbar ihres süßen Blutes wegen) schwer zu schaffen machten. Diese Stechmücken waren für mich der Anlass, einige zoologische Kenntnisse anzubringen, und plötzlich tauchte in mir der Gedanke auf, die Mücken für einen Aprilscherz zu benutzen.
„Diese Art von Stechmücken sind äußerst gefährlich“, sagte ich zu Sabine, „sie haben ein stark wirkendes Gift, und wenn man von ihnen gestochen wird, muss man sofort die Wunde aussaugen.“ Sabine lächelte zwar über diese Erklärung, doch kurze Zeit später wurde sie ängstlich. „Du“, sagte sie etwas aufgeregt, „das war doch nur Spaß, was du vorhin gesagt hast?“ „Nein, Sabine. Im Übrigen sind diese Insekten allgemein bekannt.“
Sabine wurde etwas verlegen: „Ich glaube, eben hat mich eine gestochen.“ „Dann saug schnell die Wunde aus!“ riet ich ihr hastig. „Das kann ich nicht“, flüsterte Sabine, „es ist nämlich hier.“ Dabei rieb sie eine Stelle, welche - mit Verlaub zu sagen - zwei Handbreit über dem linken Knie lag. „Dann muss ich es tun, Sabine, mach schnell!“ - und schon ging ich an die Verwirklichung des vorhin verratenen Rezeptes...
Als ich mich geraume Zeit später von Sabine vor ihrer Haustür verabschiedete, konnte ich mich eines langunterdrückten Ausrufes nicht enthalten. „April! April!“ rief ich ihr zu. „Wieso?“ fragte sie verständnislos. „Ach, Sabine“, lachte ich, „das mit den Mücken war doch nur ein Scherz: Sie sind nämlich gar nicht giftig!“ Ich lachte aus vollem Halse. Aber plötzlich war es Sabine, welche losprustete: „April! April!“ „Wieso?“ fragte ich verdutzt. Sie setzte ein schelmisches Lächeln auf: „Es hat mich ja gar keine gestochen!“ Und schon fiel die Tür ins Schloss. Unter uns gesagt: Eigentlich freue ich mich, dass ich es war, der in den April geschickt wurde.
La Belle Yvonne (17.3.1957)
Für unsere Kleinstadt war es schon ein Ereignis, als das Auftreten einer Solotänzerin aus Paris angekündigt wurde. „La Belle Yvonne“ stand mit leuchtenden Buchstaben auf allen Plakaten, die Zeitungen brachten werbende Vorberichte, die Bürger des Städtchens sprachen seit Tagen von nichts anderem, kurz: Eine ganze Stadt lag im Fieber. Kein Wunder, dass sehr bald nach Beginn des Vorverkaufs die Vorstellung ausverkauft war. Zahlreiche Kunstenthusiasten, darunter auch ich, hatten das Nachsehen, weil sie eine so stürmische Nachfrage bei allem Optimismus nicht erwartet hatten.
So kam es, dass ich an dem besagten Abend - eine Stunde vor Beginn der Vorstellung - mit einigen Freunden im Ratskeller saß, wo wir versuchten, unsere Sorgen bei einigen Flaschen Riesling zu vergessen. „Zu dumm“, sagte Leopold, „dass wir die Yvonne nicht sehen können.“ - „Ich habe alles versucht“, meinte Ludwig, „sogar mit der Theaterdirektion habe ich gesprochen - alles vergeblich. Nicht eine Karte gäbe es, und wenn ein indischer Maharadscha käme!“ - „Zu dumm“, sagte Leopold noch einmal, dann folgte eine bedrückende Stille.
Inzwischen hatte der Wein mein Blut in Wallung gebracht. „Wir kommen hinein!“ rief ich. Ein Gelächter war die Antwort. „Wetten, dass wir hineinkommen?“ fragte ich mit gehobener Stimme. Die Freunde schienen Spaß zu verstehen, sie setzten eine Flasche Riesling, auszustechen nach der Vorstellung. „Es gilt!“ sagte ich. Und schon zogen wir guten Mutes zum Theater. Am Bühneneingang, wo ich meinen Freunden zu warten gebot, ließ ich den Portier rufen. In gebrochenem Deutsch erklärte ich ihm, dass ich aus Paris sei und unbedingt vor der Vorstellung noch die Künstlerin sprechen müsste. Dienstfertig verschwand er, um mich bald zu der gefeierten Tänzerin zu führen.
Mein Plan war folgender: Ich wollte mich mit Hilfe einiger von der Schule haftengebliebener französischer Vokabeln entschuldigen und La Belle Yvonne inständig bitten, für meine beiden Freunde und mich wenigstens Stehplätze anweisen zu lassen. Mehr als Nein sagen konnte sie ja nicht, und ich riskierte eigentlich gar nichts. Es kam aber völlig anders: Im Künstlerzimmer angelangt, stand ich Yvonne gegenüber. Sie war das Urbild einer tänzerischen Schönheit. Einstweilen möge jedoch die Bemerkung genügen, dass ihre Augen schwarz und ihre Lippen rot waren.
„Pardon, Madame!“ stotterte ich, doch sie unterbrach mich hastig: „Bitte, lieber Freund, hören Sie mich an: Ich weiß, Sie kommen aus Paris, der Portier hat es mir gesagt - aber erfüllen Sie mir um Himmels Willen den einen Wunsch und verraten Sie mich nicht! Niemand braucht zu wissen, dass ich nicht Französisch kann und noch nie in Paris war. Ich stamme nämlich aus Kötzschenbroda. Ach, lieber Freund, durch Sie könnte jetzt alles herauskommen - bitte, ich will alles für Sie tun! Sagen Sie, was Sie von mir wollen!“
„Drei Plätze in der Loge!“ sagte ich mechanisch. La Belle Yvonne lächelte, schrieb etwas auf einen Zettel, gab ihn mir und flüsterte: „Gehen Sie hiermit zum Portier! Er wird Sie in die Loge geleiten.“ Dann fügte sie geheimnisvoll hinzu: „Wenn Sie wollen, können Sie mich nach Schluss der Vorstellung am Bühnenausgang erwarten.“ Ich verneigte mich höflich und ging.
Meine Freunde glaubten zu träumen, als sie mit mir von dem freundlichen Portier in die Loge geführt wurden. „Wie hast du das angestellt?“ fragte Leopold, doch ich legte ermahnend den Finger auf den Mund; denn soeben hob sich der schwere Bühnenvorhang, und La Belle Yvonne begann zu tanzen. Ich lächelte, blickte genießerisch auf La Belle Yvonne, die soeben zu tanzen begann, und raunte überlegen: „Fremdsprachen muss man können!“
Die Spröde (21.3.1957)
Sie saß ganz keusch mit einem Buch
im Park auf einer Bank.
Er hob ihr auf das Taschentuch,
da sprach sie: „Vielen Dank!“
Er sagte: „'s wird bald Frühling sein.“
Sie nestelte am Schuh.
Er blickte in ihr Buch hinein,
da klappte sie es zu.
Er rückte sacht in ihre Näh'.
Sie wandte sich ihm ab.
Er fasste ihre Hand - doch jäh
fühlt' er ein Fäustchen. Klapp!
Jetzt wagte er den letzten Streich
und sprach: „Ich liebe Sie!“
Sie sagte ihm: „Das ist mir gleich,
ich selber liebe nie!“
Da stand er auf (nicht grade froh)
Und sprach, wie's oft der Brauch:
„Verzeihen Sie: Ich tat nur so!“
„Ich auch, mein Herr - ich auch!“
Die kalte Dusche (31.3.1957)
Der D-Zug Erfurt-Berlin war bis auf den letzten Platz besetzt. Auch das Abteil, in welchem ich glücklicherweise einen Sitzplatz erhalten hatte, war „komplett“, und ich machte mir aus purer Langeweile Gedanken über die Fahrgäste.
Über einen konnte ich mir allerdings nicht klarwerden, und dieser saß mir direkt gegenüber. Es war eine junge Dame, wie man sie in manchen Magazinen abgebildet sieht, aber zugleich mit einem Esprit verratenden Charme, welcher nur wenige weibliche Schönheiten auszeichnet. Ihre Kleidung war dezent und geschmackvoll, lange braune Haare fielen mädchenhaft anmutend über beide Schultern, eine zierlich geformte Nase brachte die geschwungenen Lippen noch mehr zur Geltung, und Augen führten die Herrschaft über das Ganze - Augen wie die eines Engels!
Ich hätte stundenlang dieses Bild, das ich mit der Sixtinischen Madonna verglich, betrachten mögen, aber plötzlich unterbrach der Kellner des Zuges meine Andacht. „Zigaretten? Keks? Schokolade?“ Alle schüttelten die Köpfe.
„Mein Fräulein“, sagte er zu meinem Idol, „ein paar Fruchtbonbons gefällig?“ Und nun geschah etwas Furchtbares: Die Sixtinische Madonna öffnete ihren Mund und sagte in einer Sprache, die offenbar eine Mischung von Sachsen, Thüringen und Mansfelder Land darstellte: „Nä, danke scheen! Ich nähme nischt!“
Auf mich wirkten diese Worte wie eine kalte Dusche. Wie war so etwas möglich? Auch fühlte ich, dass ich nicht der einzige war, welcher jäh enttäuscht wurde; denn man blickte allgemein erstaunt auf die junge Dame.
Schade, dachte ich, wenn man ihr doch helfen und sie auf diesen empfindlichen Widerspruch aufmerksam machen könnte! Der Kellner wandte sich an mich: „Eine Zigarre, mein Herr?“ - Jetzt oder nie! dachte ich und sagte laut, indem ich die Schöne vorwurfsvoll ansah: „Nä, danke scheen! Ich nähme nischt!“ Alle lachten. Sie aber hüllte sich in Schweigen.
In Berlin stiegen wir aus. Nach Verlassen des Abteils trat sie an meine Seite und flüsterte: „Also einerseits warn Se mir ähjentlich sympathisch, awwer Ihre Sprache - nä, das hätt'ch nich jedacht!“
Ich fühlte mich wie vor den Kopf geschlagen. Und da mir die hübsche Dame wieder zu gefallen anfing, antwortete ich im reinsten Hochdeutsch: „Meine Aussprache ist nicht so schlecht, wie Sie annehmen, aber ich wollte Ihnen einmal vorführen, wie Sie sprechen, mein Fräulein. Es ist wirklich schade, dass Sie einen solch entstellenden Fehler haben. Man sollte sich nicht so gehen lassen.! Übrigens bin ich Schriftsteller, mein Name ist Ralph Wiener.“ Ich machte eine kleine Verbeugung.
Wer aber beschreibt min Erstaunen, als die Schöne ebenfalls im reinsten Hochdeutsch erwiderte: „Das leuchtet mir ein. Und wie Sie hören, kann ich genau wie Sie sprechen. Ich bin nämlich Schauspielerin.“
Verblüfft starrte ich Sie an. „Warum haben Sie sich dann so seltsam benommen?“ fragte ich. Die Künstlerin lächelte. „Erinnern Sie sich, wie Sie vorhin im Zug saßen: Hemd halb offen, Kopf auf Ihrer Nachbarin, Hände in den Taschen, Füße unter meinen Sitz gestreckt - da wollte ich es Ihnen mal gleichtun. Übrigens: Heute Abend spiele ich die Emilia Galotti: ich werde für Sie eine Karte an der Abendkasse hinterlegen lassen.“ - „Vielen Dank!“ erwiderte ich und lüftete meinen Hut. Kurz vor der Sperre drehte sie sich noch einmal um: „Komm Se awwer nich zu schpäte; denn bevor Se nich da sin, fang ich jar nich erscht an!“- Und merkwürdig: Diesmal wirkten ihre Worte nicht wie eine kalte Dusche, sondern wie ein lieber, vertrauter Gruß...
Redaktionelle Anmerkung: Die letzten drei Abschnitte sind im Buch „Kein Wort über Himbeeren“ weggelassen.
Ein netter Film (9.4.1957)
„Also Sie wollen mit meiner Tochter ins Kino gehen“, sagte Herr Stauffenbach und setzte sich behaglich im Lehnstuhl zurecht, „ich habe zwar im Grunde nichts dagegen einzuwenden - junge Leute sollen sich auch einmal vergnügen, und „Dreizehn Stühle“ soll ja ein netter Film sein - aber ich muss Sie bitten, Eva pünktlich nach Schluss der Vorstellung hier wieder bei mir abzuliefern.“ - „Das wird selbstverständlich geschehen“, versicherte ich und machte eine tiefe Verbeugung.
In diesem Augenblick trat Frau Mama ein. „Aber Gustav, du wolltest doch Herrn Wiener für heute Abend zu einer Tasse Tee einladen!“ Und gleich darauf wandte sie sich an mich: „Bitte, kommen Sie nach dem Kino ruhig noch auf ein Stündchen mit vorbei!“ „Vielen Dank“ stotterte ich, mich nochmals verbeugend, und dann durfte ich mit Eva enteilen.
Es war das erste Mal, dass ich mit Eva in ein Kino ging, obwohl wir uns schon vier Monate kannten. Wir sagten sogar noch „Sie“ zueinander. Der Leserwird das nicht glauben, aber ich erinnere an meinen Kollegen, den Dichter Wieland, der seiner Braut nach vierjähriger Bekanntschaft zum ersten Mal die Hand zu küssen wagte - was bin ich gegen ihn für ein Draufgänger!
Nun saß ich mit Eva in der letzten Logenreihe. Der Saal war bereits in Dunkel gehüllt, ein Vorfilm hatte begonnen. Während ich das Publikum überblickte, fiel mir die Geschichte von jenem Witzbold ein, der gewettet hatte, dass auf einen Satz, den er die Platzanweiserin laut ausrufen lassen wollte, ungefähr zweihundert Herren heimlich durch den Notausgang verschwinden würden. Leise erzählte ich Eva den Scherz. „Und was hat er ausrufen lassen?“ fragte sie flüsternd. Ich näherte meinen Mund ihrem Ohr:
„Der Herr, welcher mit seiner Freundin hier ist, wird gewarnt - seine Frau steht draußen!“ Eva lächelte und sah mich an. Da nahm ich ihre Hand und ließ sie bis zum Schluss der Vorstellung nicht mehr los...
„Nimm dich in Acht“, sagte sie auf dem Nachhauseweg, „dass du dich nicht versprichst; bei uns musst du wieder 'Sie' zu mir sagen!“ - „Du auch!“ sagte ich, und wir schmunzelten. „Na, wie war denn eigentlich der Film?“ fragte Herr Stauffenbach, nachdem wir uns gemütlich zum Tee niedergelassen hatten. „Großartig“, sagte ich, „also dieser Heinz Rühmann...“ - „Und diese dreizehn Stühle...“, schloss sich Eva an. „Hab'n wir gelacht!“ riefen wir schließlich beide und dann spielten wir tatsächlich einige Szenen vor. „Köstlich, köstlich!“ jubelte Herr Stauffenbach. „Entzückend!“ flötete Frau Mama.
Alles wäre gut gegangen, wenn nicht Tante Clärchen gekommen wäre. „Ach, da sind ja die jungen Leute! Ich habe sie doch vorhin im Kino gesehen.“ -- „Du warst auch im Kino?“ schmunzelte Herr Stauffenbach, „na, da kannst du uns ja sagen, ob die Beiden alles richtig nachspielen.“ Und erklärend fügte Frau Mama hinzu: „Sie haben uns nämlich soeben den ganzen Film 'Dreizehn Stühle' vorexerziert. Ach, ich muss jetzt noch lachen - also dieser Heinz Rühmann...“
„Heinz Rühmann?“ fragte Tante Clärchen. „Na ja“, erwiderte Frau Mama, „der Film war doch mit Heinz Rühmann.“ Tante Clärchen sah skeptisch in die Runde: „Also das ist doch - na, jedenfalls haben sie 'Der blaue Engel' gespielt. Der Heinz-Rühmann-Film 'Dreizehn Stühle' läuft erst ab morgen...“
Weder Herr Stauffenbach noch Frau Mama konnten sich erklären, wieso wir einen anderen Film gesehen hatten als Tante Clärchen, obwohl wir zur gleichen Zeit im selben Kino gesessen hatten. Vielleicht lösen Sie dieses Rätsel, teurer Leser?
Rapunzelöl (11.4.1957)
Der Gemischtwarenhändler Sebastian Habermann in Wuppertal rieb sich ächzend den Schweiß von der Stirn. Dieser ältere Herr, der da vor ihm stand, war heute schon der neunte Kunde, welcher das vermaledeite Rapunzelöl verlangte - eine Neuheit, die offenbar alle Köpfe seiner Kundschaft verrückt machte und die er bisher noch nicht bei sich eingeführt hatte.
„Bedaure, Rapunzelöl führe ich nicht“, sagte er mit verzweifelter Miene, während bereits eine junge Dame seinen Laden betrat. „Bitte, drei Flaschen Rapunzelöl!“ flüsterte sie. Sebastian Habermann schüttelte schwergeprüft sein Haupt. Die junge Dame und der ältere Herr gingen enttäuscht hinaus.
Noch während sich Sebastian Habermann dem reuevollen Gedanken hingab, warum er eigentlich kein Rapunzelöl bestellt habe, und in allen Katalogen vergeblich nach der Firma suchte, die dieses Öl liefern würde, betrat eine stattliche Frau mit zwei großen leeren Koffern den Laden. „Guten Tag! Sind Sie Herr Habermann?“ „Gewiss, meine Dame, Sie wünschen?“ „Ich möchte für unser Pflegeheim zwei größere Posten Rapunzelöl kaufen, und Sie möchten so freundlich sein und...“ Weiter kam sie nicht; denn Sebastian Habermann war auf seinem Hocker zusammengebrochen.
Als er wieder zu sich kam, ging er die Sortimentslisten seiner sämtlichen Lieferanten durch - keiner führte Rapunzelöl. Ein Herr in mittleren Jahren betrat den Laden. „Wollen Sie etwa auch Rapunzelöl?“ fragte Sebastian Habermann verzweifelt. Der Herr in mittleren Jahren lächelte. „Ich? Nein. Aber wenn Sie etwas wollen, Herr Habermann - ich komme nämlich von der Firma Redlich & Co. Wir bieten Ihnen erstklassiges Rapunzelöl an. Sie erhalten die Flasche zum günstigsten Einkaufspreis von vier Mark achtundneunzig.“
„Rapunzelöl!“ rief Sebastian Habermann aus. „Sie kommen wie gerufen, wir schließen sofort ab!“ Der Herr in mittleren Jahren witterte Morgenluft. „Die Mindestmenge beträgt allerdings fünfhundert Stück“, sagte er, „und fünfzig Prozent müssten Sie anzahlen.“ „Mit Vergnügen, Herr, mit Vergnügen!“ jubelte Sebastian und schloss ab.
In den nächsten Tagen und Wochen saßen außer Sebastian Habermann dreiundsiebzig Gemischtwarenhändler der Stadt auf ihrem Rapunzelöl, ohne auch nur ein Fläschchen zu verkaufen. Sie wussten nicht, warum kein Kunde mehr nach Rapunzelöl fragte. Sie konnten es auch nicht wissen. Denn jene elf Personen, die an dem fraglichen Tage bei vierundsiebzig Gemischtwarenhändlern so beharrlich Rapunzelöl verlangt hatten, waren Angestellte von Redlich & Co.
Sieben Tage hat die Woche (11.4.1957)
Lange, sehr lange musste ich bei Doris klingeln, bis sie mir endlich öffnete. Ihre Haare waren nur flüchtig geordnet und etwas aufgeregt war sie scheinbar auch. Klaus, du bist schon von der Reise zurück? Wir haben doch erst Montag - ich denke, du wolltest...“ - „Na, freust du dich denn gar nicht?“ unterbrach ich sie. „O doch“, kam es zögernd von ihren Lippen, „aber ich habe gerade Besuch - ein Kollege, weißt du.“ - „So, ein Kollege. Also dann will ich mir mal deinen Kollegen ansehen!“ Und wir begaben uns in die Wohnung.
Der Kollege hatte sich bei meinem Eintritt erhoben, und Doris stellte uns gegenseitig vor. „Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen!“ versicherte er mir; ich erklärte, dass die Freude ganz auf meiner Seite wäre. Dann nahmen wir Platz und tranken Kaffee. Hierbei wurde mein anfänglicher Verdacht, dass Doris mich mit diesem Kollegen betrog, zur Gewissheit.
Was sollte ich tun? Ich stand vor der im Leben häufig auftretenden, aber immer wieder schwer zu lösenden Frage, wie man sich benimmt, wenn man seine Geliebte in flagranti erwischt. Heute, wo dieses Ereignis weit in der Vergangenheit liegt, kann ich mit Stolz behaupten, dass ich das erwähnte Problem wie ein Weltmann gelöst habe.
Ich tat nämlich folgendes: Als ich merkte. wie sehr meine plötzliche Rückkehr die beiden Ertappten deprimiert hatte, stand ich auf, sagte ihnen, dass ich den Eindruck hätte, sie liebten sich, und dass ich es nicht verantworten könne, noch länger ihr Glück zu stören. Sie widersprachen zwar heftig, doch ließ ich mich nicht beirren. Nachdem ich das Zimmer verlassen hatte, schloss ich die Tür ab und ging meiner Wege.
Am nächsten Tage (es war Dienstag) brachte ich ihnen eine genügende Menge Proviant mit. Sie dankten mit dem Hinweis, das wäre gar nicht nötig, und schienen überhaupt nicht bemerkt zu haben, dass sie eingeschlossen waren. Am Mittwoch lächelten sie noch immer, und als ich sagte, ich würde die Tür wieder verschließen, meinten sie: „Das stört uns gar nicht!“
Am Donnerstag brachte ich ihnen Champagner, Krebs-Mayonnaise und Milchsemmeln. Sie freuten sich sehr darüber. Am Freitag lächelten sie sich nicht mehr so freundlich an und fragten, wozu ich eigentlich jedes Mal die Tür verschließe, wenn ich ginge. Am Sonnabend hatte ich nicht mehr den Eindruck von einem Liebespaar, sondern von zwei Menschen, die sich gleichgültig sind und sich offenbar langweilen.
Am Sonntag war die Hülle geplatzt. Der „Kollege“ schrie mich an: „Lassen Sie mich hinaus! Ich kann diese Frau nicht mehr sehen! Sieben Tage hocken wir hier zusammen - morgen hängen wir uns auf!“ Lächelnd gab ich die Tür frei: „Bitte sehr!“ Mit einem Satz war er entschwunden, und weder Doris noch ich haben ihn jemals wiedergesehen.
Den Männern aber, die im Begriff sind, gehörnt zu werden, rufe ich zu: Bewahrt Haltung! Rennt nicht gegen das Schicksal an! Verhindert Blutvergießen! Und vergesst niemals den kleinen Zauberspruch: Sieben Tage hat die Woche!
Brandmaier gegen Brandmaier (12.4.1957)
Nichts geht über Bayern. Im Amtsgericht Oberwieselbach herrschte Hochbetrieb: Sechs Strafsachen standen zur Verhandlung, und Amtgerichtsrat Weinzierl war in höchster Aufregung; denn es war schon neun Uhr und der Schöffe Toni Brandmaier noch immer nicht erschienen. „Wenn Herr Brandmaier kommt“, sagte er zum Wachtmeister Banzl, „schicken Sie ihn sofort zu uns ins Beratungszimmer!“ - „Sehr wohl, Herr Amtgerichtsrat!“ machte Banzl und salutierte.
Als der wegen gefährlicher Körperverletzung in Verbindung mit Rauferei angeklagte Sepp Brandmaier das Gerichtsgebäude betrat, ahnte er nicht, was für eine bedeutende Rolle er in der Geschichte des Amtsgerichtes Oberwieselbach spielen sollte. „Mein Name ist Brandmaier“, sagte er zum Wachtmeister Banzl, welcher ihm freudig die Hand schüttelte. „Grüeß Ihna, Herr Brandmaier! Der Herr Rat hat schon auf Sie g'wartet. Bitt'schön, kommen S' mit!“
Im Beratungszimmer erhob sich Amtgerichtsrat Weinzierl: „Na, endlich, Herr Brandmaier! Wo waren Sie denn so lange?“ „Entschuldigen S', Herr Rat, aber mei Weib, dös Malefiz-Frauenzimmer, hot mi unbedingt noch so a paar überflüssige Maßregeln mitgeb'n wolln - na, und wann so a Weiberl erst im Schwafeln is, do hört's nimmer auf.“
„Schon gut, Herr Brandmaier“, unterbrach der Gerichtsrat, „aber merken Sie sich: Das Amt eines Schöffen erfordert Pünktlichkeit, und da Sie nun einmal Schöffe sind...“ „Aber Herr Rat, i bin doch halt...“ „Genug der Entschuldigungen, Herr Brandmaier! Wir sind stark im Rückstand und müssen sofort mit der Sitzung beginnen, wenn wir zeitig zum Essen sein wollen.“ Damit führte er die beiden Schöffen in den Sitzungssaal, wo unverzüglich die Verhandlungen begannen.
Sepp Brandmaier machte seine Sache großartig, und alles ging gut, bis seine eigene Angelegenheit aufgerufen wurde. „Rufen Sie den Angeklagten Brandmaier herein!“ sagte der Rat zum Wachtmeister Banzl. „Der Angeklagte Brandmaier!“ rief Banzl in den Flur. Es erschien niemand. „Eine Unverschämtheit!“ donnerte Weinzierl und ergänzte: „Wenn dieser Brandmaier kommt, packen Sie ihn beim Kragen und befördern ihn unverzüglich herein!“ Banzl salutierte.
Inzwischen war - was des Öfteren vorkam - ein Instrukteur vom Ministerium erschienen, welcher die Amtsgerichte inspizierte und auch ab und zu den Verhandlungen beiwohnte. Er nickte dem Amtgerichtsrat gönnerhaft zu und nahm auf einer Zuhörerbank Platz. Alles klappte wie am Schnürchen, und Weinzierl rieb sich froh die Hände.
Zum Unglück war jedoch der echte Schöffe Brandmaier, der wegen eines versäumten Zuganschlusses verspätet in Oberwieselbach eingetroffen war, inzwischen bei Banzl erschienen, welcher ihn, nachdem er nur seinen Namen gehört hatte, ohne alle Formalitäten befehlsgemäß beim Kragen nahm und in den Sitzungssaal schleppte. „Hier is der Brandmaier, der G'sottene!“ rief er und drückte den völlig Überraschten auf die Armesünderbank.
„Ich protestiere!“ wagte dieser auszurufen, doch da hatte er nicht mit der Verschlagenheit seines Namensvetters gerechnet, der sofort die Situation erfasste und ihm energisch in die Parade fuhr: „Sie ham gor nix zu protestieren, Sie Pfundshammel, pfundiger! Erst lassen S' das G'richt warten und dann noch daherreden - ja, gibt's denn dös a? Aber Ihna werd'n wir's Mäu stopfen, gölns, Herr Rat?“ Amtgerichtsrat Weinzierl nickte. „Und überhaupt“, fuhr der Schöffe in seiner Brandrede fort, „was san denn Sie für a Früchterl? Körperverletzung! Rauferei! Dös is gegen unsere Parigafen! Mir san a friedlicher Staat, Sie Haderlump, Sie!“
Nach diesen kräftigen Worten hatte sich der im Zuhörerraum weilende Instrukteur erhoben und zum Richtertisch begeben. „Bravo!“ rief er. „Wirklich ausgezeichnet! Solche Schöffen brauchen wir, Herr Amtgerichtsrat! Ich werde beim Ministerium erwirken, dass dieser Herr Schöffe in die gehobene Beamtenlaufbahn aufgenommen wird.“
Wieder schien für den unechten Schöffen alles gut zu gehen, doch da nahte endgültig das Unheil: Seine Frau kam nämlich in den Gerichtssaal gestürzt, eilte nach einem kurzen Blick auf ihn zu, indem sie ihn anschrie: „Mannsbild, verrücktes! Hob' i dir net sauber aufg'schrieb'n, wie's dich verteid'gen sollst? Un da loßt's den Zettel einfach daham liegen, damit s' di hier wegen der Rauferei, der miserablen, nur gnua aufdrucken!“ Mit diesen Worten warf sie einen Fetzen Papier auf den Richtertisch.
Amtgerichtsrat Weinzierl blickte erst seinen „Schöffen“ an, dann zum Angeklagten. Dieser erhob sich langsam von der Armesünderbank und sagte mit schüchterner Stimme: „I hob' ja immer sag'n wolln, dass i net der Sepp Brandmaier bin.“ „Na, wer sind Sie denn nun?“ fragte der Instrukteur. Verzweifelt sank der Angeklagte wieder auf seine Bank und seufzte: „Der Toni Brandmaier.“ „Die Sitzung ist geschlossen!“ verkündete Amtgerichtsrat Weinzierl und führte den Instrukteur in sein Amtszimmer...
Freitag, der Dreizehnte (13.4.1957)
„Heute gehe ich nicht aus dem Hause“, sagte Frau Marianne eines Morgens zu ihrem Gatten, „wer weiß, was passieren kann.“ „Wie kommst du denn darauf?“ fragte Adolar. „Hast du noch nicht auf den Kalender gesehen? Heute ist Freitag, der 13.!“ belehrte ihn Frau Marianne. „Na, und?“ „Was heißt 'Na und'? Freitag, der 13. bedeutet Unglück. Da geht man am besten gar nicht aus dem Haus.“
Adolar sah seine bessere Hälfte etwas vorwurfsvoll an. „Dass ich nicht lache! Wegen eines solchen lächerlichen Aberglaubens willst du den ganzen Tag im Zimmer hocken? Als ob dich nicht auch hier in der Wohnung ein Unglück treffen könnte!“ „Gib dir keine Mühe, Adolar! Es ist Freitag, der 13. - da bleibe ich zu Hause, sonst gibt es ein Unglück.“ „Und heute Abend? Du weißt, dass ich zwei Karten fürs Kabarett besorgt habe.“ „Von mir aus geh allein, mich kriegst du nicht aus dem Haus!“ „So ein Blödsinn!“ rief Adolar und ging ins Büro.
Am Abend rief er Frau Marianne an: „Also was ist? Gehen wir ins Kabarett?“ „Aber Liebling, heute ist doch Freitag der 13, und wenn man da aus dem Hause geht...“ Wütend hängte Adolar auf und beschloss, allein ins Kabarett zu gehen. An dem Tisch, wo er sich niedergelassen hatte, saß Nelly. Sie hatte die Beine übereinander geschlagen und in dem Augenblick, als sich Adolar ihrem Tisch näherte, schnell noch etwas Rouge aufgelegt. Das Kabarettprogramm umfasste zwölf Nummern. Bei Nummer drei wechselten sie die ersten Worte. Bei Nummer sechs bestellte er für sie einen Sherry. Bei Nummer acht legte sie ihre Hand in die seine. Bei Nummer zehn sagten sie sich „du“. Bei Nummer zwölf wusste er, dass er sie nach Hause bringen durfte...
Gegen drei Uhr morgens betrat er das eheliche Schlafzimmer. Frau Marianne sah ihn glücklich an: „Siehst du, Liebling, ich habe doch recht gehabt, dass ich nicht aus dem Hause gegangen bin - es ist kein Unglück passiert!“ „Du hast immer recht, Schatzi!“ meinte Adolar. Und Frau Marianne wunderte sich, warum er plötzlich nichts mehr gegen Aberglauben hatte...
Gelegenheit macht Liebe (7.6.1957)
Er war sehr vornehm und konnte es sich leisten, wochenlang wegen Kreislaufstörungen auf der Privatstation des Krankenhauses zu S. behandelt zu werden. An seinem Einzelzimmer mussten die Schwestern erst dreimal anklopfen, bevor sie es wagen konnten, hineinzutreten. „Guten Morgen!“ oder dergleichen sagte er niemals, höchstens schob er etwas die Brille zurecht, wenn er kurz von seinen Akten aufsah, welche er sich täglich von seinem Büro bringen ließ.
Seine Manieren waren so überheblich, dass man --wenn von ihm die Rede war - immer nur vom „Herrn Grafen“ sprach. „Bitte, gießen Sie den Kaffee geräuschlos ein; ich habe etwas Migräne!“ sagte er einmal zur diensthabenden Schwester, und ein andermal: „Wenn die Visite kommt - ich bin heute unpässlich.“
Er galt als unnahbar. Einmal täglich verließ er sein Zimmer. Dies war meist gegen Abend, wenn er von der Telefonzentrale aus seine geschäftlichen Gespräche erledigte. In der Zentrale arbeitete Herr Schnorr. Nach einiger Zeit hatte Herr Schnorr mit seinem regelmäßigen Fernsprechkunden doch einen gewissen Kontakt geknüpft und hierbei eine sonderbare Entdeckung gemacht: Der „Herr Graf“ war gar nicht so vornehm, wenn man ihn näher kannte - ja, man konnte sich sogar vernünftig mit ihm unterhalten. Weiß der Himmel, warum er so eine undurchdringliche Mauer um sich errichtete! Aber bald wusste Herr Schnorr mehr:
Der sogenannte Graf war einmal von einer Frau, die er geliebt hatte, enttäuscht worden - so sehr enttäuscht worden, dass er sich geschworen hatte, allen Frauen künftig mit Verachtung zu begegnen. Herr Schnorr begann, den Grafen zu verstehen. Und nun war er wieder einmal in der Zentrale. Als er seine Gespräche beendet hatte, fragte ihn Herr Schnorr: „Dürfte ich Sie diesmal um eine kleine Gefälligkeit bitten?“ „Aber selbstverständlich. Was haben Sie auf dem Herzen?“
Herr Schnorr holte ein kleines Päckchen aus der Ecke: „Dies ist vorhin aus einer Schneiderei abgegeben worden: Ein Kleid für Schwester Erika. Ich soll es hinaufbringen, kann aber hier schlecht weg. Wenn Sie mir vielleicht den Weg abnehmen könnten...“ „Wo soll ich es abgeben?“ fragte er, indem er das Päckchen zu sich nahm. „Im Schwesternheim, Zimmer acht! Und nicht vergessen: Schwester Erika!“
Langsam ging er die vier Treppen zum Schwesternheim hinauf und blieb vor Zimmer acht stehen. Er klopfte kurz. Eine hübsche Blondine öffnete. „Sind Sie Schwester Erika?“ fragte er in geschäftlichem Tone. „Ja!“ flüsterte sie mit einem bezaubernden Lächeln. Ihn schien sie nicht bezaubert zu haben; denn streng sachlich erklärte er: „Ich wurde gebeten, Ihnen dieses Päckchen abzugeben.“ Er hielt es ihr hin, so dass sie eigentlich nur zuzugreifen brauchte. Aber sie griff nicht zu. „Das ist sehr freundlich von Ihnen!“ sagte sie und machte eine einladende Geste: „Bitte!“ Wohl oder übel musste er eintreten; denn er konnte ja das Päckchen nicht einfach auf den Fußboden legen. Also legte er es auf den Tisch, machte eine Verbeugung und sagte: „Auf Wiedersehen!“
In diesem Augenblick hörte man vom Flur her Stimmen. „Das ist unsere Oberschwester“, flüsterte Schwester Erika, „gehen Sie jetzt bitte nicht - man würde denken, ich hätte Herrenbesuch, und das wäre mir sehr peinlich.“ Er sah dies ein und setzte sich auf einen Sessel. Draußen war die strenge Oberschwester mit dem Verwaltungsleiter in ein fesselndes Gespräch vertieft; das nach einer halben Stunde noch immer nicht beendet war.
„Schwester Erika“, sagte er nunmehr, „jetzt muss ich aber gehen, man wird mich auf der Station suchen.“ „Wo denken Sie hin?“ erwiderte sie aufgeregt, „wenn man Sie jetzt herausgehen sieht, wird man erst recht Übles denken - Sie sind schon über eine halbe Stunde hier; kein Mensch wird glauben, dass Sie nur ein Päckchen abgegeben haben...“ „Furchtbar, furchtbar!“ seufzte er und wartete.
Inzwischen war auch Schwester Erika etwas nervös geworden: Sie war auf acht Uhr beim Kino verabredet und hatte sich noch nicht einmal umgezogen. Gerade hatte sie ihm ihre Sorgen mitgeteilt, als sie hörten, wie die Oberschwester sagte: „Also gute Nacht!“ Sie atmeten auf - doch schon ging draußen das Gespräch weiter. „Wissen Sie“, sagte er plötzlich, „machen Sie sich ruhig fertig - ich drehe mich um.“
Notgedrungen akzeptierte sie seinen Vorschlag, Sie wusch sich, kleidete sich um, legte Rouge auf, frisierte sich, während er ihr kühl den Rücken zuneigte und völlig ungewollt in einen Spiegel sah. Erst blickte er voller Entsetzen weg, dann wagte er einen ganz verstohlenen Blick, sah schließlich öfter hin, bis er nur noch ganz selten wegsah. Als Schwester Erika ihre Toilette beendet hatte, dauerte es noch eine Viertelstunde - dann war draußen endlich „die Luft rein“, wie man zu sagen pflegt.