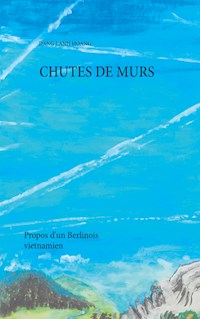2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch ist eine Sammlung persönlicher Erlebnisse des Autors. Bevor er in die DDR kam, hat er in Vietnam gelebt, und sowohl die Zeiten des Kriegs in Nordvietnam als auch die Wiedervereinigung der Nord- und Süd-Teile des Landes, das durch einen langen Krieg jahrzehntelang getrennt worden war, miterlebt. Jetzt in Deutschland, das nach einer langen Ost-West-Teilung ebenfalls wiedervereint und seine Wahlheimat geworden ist, kommt es nicht selten vor, dass die Erinnerungen an die Jahre in Vietnam wieder wach werden. Das kann auf dem Weg zur Arbeit passieren oder einfach beim Spazieren im Wald, beim Beobachten von Barfußspuren auf Straße oder von Flugzeugen im Himmel. Trotz der großen Entfernung, die zwischen seiner neuen und alten Heimat liegt, trotz des großen Zeitraums, der sein Leben in Vietnam und in Deutschland trennt, scheint es merkwürdigerweise fast immer direkte oder indirekte Verbindungen zwischen verschiedenen Orten und Zeiten zu geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Über den Autor
Über das Buch
Über den Illustrator
Barfußspuren
Die Universität im Wald
Die Hochschule am Schwarzen Fluss
1972. Eine Fliegerbombe mit Zeitzünder.
Das Gästehaus der Akademie der Wissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik
Ankunft in Ost-Berlin, Hauptstadt der DDR
Big Business DDR – SRV
Apropos Kulturattaché!
Zwei Seiten der Medaille
Gruppenleiter im Gästehaus
Der Hausmeister des Gästehauses
Die 5-DM Münze
Ein braver neuer Bürger
Sprachtest
Die Loyalitätserklärung
Die Einbürgerungsurkunde
Falsch und richtig
Von Mauern und Plastiktüten
Danksagung
Über den Autor
Dang Lanh Hoang wurde 1948 in Vietnam geboren. 1971 schloss er sein Chemiestudium an der Universität Hanoi ab und arbeitete bis 1975 danach als Hochschullehrer in Vietnam. Im Zeitraum zwischen 1975 und 1988 war Hoang als Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Nationalen Forschungszentrums Vietnam (NFZ) in Ho-Chi-Minh-Stadt (ehem. Saigon) tätig. Im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit zwischen dem NFZ Vietnam und der Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW) wurde er zum Doktor der Chemie promoviert und hat anschließend von 1988 bis 1991, während der Zeit des Berliner Mauerfalls, als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Forschungsinstitutes der AdW der DDR in Berlin gearbeitet. In der Folgezeit war er an Forschungsinstituten in Berlin und Rostock tätig, bevor er 2014 in den Ruhestand ging.
Seitdem lebt Hoang in Berlin. Er ist Autor von Kurzgeschichten und Übersetzer literarischer Texte aus dem Vietnamesischen ins Deutsche und aus dem Deutschen ins Vietnamesische, darunter „In Zeiten des abnehmenden Lichts” von Eugen Ruge, „Auslöschung“ und „Holzfällen“ von Thomas Bernhard, sowie „Deutschstunde“ von Siegfried Lenz1* und „Sie kam aus Mariupol“ von Natascha Wodin.
Über das Buch
Das vorliegende Buch ist eine Sammlung persönlicher Erlebnisse des Autors. Bevor er in die DDR kam, hat er in Vietnam gelebt, und sowohl die Zeiten des Kriegs in Nordvietnam als auch die Wiedervereinigung der Nord- und Süd-Teile des Landes, das durch einen langen Krieg jahrzehntelang getrennt worden war, miterlebt. Jetzt in Deutschland, das nach einer langen Ost-West-Teilung ebenfalls wiedervereint und seine Wahlheimat geworden ist, kommt es nicht selten vor, dass die Erinnerungen an die Jahre in Vietnam wieder wach werden. Das kann auf dem Weg zur Arbeit passieren oder einfach beim Spazieren im Wald, beim Beobachten von Barfußspuren auf Straße oder von Flugzeugen im Himmel. Trotz der großen Entfernung, die zwischen seiner neuen und alten Heimat liegt, trotz des großen Zeitraums, der sein Leben in Vietnam und in Deutschland trennt, scheint es merkwürdigerweise fast immer direkte oder indirekte Verbindungen zwischen verschiedenen Orten und Zeiten zu geben.
1www.literaturport.de/wab/Dang-Lanh.Hoang sowie stadtsprachen.de/author/dang-lanh-hoang/
Über den Illustrator
JP Bouzac wurde 1960 in Cognac, Frankreich geboren und lebt seit 1986, nach Absolvieren seines Militärdienst im Alliierten Stab, in Berlin. Er hat mehrere Bücher in französischer und deutscher Sprache, Kurzgeschichten und weitgehend autobiografische Berichte wie Mein kalter Krieg veröffentlicht. Als Grafiker verwendet er verschiedene selbst erlernte Techniken, in diesem Fall Collage, Zeichnung und Acrylmalerei.
Barfußspuren
Sie war eine junge Frau und ich sah ich oft im Bus der Linien 25 oder 27, die in Rostock Reutershagen mit dem Saarplatz verbinden. Sie war hübsch, hatte große, klare Augen, lange braune Haare mit kleinen Locken. Sie wirkte bescheiden, sogar ein wenig schüchtern, mit ihrem leichten, versteckten Lächeln. In einer Universitätsstadt wie dieser, wo Studentinnen und Studenten fast an jeder Ecke zu sehen sind, wäre auch sie nicht so auffällig gewesen, wenn sie nicht barfuß gegangen wäre.
Als ich sie zum ersten Mal im Bus barfuß stehend gesehen hatte, hatte ich zunächst nur gedacht, vielleicht hat die junge Frau Spaß, mal barfuß zu laufen. Wie man es ab und zu mal macht, spontan, eben nach Laune. Insbesondere hier, in Rostock, nicht weit vom Ostseestrand, wo man dies gern tut. Ich hatte schließlich sogar schon mal mit meinen Augen gesehen, und konnte es nicht glauben, wie ein junger Mann, im stark verschneiten Winter, barfuß auf dem Schnee am Strand von Warnemünde gelaufen ist. Aber als ich sie später mehrmals wieder barfuß laufen sah, dachte ich zwar nicht, sie wäre ein Mitglied des Mönchsordens der Barfüßler in Rostock, habe aber verstanden, dass es bei ihr keine spontane Aktion war.
Zufall oder nicht, sie stieg jedes Mal genauso wie ich an der Busstation Parkstraße aus, lief die Laurembergstraße und dann die Erich-Schlesinger-Straße entlang, bog in einen zu meinem Institut führenden Fußgängerweg ab, bevor sie in irgendeinem der in der Nähe liegenden Uni-Gebäude verschwand. Und jedesmalig folgte ich ihr, Abstand haltend. Die Straßen sind asphaltiert und ihre Fußabdrücke waren natürlich nicht zu sehen. Erstaunlicherweise erschienen diese unsichtbaren Spuren dennoch deutlich vor meinen Augen, wie die sichtbaren Barfußspuren von damals, auf der Oberfläche eines Deiches in Nordvietnam im Sommer 1966.
Zwei Jahre schon, seit August 1964, hatten amerikanische Kampfflugzeuge Nordvietnam bombardiert. Die Stadt Hanoi wurde von ihnen zwar noch nicht richtig heftig angegriffen, aber der Krieg hatte uns alle schon längst und vollständig in seine Gewalt gezogen. Tags oder nachts konnten die Sirenen, die überall in der Stadt, hoch auf den Häusern installiert worden waren, jederzeit plötzlich zu heulen beginnen, bevor aus den Lautsprechern, die an fast jeder Straßenkreuzung an Laternenpfählen oder Strommasten aufgehängt worden waren, eine strenge, bedrohliche Stimme zu hören war: „Achtung, Mitbürger! Achtung, Mitbürger! Feindliche Kampfflugzeuge sind fünfzig Kilometer vor der Stadt“.
Die größten Sirenen befanden sich auf dem Dach des Hanoier Opernhauses. Sie konnte man auch aus großer Entfernung am deutlichsten hören. Jedes Mal, wenn US-Kampfjets sich der Stadt näherten, wurden alle über Lautsprecher aufgefordert, sich unverzüglich in die da und dort installierten Schutzanlagen zu begeben. Sie waren fast überall in der Stadt zu finden, entlang der Straßen, an den Kreuzungen, in Hinterhöfen oder in jedem Park. Für Fußgänger wurden sogenannte Personenschutzanlagen installiert, die nichts anderes als mannshohe, senkrecht in die Erde eingegrabene Zylinder aus Beton waren, die damals speziell für diesen Zweck massenhaft produziert wurden. Und, wie oft musste ich schon in so eine Anlage hineinspringen, wenn nicht mit Freunden, meinem Bruder, meiner Schwester oder meiner Mutter, dann allein oder mit völlig fremden Leuten, und am ganzen Körper zitternd hören, wie oben Maschinengewehre aller Kaliber von den Hochhausdächern in den Himmel feuerten.
Pamm! Pamm! Pamm! Pamm!
Nach fast fünfzig Jahren kann ich mich immer noch sehr gut daran erinnern, wie laut, wie scharf und wütend diese kurzen, hastig abgegebenen Salven aus einer Vierling-Luftabwehrkanone waren, die man auf dem Dach eines unserem Haus gegenüberliegenden Kaufhauses montiert hatte. Angst war es gewesen, die ich ständig fühlte. Und, diese alarmierende Stimme aus den Lautsprechern, dieser bedrohliche Krach von Kanonensalven werden mich immer begleiten.
Manchmal dachte ich darüber nach, ob die US-Bomberpiloten uns von oben sehen könnten. In Erinnerung an die tödlichen Erfahrungen des noch nicht so lange zu Ende gegangen Krieges gegen die Franzosen dachte man, sie würden alles sehen und darauf schießen, was weiß ist und sich bewegt. Man zog sich daher fast nur dunkel an, in dem naiven Glauben, dies wäre eine gute Tarnung. Hosen, fast ohne Ausnahme, waren bei Frauen von damals sowieso nur schwarz, und bei Männern, wenn nicht dunkelblau, oder militärgrün, dann braun. Helle Oberteile versuchte man mit etwas Dunklem zu färben. Man entwickelte sogar eine Technik, ein weißes Hemd grau zu verfärben, indem man es in eine Lösung chinesischer schwarzer Tinten tauchte. Wer von uns konnte schon ahnen, wie kindlich und lächerlich all das gegen die moderne elektronische Technik der US Air Force gewesen war.
Ob auf dem Weg zur Schule oder auf einem Spielplatz mussten Kinder meist breite selbstgebastelte Sombrero ähnliche Hüte aus Reisstroh mitschleppen, die so groß und schwer waren, dass man sie lieber auf dem Rücken trug, als sie auf dem Kopf zu balancieren. Immerhin hatten sie das Leben vieler vietnamesischer Kinder vor diesen unheimlich heimtückischen, sogenannten „Kugel-“ oder „Ananas-“ Bomben der Amerikaner mehr oder weniger erfolgreich gerettet. Eine Bombe dieser Art sah zwar in Form und Farbe tatsächlich harmlos wie eine Ananas aus, enthielt aber Dutzende, ja Hunderte kleiner Kügelchen aus Metall oder Plastik, die bei der Detonation in den Körper des Opfers eindringen und entweder es gleich töten, oder schmerzhaft durch sein Leben begleiten würden. Gegen direkte Detonation einer Bombe hätten Reisstrohhütte natürlich keine Chance, sie konnten Kinder aber vor Bombensplittern und solchen Kügelchen gewissermaßen auch schützen.
Was mich bis heute sehr wundert, ist, dass man kaum etwas über die Zeit der Evakuierungen erzählt. Warum eigentlich? Es geht nicht um Nostalgie oder ähnliches. Es war eine der großartigsten Meisterleistungen in logistischer wie organisatorischer Hinsicht, die man während dieser Zeit vollbracht hat, in der sich die US Air Force (USAF) nach Kräften bemühte, Nordvietnam in die Steinzeit zurück zu bomben. Diese Bemühungen der USAF hatten immerhin acht Jahre lang, von 1965 bis 1973, gedauert.
Ob Nordvietnam tatsächlich zurück in der Steinzeit angelangt war, darüber lässt sich noch streiten. Das Leben der Menschen in Nordvietnam wurde dadurch aber gewiss total durcheinandergebracht. Die meisten Schulen, Institute, Universitäten, Ministerien, Fabriken wurden verkleinert, reorganisiert, aus den Städten evakuiert und auf das ganze Land verteilt.
Ich wusste nicht, ob die ländliche Bevölkerung auf irgendeine Weise dazu gezwungen wurde, uns als Städter bei sich in ihren Dörfern und Häusern aufzunehmen. Aber als meine Oberschule 1965 nach Phu Dong, einem Dorf bei Hanoi, evakuiert wurde, kann ich mich sehr gut daran erinnern, wurden wir Schüler einfach verteilt und in den Häusern von Bauern im Dorf untergebracht. Bauern haben uns wie ihre eigenen Kinder aufgenommen, uns geholfen so gut wie sie konnten, mit uns buchstäblich fast alles geteilt, was das primitive ländliche Leben in Vietnam von damals zu bieten hatte, kostenlos oder gegen nicht nennenswerte Gegenleistungen. Genauso war es auch bei meinen Eltern und Geschwistern sowie bei vielen Tausend anderen aus Hanoi ins Land evakuierten Familien. Wenn all das unter irgendwelchem Zwang stattgefunden hätte, wäre es kaum vorstellbar, dass solch ein Zusammenhalt zwischen Menschen lange Jahre hätte dauern können. Aber ist es nicht immer so gewesen? In jeder Nation, in jedem Land, schweißen die Gefahren des Krieges oder der Naturkatastrophen, die Nähe des Todes, die Nöte und auch die Angst, Menschen immer zusammen.
Das Dorf Phu Dong, wohin unsere Oberschule evakuiert wurde, liegt direkt am Duong Fluss, der abzweigende Arm des Roten Flusses in dessen Delta. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist der sehr alte, direkt am Haupteingang des Dorfes gebaute Tempel zur Verehrung des Volkshelden und Halbgottes Thanh Giong. Einer Legende nach wurde Giongs Mutter schwanger, nachdem sie einen riesigen Fußabdruck auf ihrem Reisfeld entdeckt und versucht hatte, ihren eigenen Fuß darauf zu stellen. Giong war geboren, und im Alter von drei Jahren, als chinesische Eindringlinge aus dem Norden die Heimat der Vietnamesen bedrohten, hatte er sie allein, mit seinem Pferd aus Eisen und bewaffnet mit Bambusrohren, besiegt und zurückgeschlagen. Nach seiner Heldentat flog er mit seinem Eisenpferd in den Himmel und verschwand für immer.
Direkt vor dem Tempel ist ein Deich, der unter der Ly-Dynastie errichtet wurde. Seit fast tausend Jahren hatte man ihn Jahr für Jahr fleißig wie die Ameisen erweitert, verlängert und befestigt, um die tiefer liegenden Felder und Dörfer gegen eine Überschwemmung zu schützen. Der Deich ist breit und man nutzte ihn wie eine Straße, die die Ortschaften längst des Flusses verbindet. Und genau hier war es, wo ich diese Abdrücke von Barfüßen schon einmal gesehen hatte! Unzählig viele, neue und alte, kleine und große, von Kindern und Erwachsenen, aufeinander liegend, nacheinander folgend, entfernten sich diese barfüßigen Abdrücke auf der Deichoberfläche unendlich in beide Richtungen des Deichs. Vielleicht wusste auch nur der heilige Thanh Giong, seit wann und woher oder wohin sie liefen, ganz gleich, ob es bitterkalt oder heiß, sonnig oder regnerisch war.
Ich war ein Stadtkind. Dort lief man selten barfuß, jeder besaß trotz all des Mangels, wenn schon nicht richtige Schuhe oder Sandalen aus Plastik (die aus Leder waren schon längst verschwunden und kaum einer kannte sie mehr), dann solch besonderes Schuhwerk, das aus abgenutzten Autoreifen angefertigt wurde und als eine Erfindung während des noch nicht so lange zu Ende gegangenen Krieges gegen die Franzosen galt. Alle Sorten von Schuhwerk waren knapp. Auf Hanoier Straßen waren damals überall, neben mobilen und kleinen „Werkstätten“ für die Reparatur von Fahrrädern, auch solche für die Nachbesserung von abgenutzten Sandalen, aber auch von alten Schuhen, zu finden. Ich kann mich noch erinnern, dass es am Ende der Luong-Van-Can-Straße, die zum Hoan-Kiem-See im Zentrum Hanois führt, eine Reihe von solchen „Werkstätten“ gab, wo man ein Paar alte Lederschuhe, die vielleicht französische Fremdenlegionäre bei ihrer Evakuierung im Jahr 1954 zurückgelassen hatten, anprobieren und sich für sehr viel Geld anpassen lassen konnte.
Man muss doch irgendwas an den Füßen haben. Besonders begehrt waren Schuhe aus durchsichtiger Plastik, von der Tien-Phong-Fabrik fabrizierte Sandalen, die aber nur mit besonderen Zuteilungsmarken für hochrangige Kader zu bekommen waren. Bauern und ihre Kinder in Phu Dong, wo der Volksheld und Halbgott Thanh Giong durch einen barfüßigen Fußabdruck geboren sein sollte, besaßen solche besondere Zuteilungsmarken natürlich nicht. Und erst hier, in Phu Dong, war mir bewusst geworden, dass die Bevölkerung Vietnams zu fast neunzig Prozent ländlich war und gerade diese Mehrheit auf dem Land nur sehr selten oder niemals in ihrem Leben auch nur das einfachste Schuhwerk besessen hatte.
„I have a dream“ zu sagen wäre übertrieben, wenn nicht angeberisch. Aber auf dem Deich vor dem Thanh-Giong-Tempel, angesichts dieser bis zur Unendlichkeit laufenden barfüßigen Abdrücke, entstand in mir nun jener simple Gedanke, der schließlich entscheidend dazu beitragen sollte, warum ich später Chemiker geworden bin: Du musst Chemie studieren, Ingenieur werden, ausreichend Polymere herstellen, viele, sehr viele, Sandalen produzieren, damit alle Menschen in Vietnam auch ohne besondere Zuteilungsmarken, diese durchsichtigen, begehrten Plastiksandalen erwerben können. Angesichts der Tatsache, dass Plastikmüll heutzutage ein gefährliches Problem für die Umwelt geworden ist, kommt einem der Traum über eine massenhafte Produktion von Polymeren zur Herstellung von Plastiksandalen wahrscheinlich absurd vor. Aber es war ebenso gewesen, dass Plastiksandalen lange Zeit zu den fast unerreichbaren Wünschen der Mehrheit von Menschen in Vietnam gehört haben. Die Träume können zeitlich und geographisch eben sehr unterschiedlich sein.
Im Winter 2008, mehr als vierzig Jahre später, kam ich zurück nach Vietnam und besuchte wieder Phu Dong. Es hatte sich viel verändert. Der Duong-Fluss musste inzwischen schon eine Unmenge an Wasser aus dem Roten Fluss an dem Dorf Phu Dong vorbeigebracht haben. Ich erkannte nichts mehr. Die Straße auf dem Deich war auch schon asphaltiert worden, darauf konnten jetzt sogar kleine Pkws fahren. Der Thanh-Giong-Tempel war zum Teil restauriert und wieder der Verwaltung von Mönchen unterstellt worden. Nur der schöne Banyanbaum und ein großer Steinblock, der wahrscheinlich seit Ewigkeiten direkt unter dem Baum lag, waren zu meiner großen Freude noch da. Hier, vor dem Tor des Tempels, hatte ich damals oft meine Freizeit verbracht, allein oder mit Freunden.
Unterwegs erwischte ich mich oft dabei, schnell auf die Füße der Leute zu blicken. Wie in Hanoi, so läuft auch heute in Phu Dong kein Mensch mehr barfuß. Man trägt Schuhe oder Sandalen, bloß nicht mehr die aus alten Autoreifen oder aus durchsichtigem Plastik. Ich glaube zwar nicht, dass Bata, Nike, Adidas … es schon geschafft haben, überall in Vietnam Fuß zu fassen, um den armen Bauern im Norden wie im Süden preiswertes Schuhwerk anzubieten. Ihr Siegeszug ist jedoch nicht zu leugnen. (Schließlich musste sogar die EU-Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass billiges Schuhwerk aus Vietnam den europäischen Markt überschwemmt). Und, während dieses Siegeszuges erzeugten sie, unter anderem, eine Armee von zahlreichen Schuhputzern – eine Armee, die einst Armut und Erniedrigung der Nation symbolisierte und in einem sozialistischen, von den Fremdherrschaften befreiten Land hätte eigentlich nicht mehr existieren dürfen.
Sie, diese einst so begehrten Plastiksandalen, habe ich erst während einer Sonderausstellung über die sogenannte „Zeit der Subvention“ im Museum für Ethnologie in Hanoi wiedergesehen. Alt, vergilbt, einsam, verlassen, armselig und nutzlos lagen sie in einer Vitrine. Darunter stand: „Plastiksandalen der Marke Tien Phong waren rationiert. Für einfache Kader und die werktätige Bevölkerung war es schwer, sie zu erwerben.“ Ob es Absicht gewesen war, war schwer zu beurteilen, aber das Paar Sandalen lag in der Vitrine neben einer blonden Puppe sowjetischer Produktion. Gleich daneben war ein anderer hoher Glasschrank, in dem ein alter DDR-Anorak ausgestellt wurde. Im Hintergrund war eine nachgebaute Musterwohnung zu sehen, deren Wand an der Vorderseite offen war, so dass die Museumsbesucher hineinschauen konnten; alte Möbel, ein paar alte Bücher, ein Radioempfänger, ein Fahrrad.
Alle diese Gegenstände, die alten, vergilbten Sandalen, der abgetragene Anorak, die komisch aussehende Puppe sowie die Wohnung mit all den darin ausgestellten Sachen waren unsere Träume; gewollt oder gezwungen, symbolisierten, widerspiegelten, prägten und beherrschten sie damals die Vorstellungen von Glück und Erfolg, die Generationen von Nordvietnamesen nach 1945 gehegt hatten, in einem seltsamen Gesellschaftsmodell, das allmählich in Vergessenheit geraten ist.
Nun gehören sie alle dem Museum.
Von Phu Dong (Tempel) nach Rostock (Universität), barfuß
Die Universität im Wald
Es ist schwer, gleich zu sagen, was genau in Todtmoos, einem Kurort im tiefen Südschwarzwald, der sich nicht sehr weit vom Dreiländereck Frankreich-Deutschland-Schweiz befindet, mich an einen kleinen Ort erinnerte, der sehr weit, fast eine halbe Weltreise von Todtmoos entfernt, in Nordvietnam liegt. Das war Dai Tu, jener Ort, zu dem die Universität Hanoi, samt allen ihren Fakultäten wegen des in den Jahren 1965-70 immer heftiger gewordenen Bombardements der Stadt Hanoi durch die US-Luftwaffe evakuiert worden war. Ich fand es merkwürdig, weil sich zwischen Dai Tu dort und Todtmoos hier nicht nur eine große Entfernung, sondern auch ein großer Zeitraum von knapp fünfzig Jahren meines Lebens erstreckt.
Die Landschaft war es bestimmt nicht, die mich in Todtmoos an Dai Tu erinnerte.
Todtmoos liegt zwar auch im Wald, aber in Europas Wald, wo jede Ecke, jeder Weg, jedes Bächlein oder Fließ genau und sorgfältig vermessen, gekennzeichnet, dokumentiert, beschildert und bestimmt schon amtlich besiegelt, und mit solchen lustigen Namen, wie Herrenkopfweg, Schweineweg oder Sägebach auf einer Karte für Kurgäste bezeichnet wird. Im Wald werden wahrscheinlich noch Spuren von legendären germanischen Stämmen bewahrt, die sich vor langer Zeit während ihrer Wanderung nach Süden hier im Wald verirrt hatten, oder womöglich sogar Spuren von Thomas Mann oder Maxim Gorki, die viele Jahre später, zwar nicht gerade in Todtmoos, aber irgendwo in der Nähe, wie man uns erzählte, ihre Freizeit verbracht haben sollen.
In meiner Erinnerung war Dai Tu damals landschaftlich, aber völlig anders. Die Landfläche, auf der sich die Fakultät für Chemie der Hanoier Universität für fast vier Jahre niedergelassen hatte, erstreckte sich am östlichen Auslauf der Tam-Dao-Gebirge, beinahe eingekesselt zwischen Bergen, Hügeln und Wäldern an der Rückseite und einem Wildbach an der Vorderseite. Die Entfernung bis zur Hauptstadt Hanoi, die nur circa siebzig Kilometer betrug, wäre aus heutiger Sicht wahrscheinlich nur ein Katzensprung. Sie schien uns damals allerdings schon so weit entfernt zu sein, als ob wir uns bereits im Urwald, völlig abgekoppelt von der zivilisierten Außenwelt, befänden. Um uns im Wald zu bewegen, mussten wir tatsächlich nicht selten selbst Wege mit Mühe durch fast undurchdringliches Dickicht freimachen. Damals hatten wir, nicht wie Kurgäste hier in Todtmoos, keine amtliche Karte, nach der wir uns halbwegs orientieren konnten.
Das Wetter war gewiss auch nicht das, was diese zwei Orte miteinander in Verbindung bringen konnte.
In Todtmoos war das von mir in diesem Januar erlebte Wetter ja sehr „weiblich“