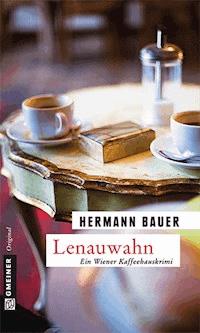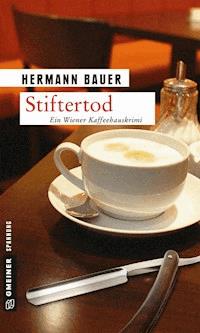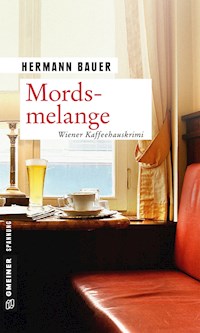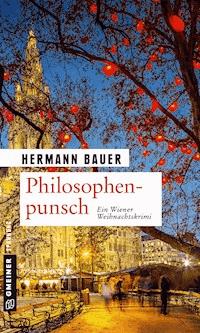Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Chefober Leopold W. Hofer
- Sprache: Deutsch
Im gemütlichen Café Heller sorgt die neue Bücherecke für Aufregung. Als Stammgast Reinhard Sageder ein Buch mit seiner eigenen Widmung aus vergangenen Tagen an eine damalige Geliebte entdeckt, bittet er Oberkellner Leopold um Hilfe bei der Suche nach der Herkunft des Buches. Doch bevor die Wahrheit ans Licht kommt, wird Sageder tot aufgefunden - ertrunken unter einem Steg der Alten Donau. Was zuerst wie Selbstmord aussieht, erweist sich als Mord. Bei der Suche nach Antworten stößt Leopold auf immer mehr unerwartete Querverbindungen, die die Lösung des Falles äußerst schwierig gestalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hermann Bauer
Melange mit Buch
Kaffeehauskrimi
Zum Buch
Bei Widmung Mord Der aus Deutschland zurückgekehrte Reinhard Sageder stößt in der neu eingerichteten Leseecke des Café Heller auf ein Buch, das er einst seiner Flamme Regina gewidmet und geschenkt hat. Ein zweites Buch mit der Widmung eines Mannes namens Robert an dieselbe Regina wird dem Kaffeehaus am nächsten Tag gespendet. Doch ehe Oberkellner Leopold weitere Nachforschungen anstellen kann, liegt Sageder tot neben einem Steg am Grund der Alten Donau – Mord, und nicht Selbstmord, wie zuerst angenommen. In der Leseecke interessiert sich plötzlich eine junge Frau namens Cornelia auffällig für das Buch mit Roberts Widmung. Rasch treten immer mehr Details zu zerrütteten Familienverhältnissen und zerbrochenen Freundschaften zutage, in die auch der Pathologe Konrad Otto verwickelt ist. Leopold muss sein ganzes Geschick aufwenden, um hinter das Motiv für das Verbrechen zu kommen und diesen kniffligen Fall zu lösen.
Hermann Bauer wurde 1954 in Wien geboren. Dreißig wichtige Jahre seines Lebens verbrachte er im Bezirk Floridsdorf. Bereits während seiner Schulzeit begann er, sich für Billard, Tarock und das nahe gelegene Kaffeehaus, das Café Fichtl, zu interessieren, dessen Stammgast Bauer lange blieb. Von 1983 bis Anfang 2019 unterrichtete er Deutsch und Englisch an der BHAK Wien 10. Er wirkte in 13 Aufführungen der Theatergruppe seiner Schule mit. Im Jahr 2008 erschien sein erster Kriminalroman »Fernwehträume«, dem 17 weitere Krimis um das fiktive Floridsdorfer Café Heller und seinen Oberkellner Leopold folgten. »Melange mit Buch« ist der 18. Kaffeehauskrimi des Autors. Er lebt mit seiner Frau Andrea in Wien und Eisenstadt.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Fotos von: © A.B. / iStock.com und Debby Hudson / unsplash
ISBN 978-3-7349-3406-3
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Kapitel 1
Dienstag, 15. Oktober, nachmittags und abends
Leopold W. Hofer, der Oberkellner des Floridsdorfer Café Heller, warf von der Theke aus einen Blick in die Runde. Alle Gäste schienen für den Augenblick zur Genüge mit Speis und Trank versorgt zu sein. Sie plauderten angeregt miteinander, blätterten in einer Tageszeitung oder spielten eine Partie Karambol. Also hatte er kurz Zeit, um eine SMS an seine Lebensgefährtin Erika Haller, welche die nahe dem Kaffeehaus gelegene Buchhandlung Lederer betrieb, zu verfassen.
»Ui jegerl! Schon wieder! So ein Blödsinn«, brummte er dabei verärgert in sich hinein.
Frau Heller, die ihm gegenüber hinter der Theke stand und ebenfalls gerade mit ihrem Mobiltelefon beschäftigt war, blickte auf. »Was haben Sie denn?«, fragte sie.
»Sie müssen schon verzeihen, Frau Sidonie«, schilderte Leopold seine Lage. »Aber meine groben Finger und die filigrane Tastatur auf dem kleinen Handybildschirm können sich einfach nicht miteinander anfreunden. Dauernd vertippe ich mich! Wenn das so weitergeht, brauche ich mit meiner Nachricht an Erika bis zur Sperrstunde!«
»Und unsere Gäste verhungern und verdursten in der Zwischenzeit. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf«, wies ihn Frau Heller zurecht. »Warum mühen Sie sich überhaupt so ab, wenn Sie mit der neuen Technik ohnehin nicht zurechtkommen? Rufen Sie Erika doch einfach an! Das können Sie wenigstens.«
»Das darf ich eben nicht mehr«, klagte Leopold. »Erika fühlt sich dadurch seit Neuestem in ihrer Arbeit gestört. Sie hält mir vor, dass ich ihre Kundengespräche in der Buchhandlung unterbreche und sie sich selbst dann, wenn sie ihr Gerät zwischenzeitlich ausgeschaltet hat, verpflichtet fühlt, mich später zurückzurufen. Jetzt verkehren wir eben bis zum Abend nur mehr schriftlich miteinander. Dass wir uns dann noch sehen, ist aufgrund meiner Tätigkeit hier auch nicht immer garantiert. Also bleibt es ungewiss, wann wir uns vor dem Sonntag wieder etwas sagen können. Ist das nicht pervers?« Er schüttelte den Kopf. »Der nächste Fehler! Und in der Zeile oben habe ich mich auch geirrt. Ich geb’s bald auf!«
Er erwartete nun ein paar belehrende Worte von seiner Chefin, doch zu seiner Überraschung nickte sie nur und sagte: »Ich verstehe zwar Erikas Anliegen, während der Arbeit nicht gestört zu werden, aber auch mir fällt schon seit einiger Zeit auf, dass die Leute nur mehr stumm über ihr Handy kommunizieren, statt miteinander zu reden. Leider betrifft mich das mittlerweile ebenfalls persönlich.« Sie hielt ihm ihr Mobiltelefon unter die Nase. »Da, lesen Sie«, forderte sie ihn auf.
»Ich kann das auf dem kleinen Bildschirm kaum entziffern«, wandte Leopold ein. »Das ist das Nächste, was mir neben dem Getapse mit den Fingern Probleme macht.«
Frau Heller vergrößerte den Text seufzend mit ihren Fingern und wiederholte: »Lesen Sie!«
Nun konnte Leopold die Nachricht entschlüsseln. Sie lautete: Erbitte demnächst Melange mit zwei Zucker. LG H.
»Was soll das bedeuten?«, erkundigte er sich ratlos.
»Das ist von meinem Heinrich«, raunte Frau Heller ihm zu. »Er will seinen Kaffee!«
Leopold verstand noch immer nicht. »Aber der Chef sitzt doch am Haustisch«, wunderte er sich. »Warum sagt er es Ihnen nicht einfach?«
Frau Heller bedeutete ihm, leise zu sein. »Er braucht uns nicht zu hören«, flüsterte sie. »Obwohl er wahrscheinlich ohnehin so vertieft in sein Handy ist, dass er nichts mitkriegt. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass mein Mann und ich in letzter Zeit hier im Lokal kaum mehr miteinander reden? Und zwar deshalb, weil er nur noch über dieses Kastl Mitteilungen macht oder entgegennimmt. Das sei viel bequemer, meint er. Man müsse sich nicht so anstrengen. Zum Reden sei in der Wohnung auch noch Zeit. Und wissen Sie, was er dort sagt? ›Gute Nacht‹, und wenn ich Glück habe, am nächsten Tag ›Guten Morgen‹. Sonst nichts.«
»Das ist wirklich seltsam«, musste Leopold zugeben. Er schaute kurz in Richtung Haustisch und Herr Heller. Der war so sehr mit seinem Mobiltelefon beschäftigt, dass er kaum registrierte, was um ihn herum vorging.
»Es betrifft ja nicht nur mich«, beschwerte sich Frau Heller weiter. »Ist Ihnen noch nicht aufgefallen, dass er mit beinahe niemandem im Kaffeehaus mehr redet? Dafür ist er in einer WhatsApp-Gruppe.«
Leopold horchte auf. »WhatsApp? Was ist das?«
»Das ist ein Zusatzdienst am Handy, mit dem man innerhalb einer Gruppe, die man gemeinsam festlegt, Nachrichten versenden kann. Die Botschaften gehen an alle gleichzeitig, darin besteht der Vorteil«, erklärte Frau Heller. »Auf diese Weise tut sich mein Heinrich mit einigen seiner Freunde zusammen. Sie tauschen den ganzen Tag Informationen untereinander aus. Der Böhm Xandl ist dabei, der Schulz Fredi …«
»Einen Moment, Frau Sidonie«, unterbrach Leopold. »Der Xandl und der Fredi sind beide im Lokal. Nur sitzt der eine da, der andere dort, und der Chef sitzt hier.«
»Eben! Das sage ich ja«, versuchte Frau Heller, ihm ihr Problem verständlich zu machen. »Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie bemerken, dass jeder von ihnen sein Smartphone vor sich auf dem Tisch liegen hat. Das bedeutet, dass sie gerade in intensiven Kontakt miteinander getreten sind. Es ist nicht mehr auszuhalten!«
»Sie könnten sich doch genauso gut zusammensetzen und normal unterhalten«, wandte Leopold ein.
»WhatsApp ist leider das neue Normal! Zumindest für meinen Heinrich«, äußerte Frau Heller bekümmert. »Er hält es, wie gesagt, für ökonomischer, als miteinander zu sprechen. Das Wichtigste könne so in aller Kürze mitgeteilt werden. Sämtliche unnötigen und zeitaufwendigen Einschübe würden wegfallen. Außerdem gebe es nur wenig Spielraum für Diskussionen. Und mein Heinrich hasst Diskussionen.«
Leopold begann, die gesamte Tragweite dieser Entwicklung zu verstehen. »Das sind ja schöne Aussichten«, entfuhr es ihm.
»Und zwar deswegen, weil diese Unsitte wie eine Seuche um sich greift«, belehrte ihn Frau Heller. »Wie das Beispiel meines Gatten und seiner Freunde zeigt, huldigt längst nicht mehr nur die Jugend dieser unseligen Mode. Wissen Sie, was das bedeutet? Wenn es so weitergeht, wird in einer Kirche bald mehr geredet werden als bei uns im Kaffeehaus!«
Man hörte nun ein kurzes, aber bestimmtes Räuspern vom Haustisch. Herr Heller wollte offenbar sichergehen, dass seine Frau seine Botschaft erhalten hatte und er die Melange bekam. Die machte allerdings keinerlei Anstalten, sich an die Kaffeemaschine zu begeben. »Dem muss Einhalt geboten werden«, wandte sie sich stattdessen weiter an Leopold. »Darum bin ich froh, dass wir Erikas Vorschlag für eine Bücherecke umgesetzt haben. Ein Teil unserer Gäste nutzt diese Möglichkeit bereits, um ein wenig mit der Seele zu baumeln, aber auch, um über den Umweg der Bücher miteinander ins Gespräch zu kommen.«
Tatsächlich konnte man seit einiger Zeit im hinteren Teil des Café Heller, ein wenig abgesetzt von den Tischen, an denen Schach oder Karten gespielt wurde, einen Bereich ausmachen, der allein dem Lesen und der literarischen Plauderei gewidmet sein sollte. An der Wand befand sich ein Bücherregal, das bereits zu einem ansehnlichen Teil gefüllt war. Davor standen zwei Couchtische und um sie herum bequeme Loungesessel zum Abhängen. Die gemütliche Ecke war so geschickt und ökonomisch eingerichtet, dass sie ausreichend Platz bot, ohne zu viel Raum zu beanspruchen.
Erika Haller war die Idee dazu durch einige ihrer Kunden gekommen, die nachgefragt hatten, wo sie ihre alten, gebrauchten Bücher denn hintragen konnten, damit sie noch Verwendung fanden. Frau Heller und sie kamen daraufhin rasch überein, dass es ein interessanter Versuch wäre, eine Bücherecke im Café Heller einzurichten. Die kleinen baulichen Veränderungen waren schnell erledigt, auf einem Plakat wurde um Buchspenden gebeten, und schon bald wurden die ersten Bände in die Regale eingeräumt. Erika schaute selbst immer wieder auf einen Sprung vorbei, um die Spreu vom Weizen zu trennen – absolut untaugliche Bücher auszusortieren – und dem übrigen, aufgrund der Spendierfreude der Floridsdorfer rasch anwachsenden Bestand eine übersichtliche Ordnung zu verleihen.
»Ich stelle mit Freude fest, dass sich unsere Bücherecke wachsender Beliebtheit erfreut«, registrierte Frau Heller. »Der Herr mit der Brille und die kurzhaarige brünette Frau, die übrigens ausgezeichnet zu ihm passen würde, waren gestern auch schon da. Ich habe so ein Gefühl, dass das unsere ersten Bücherstammkunden werden.«
»Bloß reden sie nichts miteinander«, stellte Leopold mitleidlos fest.
»Das kommt schon noch«, zeigte sich Frau Heller überzeugt. »Bald werden sie das Bedürfnis verspüren, ihr Schweigen zu brechen, und wenn auch nur einer den anderen schüchtern fragt, was er gerade liest.«
»Wozu sollten sie? Das sieht man doch auf einen Blick, wenn man genau hinschaut«, vermerkte Leopold kopfschüttelnd.
»Diese Aussage beweist nur wieder einmal, wie unromantisch Sie sind«, machte ihn Frau Heller aufmerksam. »Ich wette jedenfalls, dass sich zwischen den beiden eher ein Gespräch anbahnt als in der WhatsApp-Gruppe von meinem Heinrich. Achten Sie übrigens darauf, dass in der Bücherecke niemand sein Mobiltelefon verwendet. Dort ist selbstverständlich handyfreie Zone!«
Leopold kam nicht dazu, einen weiteren Kommentar abzugeben, denn vom Haustisch dröhnte ein lautes und ungeduldiges »Meine Melange!« herüber.
»Mein Heinrich redet wieder mit mir. Wie schön«, konstatierte Frau Heller sarkastisch und begab sich eilends hinter die Kaffeemaschine.
*
Am Abend waren der Mann mit der Brille und die kurzhaarige brünette Frau längst gegangen, ohne ein Wort miteinander gewechselt zu haben. Die Bücherecke lag einsam und verlassen da. »Das wird sich bald ändern«, versicherte Frau Heller, deren Gedanken ständig um diese neue Einrichtung ihres Kaffeehauses kreisten, ihrem Oberkellner. »Mit der geeigneten Werbung und den richtigen Ideen füllen wir unseren neuen Wohlfühlbereich auch zu später Stunde.«
»Ich weiß schon, was Sie meinen«, sinnierte Leopold. »Vorhin beim Abräumen habe ich etwa den Roman Josefine Mutzenbacher oder Die Geschichte einer Wienerischen Dirne bemerkt. Wenn wir nun groß plakatieren, dass man solche Meisterwerke der erotischen Literatur bei uns gratis spätabends lesen kann …«
»Sie machen sich schon wieder über alles lustig«, schnitt ihm Frau Heller das Wort ab. »Natürlich müssen wir achtgeben, dass unsere Schüler aus dem Gymnasium nebenan eine derartige Lektüre nach Unterrichtsschluss nicht in die Finger kriegen. Wir müssen überhaupt aufpassen, dass kein Missbrauch mit den Büchern geschieht und sich die Leute nichts heimlich mitnehmen. Aber zuallererst gilt es zu schauen, dass unser Angebot auch angenommen wird. Mir schwebt da etwa als erste Maßnahme ein spezieller Bücherwein vor, den man abends als Lesebegleitung ausschenkt.«
Sie war ganz auf ihre literarischen Herausforderungen der Zukunft fokussiert, sodass sie erschreckt auffuhr, als plötzlich das zerfurchte und mitgenommene Gesicht eines Mannes vor ihr an der Theke auftauchte. Sein gewelltes, grau meliertes Haar mochte irgendwann einmal an diesem Tag ordentlich nach hinten gekämmt gewesen sein. Jetzt bahnte es sich seinen Weg nach allen Richtungen. Seine vom Lehnen und Stehen an unzähligen Tresen und Bars gekrümmte Gestalt schwankte unter der sichtlichen Einwirkung des Alkohols. Frau Heller zog sich dezent zum Haustisch zurück und überließ Leopold diesen Neuankömmling.
»Was wünschen der Herr?«, fragte der vorsichtig, während er den Gast einer eingehenden Musterung unterzog. Alkoholisierte Personen, die man kannte, wusste man zumeist richtig einzuschätzen und zu behandeln. Man konnte mit ziemlicher Sicherheit voraussehen, ob sie sich friedlich verhalten oder einen Wirbel veranstalten würden. Bei Fremden fehlten diese Erfahrungswerte. Also hieß es vorsichtig sein.
»Einen kleinen Obstler und ein Seidel Bier«, antwortete der ramponierte Mann mit zugekniffenen Augen.
Leopold überlegte kurz, ob er ihm ein derart hochprozentiges Getränk einschenken sollte. Seine Chefin war ihm dabei keine große Hilfe. Sie hatte soeben mit ihrer neuen Lieblingsbeschäftigung, dem Lösen eines Sudoku-Rätsels, begonnen. Also servierte er dem Unbekannten seinen Schnaps und sein Bier, um Zeit zu gewinnen und zunächst einmal jegliche Diskussion zu vermeiden.
Der Mann stürzte den Obstler in einem Zug hinunter. Dann nahm er sein volles Bierglas und wankte damit an den Billardtischen vorbei in den hinteren Teil des Café Heller. Leopold schwante Übles. Der Unbekannte steuerte genau auf die Bücherecke zu. Offenbar hatten es ihm die bequemen Sitzgelegenheiten angetan. Wenn er nun dort sein Bier verschüttete, war die Katastrophe fertig. Frau Heller hatte nicht bedacht, dass dieser gemütliche Bereich auch auf Menschen ohne literarische Ambitionen Anziehungskraft ausüben könnte.
»Einen Augenblick«, versuchte Leopold deshalb, den Gast aufzuhalten. »Da können Sie nicht hin!«
Der Mann schien unbeeindruckt. »Und warum nicht?«, fragte er.
»Das ist eine Bücherecke«, machte Leopold ihn aufmerksam. »Die ist nur für Leute gedacht, die eines der Bücher aus den Regalen lesen möchten.«
Der Gast verzog seinen Mund zu einem schwachen Grinsen. »Aber genau das will ich ja«, gab er zurück.
Leopold blieb skeptisch. Andererseits ging es darum, den Mann nicht unnötig zu provozieren. Also entschied er sich für einen Kompromiss. »Schauen Sie einmal, ob Sie etwas finden, das Sie interessiert«, schlug er vor. »Das Bier lassen Sie inzwischen auf der Theke stehen, das stört Sie nur dabei. Wenn Sie etwas für sich entdeckt und eine stabile Position eingenommen haben, bringe ich es zu Ihnen.«
Der Mann überlegte. »Na schön«, fügte er sich dann. »Schaue ich eben, was ihr so habt. Ich sehe sowieso gleich, ob eure kleine Sammlung was taugt oder nicht. Ich merke das an einem einzigen Buch! Wenn es fehlt, habt ihr nur zweitklassigen Ramsch anzubieten.«
Leopold verwünschte den Augenblick, als der Unbekannte das Café Heller betreten hatte. Jetzt musste er sich nicht nur um seine anderen Gäste kümmern, sondern vor allem beständig ein Auge auf ihn haben. Immerhin wirkte der Mann so, als interessiere er sich tatsächlich für den angebotenen Bestand an Literatur. Er ging die Buchrücken einzeln durch, zog hin und wieder einen Band heraus und schob ihn dann wieder zurück. Es sah so aus, als suche er nach etwas Bestimmtem. Schließlich schien er gefunden zu haben, was sein Herz begehrte. Ungläubig und überrascht hielt er den Roman Salz auf unserer Haut von Benoîte Groult in Händen. »Sie haben es tatsächlich. Es ist sogar dieselbe Ausgabe«, redete er erstaunt zu sich selbst, setzte sich in einen der Loungesessel und begann, darin zu blättern.
Dabei ging auf einmal ein jäher Ruck durch seinen Körper. Er griff sich aufs Herz und stieß einen unterdrückten Schrei aus. Er atmete schwer. Leopold eilte sofort zu ihm, um nach dem Rechten zu sehen. »Fehlt Ihnen etwas?«, erkundigte er sich besorgt.
Der Mann winkte ab. »Es geht schon«, versicherte er. »Sie brauchen mich nicht zu bedauern. Bringen Sie mir lieber mein Bier. Oder nein, ich komme gleich wieder zu Ihnen nach vorn.«
Schwerfällig erhob er sich nach kurzer Zeit, machte dabei jedoch keine Anstalten, das Buch zurück auf seinen Platz zu stellen. Leopold seufzte. »Bitte geben Sie das Buch wieder dorthin, wo Sie es hergenommen haben«, forderte er den Mann auf.
Der reagierte nicht, klemmte es unter seinen Arm und bewegte sich auf unsicheren Beinen in Richtung Theke. »Haben Sie nicht gehört?«, rief Leopold ihm nach. Warum nur mussten es einem manche Leute so schwer machen?
»Doch! Aber ich würde es gern mitnehmen«, entgegnete der Mann.
»Das geht nicht«, bemerkte Leopold unwirsch. »Es gehört ja nicht Ihnen!«
»In gewissem Sinne schon«, rechtfertigte sich sein Gegenüber.
Jetzt wurde es Frau Heller zu bunt. Sie eilte vom Haustisch auf den Gast zu und stellte ihn zur Rede. »Wir sind ein Kulturcafé und kein Basar, mein Herr«, ließ sie ihn wissen. »Wenn Sie sich gratis Lektüre für zu Hause beschaffen wollen, müssen Sie schauen, ob Sie etwas Passendes in einem der öffentlichen Bücherschränke im Bezirk finden. Ansonsten können Sie unsere Angebote gern in der gemütlichen Atmosphäre unseres Kaffeehauses lesen. Wir würden dieses Buch sogar für Sie reservieren, bis Sie damit fertig sind.«
Der Mann schüttelte entschieden den Kopf. »Das macht für mich keinen Sinn«, behauptete er. »Aber es bleibt sicher hier? Es kommt nicht weg?«
»Da schauen wir drauf, wie Sie eben selbst gemerkt haben«, versicherte Frau Heller ungeduldig.
»Gut«, zeigte sich der Mann zufrieden. Es entstand eine kurze Pause. »Woher bekommen Sie die Bücher eigentlich?«, wollte er dann wissen.
»Die meisten werden uns dankenswerterweise von unseren Gästen zur Verfügung gestellt«, informierte ihn Frau Heller. »Sie können gern auch welche vorbeibringen.«
Der Mann hatte immer mehr Mühe, zusammenhängend zu kommunizieren, was er meinte. »Das möchte ich nicht«, äußerte er träge. »Ich möchte wissen, von wem Sie dieses Buch bekommen haben.«
»Das sind vertrauliche Auskünfte, die wir Ihnen leider nicht geben können«, antwortete Frau Heller knapp, erklärte das mühselige Frage- und Antwortspiel für sich damit als beendet und zog sich wieder an den Haustisch zurück.
»Können Sie mir vielleicht helfen?«, wandte sich der Mann daraufhin an Leopold.
»Es wäre von Vorteil, wenn Sie mir mitteilen könnten, warum Sie diese Information wünschen«, versuchte dieser, dem zugeknöpften Gast etwas zu entlocken.
Aber der verfiel in eine immer größere Lethargie. »Dann eben nicht«, resignierte er. »Ich finde das auch allein heraus.«
So schnell wollte Leopold die Sache nun auch wieder nicht auf sich beruhen lassen. Sein sechster Sinn sagte ihm, dass da unter Umständen mehr dahintersteckte als ein Betrunkener, der auf ein in die Jahre gekommenes Buch fixiert war. »Wie kann ich Sie denn erreichen, sollte ich etwas in Erfahrung bringen?«, fragte er deshalb.
»Ich komme einfach in den nächsten Tagen wieder vorbei«, versicherte der Mann.
Leopold überreichte ihm seine Visitenkarte. »Da sind meine Kontaktdaten«, erwähnte er. »Sie können sich jederzeit bei mir melden, Herr …«
»Reinhard, wie Sie bald selbst herausfinden werden«, ließ ihn der Mann ohne große Begeisterung wissen und steckte die Karte in die rechte Tasche seines abgetragenen Mantels. Dann trank er sein Bier aus, zahlte und ging seiner Wege.
Leopold betrachtete das Buch. Er konnte sich vage daran erinnern, den Roman Salz auf unserer Haut vor mehr als 30 Jahren, als er in den Bestsellerlisten ganz oben zu finden gewesen war, sogar gelesen zu haben, und zwar vor allem aufgrund seines romantisch-erotischen Inhalts. Es ging darin um die sexuelle Beziehung, die eine intellektuelle Frau und ein bretonischer Fischer über Jahrzehnte abseits ihres alltäglichen Lebens führten, bis der Mann schließlich starb. Gehobene Durchschnittsware, kein Sammlerstück. Bei Leopold hatte das Buch keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Es musste für Reinhard eine persönliche Bedeutung haben.
Als Leopold es öffnete, war das Rätsel sogleich gelöst. Auf der allerersten noch unbedruckten Seite fand er die folgende Widmung: Von Reinhard an meine geliebte Regina als Zeichen für unsere wunderschöne gemeinsame Zeit. R mit Herz
»Jetzt ist alles klar«, bemerkte Leopold in Richtung seiner Chefin. »Offenbar war dieses Buch ein Geschenk von unserem Reinhard an eine Frau, die er sehr mochte, und jetzt ist es ihm zufällig wieder in die Hände gefallen. Aus seiner Reaktion schließe ich, dass die Verbindung zwischen den beiden abgerissen ist. Sein spontaner Wunsch ist nun, diese Frau wiederzusehen. Und trotz seiner Alkoholisierung schließt er messerscharf, dass die beste Möglichkeit, seine Angebetete zu finden, darin besteht, zu eruieren, wer das Buch bei uns abgegeben hat.«
»Und Sie meinen, wir sollten der ungepflegten Erscheinung dabei helfen?«, zweifelte Frau Heller.
»Nun ja, seine Entdeckung scheint ihn ziemlich mitgenommen zu haben«, gab Leopold zu bedenken. »Die alten Gefühle sind wohl wieder zurückgekommen.«
»Tun Sie nicht so, als ob Sie Mitleid mit ihm hätten oder plötzlich der Romantiker in Ihnen erwacht wäre«, beanstandete Frau Heller. »In Wirklichkeit sehnt sich doch nur Ihre detektivische Ader nach Betätigung, da im Augenblick weit und breit kein Mord in Sicht ist.«
»Wer weiß, welches Schicksal die beiden heimgesucht hat«, versuchte Leopold, sie zu überzeugen. »Wenn Sie also etwas über den Überbringer oder die Überbringerin des Buches wissen, sollten Sie damit nicht hinterm Berg halten. Dann können wir einmal vorsichtig und diskret Nachforschungen in dieser Richtung anstellen und dem armen Kerl vielleicht helfen.«
»Na schön, irgendwann locken Sie mir es ja doch heraus«, gab Frau Heller nach. »Ich habe das betreffende Buch zusammen mit Erika in unser Regal eingeordnet, kurz nachdem ich es bekommen habe, deshalb erinnere ich mich daran. Es befand sich in einem auffälligen roten Plastiksackerl. Darum habe ich mir gemerkt, von wem es gekommen ist.«
»Vielleicht von einer Dame mit Namen Regina?«, forschte Leopold.
»Das wäre wohl zu einfach«, konstatierte Frau Heller. »Die edle Spenderin war vor einigen Tagen gemeinsam mit meiner Freundin Martina Windisch bei uns. ›Schau, was wir da für deine Bücherecke haben‹, hat Martina gesagt. ›Genug Lesestoff für den ganzen langen Winter.‹ Daraufhin hat mir ihre Begleiterin zwei rote Plastiksackerln überreicht, die bis oben voll mit Büchern waren.«
»Sie wissen aber nicht, wie diese Begleiterin geheißen hat.«
»Woher sollte ich? Martina hat sie mir nicht vorgestellt«, rechtfertigte sich Frau Heller. »Die beiden sind auch nur auf einen kleinen Mokka geblieben, den sie im Stehen an der Theke getrunken haben. Kaum hatte ich die Bücher, waren sie schon wieder weg.«
»Dann müssen Sie umgehend mit Ihrer Freundin reden, um mehr herauszubekommen«, forderte Leopold.
»Müssen tu ich gar nichts«, erklärte Frau Heller. »Aber wenn Sie mir versprechen, dass Sie schön brav sind, wie es sich gehört, und sich nicht in unser Gespräch einmischen, werde ich Martina morgen hierher zum Mittagessen einladen. Da kommt sie sicher, wie ich sie kenne, weil sie alleinstehend und zu faul zum Kochen ist. Dann können wir gemütlich über die ganze Sache plaudern.«
Leopold zeigte sich zufrieden. »Jawohl, so machen wir’s«, stimmte er zu.
*
Im Café Heller ging es auf die mitternächtliche Sperrstunde zu. Draußen hatte ein ungemütlicher kalter Wind zu blasen begonnen. Frau Heller schaute in immer kürzeren Abständen auf ihre Uhr. Die meisten Gäste waren bereits hinaus in die unfreundliche Nacht verschwunden, und sie hoffte, dass sie ein wenig früher Schluss machen konnte, um mit ihrem Ehemann wenigstens vor dem Schlafengehen noch ein paar Worte ganz ohne Mobiltelefon zu wechseln. Aber wie so oft, wenn sich nur noch ein paar Leute im Lokal befanden, machten diese keine Anstalten zu gehen. Die unwirtliche Witterung verstärkte nur noch ihren Hang zum Sitzenbleiben.
Da öffnete sich, halb von menschlicher Hand, halb von einer Sturmbö aufgestoßen, noch einmal die Kaffeehaustür. Eine von oben bis unten in Schwarz gekleidete ältere Frau, deren graues Haar links und rechts in dichten Strähnen herabfiel, betrat das Heller. Obwohl sie hier nur ein seltener Gast war, erkannte sie jeder sofort. Man kannte von ihr nur den Vornamen und nannte sie allgemein »Johanna die Wahnsinnige«.
Woher diese Bezeichnung und der Vergleich mit der ehemaligen Königin von Kastilien kam, war ungewiss. Historische Hintergründe spielten hier wohl kaum eine Rolle. Manche führten es auf ihr exzentrisches Verhalten in ihrer Jugendzeit zurück, als sie sich sowohl Männern als auch Frauen leidenschaftlich und wild an den Hals geworfen hatte. Gleichzeitig hatte sie die Eifersucht gewalttätig gegen Vertreter beiderlei Geschlechts werden lassen. Einer Frau hatte sie, wann man den Gerüchten glaubte, einmal beinahe die Augen ausgekratzt. Man munkelte auch etliche unheimliche Dinge über sie. Je älter sie wurde, desto mehr war sie als Unglücksbotin verschrien, und die Leute wichen ihr angsterfüllt aus, wenn sie ihr auf der Straße begegneten. Aufgrund ihrer schwarzen Kleidung, die sie stets trug, bedeutete es im Volksmund wie bei einer schwarzen Katze Pech, wenn sie einem über den Weg lief.
Johanna lebte zurückgezogen irgendwo am Bruckhaufen. Von Zeit zu Zeit machte es ihr aber Spaß, ihrem Ruf gerecht zu werden und die Menschen zu erschrecken. Dann spazierte sie durch den Bezirk, delektierte sich daran, dass sich einige bekreuzigten, wenn sie ihrer ansichtig wurden, und hatte für diejenigen, die es genau wissen wollten, stets ein Bündel düsterer Prophezeiungen auf Lager. Auch jetzt schien sie sich auf einem solchen Rundgang zu befinden.
»Wir schließen gleich, Gnädigste«, beeilte sich Leopold, ihr zuzurufen, als er sah, dass sie vorhatte, ihre Zelte an der Theke aufzuschlagen.
»Es ist wegen der Hexe, nicht wahr? Der Hexe, die es wagt, zu nächtlicher Stunde ein beschauliches Lokal in Angst und Schrecken zu versetzen«, versetzte Johanna lispelnd in schnippischem Ton.
»Es ist wegen der Uhr«, korrigierte Leopold sie. »Die Zeiger stehen bereits auf fünf Minuten vor dreiviertel zwölf.«
»Genug Zeit für einen Drink«, konterte Johanna. »Ein Achtel Rot geht sich auf alle Fälle noch aus.«
»Ein schnelles Achtel«, machte Leopold sie aufmerksam und schenkte ihr widerwillig ein Glas ein. Diese Frau war auch ihm nicht geheuer.
»Ich habe euch sogar etwas mitgebracht«, verkündete Johanna stolz. Nun erst sah Leopold eine schwarze Tasche, die sich in dem matten Kaffeehauslicht kaum von ihrer Kleidung abhob und voll mit Büchern war.
Er wollte Johanna schon erklären, dass für den Augenblick genug Lesestoff zur Verfügung stehe, da bekam Frau Heller noch einmal einen Energieschub. »Wie schön, dass auch Sie an uns gedacht haben«, rief sie und eilte herbei. »Und so viel ist es auch noch! Wie haben Sie denn von unserer Bitte um Spenden erfahren?«
»So etwas spricht sich herum«, antwortete Johanna knapp.
»Unsere Expertin von der BuchhandlungLederer wird das Material genau prüfen und dann in unser Bücherregal einordnen«, versicherte Frau Heller.
Johanna verzog ihren Mund zu einem sarkastischen Lächeln. »Was heißt das?«, mokierte sie sich. »Ist hier etwa die Rede von Zensur? Das würde meinen Prinzipien gewaltig widersprechen. Entweder meine Bücher finden alle einen Platz bei Ihnen, oder ich nehme sie gleich wieder mit.«
Frau Heller hatte nicht mit einer derart resoluten Reaktion gerechnet. »Aber, aber, seien Sie doch nicht gleich so eingeschnappt«, versuchte sie, beruhigend auf Johanna einzuwirken. »Wir schauen doch nur nach, ob wir etwas bereits in unserem Sortiment haben, oder – das ist bis jetzt allerdings noch nicht vorgekommen – ob es vom Inhalt her zu speziell für unsere Gäste ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein Buch über die Geschichte einer kaum bekannten Chorvereinigung würde wohl bei aller Toleranz durchfallen.«
»Wenn ich etwas zur Verfügung stelle, bin ich es nicht gewohnt, dass es extra bewertet wird«, gab Johanna verärgert zurück. »Sollten Sie meine Gabe annehmen, erwarte ich, dass ich jedes – ich wiederhole, jedes – dieser Bücher in Ihrer Leseecke wiederfinde. Es befinden sich wahre Schätze darunter. Also entweder oder!«
Frau Heller überlegte. Sie konnte es sich jetzt, wo die Bücherecke im Aufbau begriffen war und ihren Weg in die Herzen möglichst vieler Menschen finden sollte, nicht leisten, Johanna abzuweisen. Eine Ablehnung ihres Angebotes würde sich schnell herumsprechen und für negative Reklame sorgen. Die wenigen verbliebenen Gäste spitzten bereits ihre Ohren und schrieben jedes Wort, das sie hörten, im Geist genau mit. Außerdem wusste man nicht, wie viele negative Kräfte diese angebliche Unheilsverkünderin tatsächlich aktivieren konnte.
»Selbstverständlich nehmen wir alle Ihre Bücher dankend in unseren Bestand auf«, sicherte ihr Frau Heller deshalb mit verkrampftem Lächeln zu. »Haben Sie etwa vor zu kontrollieren, ob ich mich an mein Versprechen halte?«
»Mag sein«, ließ sich Johanna nicht in die Karten blicken. »Dieser Rotwein ist ein edler Tropfen, dessentwegen es sich lohnt, immer wieder einmal vorbeizuschauen. Behandeln Sie meine Geschenke also gut. Sie haben alle ihre Bedeutung für mich. Hinter jedem Buch steckt eine eigene Geschichte. Eines davon hat einmal sogar einen Mord verursacht!«
Leopold, der gerade damit beschäftigt war, die Billardtische mit einem kleinen Handsauger zu reinigen, schaltete diesen sofort ab. Er hatte die letzten Worte nur undeutlich verstanden, aber das genügte. »Einen Mord?«, vergewisserte er sich.
»Jawohl, Mord«, bestätigte Johanna amüsiert. »Da werden müde Oberkellnergeister wieder munter, was?«
»Bei einer derart großspurigen Behauptung allerdings«, äußerte Leopold. »Können Sie das auch beweisen? Um welchen Mord soll es sich denn handeln?«
Johanna nahm genüsslich einen letzten Schluck aus ihrem Weinglas. »Es ist gleich Mitternacht«, erinnerte sie ihn. »Zeit zu gehen, wie Sie mir selbst bei meinem Eintreten deutlich signalisiert haben. Es zieht mich wieder hinaus in die kühle Nacht. Wer weiß, was sie heute noch alles für mich bereithält.«
»Wollen Sie vielleicht noch ein schnelles Fluchtachterl zum Drüberstreuen?«, fragte Leopold. »Dann könnten Sie mir ja einen kleinen Hinweis …«
»Nichts da, jetzt ist Schluss«, unterbrach ihn Frau Heller. »Haben Sie überhaupt schon bei allen abkassiert? Wenn nicht, dann tun Sie Ihre Pflicht!«
Schweren Herzens musste Leopold sich fügen. Johanna nahm einstweilen die Bücher aus ihrer schwarzen Tasche und legte sie auf die Theke. »Es gibt eine ganze Menge von Gründen, weshalb ein Buch die Schuld an einem Mord tragen kann«, palaverte sie dabei. »Es kann Anleitungen dazu enthalten, wie sie zum Beispiel in Kriminalromanen zu finden sind. Es kann jemandem weggenommen worden sein, der es sehr liebte. Es kann die Ursache für eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Menschen gewesen sein und vieles mehr. Oft geschehen unvermutete Dinge mit zum Teil verheerenden Auswirkungen.«
»Und Sie kennen den Mörder und die ganze Geschichte? Und haben das Buch von ihm oder dem Opfer in Ihren Besitz genommen?«, versuchte der wieder an die Theke zurückgekehrte Leopold, Johanna noch irgendetwas zu entlocken. Aber es war vergeblich.
»Finden Sie es einfach heraus«, war ihre einzige Reaktion. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie sich für kriminalistische Rätsel interessieren. Also bitte! Dann ist das ein perfektes Training für Sie!«
»Sie wollen mir nicht einmal den geringsten Hinweis geben?«, flehte Leopold.
»Der Täter oder die Täterin ist nie gefasst worden«, erwähnte Johanna kryptisch, zahlte und war auch schon zur Tür draußen.
»Sperrstunde«, rief Frau Heller noch einmal durchs Lokal. »Lassen Sie die Bücher jetzt Bücher sein, Leopold, und gehen Sie zu Ihrer Erika nach Hause. Morgen ist auch noch ein Tag.«
Kapitel 2
Mittwoch, 16. Oktober, vormittags und mittags
Leopold musste seine ganze Überredungskunst einsetzen, um Erika dazu zu bewegen, am nächsten Morgen mit ihm gemeinsam zu seinem Dienstbeginn ins Café Heller zu gehen. »Weißt du, was das heißt? Du fängst um 7 Uhr an, ich normalerweise erst um 9 Uhr. Ich opfere dir also zwei Stunden meiner freien Zeit«, machte sie ihm klar.
»Ich will doch nur, dass du dir die paar Bücher ansiehst, die am Abend noch hereingekommen sind«, erklärte er ihr. »Du kennst dich da viel besser aus als ich. Es könnte wichtig sein. Vielleicht war eines davon wirklich in einen Mord verwickelt.«
»Vielleicht hat sich diese seltsame Dame auch alles nur ausgedacht«, wandte Erika ein. »Und selbst wenn es stimmt: Dann ist dieser Mord unter Umständen schon einige Zeit her. Reicht es nicht, wenn du deine detektivischen Aktivitäten auf aktuelle Verbrechen beschränkst? Das ist anstrengend genug!«
»Man weiß nie, wie die Dinge zusammenhängen. Ist es nicht außerdem beunruhigend, wenn ein Mörder frei herumläuft?«, gab ihr Leopold zu bedenken.
»Es ist vor allem beunruhigend, wie du dich durch jeden noch so kleinen Köder zu einer Verbrecherjagd verleiten lässt, Schnucki. Kaum hörst du was von einem Mord, lässt du alles andere liegen und stehen. Das ist bei dir schon wie eine Sucht«, konstatierte Erika wenig begeistert.
»Erstens hat dich Frau Heller ohnehin gebeten, alle neu eingelangten Bücher sachkundig zu prüfen. Zweitens könntest du im Kaffeehaus gleich ein bekömmliches Frühstück einnehmen.«
»Und drittens?«, lauerte Erika.
»Drittens? Nun ja! Wir könnten wieder einmal essen gehen … oder ins Kino …«, bot ihr Leopold, der außer seiner Arbeit und der kriminalistischen Aufklärung am liebsten seine Ruhe hatte, schweren Herzens an.
Davon ließ sich Erika überzeugen. Und so warfen sie, noch ehe das Heller seine Pforten öffnete, gemeinsam einen Blick auf Johannas Bücherspende. Leopold hoffte, dass sie dabei auf etwas Auffälliges stoßen würden, das ihn auf eine weiterführende Spur brachte.
Sie nahmen sich ein Buch nach dem anderen vor. Ganz oben auf dem Stoß lagen zwei Krimis von Agatha Christie, Alibi und Das fehlende Glied in der Kette. »Das schaut schon einmal sehr gut aus«, überlegte Leopold. »Aber ist es nicht zu offensichtlich?«
»Meines Wissens geht es in beiden Romanen um Giftmorde, bei denen der Täter versucht, sie jemand anderem unterzuschieben«, führte Erika aus. »Gift ist ein zentrales Thema bei Agatha Christie. Sie hatte in ihrer Jugend freiwillig Dienst in einem Krankenhaus verrichtet und deshalb fundierte Kenntnisse in dieser Richtung. Und raffinierte Alibis hat sie sich, wie du weißt, serienweise ausgedacht. Theoretisch kann das für jemanden eine Anregung gewesen sein, sich weiter damit zu befassen und so ein quasi perfektes Verbrechen zu begehen. Ob das in der Praxis tatsächlich vorkommt, kann ich nicht beurteilen.«
»Gift hinterlässt keine Fingerabdrücke und keine DNA«, sinnierte Leopold. »Ich werde mich am Nachmittag gemütlich hierhersetzen und in beide Krimis hineinlesen, das kann nicht schaden. Was haben wir noch? Das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir.«
»Das Standardwerk über das Geschlecht der Frau und ihre dadurch bedingte Rolle in der Gesellschaft«, bemerkte Erika stolz. »Ein sozialgeschichtlich-philosophischer Überblick, veröffentlicht knapp nach dem Zweiten Weltkrieg, Klassiker der feministischen Literatur. Pflichtlektüre! Das brauchst du nicht hier zu lesen, das haben wir bei uns zu Hause stehen, Schnucki!«
»Ich muss auf jeden Fall hineinschauen, damit ich weiß, was du so alles liest, wenn ich nicht daheim bin«, kündigte Leopold an. »Doch hilft es uns weiter? Ermordet man jemanden wegen so etwas? Wenn das Opfer eine Frau ist, war unter Umständen ein Mann wütend auf sie, weil sie sich ihm gegenüber nach der Lektüre des Werkes zu viel herausgenommen hat. Aber sonst? Mal sehen!«
Die nächsten beiden Bücher, die Leopold in Händen hielt und Erika zeigte, gehörten offensichtlich zusammen. »Biss zum Morgengrauen und Biss zur Mittagsstunde sind zwei moderne, nicht mehr ganz aktuelle Vampirromane von Stephenie Meyer«, klärte sie ihn auf. »Einfach geschrieben, stereotype Charaktere, voraussehbare Handlung, aber wegen der Thematik vor allem unter jungen Lesern nach wie vor beliebt. Die vollständige Serie umfasst vier Bände. Erzählt wird die Liebesgeschichte zwischen einer normalsterblichen 17-Jährigen und einem Vampir, der schon über 100 ist, aber noch immer cool und wie ein Teenager aussieht.«
Leopold blätterte hastig und unaufmerksam in den beiden Büchern. »Wird man zu einer morbiden Grufti-Tat animiert, wenn man das liest?«, fragte er sich. »Ist es ein Hinweis, dass zwei Bände fehlen? Ich weiß es nicht.« Er nahm sich das nächste Buch vor, welches zwei Titel trug: Message in a Bottle und Weit wie das Meer von Nicholas Sparks.
»Von diesem Roman sind die einen ganz begeistert, die anderen halten ihn für eine lebensfremde Schnulze«, begann Erika sofort zu dozieren. »Der Inhalt: Journalistin findet Liebesbrief als Flaschenpost und veröffentlicht ihn, Leser schicken weitere Flaschenpostbriefe ein. Sie sucht den Verfasser und findet einen Bootsbauer, der die Briefe an seine verstorbene junge Frau zur Bewältigung ihres Todes adressiert hat. Romantische Liebesbeziehung entsteht. Kleiner Durchhänger entsteht, als er erfährt, dass sie diese persönlichen Briefe in einer Zeitung abgedruckt hat. Als sich die Wogen wieder glätten und alles paletti erscheint, verunglückt er mit seinem Boot tödlich.«
Leopold stutzte. »Das klingt so ähnlich wie die Handlung eines anderen Buches, das ich gestern in Händen gehabt habe, und das einen späten Gast einigermaßen aus der Fassung gebracht hat: Salz auf unserer Haut. Da geht es doch auch um ein außergewöhnliches Liebesverhältnis. Ich habe es sogar einmal vor Jahren gelesen.«
Erika lächelte. Immer wieder kam es vor, dass ungeübte Leser wie ihr Schnucki glaubten, zwischen zwei Büchern Parallelen zu erkennen, die im Grunde an den Haaren herbeigezogen waren. »Das ist aber auch schon die einzige Gemeinsamkeit zwischen den beiden Romanen«, eröffnete sie ihm. »Bei der Message stehen wirkliche Gefühle, Liebe, Trauer und Sehnsucht im Vordergrund. Salz auf unserer Haut schildert eine rein sexuelle On-Off-Beziehung zwischen einer Frau aus bürgerlichen Kreisen und einem Fischer, die sich von Kind auf durch ihre Ferienaufenthalte in seinem Dorf kennen.«
»Aber es sterben doch auch beide Männer am Schluss«, wandte Leopold ein.
»Das ist halt so, Schnucki«, bemerkte Erika achselzuckend. »Ein tragisches Ende zählt offenbar zum Erfolgsgeheimnis solch zart-bitterer Romanzen. Die Leser, vor allem aber die Leserinnen, vergießen gern noch ein paar Tränen, ehe sie das Buch beiseitelegen.«
»Eine Journalistin und ein Bootsbauer, eine Frau aus gutem Haus und ein Fischer. Stadtfrau mit Grips trifft auf einfachen Naturburschen. Das ist eine weitere auffällige Ähnlichkeit«, zog Leopold immer eifriger seine Vergleiche.
»Warum ist das auf einmal so wichtig?«, wollte Erika wissen. »Wenn ich dich richtig verstanden habe, suchen wir doch in erster Linie ein Buch, das einen Mord verursacht haben könnte.«
»Das schon«, bekannte Leopold. »Aber zunächst einmal liefert jedes amouröse Verhältnis, ob in der Fiktion oder in der Realität, dafür enormen Sprengstoff. Zusätzlich beschäftigt mich die Wirkung, die Salz auf unserer Haut gestern auf einen unserer Gäste gehabt hat. Vielleicht besteht hier ein Zusammenhang.« Er schilderte Erika daraufhin in kurzen Worten die Umstände seiner Begegnung mit dem sonderbaren Mann namens Reinhard.
»Du hörst wieder einmal überall das Gras wachsen, Schnucki«, blieb Erika skeptisch. »Der Mann hat durch Zufall ein Buch wiederentdeckt, das er vermutlich einmal einer Frau geschenkt hat, und interessiert sich jetzt dafür, was aus der Adressatin geworden ist. Was hat das mit Message in a Bottle zu tun?«
»Das werde ich auf jeden Fall genau prüfen«, nahm sich Leopold vor. Er schlug dabei Nicholas Sparks’ Roman auf, um darin zu blättern. Plötzlich hielt er inne.
»Was ist?«, fragte Erika.
Leopold pfiff durch seine Zähne. »Ich glaub’s ja nicht«, rief er aus. »Da steht eine Widmung, wie in dem anderen Buch: Liebe Regina! Vergiss nicht, dass ich dich stets in meinem Herzen trage. Dein dich liebender Robert.«
»Und was bedeutet das deiner Meinung nach?« Nun wurde auch Erika neugierig.
»Zwei Widmungen, zweimal an eine Regina. Ist das nicht seltsam? Ich wette, es handelt sich um ein und dieselbe Frau«, kam Leopold in Fahrt. »Allerdings hat sich hier nicht Reinhard, sondern ein gewisser Robert verewigt.«
»Und wenn es sich um eine andere Regina handelt?«, gab Erika zu bedenken.
»Das wäre ein eigenartiger Zufall«, tat Leopold ihren Einwand sofort ab. »Bei zwei Romanen ähnlichen Inhalts erscheint es wahrscheinlicher, dass es ein und dieselbe Frau ist, und zwar eine, die einen Hang zu melancholischen Liebesgeschichten hat. Wirklich interessant, dass sie die Bücher und Widmungen von zwei verschiedenen Männern erhalten hat. Leider wissen wir nicht, wann und in welchem zeitlichen Abstand. Dazu gibt es keine Angaben.«
»Message in a Bottle ist zu Ende des vorigen Jahrhunderts und einige Jahre nach Salz auf unserer Haut erschienen«, erinnerte Erika sich.
»Gut! Dann nehmen wir an, dass Reinhard zuerst dran war, und zwar vor circa 30 Jahren«, versuchte Leopold, die Dinge zu ordnen. »Vor etwa 25 Jahren kam dann Robert. Aber natürlich können die Widmungen auch näher beisammen liegen.«
»Gehe ich recht in der Annahme, dass du hier die Wurzeln der von Johanna erwähnten Mordgeschichte vermutest?«, erkundigte sich Erika.
»Vollkommen recht«, bestätigte Leopold. »Parallel zu den Liebesdramen in den Büchern könnte eine ganz reale Liebestragödie entstanden sein. Aber wer hat wen auf dem Gewissen? Und kam ungestraft davon?«
»Mich würde eher interessieren, warum eine Frau Bücher mit derart persönlichen an sie gerichteten Widmungen überhaupt hergibt. So etwas behält man doch«, wunderte sich Erika.
»Da gibt es einen einleuchtenden Grund, nämlich dass sie nicht mehr am Leben ist«, äußerte Leopold kryptisch.
*
Zum Dank für ihre Hilfe bekam Erika von Leopold ein ausgiebiges Frühstück serviert, das alle Stückerln spielte. Als Reaktion darauf erhielt er eine SMS von Herrn Heller, der es sich in der Zwischenzeit am Haustisch bequem gemacht hatte: