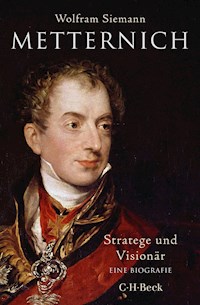
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"DIES IST MEHR ALS EINE BIOGRAFIE - ES IST EIN SCHLÜSSEL ZUM EUROPÄISCHEN 19. JAHRHUNDERT." - CHRISTOPHER CLARK
Metternich gilt traditionell als Inbegriff der Reaktion, als rückwärtsgewandter Feind aller liberalen und nationalen Kräfte. Der Historiker Wolfram Siemann zeichnet in seiner grandiosen Biografie ein fundamental neues Bild des Staatsmanns, der vier Jahrzehnte lang die Geschicke Europas prägte. Wie Metternich in den Schlüsselmomenten dieser Zeit agierte und welche Motive ihn langfristig antrieben, stellt Wolfram Siemann aufgrund von neuen Quellen erstmals präzise und anschaulich dar. Metternichs Denken war moderner, seine Diagnosen hellsichtiger und sein Wirken zukunftsweisender, als man ihm lange zugestanden hat.
- «Eine bahnbrechende Biografie.» Alexander Cammann, Die ZEIT
- «Ein Meisterwerk.» Jörg Himmelreich, Neue Zürcher Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Metternich gilt traditionell als Inbegriff der Reaktion, als rückwärtsgewandter Feind aller liberalen und nationalen Kräfte. Der Historiker Wolfram Siemann zeichnet in seiner grandiosen Biografie ein fundamental neues Bild des Staatsmanns, der vier Jahrzehnte lang die Geschicke Europas prägte. Wie Metternich in den Schlüsselmomenten dieser Zeit agierte und welche Motive ihn langfristig antrieben, stellt Wolfram Siemann aufgrund von neuen Quellen erstmals präzise und anschaulich dar. Metternichs Denken war moderner, seine Diagnosen hellsichtiger und sein Wirken zukunftsweisender, als man ihm lange zugestanden hat.
«Dies ist mehr als eine Biografie — es ist ein Schlüssel zum europäischen 19. Jahrhundert.»
Christopher Clark
«Eine bahnbrechende Biografie.»
Alexander Cammann, Die Zeit
«Ein Meisterwerk.»
Jörg Himmelreich, Neue Zürcher Zeitung
Über den Autor
Wolfram Siemann
METTERNICH
Stratege und Visionär
Eine Biografie
C.H.Beck
Inhalt
EINLEITUNG
1. Ein Mann – sieben Epochen
Bereits zwölf Jahre vor dieser Paperback-Ausgabe ist eine schmale Monografie erschienen, in der ich mein Bild von Metternich in Umrissen skizziert habe. Ihr Dasein nötigt mir eine Erklärung ab. Ich kann die Lebensgeschichte dieses bedeutenden Staatsmannes hier nicht im gleichen Duktus, nur in erweiterter Form, wieder- und weitererzählen. Die gedrängte Form legte ehedem nahe, das Ergebnis vorwegzunehmen und mit einem Persönlichkeits- und Charakterbild des Mannes einzuleiten, das dem Leser eigentlich erst am Ende der Lebensbeschreibung hätte anvertraut werden sollen. Die große Form erlaubt einen anderen Zugang, denn sie macht mich freier. Sie schenkt mir eine andere Rolle – bildlich gesprochen die eines kundigen Wegbegleiters und Reiseführers, der den wissbegierigen Leser und die neugierige Leserin auf eine Reise durch die Vergangenheit mitnimmt. Wir werden uns gemeinsam zurückfallen lassen in Zeitalter und historische Landschaften, die uns Heutigen fremd geworden sind. Dabei ist über ein Leben zu berichten, das so viele historische Epochen vereinte, wie sie selten ein Staatsmann erleben, über ein ganzes Menschenalter von rund fünfzig Jahren mitgestalten und dann rückblickend kommentieren konnte.
Es sind – von den bis ins Mittelalter zurückreichenden Spuren der Metternichs einmal abgesehen – insgesamt sieben vergangene Landschaften, getrennt durch sechs historische Umbrüche, die immer wieder politische Systemwechsel markierten und den Zeitgenossen den Weg vom sogenannten Ancien Régime in die Moderne des 19. Jahrhunderts bahnten. Es soll hier ein knapper Reiseprospekt entworfen werden, der im Voraus andeutet, was die Leser erwartet, die sich auf diese Fahrt einlassen wollen. Epochal wurde eine historische Erfahrung jeweils dann, wenn sie sich so gewaltig und nachhaltig in das kollektive Gedächtnis der Mitlebenden eingebrannt hatte, dass jene sie zeitlebens nicht mehr losließ und in ihren Gesprächen, Erinnerungen und Deutungen immer wieder auftauchte. Ich will zu jeder epochalen Zeiterfahrung zugleich andeuten, von welchen gegensätzlichen Blickwinkeln sie im Extrem wahrgenommen werden konnte.
1. Für Metternich reichte die erste seiner sieben Epochen von seinen frühen Kindheitsjahren bis ins prägsame Jünglingsalter (1773–1788). Diese Jahre ließen den empfindsamen Beobachter teilhaben an dem Gepränge und der Untergangsstimmung des Ancien Régime und ebenso an der intellektuellen Faszination einer die adligen und bürgerlichen Schichten durchdringenden Aufklärung. Dabei stifteten die Jahre zwischen etwa 1766 und 1777 eine noch näher zu beschreibende Generationsgemeinschaft der später geistig, politisch und militärisch führenden Köpfe der europäischen Welt. Für sie prägte die Geschichtsschreibung die Begriffe der «Generation Metternich» (* 1773) und – gleichsam spiegelbildlich – der «Generation Bonaparte» (* 1769).[1] Alle ihr Angehörenden waren eingebettet in das alte kosmopolitische Europa der aufgeklärten Gelehrsamkeit – distanziert in der geschäftigen Metropole London, ungestüm im flirrenden geistigen Brutofen von Paris, bedächtig und umständlich erörternd auf den Lehrkanzeln und in den Schreibstuben vieler deutscher Universitäts- und Residenzstädte, wo man die vielhundertjährige Tradition eines öffentlichen deutschen Rechts mit den Herausforderungen aufgeklärter Rationalität zu verbinden suchte.
2. Dieses alte kosmopolitische Europa zerbrach unter dem Ansturm einer doppelten Krise. Als die zuvor schon ausgebrochene Atlantische Revolution 1789 als Französische Revolution den Kontinent erfasste, zog sie den jungen Metternich und seine Familie tief in ihre Bahnen, indem sie die Rheinlande, die österreichischen Niederlande und die Generalstaaten überrollte. In einem ersten Krieg (1792–1797) versuchte eine Koalition aus Deutschen, Niederländern, Spaniern, Briten, Italienern und Russen, sich der neuen Zeit zu erwehren. Unter den Zeitgenossen hofften die einen noch verzagt auf die Reform der alten «deutschen Freiheit», während die anderen glaubten, ohne Terror («Terreur») den Widerstand der alten Mächte nicht brechen zu können.
3. Die nahezu 25 Jahre (1792–1815) eines kaum unterbrochenen Weltkriegs, wie man aus der Sicht heutiger Forschung ohne Übertreibung sagen kann, ließen Metternich erst als Gesandten, dann als Außenminister der österreichischen Monarchie den neuartigen Zusammenprall von Nationen und Imperien erfahren. Dieser Auseinandersetzung prägte Napoleon, die vermeintliche «Weltseele zu Pferde» (Hegel), seinen Stempel auf, für die einen der «Mann des Jahrhunderts», für die anderen der Ausdruck des übelsten Militärdespotismus. Diese Epoche verwirrte die Zeitgenossen und die unterworfenen Völker, weil sie blutige Kriege bisher nie gesehenen Ausmaßes hervorbrachte, zugleich aber Freiheit und moralischen Fortschritt der Menschheit verhieß. Der Mythos Napoleon schien dieses Doppelgesicht geradezu symbolhaft zu verkörpern. Was Krieg bedeutete, was er anrichtete und wie sich mit ihm auf neue Weise im Dienste des Fortschritts und der rücksichtslosen Vernichtung seiner Feinde operieren ließ: Das war ein weiteres generationsprägendes Erlebnis.
4. Die anschließende Epoche (1815–1830) umspannte die Rekonstruktion eines europäischen Staatensystems, das zwischen dem Wiener Friedenskongress von 1814 / 15 und den europäischen Revolutionen von 1848 / 49 als großer Mechanismus der Kriegs- und Revolutionsverhinderung arbeitete. Metternich agierte darin als der angebliche «Kutscher Europas», der selbst meinte, das fragile europäische Gebäude lasse sich nur immer wieder notdürftig flicken und stabilisieren, um wenigstens einem neuen großen europäischen Krieg auszuweichen, der nach seiner Sicht verheerender sein musste als alle anderen zuvor. Die Gegner erlebten diese Politik als das sogenannte Metternichsche System der «Restauration».
5. 1830 schien es so weit zu sein, als von Paris aus die Julirevolution den größten Teil des europäischen Kontinents, vor allem aber seinen Süden erfasste. Fortan schwankte die zeitgenössische Wahrnehmung zwischen einerseits der Hoffnung auf einen «Völkerfrühling», den nur eine große Erhebung, notfalls ein großer Krieg der verbündeten unterjochten Völker bringen könne, propagiert durch ein «Junges Deutschland», ein «Junges» Polen, Italien oder Ungarn, und andererseits der permanenten Furcht vor dem Ausbruch neuen unbezähmbaren Terrors, der den Zusammenbruch der Zivilisation bedeuten könne.
6. Die sechste epochale Erfahrung ging hervor aus den europäischen Revolutionen von 1848 / 49. Für die einen bedeuteten sie den Aufbruch zu geeinten nationalen Staaten mit freiheitlich-demokratischen Verfassungen. Für die anderen verkündeten die Revolutionen den Beginn einer Zeit des Exils, wie Metternich es erlebte, und eine nicht bewältigte Modernisierungskrise, welche die neuen nationalistischen Potenzen erst freisetzte und mit ihnen die Beziehungen zwischen den herkömmlichen Staaten zerstörte.
7. Die siebte Epoche schließlich umfasste die Revolutionsbewältigung, die «Reaktion» und – in der Habsburgermonarchie – die nachgeholte bürokratische Modernisierung im Neoabsolutismus. Metternich beobachtete all das, wie sein erster großer Biograf schrieb, «aus der Loge» (Heinrich von Srbik); gleichwohl zog er noch mehr, als man bisher wusste, aus dem Hintergrund die Fäden, und sein Rat war in den eingeweihten politischen Kreisen weiterhin gefragt. Diese Periode ging über den Zusammenbruch des «Wiener Systems» im Krimkrieg (1853–1856) hinaus und reichte bis zu den ersten Kämpfen der entstehenden Nationalstaaten. Ungewollt wurde die Habsburgermonarchie seit 1859 in diese Staatsbildungskriege hineingezogen, und Metternich, der im selben Jahre starb, sah sein Erbe, wenn es ein solches gab, letztendlich verspielt.
Sieben epochenprägende Erfahrungen reihten sich für ihn also aneinander: Aufklärung, Französische Revolution, Krieg als permanente Existenzbedrohung, europäische Rekonstruktion («Restauration»), «Völkerfrühling», revolutionäre Modernisierungskrise und staatsbildende Nationalitätenkonflikte. Jede einzelne hätte in anderen Zeiten für eine Generation ausgereicht – hier erlebte sie ein Mann alle nacheinander in einer Person. Was machte dies mit ihm? Metternich sah als Abkömmling eines traditionsreichen Grafengeschlechts und zugleich als aufgeklärter Freigeist alte Ordnungen untergehen, die Existenz seines Hauses beinahe eingeschlossen; vor seinem Auge entstanden neue Ordnungen, an denen er mitwirkte, und er musste sich durch Diskurse bewegen, die von der alteuropäischen («feudalen») Ständegesellschaft in den marktorientierten Kapitalismus führten. Er kam aus dem von bäuerlichen Untertanen getragenen Reichsadel und wuchs als Besitzer einer Eisenhütte mit 400 Arbeitern in den Stand eines frühindustriellen Fabrikanten hinein.
Frühere Biografien Metternichs gingen ausnahmslos von einem fast statischen Persönlichkeitskern aus. Ob die einschneidenden, systemstürzenden Erfahrungen seiner Zeit nicht auch in diesem Leben ihre Spuren und Wandlungen hinterlassen haben könnten, blieb unbedacht. Metternich war von frühester Jugend an bis ins höchste Alter ein Homo scribens, ein Intellektueller, den viele irrtümlich als unbeweglichen Doktrinär abstempelten, auch sein führender Biograf Heinrich von Srbik. Doch dieser Intellektuelle versicherte sich durch seine unentwegten schriftlichen Äußerungen immer neu seiner Beweggründe und Ziele. Er las ohne Unterbrechungen, immer auch auf den wochenlangen Kutschreisen durch Europa, er las Zeitungen, Bücher, gerne historische und belletristische Texte, und wenn es sein musste, auch Pamphlete seiner Gegner, daneben aber vor allem auch Akten sowie Denkschriften, und immer und allerorten schrieb er Briefe an die Angehörigen seiner Familie, an Freunde, Weggefährten und natürlich besonders offenherzig an seine großen Geliebten, Wilhelmine von Sagan und Dorothea von Lieven. Aphorismen, Memoranden, Memoiren, Korrespondenzen markierten seinen Lebensweg, und da er nichts, was ihm persönlich wichtig schien, wegwerfen konnte, stellen in Prag sein persönlicher, von ihm selbst geordneter Nachlass (die «Acta Clementina») und das vollständig erhaltene Metternichsche Familienarchiv eine unerschöpfliche Quelle des Wissens für diesen nicht leicht zu verstehenden, aber leicht misszudeutenden Menschen dar.
Dem imaginären Reiseführer liegt daran, diejenigen, die ihn begleiten, aus der Tiefe der Zeit immer weiter nach vorne zu führen. Es ist ihm wichtig, die prägenden Momente – die Urerlebnisse – sichtbar werden zu lassen, die in späteren Konflikten, Krisen und Konstellationen bei Metternich gleichsam einen Schlüsselreiz des Déjà-vu auslösten und damit seine Handlungen und Urteile erst nachvollziehbar machen. Grundbegriffe der «Sattelzeit» zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert (Reinhart Koselleck) werden aus dieser Perspektive womöglich neu verständlich, etwa «Recht», «Revolution», «Reform», «Nation», «Zivilisation», «Repräsentation», «Volk» und «Volkssouveränität». Alles einmal im Metternichschen Sinne zu verstehen heißt aber keineswegs, alles zu rechtfertigen. Eine Biografie wie diese darf und wird keine apologetische Absicht verfolgen. Dazu gibt es heutzutage keinen Grund mehr. Das damals von Metternich Mitgedachte, Mitgemeinte, oft aber aktuell nicht Mitgesagte aus seinem früheren Erfahrungsgrund herleiten zu können ist jedoch das Privileg des nachgeborenen Historikers. Vielleicht lässt sich so verstehen, was es heißt, einer historischen Persönlichkeit «gerecht» zu werden.
Eine reichhaltige und methodisch gewiss fruchtbare Debatte zweifelt, ob historisches Erzählen auch unter den Vorzeichen der sogenannten Postmoderne noch möglich sei, ob die Biografie als historische Gattung – als die stimmige Beschreibung eines Lebens nach dem Muster eines «Wilhelm Meister» – nicht eine «Illusion» sei (Pierre Bourdieu). Gewiss, der alte Bildungsroman und die mit ihm verbundenen historischen Gewissheiten sind tot, schon lange, eigentlich seit Johann Gustav Droysens «Historik», als er formulierte: «Das Gegebene für die historische Forschung sind nicht die Vergangenheiten, denn diese sind vergangen, sondern das von ihnen in dem Jetzt und Hier noch Unvergangene, mögen es Erinnerungen von dem, was war und geschah, oder Überreste des Gewesenen und Geschehenen sein.»[2] Mit anderen Worten: Die Vergangenheit und so auch ein ganzes vergangenes Leben lassen sich nicht «rekonstruieren»: Das verbieten die Lückenhaftigkeit und Zufälligkeit der überlieferten Fragmente. Aber Zeugnisse eines Lebens mit begründeten Fragen zu konfrontieren – das ist weiterhin möglich. Und wenn sich dabei Sinnzusammenhänge auftun, die das «Bild» der Geschichte und ihrer Persönlichkeiten nicht nur zwischen Weiß und Schwarz, also in Grautönen changieren, sondern «bunt» erscheinen lassen (Richard Evans)[3] – dann hätte auch dieses Buch ein wichtiges Ziel erreicht.
2. Metternich-Biografen im Wandel der Generationen
Vergleichbar mit anderen bedeutenden Staatsmännern, begann Metternich frühzeitig, über sein Bild in der Nachwelt nachzudenken. Seit den 1820er Jahren machte er aus dem Gedächtnis Aufzeichnungen, die als Bausteine seiner kommenden Memoiren dienen sollten. Er war sich der Rolle eines Memoirenschreibers sehr genau bewusst. Er nahm in seine Manuskripte nur das auf, was seine Person betraf und die Lücken der offiziellen Korrespondenzen schließen konnte.[4] Die wahre wissenschaftliche Arbeitsweise der Historiker lag für ihn darin, dass die Forscher Zutritt zu den kaiserlichen Archiven erhielten und «die Akten der Zeit in Verbindung mit der gegenwärtigen Arbeit [seinen Memoiren] zu Rate ziehen; aus dieser doppelten Quelle schöpfend, werden sie leichter die große Epoche beurteilen können, während welcher das Geschick mir die schwierige Aufgabe gestellt hat, eine aktive Rolle auf der Weltbühne zu spielen».[5] Unparteilich und gerecht könnten nur Geschichtsschreiber über die Taten und Ziele der Staatsmänner urteilen. Da er eine solch hohe Meinung von ihnen hatte, schied er streng zwischen Urteilen der Zeitgenossen und denen der Historiker; nur Letztere zählten für ihn. Im Jahre 1829, als er gerade wieder ein Stück seiner Erinnerungen aufzeichnete, bemerkte er, es sei «der Geschichtsschreiber für die unzähligen Ereignisse aus den ersten Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts noch nicht geboren. Die Zeitgenossen können vernünftigerweise nicht mehr beanspruchen, als die Materialien für diejenigen zusammenzutragen, denen in späteren Tagen der hohe Beruf zuteil wird, die wahre Geschichte der Vergangenheit mit jener Ruhe und Unparteilichkeit zu schreiben, die den an den Ereignissen persönlich und aktiv Beteiligten selbst immer fehlt.»[6]
Metternich war sich gleichfalls bewusst, wie polarisierend seine Persönlichkeit auf die Zeitgenossen wirkte, die – wie er selbst schreibt – das Unwort des «Metternichschen Systems» gegen ihn geschmiedet hatten. Auch hier baute er auf die methodisch andere Arbeitsweise der Historiker: «Die Archive aller Staaten enthalten zahlreiche Beweise dessen, was ich wollte und förderte, sowie dessen, was ich nicht wollte und daher bekämpfte. Das Verdikt, welches die unparteiische Geschichte zu fällen haben wird, muss über den Wert des einen und den Unwert des anderen Elementes entscheiden.»[7]
Einer seiner Besucher auf seinem Schloss Johannisberg, der preußische Politiker Joseph Maria von Radowitz, Anhänger der kleindeutschen Reichseinigung unter preußischer Dominanz, erbot sich Ende der 1830er Jahre gar als unparteiischer Biograf; Metternich werde keinen ihm näher verwandten Geist finden.[8] Radowitz verkannte Metternich gewaltig, denn dieser hielt sich wie üblich vor seinem Gegenüber höflich zurück. Tatsächlich sah er in Radowitz einen «exzentrischen Kopf» oder, mit einem Bild aus der Märchenwelt: einen «Diabolus rotae», also einen Teufel, der an einem Wagen die Rolle des vierten Rads übernimmt; er gehöre «zu den Geistern, welche nicht auf halbem Wege stehen bleiben und durch eine denselben eigene Gedanken- und Wortfülle sich selbst betäuben und andere zu betäuben bestrebt sind». Kurzum: Metternich hielt ihn für den Prototypen eines leidenschaftlichen, jedenfalls nicht unvoreingenommenen Zeitgenossen.[9]
Allerdings hatte Metternich eine zu hohe Meinung von den nachlebenden Geschichtsschreibern. Denn diese stritten über ihn wie in der Epoche vergleichbar nur noch über Napoleon. Zwischen 1836 und 2015 sind rund dreißig Biografien zu Metternich erschienen, die je sein ganzes Leben und nicht nur eine Teilspanne daraus zu behandeln versuchten. Grob besehen lassen sich fünf Generationen und wechselnde Perspektiven unterscheiden.
Erstens ist da die Generation der Mitlebenden, die eigentlich in Metternichs Augen zur Geschichtsschreibung gar nicht taugten. In ihre Zeit fallen auch die ersten Editionen von Memoiren, gesammelten Schriften und Akten von Metternichs Zeitgenossen, mit denen sich der Staatskanzler selbst noch intensiv auseinandersetzte. Mit dem Rotstift saß er über sie gebeugt, markierte und exzerpierte dann mit seinem Federkiel, was ihm wichtig schien. So studierte er etwa die von St. Helena ausgehende Memoirenliteratur zu Napoleon, die Schriften von Friedrich Gentz oder eine Biografie des Freiherrn vom Stein,[10] ja, auch die große Geschichte des Revolutionszeitalters von Adolphe Thiers, der eigens dazu Metternich als Zeitzeugen interviewt hatte. Wie sehr das Urteil der Parteilichkeit auf die Biografen zutraf, offenbarten handgreiflich zwei Zeitgenossen, beide ursprünglich aus dem Umkreis Metternichs. Der Professor der Philologie und Geschichte am Gymnasium zu Biel in der Schweiz Wilhelm Binder wagte sich 1836 mit der ersten Metternich-Biografie hervor, die man gut in die Abteilung «Heldenverehrung» legen kann. Das Gegenstück bot der ehemalige Leiter des Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien und Hofgeschichtsschreiber Josef von Hormayr. Als Anführer einer im Jahre 1813 geplanten «Alpenrevolution» hatte Metternich ihn verhaften lassen – was noch näher zu beschreiben sein wird. Damit hatte er sich einen unerbittlichen Feind geschaffen; Hormayr verließ Österreich und wechselte schließlich in den bayerischen Staatsdienst. Die Rachsucht beflügelte ihn 1848 zu einem biografisch ausgerichteten Pamphlet unter dem Titel «Kaiser Franz und Metternich». Darin machte er aus Metternich einen kalten Intriganten, Absolutisten und Unterdrücker allen geistigen Aufschwungs, frivol, oberflächlich, charakterlos. Er konstruierte den Prototypen des Hassbildes, das fortan besonders die kleindeutsche Geschichtsschreibung erfüllte.
Damit ist die zweite Generation umrissen, welche wenige Jahre nach Metternichs Tod ab 1866 vom Brandherd der gespaltenen Geschichtsschreibung entzündet war: hier reichs- und «kleindeutsch», dort habsburgisch und «großdeutsch». Dieser grundsätzliche Streit unterwarf die Deutung Metternichs unerbittlich und ausschließlich einer auf die nationale «deutsche Frage» zugeschnittenen Sicht. Was Hormayr angestimmt hatte, ließ der preußisch gewordene Sachse Heinrich von Treitschke propagandistisch zu einem Orkan werden. Seine «Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert» war zwar keine Biografie im engeren Sinne, beeinflusste aber wie kein anderes Werk das Bild von Metternich, denn sie fehlte in keinem bildungsbürgerlichen Haushalt. Der Geschichtsprofessor, der nach Metternich eigentlich «sine ira et studio», also unvoreingenommen und leidenschaftslos zu schreiben hatte, erblickte in dem Staatskanzler den Verräter an der deutschen Nation, den Intriganten in der Diplomatie, den vollendeten Weltmann, den «ideenlosen» Kopf, begabt mit «gewiegter Schlauheit» und «schamloser Herzenskälte», bestechlich, verlogen, kurzum: den «Undeutschen», den Österreicher.[11] Der erste Band dieses enragierten Werks erschien in Berlin im Jahre 1879. Nur ein Jahr später veröffentlichte der Sohn des Staatskanzlers Fürst Richard von Metternich in Wien den ersten Band der «Nachgelassenen Papiere» mit Materialien aus dem Familienarchiv und dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Er wollte dem zunehmenden Strom abfälliger Kritik Einhalt gebieten.
Unter den Universitätshistorikern trug der ursprünglich deutschnationale, dann aber ganz dem Nationalsozialismus ergebene Viktor Bibl das von Treitschke propagierte Bild in die Zwischenkriegszeit nach 1918, besonders durch eine Abrechnung mit Metternich als dem «Dämon Österreichs», wie er sein Pamphlet untertitelte. Dem Fürsten Metternich, dem angeblichen Intriganten und Lügner, gab er die Hauptschuld am Untergang der Habsburgermonarchie und meinte, es gereiche ihm «zur Genugtuung und Ehre, mich mit Heinrich Treitschke auf der Anklagebank zu sehen».[12]
Die dritte Generation während der Zwischenkriegszeit bezog ihren Fokus aus dem Erlebnis des Ersten Weltkriegs. Dazu gehörte der ambivalente Srbik, der gesondert zu betrachten sein wird, vor allem aber der heute vergessene, auch von Srbik hoch geschätzte Constantin de Grunwald, der in einer 1938 erstmals erschienenen Biografie Metternich vor Verleumdungen in Schutz nahm; dieser habe, wie er aus neuen Quellen belegte, als großer Diplomat frühzeitig die Bedrohung der europäischen Zivilisation erkannt.[13] In der Wirkung vergleichbar, schenkte der Engländer Algernon Cecil seinem Publikum 1933 die erste anspruchsvolle Biografie des Staatskanzlers in englischer Sprache, in welcher er ihn mit kontrastierenden zeitgeschichtlichen Anspielungen auf Hitler als großen Europäer und Retter vor einem totalitären, revolutionären Terrorismus verherrlichte.[14]
Die vierte Generation stand unter dem Schock des Zweiten Weltkriegs und des erneuten Zivilisationsbruchs. Das brachte die in der Zwischenkriegszeit geborenen Historiker dazu, an Metternich noch mehr den Europäer, den Meister der internationalen Gleichgewichtspolitik und den Friedensstifter hervorzuheben. Diese Historiker bezogen gewissermaßen von der Vätergeneration das Weltkriegserlebnis und fügten aus eigener Erfahrung den Zweiten Weltkrieg hinzu:[15] so der Engländer Alan Warwick Palmer (* 1926), für den Metternich der «Councillor of Europe» wurde; ebenso sein Landsmann Desmond Seward (* 1935), der seinem Buch den Untertitel gab: «The First European»; sodann der Franzose Charles Zorgbibe (* 1935), der Metternich als «le séducteur diplomate» darstellte, den Verführer auf dem Feld der Diplomatie; außerdem der Amerikaner Paul W. Schroeder (* 1927), der bahnbrechend dazu beitrug, Metternichs Diplomatie neu zu bewerten;[16] schließlich aber vor allem der gebürtige Fürther und Amerikaner Henry Kissinger (* 1923), durch dessen meisterhafte Dissertation die Erfahrung beider Weltkriege und zugleich die neue atomare Bedrohung der Weltbevölkerung hindurchscheint. Er verlieh dem Begriff der «Restauration» in seinem Werk schon durch den programmatischen Untertitel eine völlig neue Bedeutung: «A World Restored. Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace».[17] Zwar handelt es sich bei den genannten Historikern außer bei Palmer und Zorgbibe nicht um eigentliche Biografen, aber als Beispiele für die internationale Neuorientierung des Metternich-Bildes verdienen sie ebenso Aufmerksamkeit wie der Österreicher Helmut Rumpler (* 1935), der wie niemand zuvor die Nationalitätenpolitik des Staatskanzlers ernst nahm und ihn als Politiker der Habsburgermonarchie jenseits von klein- oder großdeutsch in den europäischen Zusammenhang stellte.[18]
Neben den Werken der Fachhistoriker zieht sich ein Kometenschweif hin von mehr oder weniger populären Lebensbeschreibungen aus der Hand von Diplomaten, Militärs, Journalisten, insgesamt Hobbyhistorikern, die jeweils von einer Seite Metternichs besonders fasziniert waren und durch die hohen Auflagen ihrer Werke nicht selten kräftig dazu beitrugen, bestehende Klischees zu verbreiten und zu verfestigen, und das von Anfang an. Da reihen sich seit dem Todesjahr des Kanzlers aneinander: ein preußischer Kammerabgeordneter und liberaler Journalist,[19] ein österreichischer Gymnasiallehrer und Bildungspolitiker,[20] ein englischer Colonel,[21] ein österreichischer Major mit kulturgeschichtlichem Interesse,[22] ein Spirituosenkaufmann der Firma Sandeman und Captain der englischen Armee,[23] ein feuilletonistischer Schriftsteller und Präsident des österreichischen PEN-Clubs,[24] ein französischer Botschafter in Luxemburg,[25] ein Schweizer Diplomat,[26] ein französischer Hochkommissär in Österreich und General,[27] ein Dramaturg, Schriftsteller und Schauspieler,[28] ein Chefredakteur der Deutschen Welle,[29] eine britische Klatschreporterin und Bestsellerautorin,[30] ein Schriftsteller und Mitglied der Gruppe 47[31] sowie ein Arzt, umgeschulter Historiker und Gründungsmitglied des Opus Dei.[32] Metternich eignet sich gewissermaßen als immer taugliches Medium, um als Autor einen Markt zu erreichen und sich zugleich volkspädagogisch zu betätigen. Als Beispiel sei der brandenburgische Lehrer und freie Schriftsteller Bernd Schremmer angeführt, der alle denkbaren Klischees in seinem Buch «Kavalier und Kanzler» bedient: Metternich sei ein Absolutist gewesen, ein Unterdrücker, reformunfähig, im Selbstbetrug lebend, der personifizierte Antidemokrat, dessen bleibendes Verdienst darin bestehe, durch den Widerstand, den er hervorgerufen habe, ungewollt der Demokratie Vorschub geleistet zu haben.[33]
Fast alle genannten Biografien haben eines gemein: Sie stützen sich auf die immer gleichen Zeugnisse – besonders die keineswegs immer zuverlässige Edition der «Nachgelassenen Papiere» Metternichs und andere Autoren, namentlich auf Srbik als die eigentliche, unangefochtene Fundquelle und kanonische Autorität – und konstruieren daraus ihr jeweils eigenes Metternich-Bild, ohne je ihre Wertungen an den authentischen, in den Archiven lagernden Quellen überprüft zu haben. Man muss daher sagen, dass im Grunde seit den Quellenforschungen Srbiks keine vergleichbar eigenständige Biografie Metternichs mehr erschienen ist.
3. Risiken und Grenzen der Metternich-Biografie Heinrich von Srbiks
Deshalb ragt das 1925 erschienene Werk des Wiener Historikers unter allen bisherigen Biografien hervor – an Gelehrsamkeit, Belesenheit und in der Erschließung der Quellen. Es wird zu Recht als große Lebensleistung eingeschätzt. Srbiks Name scheint nicht nur in der Fachwelt, sondern auch in der gebildeten Öffentlichkeit geradezu symbiotisch mit demjenigen Metternichs verbunden zu sein, so dass die bei ihm entnommenen Informationen schlechthin als verbürgt behandelt werden, selbst wenn sie durch neuere Forschung zweifelsfrei widerlegt worden sind.
Ich will das nur an einem Beispiel für viele andere veranschaulichen. Der zum 200-jährigen Jubiläum des Wiener Kongresses kürzlich erschienene Prachtband[34] enthält auch über Metternich einen kleinen biografischen Abriss mit dem sehr treffenden Titel «Das Leben eines Geradlinigen». Darin berührt der Autor unter anderem Metternichs Zeit als Pariser Botschafter, verbunden mit dem Urteil, Metternich habe sich in seiner Einschätzung der politischen Lage im Jahre 1809 weitreichender Fehlinterpretationen schuldig gemacht; er habe den Entschluss Österreichs zum Krieg mit seinen Berichten aus Paris und als Befürworter eines Volkskriegs «zu einem Gutteil» herbeigeführt. Diese These ist längst – seit 1968 – durch eine akribische Recherche in den Wiener und Prager Akten definitiv widerlegt.[35] Das überholte Urteil entnimmt der Autor der Interpretation Srbiks, welcher wertete, ohne die einschlägigen Quellen heranzuziehen, weil diese «schier unermesslich» seien. Srbik machte Metternich «zu einem Haupturheber des glorreichen, unglücklichen Krieges von 1809».[36] Von der Revision weiß der jüngere Autor nichts und übernimmt die Meinung Srbiks, weil er dessen Biografie für «nach wie vor […] unübertroffen» hält.[37]
Doch es sind nicht allein Einzelheiten, die der Korrektur bedürfen.Was das Werk Srbiks beim heutigen Wissensstand hochproblematisch macht, ist die Webart insgesamt, seine zugrunde liegende ideologische Textur, welche unmittelbar auf die Deutung seiner Hauptfigur abfärbt.
Jeder, der sich dem Leben und der Politik Metternichs zuwendet, steht vor einem zweibändigen Gebirge von 1431 Seiten, und kaum jemand hat jede Zeile gelesen. Da meine Biografie auch Wege zu Quellen beschreitet, die Srbik bewusst vermieden hat oder die ihm versperrt waren, erscheint es an dieser Stelle geboten, über die Risiken aufzuklären, welche der Gang durch das Œuvre von 1925 birgt. Um dabei jeden Verdacht auszuräumen: Der Abstand zwischen dem Heute und 1925 ist in jeder Hinsicht zu groß, um sich noch der «Lust an der Ermordung der Großväter» hinzugeben. Thomas Nipperdey gebrauchte diese Formulierung einst, als er dafür plädierte, die Geschichtsschreibung zu entnationalisieren. Dieser Appell allerdings ist nach wie vor aktuell.[38]
Der biologistische Rassismus Einen biologistischen Rassismus als Untergrund von Srbiks Biografie hervorzuheben mag angesichts des Renommees, das der Autor genießt, schockieren. Er lässt sich aber leider nicht verschweigen, weil er wesentlich die Grundwertung Metternichs bei Srbik steuert. Hier wie bei den noch folgenden Thesen lasse ich Srbik ausnahmsweise ausführlich in eigenen Formulierungen zu Wort kommen, weil die authentische Dokumentation vor dem Vorwurf bewahren soll, ihm werde unzulässigerweise oder gar böswillig etwas unterstellt, das nicht zutreffe.
Srbiks Schlüsselthese bei der Suche nach dem «Ideengehalt des Systems» Metternich lautet: «Der übergeordnete Begriff ist Metternich der Begriff der Rasse» (1, 389). Das ist vollkommen abwegig.[39] Sucht man nach Schlüsselbegriffen Metternichs, so sind es das «Recht», wie er es verstand, die «Nationalität» und vor allem die «Gesellschaft», und gerade diese begriff er ganz im modernen Sinne als einen «Kollektivsingular» (Reinhart Koselleck).[40] Schon das allein rückt Metternich in ein anderes Koordinatensystem als das von Srbik unterstellte. Und die zitierte These ist kein einzelner Ausrutscher. Vertiefend sagt Srbik über Metternich: «Den Sonderungstrieb der deutschen Stämme, Staaten und Landschaften sah er als unveränderliche Rasseneigenschaft tief in der deutschen Natur und Geschichte verwurzelt» (1, 406). Die «geistige Eigenart», den «Charakter der großen Völkerstämme», welche Srbik an Metternich erkennt, vereint er unter dem Oberbegriff von «Rassen», in die Europa im 19. Jahrhundert zerfallen sei (1, 355). Diese Nomenklatur hat System, wie sein Urteil über die Verträge von Tilsit aus dem Jahr 1807 zeigt: «Romanen- und Slawentum einigten sich zur Beherrschung und Teilung der Erde und zur Erdrückung Deutschlands und Englands» (1, 115).
Beim Staatsbegriff stellt Srbik, der völkischen Zivilisationskritik folgend, den alten Staat als regelgerecht arbeitenden Apparat und rational zu begreifenden Zweckverband einem neuen Staat gegenüber, der ihm «als blutvoller Naturkörper» gilt (1, 374). Er präfigurierte darin die nationalsozialistische Volkskunde. Er definierte als eigentliche politische Aufgabe, welche Metternich in seinen Augen verfehlte, «die Führung des deutschen politischen Körpers» zu sichern (2, 391). Den Gegensatz dazu erkennt er in der «europäischen Staatspersönlichkeit Österreichs» (1, 198). Ganz im Sinne des von ihm rezipierten Oswald Spengler machte er Völker und Kulturen zu «individuell beseelten Organismen».[41]
Srbik fragt nach der «Scheidung von Rasse, Volk und Nation» (1, 406). Es sei «das deutsche Volk ein Gefüge von germanischen Volksstämmen», das in «Blutsgemeinschaft» lebe (2, 391). Was teilweise anmutet, als zitiere er aus historischen Texten, ist Srbiks ureigene Überzeugung, welche er 1951 noch einmal ausdrücklich bekräftigte, als er «der möglichst unbefangenen Wertung der Rassenideologie» das Wort redete[42] und auch da noch für eine richtig verstandene «deutsche Rassenlehre» plädierte.[43]
Nationalismus als Waffe Die Konsequenzen für das Metternich-Bild liegen auf der Hand und bestehen in einer Kette abwertender Urteile, wo der Historiker eigentlich Erklärungen durch historisches Einordnen erwartet. So heißt es über Metternich: «Die sittlichen und geistigen Energien im Volk, die wachgerufen das wahrhaft größte Rettungsmittel bildeten, waren ihm innerlich fremd geblieben» (1, 124). Srbik konstruiert und unterlegt deduktiv einen integralen und unhistorischen Begriff von «Volk», wo bei Metternich der anders zu verstehende Ausdruck «Nationalität» steht. Diesem Maßstab folgend, schließt er, dem Wesen Metternichs habe «die Gabe des Heroismus, die zum Höchsten befähigt», gefehlt, «da ihm die Erkenntnis vom politischen Wert nationaler Kulturgüter, eines autonomen Nationalstaates und der Umwandlung des Monarchenheeres zum Volksheer nicht aufgegangen war»; Srbik vermisst an ihm die Einsicht in die «Einheit von Staat und Volk, Staat und Kultur» (1, 127).
Metternich habe «von Haus aus von einer staatlichen und kulturellen Gemeinschaft des deutschen Volks nur geringe und vage Vorstellungen» gehabt «in seiner nations- und staatsfremden Denkart» (1, 85). Der «Maßstab deutschen Nationalstaatsempfindens» sei ihm während der Jahre 1813–1815 fremd gewesen (1, 180), und er habe eine «Kälte gegen das nationale Wollen» gehegt (1, 197). Srbik spricht Metternich «vaterländisches Gefühl» ab (1, 125), und selbst wenn Metternich gegenüber Napoleon vorbringt, er verstehe sich als Deutscher, wendet Srbik ein: Sein «Deutschtum war ganz das unrealistisch-universale des endenden vergangenen Jahrhunderts» (1, 407), womit er Metternich im Letzten als «undeutsch» ausweist: So diagnostiziert er «seine europäische, nach der Anschauung von heute unnationale Gesinnung», welche ihn «mit Österreichs unnationaler Staatspersönlichkeit innerlich verband» (1, 193). Er folgert: «In Metternichs Geist und Herzen gab es keinen Bezirk, der sich den hohen Werten eines deutschen nationalen Reiches oder Bundesstaates erschlossen hätte» (2, 378). Srbik behauptet das, obwohl Metternich vom Deutschen Bund als «Deutschland» und «Vaterland» sprach. Damit ist der von Metternich gewollte Föderalismus im Kern verurteilt, weil der Staatskanzler «ein Vertreter der für Österreich in der Tat gebotenen föderalistischen Idee war. Diesen Föderalismus wollte er nicht auf nationalen Einheiten, sondern auf den historisch-staatsrechtlichen Körpern der Länder aufbauen und nicht über die verwaltungsrechtliche Sphäre hinausgedeihen lassen» (2, 189).
Der vermisste Wille zu einem deutschen Kulturimperialismus Metternich distanzierte sich mehrfach und ausdrücklich von jeglichem «Germanisieren» nach dem Muster Kaiser Josephs II. und plädierte für eine Gleichberechtigung der Nationalitäten in der österreichischen Gesamtmonarchie. Daraus macht Srbik einen Vorwurf, denn er vermisst an Metternich den für ihn gebotenen Kulturimperalismus der Deutschen nach innen. «Der deutschen Nationalität gebührt ein Vorrang unter den vielen, die den Raum des Staates füllen, da das Herrscherhaus ihr ursprünglich angehört und da sie das wahre zivilisatorische Element in dieser ungeheuren Vereinigung von Völkern ist. Kraft ihrer kulturellen Überlegenheit ist sie also zur Führung im Staat berufen.» (1, 431)
Srbiks Grundverständnis führt dahin, dass er Metternichs elementar defensive, d. h. auf Friedenswahrung bedachte Politik nach außen von vornherein als falsch zensiert. Deshalb verfehlt der Staatskanzler auch seinen vermeintlichen Auftrag in Ost- und Südosteuropa während der Revolution von 1848 / 49, als «die deutsche Seele im tiefsten verwundet» worden sei (2, 372). Srbik beschreibt für die Revolutionszeit die Gefahr, dass Österreichs «deutsches Führervolk in dem vielsprachigen Staat als Minderheit von den Fremdnationalen zurückgedrängt, überwältigt, zur Erfüllung der Aufgabe unfähig werde, einen natürlichen Raum mit vorwiegend deutscher Kultur zu durchdringen»; er sieht die «deutschösterreichische volkliche Sonderart vor der Gefahr der Verslawung» und plädiert für «eine Ausbreitung deutschen materiellen, geistigen und machtpolitischen Einflusses nach dem ferneren Osten» in Europa (2, 373). Srbik folgt dabei der Überzeugung: «Die panslawische Idee wandte sich von Anbeginn mit dem elementaren Undank des nationalen Instinkts gegen das kulturbringende Deutschtum» (2, 188). Aus allem wird deutlich: Srbik wirft Metternichs Vorstellungen von Staat, Recht, Föderalismus und Nationalität ein Deutungsmuster über, das per se nicht auf historische Erklärung, sondern auf Verurteilung hinausläuft. Metternichs Fehler lag für Srbik darin, den europäischen Osten nicht für die Deutschen erobern zu wollen.
Das Herrenmenschentum und der politische Führermythos Für einen Biografen ist es eine elementare Frage, ob und inwiefern er ein bestimmtes eigenes Menschenbild zur Norm erhebt. Ein wissenschaftlich arbeitender Historiker muss gerade hier das Äußerste an Selbstkritik und Vorsicht aufbieten. Der Leser und die Leserin Srbiks werden demgegenüber mit einem apodiktischen Ideal konfrontiert, dem sich Metternich zu beugen hat. Es gibt Persönlichkeiten, welche für Srbik vorbildlich sind: Mazarin, Richelieu, Stein, Napoleon und vor allem Felix Fürst zu Schwarzenberg, der 1848 aus der Revolutionsära hervorgegangene österreichische Ministerpräsident. Zu Srbiks Wertekanon gehören folgende Urteile: Metternich «fehlte stets das Größte: politische Leidenschaft, eiserne Energie, neue gestaltende Schöpferkraft» (1, 316); er sei «keine starke Persönlichkeit, kein Richelieu und kein Mazarin» (1, 319); Napoleon hingegen besitze «die Gewalt der Persönlichkeit des Weltbezwingers» und ein «titanenhafte[s] Herrschaftsstreben» (1, 347). Zu 1848 schreibt Srbik, es «fehlte der Zeit an einem großen Menschen zur Schaffung einer neuen Weltordnung»; Metternich «entbehrte in seiner Politik des prometheischen Funkens wahrhaft schöpferischer Kraft» (1, 229). «Ein Mann der großen, entscheidenden, schaffenden Tat ist er niemals gewesen» (1, 113).
Das positive Gegenbild sieht Srbik in Schwarzenberg verkörpert: Dieser sei ein «Tatmensch», «ein schöpferischer Geist, absolutistisch seinem ganzen Wesen nach, aber fähig, für seine große Staatsidee auch mit Verfassung, Bürgertum und Massen zu paktieren; ein kühner und kaltblütiger Rechner mit Machtrelationen und Augenblickslagen, der mit andern Staaten ohne Rücksicht auf Legitimität und Tradition ein virtuoses Schachspiel treibt […]; eine politische Herrennatur und ein Kämpfer» (2, 391). Srbik glorifiziert in Schwarzenberg den «ehernen Willensmenschen» mit «der politischen Führergabe» (2, 450). Was Metternich in den Augen des Biografen nicht vermochte: «Schwarzenberg trieb die deutsche Frage der Lösung zu» (2, 392).
Srbiks Ideologie des Herrenmenschentums hervorzuheben ist bedeutsam, weil sie in einem Koordinatensystem verankert ist, welches den Typus des westeuropäischen Rechtsdenkens mit seiner Betonung von Völkerrecht und Konstitutionalismus für veraltet erklärt. Die Konsequenz für Srbiks Biografie lautet: Sie lässt Metternich als den Staatsmann der verflossenen Zeit erscheinen, der Österreich zwar zu stärkerer Einheit habe führen wollen, aber nach dem Maßstab des Völkerrechts und der Urkunde des Deutschen Bundes (2, 391). Der Rationalität politischen Handelns wird die Irrationalität der Tat übergeordnet. «Das Wesen eines führenden Staatsmanns ist […] niemals durch seine politische Theorie zu erschöpfen. […] Aus seinem Handeln ist das egoistische Moment, der Machtwille und Wirkensehrgeiz nicht wegzudenken.» (1, 414 f.) Metternich ermangelte «des blutvollen Lebenstriebes in der eigenen Brust», der ihn – wie einst Friedrich den Großen – befähigt hätte, «heroisch-kühn zu handeln und machiavellistische Politik zu treiben», nicht aber «die kleinen und kleinlichen Mittel der Staatskunst» anzuwenden (1, 415).
Zur weltkriegsentscheidenden Vermittlungspolitik Metternichs Mitte 1813 urteilt Srbik seinem Maßstab gemäß: «Diese Politik ist von keinem Strahl von Heroismus umglänzt, sondern kaltherzig und noch verschlagener als die Hardenbergs; sie kannte nicht Hass und Seelengröße» (1, 149). Was hilft es da, dass Srbik nach dieser kompromisslosen Verurteilung und vollkommen im Widerspruch dazu gerade diese Politik als alternativlos ausgibt: «Sie war in ihrer meisterhaften Überlegtheit doch wohl allein geeignet, das wracke Boot Österreich wieder flottzumachen und zugleich den engeren Staatsinteressen wie der alten Staatengemeinschaft zu dienen und doch nicht alles auf eine Karte zu setzen». Denn es bleibt das Urteil: «Seine Politik sollte die der Nüchternheit, der leidenschaftslosen Phantasielosigkeit sein» (1, 164). Metternichs Vorbehalte gegenüber Blüchers risikobehafteten Eigenmächtigkeiten, wodurch manches Gefecht verloren ging, könne man als «ethisch nicht allzu hoch werten» (1, 167).
Hier muss das Charakterbild, das Srbik von Metternich entwirft, im Zusammenhang zitiert werden, um es zutreffend verorten zu können. Er resümiert: «Doch hat Metternich nicht zu den ganz Großen gehört, die ihre persönliche Eigenart, die Individualität ihres Lebens neu gestaltend einem Zeitalter aufgeprägt haben. […] Er war kein tiefer und kraftvoller Denker, und es fehlte ihm die Gabe eisern und rücksichtslos zugreifender konzentrierter Energie. Metternich hatte keinen gewaltigen Machtinstinkt, er war seiner ganzen Natur nach kein Tatmensch, er scheute die entschiedene Opposition und scheute den Kampf großen Stils […]; denn das graziöse Weichempfängliche seines Wesens überwog den männlichen Wagemut von Anbeginn an.» (1, 257) Es spricht für sich, dass Srbik diese Charakterzeichnung ausgerechnet dem Metternich-Hasser Hormayr verdankt.
Nimmt man alle Charakterisierungen Srbiks zusammen, so verdichten sie sich zur Ideologie des Herrenmenschentums und zu einem Führermythos, wie Srbik sie geistesgeschichtlich vor allem bei Nietzsche vorfand. Über diesen Menschentyp referiert er distanzlos, er setze sich «über die Konvention und Moral […] durch die Herrenmoral des Starken, des neuen Übermenschen, hinweg, der, ganz dem Diesseits hingegeben, heroisch nach seinem eigenen Gesetz allein lebt. Er ist der Führer einer adeligen Auslese, der die Knechtsnaturen zu gehorchen haben, der Wille zur Macht steht an der Spitze seiner Tafel der Werte, der Übermensch steht über dem Recht, ein Wagender, Kämpfer und Sieger inmitten des raubtierhaften Menschentums.»[44] Srbik ließ sich in diesem Pathos, vor dem ein rationaler Politiker wie Metternich zwangsläufig scheitern musste, ebenso von Nietzsches Schüler Oswald Spengler inspirieren.[45] Hier überwindet die Norm die historische Realität, denn sie ignoriert die politischen Handlungsspielräume Metternichs. Ausgeblendet bleibt bei Srbik auch, wie stark der Kaiser und die anderen Hofstellen, besonders die Hofkammer, den «Tatmenschen» im Handeln immer beschränken mussten.
Die Irreführung durch persönliche Erinnerungen Doch es sind nicht allein die ideologischen Vorurteile, welche Srbiks Metternich-Bild geradezu kontaminieren: Auch das Übermaß an Erinnerungsquellen kann seinen sachlichen Blick gefährden. Denn Srbik bekennt einleitend, «dass an eine systematische Durcharbeitung der schier unermesslichen Bestände des Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien und der Akten- und Briefmassen des Fürstlich Metternichschen Familienarchivs in Plaß für den Einzelnen […] nicht zu denken war» (1, XII). Akten untersuchte er stichprobenweise und enttäuschte gerade darin Metternichs bereits beschriebene Hoffnung, künftige Historiker würden sich nicht auf die Meinungen, Gerüchte und Stimmungen der Zeitgenossen verlassen, sondern nach den Taten und Handlungsabläufen forschen, wie sie in den staatlichen Akten niedergelegt seien. Welche Erkenntnisse gewährt beispielsweise die Reihe der «Vorträge» Metternichs an den Kaiser zwischen 1809 und 1848 im Wiener Archiv, wenn man sie einmal systematisch – namentlich bis zum Tode Kaiser Franz’ I. 1835 und nicht nur stichprobenweise für drei Jahre – durchmustert! Erst so versetzt man sich gleichsam an Metternichs Schreibtisch in der Staatskanzlei, löst sich von den subjektiven Augenblickseindrücken der Zeitgenossen und kann ermessen, welche und wie viele Probleme und Themen im Laufe seiner Amtszeit über sein Pult gingen.
Persönliche Quellen, wie Srbik sie bevorzugt, sind als solche zwar auch wertvoll, aber riskant, weil sie nicht verraten, inwiefern sie über subjektive Impressionen hinaus Gültiges mitteilen. Wie zuverlässig ist etwa ein Urteil über Metternichs Charakter und Persönlichkeit aus der Sicht des verbitterten Hormayr? Srbik erliegt oft den Urteilen seiner Gewährsleute oder – vielleicht schlimmer – betont daran, was seinem Normenraster entgegenkommt. Wenn Friedrich Gentz an einem bestimmten Tag aus dem Augenblick heraus an Metternich eine «Neigung zu Trägheit» feststellt – reicht das, um diesen als zeitweise pflichtvergessen, sprunghaft und ohne feste Zeiteinteilung darzustellen, weil er seinem «individuellen Genusstriebe» nachgehen wollte (1, 255)? Damit bedient Srbik einmal mehr das Klischee des genusssüchtigen Höflings, oberflächlich, eitel, leichtsinnig (1, 143) und von groteskem Eigendünkel (1, 270). Wie kann ein Mensch dieses Zuschnitts so viele Dokumente hinterlassen, dass Srbik in den Archiven von Wien und Plaß vor den «schier unermesslichen Beständen» persönlich kapituliert hat?
Die Widersprüche im Metternich-Bild Auch wenn man Srbiks Leistung ungeachtet aller genannten Einwände gerecht werden will, macht er es dem lesenden Publikum nicht leicht. Denn unterhalb seiner Axiome kommt er zu vielen zutreffenden Charakterisierungen, mit denen er seinem ideologischen Überbau diametral widerspricht. Einerseits sah Metternich angeblich «die nationale und die freiheitliche Tendenz des Jahrhunderts schlechterdings nur als zerstörende Kräfte» (2, 312); andererseits habe er dahin gewirkt, «dass der Staat durch Schonung der nationalen Verschiedenheiten an Festigkeit gewinnen könne»; denn er habe die «Förderung der geistigen und materiellen Entwicklung der Nationalitäten» gefordert (2, 184).
Bei der Herabsetzung der geistigen Qualitäten Metternichs geizt Srbik an keiner Stelle: «Er hat niemals erkannt, wie viel Doktrinarismus seine Prinzipienlehre enthielt» (1, 322). Ganz im Gegensatz dazu befindet er: «Er ist Empiriker, aber über dem reinen Empirismus steht die konstruktiv das Wirkliche zusammenfassende Theorie» (1, 306). «Er war ‹Philosoph› im Sinn der Zeit seiner Geburt; theistisch gerichtet, ein Verehrer der Vernunft, die fähig ist, die ewigen Wahrheiten bis zu einer sehr fernen Grenze zu erkennen.» (1, 307)
Einerseits erscheint Metternich als Reaktionär und Stabilitätspolitiker des «patriarchalisch-ständischen Absolutismus» (2, 446), als Mann der «reinen Monarchie» (2, 303). Im Gegensatz dazu attestiert Srbik ihm an anderer Stelle, er habe zwischen 1842 und 1844 die ganze Staatsverwaltung reorganisieren wollen, ein großes Sanierungsprogramm geplant (2, 198) und im Falle Ungarns «einen entschiedenen Willen zur positiven fruchtbaren Arbeit bekundet» (2, 200).
Diese und andere Widersprüche des Biografen lassen sich allesamt nicht auflösen. Sie deuten darauf hin, dass im Manuskript unterschiedliche Stufen der Bearbeitung ineinander gefügt worden sind oder aber der Autor situationsbedingt dem vorherrschenden Eindruck der ihm je vorliegenden Quellen erlegen ist. Immerhin vermochte er die Fülle der Beobachtungen und Informationen nicht gänzlich dem Diktat der eigenen Normen zu unterwerfen – man möchte sagen: glücklicherweise, weil dadurch mitunter die apodiktischen Verurteilungen wieder relativiert werden. Leser und Leserin müssen sich freilich mit der gehörigen Skepsis wappnen, um zu entscheiden, welche Urteile sie für richtig halten und übernehmen. In diesem Sinne bekommt die lange kanonisierte Biografie wegen ihrer zwiespältigen Wertungen und Weglassungen tatsächlich biblische Dimensionen: Man kann aus ihr einen «guten» und einen «bösen» Metternich herauslesen.
Alles in allem ist der Punkt gekommen, an dem der heutige Biograf einer neuen Zeitgenossenschaft gerecht zu werden hat, der ja kein Autor entkommen kann. Eine solche öffnet jeweils auch neue Blicke auf ein früheres Leben. Diese Zeitgenossenschaft ist jetzt nicht mehr diejenige der Weltkriege, sondern die einer fünften Generation nach 1945: die der weltpolitischen Wende von 1989 / 90. Diese vermag gleichermaßen eine Generationserfahrung von Historikern zu prägen, hat sie doch bis heute die größten Folgen für Europa wie für die «deutsche Frage». Zu den Themen der nach 1945 geborenen Generationen gehört nicht allein «Metternich and Austria. An Evaluation»,[46] sondern in einem weiteren Sinne noch – in meiner Formulierung – «Metternich and Europe: revisited». Es ist ein vielversprechendes Zeichen, dass jüngst der Italiener Luigi Mascilli Migliorini (* 1952) die erste Metternich-Biografie seines Landes veröffentlicht hat, in welcher der Staatskanzler als «Architekt Europas» und nicht als Feind Italiens erscheint.[47]
I. HERKUNFT
Familienbande und Aufstieg
Warum gerade die Metternichs? So könnten Leser fragen, wenn vor ihren Augen genealogische Tafeln mit Hunderten von ausgestorbenen Adelsgeschlechtern seit dem Mittelalter vorbeiziehen. Warum sind diese übrig geblieben und andere nicht? Eine solche Genealogie, ein «Geschlechts-Register», hat schon im Jahre 1751 Johann Gottfried Biedermann veröffentlicht, der hochfürstlich brandenburgisch-kulmbachsche Pfarrer. Die aus dem Mittelalter herkommenden Ahnenreihen lesen sich bei ihm wie ein großer Adelsfriedhof, auf dem immer neue Zweige von Geschlechtern ihre letzte Ruhestätte fanden, Vertreter des niederen landsässigen Adels, der aufgestiegenen Freiherren und der Reichsgrafen. Von diesem Aussterben waren auch die meisten Seitenlinien der Metternichs nicht verschont geblieben, die zu Burscheid, zu Niederberg, zu Chursdorff, zu Rodendorff und Müllenarck. Aber die wichtigste Linie hatte überlebt: die zu Winneburg und Beilstein. Über die Bedeutung der Herren, Freiherren und Grafen von Metternich urteilte Biedermann: «Dieses ist eines der größten und vornehmsten gräflich und freiherrlichen Häuser in ganz Teutschland». Es hatte bis dahin allein drei kurfürstliche Erzbischöfe hervorgebracht – so viele wie neben ihm nur die Schönborns. Und von dem berühmtesten Zögling, dem späteren österreichischen Staatskanzler, war damals noch keine Rede![1] In diesen dynastischen Urgrund wurde er hineingeboren.
Liegt in jenem Überleben der Linie möglicherweise ein Schlüssel, der auch die Tür zu dem beispiellosen Lebensweg der Hauptfigur dieses Buches öffnen hilft? Bisher hat man viel zu wenig danach gefragt, was Metternich seine altehrwürdige Herkunft bedeutet haben mag, aber auch, was sie ausstrahlte. Sie gab ihm, wonach ein Emporkömmling wie Napoleon geradezu gierte: Das alte, über Generationen zurückreichende Herkommen verlieh ein Selbstbewusstsein, aus eigenem Recht zu leben, das auf «Land und Leuten», also großem Besitztum und eigenberechtigter Herrschaft beruhte, welche eingebettet waren in ein weitverzweigtes Netzwerk von nahen und ferneren Verwandten über das ganze Alte Reich hinweg. Allein der ruhmvolle, klingende Name eines Geschlechts übertrug eine Aura auf dessen einzelne Vertreter. Sosehr die bürgerlich-revolutionäre Adelskritik die Sichtweisen seit 1789 verändert haben mochte: Als sich Metternich und Napoleon im Juni 1813 in ihrem berühmten Dresdner Disput gegenüberstanden, schwang jenseits der ausgetauschten Worte auf einer höheren Ebene das Bewusstsein mit, dass hier ein Aufsteiger – Metternich sagte «Parvenu»[2] – einem traditionsreichen Würdenträger gegenüberstand, obwohl der eine sich «Empereur», der andere nur Staatsminister nannte. Deshalb lohnt es die Mühe, sich auf jene andere, altadlige und zugleich alteuropäische Denk- und Lebenswelt einzulassen. Nur so versteht man dann später, ob und inwiefern Metternich tatsächlich nur als Exponent des Ancien Régime, der «Restauration» und des Rückschritts zu gelten hat oder nicht vielmehr als der Überwinder einer im Alten Reich befangenen Traditionalität.
Wie wenig man die adlige Herkunft der Metternichs und ihre Einbettung in den Reichsverband unterschätzen darf, zeigen nicht nur diese wenigen Vorausdeutungen, sondern ebenso unsere neu gewonnenen Kenntnisse aus der frühneuzeitlichen Forschung zu vergleichbaren Karrieren prominenter Adelsgeschlechter, etwa zu der des Hauses Schönborn – einer Säule des katholischen Reichsadels in Süddeutschland.[3]
Aus dem Abstand der Zeiten heben sich drei tragende Fundamente des Jahrhunderte überdauernden Erfolges der Metternichs ab; drei Worte bezeichnen sie: Kaiser – Kirche – Familienstärke. Der Hinweis auf den Kaiser besagt: Anlehnung an die Macht, Kirche bedeutet: Einbettung in das karrierefördernde Netzwerk der katholischen Reichskirche, Familienstärke schließlich heißt: die regelmäßige Erzeugung zahlreicher Nachkommen, darunter immer eines Stammhalters, sowie die dauerhafte Entfaltung einer zielgerichteten Energie, um den familiären Besitz zu wahren und zu vermehren.
Versuchen wir einmal, uns den Aufstieg in der adeligen Rangordnung als einen Gang durch ein Palais mit fünf Stockwerken vorzustellen:[4] Im Parterre residierte der Brief-, Hof- und Dienstadel ohne alle weiteren Würden – das waren im Mittelalter zunächst die Ministerialen und einfachen Ritter. In die erste Etage hatten es diejenigen geschafft, die sich Herren nennen durften, in Fehden einen Stammsitz – eine Burg – erkämpft hatten oder für ihre Dienste damit belohnt worden waren und von dort ihre Herrschaft über «Land und Leute» (Wilhelm Heinrich Riehl) ausübten; denn adelige Qualität und Herrschaft ließen sich dauerhaft nur durch Landbesitz begründen. Die zweite Etage war den Freiherren vorbehalten, ausgestattet mit Privilegien, welche sie «Freiheiten» nannten, etwa dem Recht auf Sitz und Stimme in den ständischen Vertretungen des Landes. Einen weiteren Aufstieg bedeutete der Übergang in das dritte Geschoss der Grafen, die wie kleine Regenten über ihre Untertanen herrschten, richteten und wachten. Sie waren reichsunmittelbar, hatten Zutritt zum Reichstag des Heiligen Römischen Reiches und hatten sich dort in einer eigenen Kurie vereinigt. Die oberste Beletage schließlich war den Fürsten vorbehalten. Sie galten als der wichtigste Stand im Reichstag, und ihre Stimme hörte man, bevor die anderen an der Reihe waren. Je höher man in diesem Palais aufstieg, umso geringer war die Zahl der Bewohner, aber umso mehr Kraft bedurfte es vorzudringen. Es erforderte Zähigkeit und Ausdauer über Generationen hinweg, um nach oben zu kommen.
4. Die Ministerialen
Der folgende Weg wird uns in dem hier erdachten Palais die fünf Stockwerke durchsteigen lassen, wie es die Metternichs getan haben; in der Frühen Neuzeit hätten die Zeitgenossen den Adel im Bild einer «Ständetreppe» eingeordnet. Der Gang aufwärts wird auch die Frage «Warum gerade die Metternichs?» beantworten helfen. Die ältesten Spuren der Familie sind in der Tat im Parterre angesiedelt, wo man Angehörige des Geschlechts als rechtsprechende Vögte im Dienste der Merowinger oder der karolingischen Pippine vermutet, auf dem Gebiet der alten Colonia Agrippina und der Colonia Trevirensis (Köln und Trier). Seit dem Jahre 1166 traten dann Kämmerer der kölnischen Kirche ins Licht der urkundlich bezeugten Geschichte, Angehörige des dienstadligen Geschlechts derer von Hemberg in Hemmerich bei Bonn; sie führten drei schwarze Jakobsmuscheln im Wappen. Ein Zweig von ihnen errichtete am Fuß der Burg Hemmerich in dem Ort «Metternich» eine Wasserburg[5] und nannte sich fortan «Herren zu Metternich». Diese behielten auffälligerweise in ihrem Wappen die Muscheln bei, zeigten sich also denen zu Hemberg verbunden. Noch der spätere österreichische Staatskanzler band 1813 die drei Muscheln in sein neu zu bildendes Fürstenwappen ein.
Wappen der Metternichs aus dem Jahre 1707
Der Name «Metternich» lässt auf eine ursprünglich keltische Niederlassung schließen, und zwar dort, wo sich später durch die römische Besiedlung eine Straßensiedlung an der Strecke von Deutz nach Trier bildete. Die Legende des Metternichschen Hausarchivars, man könne gar von einer römischen Herkunft ausgehen, könnte daher vielleicht ein Körnchen Wahrheit enthalten. Der Ort existiert noch heute. Wer es genau wissen will, findet die Anfänge der Metternichschen Herrschaft räumlich zwischen Bonn und Euskirchen im fruchtbaren Lössgebiet des lang gezogenen Tals der Swist zwischen der Grenze der Herrschaft Tomberg im Süden und der Mündung der Swist in die Erft im Norden.
[6]
5. Die Herren von Königswart
Der «erste Vertreter des Muschelstammes»,[7] der sich im frühen 14. Jahrhundert als Herr von Metternich urkundlich belegen lässt, ist ein gewisser Sybgin (oder Sibido) von Metternich – ein Lehnsmann und Ritter des Erzstifts Köln. Er ist der Ahnherr einer nun ununterbrochen nachweisbaren Abfolge von Metternichs, die in der vierzehnten Generation zum Protagonisten dieses Buches führt. Der Stammvater Sybgin setzte den Fuß in das erste Stockwerk – in das der adligen Herren, die sich nun nicht nur mit einem eigenen Wappen zu erkennen gaben, sondern auch über einen Stammsitz verfügten.
Aber jetzt trat das ein, was für den Herrenstand des niederen Adels typisch war. Der Metternichsche Hausarchivar Alfons von Klinkowström, der 1882 eine kurze Rechtsgeschichte des Geschlechts verfasste, beklagte «die vielen Teilungen der Familie in eine Menge von Zweigen und Nebenzweigen», in die «vielfach zersplitterten Linien».[8] Herrschaftsänderungen erfolgten durch Erbteilung, Heiratsgewinne oder das Aussterben von Linien, mitunter auch durch Einsatz militärischer Mittel. Am wechselnden Stammsitz der Metternichs lässt sich das Ringen ums Überleben und Obenbleiben ablesen, aber auch die Orte, an denen das Geschlecht seinen Lebensmittelpunkt hatte. Bevor mit den Freiherren zu Winneburg und Beilstein dauerhaft Kontinuität eintrat, wechselten die Stammsitze im Laufe von sieben Generationen von Metternich (Linie Niederberg) nach Sommersberg (Linie Chursdorff), Zievel (Linie Burscheid) und Vettelhoven.[9] Alle diese Burgen, deren Reste teilweise heute noch existieren, befanden sich im Dreieck zwischen Düren, Bonn und Münstereifel. Sämtliche Nebenlinien starben aus – mit Ausnahme derer zu Winneburg und Beilstein.
In der siebten Generation stand der Stammhalter Johann Dietrich (1553–1625) ohne eigentlichen Stammsitz da. Er konnte sich neben einigen anderen angeheirateten Gütern nur noch auf die in Sinzig[10] stützen, wo er Amtmann war, weil das väterliche Erbe der Herrschaft Vettelhoven an seinen älteren Bruder gegangen war. Johann Dietrich war zugleich auf die Stelle eines kurtrierischen Rats gerückt. Aber in dieser siebten Generation, auf einem durch Erbteilungen erreichten Tiefpunkt, erlebte das Haus die Wende hin zu seinem beständigen Aufstieg, denn es gelang, dem ruinösen Weg der Herrschaftszersplitterungen ein Ende zu machen. Dazu bedurfte es der gemeinsamen Kraft eines Brüderpaares: Der ältere Lothar vermochte es, von den beiden Säulen Kaiser und Kirche zu profitieren, indem ihn das Trierer Domkapitel 1599 einstimmig zum Kurfürsten auf dem Erzbischofsstuhl wählte. Der Jüngere, Johann Dietrich, trug das dritte Element bei: die Fruchtbarkeit seiner Ehe mit zwölf Kindern, davon allein neun Söhnen, die jedoch keinen Stammsitz mehr hatten. Sie boten dem brüderlichen Erzbischof Gelegenheiten genug, seinen Neffen mit kirchlichen Ämtern, zugekauften Gütern und Belehnungen Gutes zu tun. Und beiden Brüdern waren Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit gemein. Beide erblickten in dem Erwerb eines dauerhaften Stammsitzes das vordringliche Ziel der Familie.
Königswart Das Fundament für einen neuen Stammsitz wurde mit dem Kauf der Herrschaft Königswart (Kynžvart) gelegt. Wenn der Historie eine innere Logik innewohnte, wäre es nur folgerichtig, dass heute der wichtigste Erinnerungsort der Familie Metternich in Tschechien – in dem damaligen habsburgischen Kronland Böhmen – liegt. Dort stößt nunmehr der moderne Zeitreisende auf das prächtig restaurierte Schloss, und, betritt er das ehemals fürstliche Anwesen, wird ihn beim Gang durch die Räume das Gefühl befallen, als habe der alte Staatskanzler sie soeben verlassen. Beinahe 150 Jahre vor seiner Geburt erhielt sein Geschlecht mit dem Kauf der Herrschaft eine bis 1945 währende Existenzgrundlage, die es vordem so nie gehabt hatte, die es fortan aber zu sichern und zu mehren galt. Als Metternich sich von 1828 bis 1833 als Bauherr des Schlosses annahm, rief er den noch heute kunsthistorisch verkannten Leiter der Wiener Akademie der bildenden Kunst und Hofbaurat Pietro Nobile zu Hilfe.[11] Dieser verwandelte das ursprünglich als Renaissancefort errichtete, Ende des 17. Jahrhunderts durch ein Barockgebäude ersetzte Anwesen in ein klassizistisches Renaissanceschloss. Metternich führte also stilistisch und historisch den Stammsitz seines Hauses in dessen erste Blütezeit zurück. Ein solcher architektonischer Verweis auf die Zeit, als der Aufschwung seiner Familie begann, konnte kein Zufall sein.
Die Umstände des Kaufs spiegeln einen bisher beispiellosen familiären Kraftakt wider, der erneut alle drei Elemente des Metternichschen Erfolges geradezu idealtypisch vereinte: Es bedurfte reichskirchlicher Begünstigung, kaiserlichen Rückhalts und zielstrebiger Familienstärke.
Schloss Königswart nach der Renovierung von 1833
Als am 10. April 1630 Johann Reinhard aus der achten Generation der Metternichs auf dem Prager Schloss den Kaufvertrag in Gegenwart eines kaiserlichen Appellationsrates für sich und vier seiner Brüder unterschrieb,[12] geschah das an der Stätte, von der aus 1618 mit dem weltberühmten Prager Fenstersturz der Dreißigjährige Krieg begonnen hatte. Als ein Jahr später die böhmischen Vertreter sich der Wahl Ferdinands II. in Frankfurt zum römischen Kaiser verweigerten und die Wahl zu scheitern drohte, war es Kurfürst Lothar von Trier, der vehement Partei für den habsburgischen Kandidaten ergriff und dessen Wahl durchzusetzen half. Das vergaßen die Habsburger den Metternichs nie und erinnerten in allen Urkunden zur Standeserhöhung ihrer Gefolgsleute daran. Lothar hatte bereits zuvor den Zusammenschluss der katholischen Fürsten zur sogenannten Liga – dem Gegenbund zur protestantischen «Union» – betrieben (1609) und bei der Königswahl 1612 einen Habsburger (Kaiser Matthias) unterstützt.
Der Kauf von Königswart war ein Kraftakt, weil die fünf Söhne des inzwischen verstorbenen Johann Dietrich gemeinsam insgesamt 66 114 Rheinische Gulden als Kaufpreis aufbringen mussten. Es steht hier nicht an, genau zu verfolgen, woher das Geld kam. Ein Hinweis ist aber doch aufschlussreich dafür, wie sich Treue gegenüber dem Kaiser auszahlte. Einer der fünf Brüder, Wilhelm, erhielt für seine militärischen Dienste vom Hof der spanischen Habsburger 1629 eine Pension von 14 624 Gulden.[13] Es lohnt außerdem, auf die Ämter der vereinten Brüder im Jahre 1630 zu schauen, wie sie der Kaufvertrag aufzählt, um daran abzulesen, was für eine Pfründenkumulation die 24-jährige Herrschaft eines so mächtigen Kurfürsten und Onkels wie Lothar im Hintergrund bewirken konnte. Als Käufer traten auf:
– Johann Reinhard von Metternich zu Streichenberg, Domprobst zu Mainz, Administrator (Statthalter) des Stifts Halberstadt, Thesaurar (Güter- und Vermögensverwalter) und Domherr zu Magdeburg, Probst zu Frankfurt, römisch-kaiserlicher Rat, kurfürstlich Mainzer Geheimrat und Hofratspräsident;
– Carl von Metternich, Chorbischof zu Trier, Domherr zu Augsburg und Eichstätt, Probst des kaiserlichen Freistifts Aachen – jener Carl, dessen kunstgeschichtlich berühmtes, von Matthias Rauchmüller gestaltetes Grabmal noch heute in der Liebfrauenkirche zu Trier zu bewundern ist;[14]
– Emmerich von Metternich, Domkapitular zu Trier, Paderborn und Verden und kurbayerischer bestellter Obrist – woran ersichtlich ist, dass es durchaus möglich war, zwischen geistlichem und militärischem Amt zu wechseln;
– Wilhelm von Metternich, Herr zu Berburg, Ritter des Ordens zu St. Jacob, römisch-kaiserlicher Rat und Kämmerer, kurtrierischer Rat, Amtmann zu Mayen, Monreal und Kaysersesch; sowie
– Lothar von Metternich, Herr zu Differdingen und Hagenbeck, kurfürstlich trierischer Rat und Amtmann zu Montabaur.





























