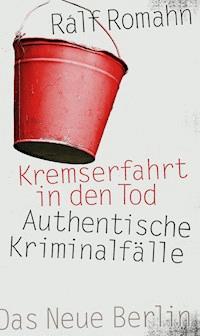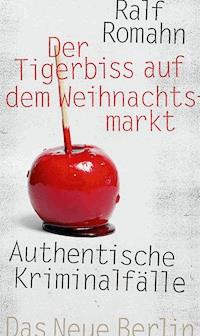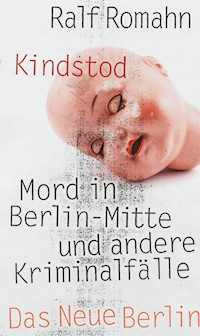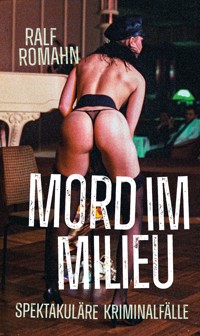
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Das Neue Berlin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Authentische Kriminalfälle aus Berlin, erzählt vom Ermittler. März 1990, Berlin-Lichtenberg. Das Mädchen, das erdrosselt aufgefunden wird, ist gerade 18 Jahre. Der Fall scheint klar. Hier, an der Frankfurter Allee, wo um 1990 ein neuer Straßenstrich entsteht, herrscht ein Geschäft ohne Gnade. Gewalt gegen Frauen und Revierkämpfe sind an der Tagesordnung. Zwei Zuhälter aus Polen lassen sechs Mädchen für sich arbeiten und kommen der deutschen Konkurrenz in die Quere. Oder geschah dieser Mord doch aus Leidenschaft? Ralf Romahn, Chefermittler der Volkspolizei, ist einer der ersten am Tatort. In diesem Buch berichtet er von fünf authentischen Kriminalfällen aus den letzten Jahren der DDR und der Wendezeit. Fälle, deren Ermittlung er selbst geleitet hat. Sie alle sind auf die eine oder andere Weise Milieumorde – ein Pärchen, das Friedhöfe plündert und einen Raubmord begeht, ein Mann, der sich als Sporttrainer ausgibt und Jagd auf Mädchen macht, ein Eifersuchtsdrama zwischen Männern, das tragisch endet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Romahn
Mord im Milieu
Spektakuläre Kriminalfälle
Das Neue Berlin – eine Marke der
Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH
eISBN 978-3-360-50190-5
1. Auflage 2023
© Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin
Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten.
Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin, unter Verwendung eines Fotos von picture-alliance/ZB: Eine der ersten Stripperinnen der DDR präsentierte sich am 2. April 1990 in einer Show in einem Berliner Nachtclub. Eine Kommission des Berliner Magistrats hatte am 5. Januar 1990 ihre Qualifikation für den Beruf überprüft und ihr die erste Lizenz als Stripperin ausgestellt.
Printed in the EU
www.eulenspiegel.com
Inhalt
Holzkopf
»Brennpunkt Spagat«
Blüten Made in GDR
Drei Farben kennt das Land
Mord im Millieu
Holzkopf
Oberleutnant, du sollst zum Chef kommen, rief Krause durch die offene Bürotür. Offenbar kam er gerade von dort, denn sonst rief der Oberst immer selbst an, wenn er mich zu sprechen wünschte. Krause war älter als ich und auch länger dabei, und dass er sauer war, am 1. Juli nicht befördert worden zu sein, zeigte er bei jeder Gelegenheit. Ich war vor zwei Jahren erst von der VP-Schule in Aschersleben als Leutnant zurückgekehrt, während die meisten anderen das Studium als Unterleutnant beendet hatten. Und nun, zum diesjährigen Tag der Volkspolizei, war ich mit dem dritten Stern auf der Silberlitze bedacht worden. Mit Verlaub: Ich war dreißig, hatte vier Jahre bei der Volksmarine gedient und danach als Hilfsarbeiter im Wortsinne Dreck gefressen. Beim »Vau-E-Be Mörderkohle«, wie der VEB Elektrokohle Lichtenberg im Berliner Volksmund hieß. Dort wurde Graphit für die ganze Republik produziert mit einer Technik, die aus Kaisers Zeiten stammte. Laut, dreckig, ungesund und umweltschädlich … Ach, was wusste dieser Sesselfurzer Krause schon vom Leben.
Verstanden, rief ich hinaus auf den Flur und griff mein Notizbuch. Wie jeder Vorgesetzter sah es auch der Genosse Oberst gern, wenn man mitschrieb. Ich verschloss, wie vorgeschrieben, mein Dienstzimmer. Das fand ich insofern ein wenig albern, als es bis hierher nie ein Betriebsfremder schaffen würde. An der Wache unten im Dienstgebäude unweit des Alexanderplatzes kam niemand unbemerkt vorbei. Und was hätte ein Dieb hier schon groß klauen können? Akten, Zigaretten, die Tagespresse, die auf dem Tisch lag? Aber es war nun mal angeordnet, das Büro zu versperren, sofern niemand im Zimmer anwesend war. Und über Nacht wurde jeder Raum versiegelt: Zwei mit Knete gefüllte Kronkorken, in Tür und Rahmen verschraubt, wurden mit einem Faden verbunden. Dann presste man die Petschaft in die weiche Masse, und schon war das Büro gesichert. Hing anderentags der Faden lose herab, bedeutete dies, das nächtens einer im Büro gewesen sein musste. Und das war unzulässig und mithin ein Vorkommnis. Alles irgendwie albern. Aber man hatte sich daran gewöhnt.
Warum mich aber der Chef zu sehen wünschte und nicht der Arbeitsgruppenleiter, konnte ich mir nicht erklären.
Werner Gutzeit saß bräsig hinter seinem Schreibtisch, als ich sein Zimmer betrat. Auf dem Weg über den langen Flur, der nach Bohnerwachs und Stiefelwichse roch, hatte ich mir vergeblich das Hirn zermartert, was der Anlass für diese Einladung sein könnte. Wollte er mit mir die politische Groß- und Kleinwetterlage erörtern? Die Proteste gegen die Stationierung von Pershing II und Cruise Missiles in Westeuropa nahmen seit Wochen zu, in der DDR gaben sich auswärtige Politiker die Klinke in die Hand und im Palast der Republik sollte es Ende des Monats ein Friedenskonzert geben, bei dem auch internationale Künstler auftreten würden – von Harry Belafonte bis Udo Lindenberg. Aber das tangierte wohl kaum die Kriminalpolizei von Berlin-Mitte. Ich war mir unschlüssig.
Der Oberst schaute nur kurz auf. Er schrieb irgendwas und wies mit einer leichten Kopfbewegung auf einen Stuhl am Tisch, der vor seinem Schreibtisch stand. Beide Tische bildeten ein T. Hinter Gutzeit in Uniform – ich trug meine nur dann, wenn es von uns verlangt wurde, und das waren gottlob nicht viele Tage im Jahr – hingen die Konterfeis des Staatsratsvorsitzenden und des Innenministers. Dickel war das schon seit zwanzig Jahren. Ich war ihm persönlich noch nie begegnet, er solle, so sagten jene, die schon mal mit ihm zu tun hatten, ein umgänglicher Typ sein. Gänzlich uneitel und bescheiden. Die offiziellen Fotos an der Wand machten den schmucklosen Raum zum Dienst- und Chefzimmer. Denn die Büsten, Medaillen, Teller und der andere Polittrödel, der sich im Laufe der Jahre im Regal gesammelt hatte, war Kitsch, nicht Kunst, und nicht unbedingt Indiz für ein von einem Musenfreund gehütetes Heiligtum in der Inspektion. Überall hinterließen Delegationen von Bruderorganen und Betriebsabordnungen die gleichen Souvenirs: bemalte Briketts aus der Lausitz, Gipsköpfe aus der Sowjetunion, Teller aus Kahla und Reliefs aus Bulgarien … An jedem Jahrestag kamen weitere geschmacklose Devotionalien hinzu.
Gutzeit steckte die Kappe auf den Füllfederhalter, schlug die Mappe zu und sagte: »So.« Dann musterte er mich, als hätte er mich seit Ewigkeiten nicht gesehen.
Ich grinste zurück. »Was gibt’s, Werner? Außer der Tatsache, dass wir mal wieder den Weltfrieden retten müssen.« Ich deutete auf die Zeitungen, die auf seinem Tisch lagen. Obenauf, wie es sich gehörte, das Zentralorgan. Honecker hatte am Vortag die Verteidigungsminister des Ostblocks empfangen und mit diesen »an die USA und ihre NATO-Verbündeten« appelliert, von den Stationierungsplänen für die neue Generation von nuklearen Mittelstreckenraketen Abstand zu nehmen.
Oberst Werner Gutzeit machte eine resignative Handbewegung. Was wird sein, sagte er. Die Russen werden bei uns und bei den Tschechen ihre SS-20 stationieren … Er schwieg. Ich sah, wie es hinter seiner Stirn arbeitete. »Aber deshalb habe ich dich nicht rufen lassen.«
»Sondern?«
»Es gibt eine Diebstahlanzeige.«
Ich lachte kurz auf.
Gutzeit warf mir einen Blick zu, der meine Reaktion zu missbilligen schien. Nur ein Blick, kein Wort. Ich wähnte mich missverstanden und setzte zu einer Erklärung an.
»Nicht nötig«, sagte er. »Ich weiß, was du sagen willst.«
Natürlich, Gutzeit wusste selbst, dass Anzeigen dieser Art nicht unbedingt an diesem Tisch erörtert wurden, es sei denn, es handelte sich um etwas Gewichtiges. Aber augenscheinlich war es nicht einmal das, weshalb er so auffällig reagierte. Er war sich des Problems bewusst. Das erklärte seine unterschwellige Gereiztheit, die ich mir nicht erklären konnte.
Ich schwieg. Auch der Oberst blieb stumm.
Was für ein Diebstahl? Und wo? Hatte man den Volvo eines Politbüro-Mitgliedes geknackt? Blödsinn, das war ein Fall für die Staatssicherheit. Gut, im Stadtbezirk Mitte der Hauptstadt befanden sich alle wichtigen Institutionen der DDR: das Zentralkomitee der Partei, der Staatsrat, die Volkskammer, der Ministerrat, die Sitze der Blockparteien, die Redaktionen von Zeitungen und Zeitschriften, die meisten arbeiteten im Haus des Berliner Verlags an der Karl-Liebknecht-Straße. Die Humboldt-Universität, die Charité, diverse Ministerien … Über allem jedoch wachte das MfS, das war doch nicht unser Beritt. Und Karnickeldiebstähle gab es hier nicht. Wer hielt sich in Mitte schon Karnickel?
Werner Gutzeit räusperte sich.
Aha, dachte ich, gleich kommt’s.
Er beugte sich leicht über seinen Schreibtisch.
Ich tat es ihm nach. Zwischen unseren Köpfen schwand die Distanz bis auf wenige Zentimeter. Ich sah das Geflecht von Äderchen in seinen Wangen, was ein Hinweis auf den hohen Blutdruck war. Und Gutzeit war Raucher. Dazu das Übergewicht aufgrund mangelnder Bewegung und zu viel Alkohol: ein Kandidat für den Herzinfarkt im Amte. Vielleicht jedoch hatte er noch eine Chance, gefahrlos bis zur Rente zu kommen, die paar Jahre bis zu seiner Verabschiedung sollte er es wohl noch schaffen. Ich gönnte es ihm. Werner war ein gemütlicher Zeitgenosse, ein väterlicher Typ, ich hatte ihn noch nie cholerisch gesehen oder erlebt, dass er sich von irgendeiner Hysterie hatte anstecken lassen. Er war der sprichwörtliche Fels in der Brandung.
»Es geht um einen Diebstahl«, sagte er mit gedämpfter Stimme, als fürchtete er, ein Dritter könnte mithören, was er zu vermeiden wünschte.
»Das sagtest du bereits, Genosse Oberst«, flüsterte ich zurück.
Abrupt lehnte er sich auf seinem Bürostuhl zurück und kehrte zur normalen Tonlage zurück.
»Nichts Besonderes«, begann er. »Aus einem Kneipenkeller hat jemand ein paar Kaffeegedecke aus Silber mitgehen lassen.«
Ich lachte hell auf. »Das ist nicht dein Ernst?!«
Gutzeit verstand meine Reaktion, er war doch nicht blöd. Diebstähle unter 10.000 Mark – und um einen solchen handelte es sich ja wohl – waren Bagatellen und Tagesgeschäft für die Kriminalpolizei. Dafür gab es maximal eine Bewährungsstrafe für den Täter. In solche Geschichten hängte sich kein Inspektionschef rein, das war Arbeit für die Fußtruppen.
»Du feixt zu früh«, setzte er fort. »Da ist nämlich noch etwas.«
»Lass mich raten.« Die Sache begann mir Spaß zu machen. »Das Geschirr gehörte dem Kaiser oder Erich Honecker, was aufs selbe hinausläuft.«
Ich wusste, dass Gutzeit für solche Anspielungen und Scherze in kleiner Runde durchaus empfänglich war. Nur wenn der Kreis zu groß war, rief er zur Ordnung. In der Elektrokohle ging es noch härter zu. Die Arbeiterklasse war sich ihrer Macht im Staate bewusst. Sie wurde glorifiziert und vergöttert, nicht die Mächtigen. Es schien nur so, dass es umgekehrt sei, beschränkte man die Wahrnehmung auf die Zeitungen und die Aktuelle Kamera.
Gutzeit grinste. »Nee, es ist weniger das Geschirr. Er oder sie, wir wissen’s noch nicht, hat oder haben auch einen Holzkopp mitgehen lassen. So’n geschnitztes Teil. Könnte Kunst gewesen sein.«
»Ja und?« Ich hatte noch immer keine Ahnung.
»Schalck-Golodkowski«, raunte Gutzeit.
Ich verstand nur Bahnhof.
Der Oberst schaute mich an wie ein Lehrer, der davon überzeugt war, dass ein aufmunternder Blick seinem Schüler auf die Sprünge helfen würde.
»Wer ist das?«
Enttäuscht ließ Gutzeit seine beiden Hände auf die Schreibtischplatte fallen. »Du musst noch viel lernen.«
»Davon bin ich überzeugt.«
»Schalck-Golodkowski ist Staatssekretär im Außenhandel.«
Ich zuckte mit der Achsel. »Muss ich die ganze Nomenklatura kennen?«
»Nicht die ganze. Nur die wichtigen Leute.«
»Daraus schließe ich, dass dieser Schalk ein wichtiger Kader ist.«
»Schalck«, sagte Gutzeit und betonte das Ende, dass es wie ein Peitschenknall klang. »Schalck mit ck. Und um deine Frage zu beantworten: ein ganz wichtiger.«
»Noch nie gehört. Muss man ihn kennen?«
»Er sorgt dafür, dass du Weihnachten Apfelsinen hast und übers Jahr gelegentlich Bananen.«
Ich starrte ihn ungläubig an. »Werner, was hat das mit diesem albernen Diebstahl zu tun?«
In Gutzeits Gesicht zog sanfte Heiterkeit, seine Mundwinkel gingen leicht nach oben.
»Bananen und Apfelsinen kosten Devisen. Richtig?« Er fixierte mich.
»Richtig«, bestätigte ich. »Auf den Plantagen bei Werder wachsen meines Wissens nur Äpfel, insbesondere der Gelbe Köstliche …«
»Und Devisen müssen erwirtschaftet werden. Richtig?« Gutzeit ließ sich nicht aufhalten.
»Du hast wie immer Recht.«
»Und womit erwirtschaften wir Devisen?«
»Na, indem wir Maschinen ins NSW verkaufen, in Schwedt veredeltes Russen-Öl in den Westen verticken und Frühgemüse aus dem Oderbruch nach Westberlin liefern. Zum Beispiel.«
»Zum Beispiel. Aber was machen, wenn die Erlöse immer geringer werden, weil die Rohstoffpreise weltweit steigen, da sie knapp werden und die Sowjetunion uns immer weniger Öl liefert, auch weil sie in Moskau inzwischen mitbekommen haben, dass wir sie behumsen?«
»Keine Ahnung. Ich bin schließlich Kriminalist, kein Ökonom oder gar Politiker.«
»Siehste, und nun kommt Schalck ins Gespräch. Er bedient Nebenmärkte, macht Devisen mit allem, womit sich im Westen Geld machen lässt: Nachgeburten, Straßenpflaster, Müllentsorgung ….« Gutzeit lächelte befriedigt, weil er mir ein großes Problem einfach und verständlich erklärt zu haben glaubte.
»Lass mich raten: auch mit Kunst?«
Das Lächeln erfuhr eine merkliche Steigerung.
»Und dieser Schalck steigt also in einen Berliner Kneipenkeller und klaut Silbergeschirr und einen Holzkopp?« Ich spürte, wie der Zeigefinger meiner rechten Hand automatisch an die Schläfe tippte.
»Dafür hat er seine Fußtruppen von der Firma.«
In meinem Hirn ratterte es, ich begann langsam zu begreifen, warum Gutzeit so geheimnisvoll tat. »Du befürchtest – deute ich das richtig? –, dass vielleicht kein kleiner Ganove dort zugange war, sondern eventuell Schalcks Leute? Oder es war jemand, der in ihrem Auftrag handelte? Und wenn wir dem oder denen auf die Schliche kommen würden, käme das nicht so gut?«
»Bei Gott, jetzt hat er’s«, trällerte Gutzeit und klang dabei wie Prof. Henry Higgins in »My Fair Lady«.
Ich hielt diese Annahme für reichlich spinnert. »Werner, nun bleib mal auf dem Teppich. Die haben doch ganz andere Möglichkeiten, um an Sachen zu kommen, die sie haben wollen. Ist der Kneiper privat, macht man’s über die Steuer. Oder schickt Handwerker in den Keller. Oder welche zum Stromablesen. Aber doch nicht auf diese dilettantische Weise, so was gibt es nicht einmal in einem Russenfilm. Da riskierte man doch, erwischt zu werden.«
»Vielleicht ist gerade das der Trick: Es soll wie ein gewöhnlicher, primitiver Diebstahl aussehen.« Gutzeit schaute triumphierend, als habe er eine dritte Brustwarze bei Marianne entdeckt, die Delacroix barbusig und fahneschwingend über die Barrikade hatte stürmen lassen. Jetzt, nach so vielen Jahren und weltweiter Verbreitung. Ganze Armeen von Gutachtern, Experten und Kunstfreunden hatten sie übersehen.
Ich schüttelte den Kopf. Wurde mein Chef langsam senil oder zeitigte die hierzulande übliche Geheimniskrämerei bei ihm fatale Folgen? »Werner, überleg doch mal logisch: Wird der Diebstahl als Diebstahl zur Anzeige gebracht, beginnt die Polizei zu ermitteln …«
»Die halten uns doch alle für blöd. ›Ein Fuchs ist schlau und stellt sich dumm – beim Bullen ist es anders rum‹, heißt es immer. Die halten uns für Amateure und für unfähig.«
Sein Blick ging in unbestimmte Ferne.
»Ist mir doch egal, was die eventuell über uns denken. Für mich ist das ein ganz normaler Fall, und wir werden auch so ermitteln wie immer. Basta.«
Oberst Gutzeit nickte. »Nichts anderes erwarte ich. Ich wollte dich lediglich gewarnt haben. Falls du also auf merkwürdige Hinweise oder gar Spuren stößt … Vorsicht! Du informierst mich dann. Wir sollten, sofern sich meine abwegige Hypothese bestätigte, gemeinsam überlegen, wie wir damit umgehen. Ich meine: Der Ruf unserer Waffenbrüder vom VEB Horch & Guck ist ohnehin im Eimer. Da müssen wir nicht auch noch unseren Senf dazugeben, du verstehst?«
Ich nickte. Wir saßen schließlich im selben Boot. Dessen war ich mir durchaus bewusst. Bekannt aber waren auch die unterschwelligen Rivalitäten zwischen den verschiedenenen Ministerien der Schutz- und Sicherheitsorgane, von denen jedes einzelne sich für das wichtigste im Lande hielt.
»War’s das?« Ich erhob mich.
Nachdem ich die Anzeige studiert hatte und vom Arbeitsgruppenleiter informiert worden war, dass man den Täter bereits gefasst habe, machte ich mich zum Tatort auf. Ich wollte völlig unbeeinflusst von irgendwelchen Aussagen des Mannes, der als vermeintlicher Täter vorgeführt worden war, der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Festgenommenen selbst wollte ich mich erst später beschäftigen.
Da weder Gefahr im Verzuge noch sonst irgendwie Eile geboten war, machte ich mich auf den Weg. Zu Fuß. Die paar hundert Meter Bewegung an frischer Luft würden mir gut tun.
Ich marschierte die Linienstraße hinunter, passierte den Alten Garnisonfriedhof, der zunehmend verwilderte. Dort lagen vorwiegend Preußengenerale aus dem 19. Jahrhundert, die nicht unbedingt in unsere progressive Ahnengalerie passten. Überdies waren die Grabmale für die verstorbenen Militärs nicht unbedingt künstlerisch bedeutend, womit das öffentliche Interesse an diesem Ort und den Toten eher gering war. Es mussten erst die Lücken in den belebten Häuserzeilen geschlossen werden. Und von denen gab es hier reichlich. Ich konnte immer wieder auf die parallel verlaufende Wilhelm-Pieck-Straße schauen. Stellte man sich die Abfolge der Mietshäuser wie ein Gebiss vor, wies dieses hier erhebliche Fehlstellen auf. Und von den Gebäuden, die standen, bröckelte seit Jahrzehnten der Putz.
Briten und Amerikaner hatten weit über dreihundert Luftangriffe auf Berlin geflogen. Die drei letzten Bombardements waren die schwersten – da stand die Rote Armee bereits vor den Toren der Reichshauptstadt. Noch immer rätselten die Historiker, ob die massiven Luftangriffe zum Kriegsende mehr zur militärischen Unterstützung des östlichen Verbündeten in der Antihitlerkoalition gedacht waren oder diesem selbst galten. Schließlich würden, was nicht erst im Frühjahr ‘45 absehbar war, die Russen Berlin erobern und besetzen. Jede dritte Wohnung war bei den Bombenangriffen total zerstört worden, weniger als ein Viertel der knapp 1,6 Millionen Berliner Wohnungen hatte den Krieg unbeschadet überdauert. Erstaunlich, was man in den dreieinhalb Friedensjahrzehnten seither geschafft hatte. Man war tatsächlich aus Ruinen auferstanden. In Gera, woher ich gekommen war, sah es ähnlich aus. Auch dort hatte es Anfang April ‘45 den schwersten Luftangriff gegeben, eine Woche, bevor die Amerikaner einrückten. Scheiß Krieg … Auch wenn ich ihn nicht mehr hatte selbst erleben müssen.
Schon bald überquerte ich hinter einer quietschenden Straßenbahn die Kreuzung am Rosenthaler Platz und wechselte hinüber in die Wilhelm-Pieck-Straße. Ich erreichte schließlich die Borsigstraße, die nach rechts abging und Richtung Norden führte. Sie endete an der Bernauer Straße, also an der Mauer.
Hier also war heute Nacht der Einbruch erfolgt. Ich betrachtete den grauen Kasten mit den abgeschlagenen Balkonen. Die ursprünglichen Türen waren durch halbhohe Gitter versperrt. Zu ebener Erde befanden sich kleine Geschäfte und die Gastronomie. Es handelte sich um eine typische Berliner Eckkneipe, wie es sie zu hunderten in der Stadt gab. Dunkel die Tapete, verräuchert die Decke, und in den Dielen steckte der Geruch von Generationen von Proleten, die hier schon immer ihr Feierabendbier tranken. Es war Nachmittag und noch nicht viel los. Am Tresen standen zwei, drei Männer, in der Rechten ein halbvolles Glas Bier. Vor sich den obligatorischen Klaren. Ich schüttelte mich innerlich, um diese Tageszeit könnte ich mir keinen Harten mehr hinter die Binde gießen. Bestimmte Volkssportarten hatte ich mir seit meiner Arbeit in der Elektrokohle abgewöhnt. In den Pausen tranken wir dort nicht Tee, sondern Schnaps, weil wir es bis zum Schichtende sonst nicht geschafft hätten. Man hatte die Wahl, sich entweder zu Tode zu schuften oder zu Tode zu saufen. Beides hatte ich nicht vor.
Prost, sagte ich und grüßte den Wirt. Der wischte sich die Rechte an seiner Lederschürze ab, bevor er mir die Hand zum Gruß reichte, nachdem ich mich bei ihm vorgestellt hatte. Ich hätte mal gern den Keller gesehen, wo bei ihm eingestiegen worden sei. Er nickte und sagte den Trinkern am Tresen, sie sollten sich eine Weile mit ihrem Bier begnügen, er müsse mal für fünf Minuten weg, könne also nicht zapfen. Die Männern grummelten irgendetwas, das wie Zustimmung klang. Was blieb ihnen auch anderes übrig?
Der Kneiper ging vor mir her und öffnete einige Türen, die wohl zum letzten Mal zu Kaisers Zeiten gestrichen worden waren. Vermutlich handelte es sich noch um den Erstanstrich. Ich fragte ihn, wie lange er schon die Kneipe führe. Seit dem Krieg, sagte er, er sei faktisch unterm Zapfhahn aufgewachsen.
Ah, antwortete ich, das ist so was wie ein Familienbetrieb.
So könne man es sagen, murmelte er. Sein Vater habe die Wirtschaft von dessen Vater, »also meinem Großvater«, übernommen, der seinerzeit das Haus erworben hatte. »Und nu ha’ck den Klops anner Backe.«
»Wieso Klops?« Meine Frage war keineswegs gespielt. Ich wohnte zeitlebens zur Miete und hatte keine Ahnung, was es bedeutete, in der DDR Eigentümer eines mehrstöckigen Wohnhauses zu sein.
»’tschuldigen Se: Der Mietenstopp von ’45 gilt noch imma.«
Er blieb stehen und musterte mich. Er schien zu bezweifeln, dass ich wirklich so unwissend war wie ich mich gab. Natürlich hatte ich schon mal davon gehört, dass die Mieten in der DDR sich auf dem Niveau des Dritten Reiches bewegten, war aber der Überzeugung, dass es inzwischen eine Reihe von Ausnahmeregelungen und Subventionen gebe.
Er lachte kurz auf. »Hier würd nischt subvenjoniert. Mit der kleenen Miete muss ick die janze Hütte in Ordnung halten und ooch noch modernisieren. Also Bäder einbauen und det Klo vom Treppenflur inne Wohnung valejen …« Er schüttelte den Kopf. »So ville könn‘ die Jungs« – er deutete in Richtung Schankraum – »janich saufen, um det allet zu finanzieren, wat ick als Hauseijentümer machen muss.«
»Kredite?«
Er griente. »Leben wir im Westen?«
In mir stieg ein vager Verdacht auf.
»Sind Sie versichert?«, erkundigte ich mich.
Natürlich, entgegnete er. In einer Kneipe gehe schnell mal was zu Bruch.
»Oder es gibt einen Bruch.«
Er ging auf mein Wortspiel nicht ein. Wahrscheinlich hatte er die Anspielung auch nicht verstanden. Oder er hatte sie nicht verstehen wollen. Vielleicht gab es Gründe, sich nicht auf diesen Pfad locken zu lassen.
Ich beließ es dabei.
So, sagte er, und öffnete eine Tür, nachdem wir einige ausgetretene Steinstufen hinabgestiegen waren. An der Wand sah ich im Vorübergehen, wenngleich nur noch schwach, einen nach unten führenden Pfeil, neben dem mit schwarzer Farbe Luftschutzraum stand.
Ob es noch tiefer gehe, hatte ich ihn gefragt, worauf er nur mit einem kurzen Kopfnicken reagierte.
Er knipste das Licht an, das heißt er betätigte den Drehschalter neben der Tür, bis es knackte. An der Decke flammte hinter einer verstaubten Glasabdeckung eine Funzel auf. An der einen Seite des Kellerraumes stapelten sich einige Holzfässer, ein Fass war an einer Steigleitung angeschlossen. Daneben stand die Flasche mit dem Gas, das das Bier nach oben in den Zapfhahn trieb und im Glas den goldgelben Gerstensaft zum Schäumen brachte.
Hier sei er rein, sagte der Wirt und zeigte auf den Fässerschacht, der oben in etwa zwei Meter Höhe von zwei Blechen verschlossen wurde. Durch die Fugen fiel etwas Licht, wie ich feststellte. Ich hörte die Schritte von Fußgängern, die über das Blech auf der Straße gingen.
Der Kutscher, der gestern Abend seine Fässer abgeworfen hattee, habe offenbar vergessen, die Platten danach wieder umzulegen und den Schacht zu verschließen, erklärte der Wirt.
Ob die Abdeckung, wenn sie denn geschlossen sei wie jetzt, auch wirklich verschlossen ist, erkundigte ich mich.
Nee, sagte er, die wird einfach zugeklappt und jut is.
Es könne also jeder hier einsteigen, erwiderte ich, er müsse nur die Klappe öffnen, runterrutschen und schon sei er im Hause?
Warum sollte er das tun? Der Wirt schaute mich an, als hätte ich ihm die absurdeste Frage der Welt gestellt.
Ich schüttelte genervt den Kopf. »Sie haben doch heute Nacht gesehn wozu.«
Das sei noch nie passiert in den über achtzig Jahren, in denen hier Bierfässer und Gasflaschen abgeladen worden sind, antwortete der Wirt mit unerschütterlicher Überzeugung. »Noch nie!«
»Irgendwann ist es immer das erste Mal.« Ich machte eine kurze Pause, um nicht völlig empathielos zu erscheinen. »Wenigstens ein Vorhängeschloss sollten Sie anbringen lassen.«
Das gehe schon deshalb nicht, weil die Bierfässer vom Getränkekombinat grundsätzlich nachts angeliefert würden, und die Fahrer wechselten sich im Schichtbetrieb ab. So viele Schlüssel könne er gar nicht ausgeben, sagte der Wirt, und die Fahrer würden sich auch schön bedanken, wenn sie sich auch noch ein Schlüsselbund zulegen sollten, denn wenn ein Kneipenbetreiber damit anfange, seinen Getränkekeller zu verschließen, würden bald die anderen nachziehen müssen.
Ich schüttelte verständnislos den Kopf und seufzte dramatisch. »Das ist Ihr Bier.«
»In jeder Hinsicht«, echote der Kneiper.
»Okay, der oder die Täter sind also vermutlich durch diesen Schacht eingestiegen. Sie haben den Verlust von sechzehn Kaffeegedecken aus Silber angezeigt. Wo befand sich das Geschirr?«
»Komm‘ Se mit«, sagte der Beklaute, »das Zeuch lach nebenan inne Abstellkammer.«
Ich schlüpfte aus dem Kellerraum. Er löschte das Licht und zog die Tür zu. Ich registrierte, dass er die Tür nicht abschloss.
»Bleibt der Raum immer offen?«
»Wär der Dieb sonst in den Schankraum jekommen?«
»Das ist mir klar. Ich meinte, ob die Tür heute Nacht nur zufällig unverschlossen gewesen war, oder ob sie nie verriegelt würde. Ob also der oder die Täter wissen konnten, dass es kein Problem darstellte, von hier in den Gastraum zu gelangen?«
Der Wirt schaute mich an wie ein Eichhörnchen, dem man die Nüsse weggenommen hatte.
»Ich meine: Hatte der Einbrecher zufällig Glück, dass die Tür offen stand, oder war er informiert, dass sie in dieser Nacht unverschlossen war?«
Das hieße ja, so schloss messerscharf der dickbäuchige Kneiper, dass die Rutschpartie geplant gewesen sein könnte.
»Genau das meine ich.«
»Nee, könn’ Se vajessen. Der Bierraum is immer offen. Schon wejens Bier. Wenn also mal janz schnell det Fass jewechselt werdn muss, wa.«
Dann öffnete er die Abstellkammer nebenan und machte das Licht an. In den Regalen an den Wänden stapelten sich Kartons, leere wie volle mit Biergläsern, Pappuntersetzern und anderen Kneipenutensilien. Auf der Fläche davor stapelten sich Stühle, Tische und weiterer Trödel.
Ich ließ meinen Blick schweifen.
»Und das Silbergeschirr stand offen im Regal?«
»Nee, natürlich nich.«
»Sondern?«
»Dit ha’ck doch schon Ihrn Kollejen jesacht: Det Zeuch war in’n Betttuch einjeschlajen, damit’s nicht einstaubt. Der …«
»… oder die Diebe …«
»… der oder die Diebe ham dit jleich jesehen und jegrapscht. Wat anderet ham‘se nich anjerührt. Hier unten, wa. Oben im Schankraum ham‘se reichlich Zijaretten und etliche Pullen Schnaps mitjehen lassen. Un den Holzkopp.«
Okay, sagte ich, das schauen wir uns gleich an. Vielleicht noch ein Wort zum Geschirr.
»Sechzehn Kaffejedecke.«
»Ja, ich weiß. Was gehörte zu so einem Gedeck?«
»Wir ham dit aussortiert, weil wia keen Kaffe mehr anbieten tun.«
Der Kneiper sagte nicht Kaffee mit der Betonung auf der zweiten Silbe und dem gedehnten e, sondern betonte wie alle Berliner den ersten Teil des Wortes, den Rest verschluckte er. Also Kaffe.
Hm, sagte ich und wiederholte meine Frage.
»Also een Jedeck bestand ausse Tasse und Untertasse, een Kaffe- und een Milchkännchen unne Zuckerdose.«
»Kein Teller?«
»Nee, der war aus Porzellan. Kuchen von‘ Silberteller kannste nich essen, schmeckt scheiße.« «
»Also sechzehn mal fünf Teile, macht zusammen achtzig. Das muss ein ordentlicher Sack gewesen sein.«
»Dit kannste jloben.«
»Und alles aus Silber?«
Der Kneiper nickte.
»Bevor ich Sie frage, wie viel das Ganze wert war, würde mich interessieren, woher Sie es hatten.«
Er schaute wieder wie ein bestohlenes Eichhörnchen. »Mann, det war Familjenbesitz. Ha’ck von meinem Vadder jeerbt, un der hat’s von seinem Alten. So wat kriechste heute nich mehr. Dit war Friedensware, wenne vastehst, wat ick meine.«
Ich verstand. »Und wie viel, schätzen Sie, war das alles wert?«
»Dit war unbezahlbar. Wejen de Erinnrungen, die da dranhingen, wa.«
Verstehe, sagte ich und unterdrückte einen Anflug von Heiterkeit. »Ich frage mal anders: Was würde das bringen, wenn man es beim An- und Verkauf vertickte? Etwa vorn am Rosenthaler Platz, da ist ja so ein riesiger A&V, wo man auf mehreren Etagen alles Mögliche verkaufen und kaufen kann. Zum Beispiel auch Silbergeschirr.«
»Keene Ahnung. Die drücken ja de Preise, weil se ja ooch ihren Schnitt machen wolln, wa.«
»Ein Gedeck, bestehend aus fünf Teilen, Gewicht etwa ein Kilo. Reiner Materialwert«, ich überlegte: in den letzten zehn Jahren hatte sich der Silberpreis auf dem Welt vervielfacht, von 1,29 Dollar je Unze auf 52 im Jahr 1980, wie ich vorhin gelesen hatte. Nun rechneten wir in der DDR weder mit Dollar noch mit Unze, sondern in Mark der DDR und in Kilo. Eine Unze war etwas mehr als dreißig Gramm, der Dollar stand aktuell bei 2,55 West-Mark. Ich begann im Kopf zu überschlagen.
»Für sechzehn Kilo Silber muss man aktuell auf dem Weltmarkt an die 28.000 Dollar hinblättern, über 70.000 West-Mäuse …«
»Wat? So ville war das Zeuch wert?«
»Reines Silber, wohlgemerkt. Und nur überschlagsweise«, versuchte ich die Euphorie des Kneipers zu bremsen. In dessen Augen leuchteten bereits die bunten Scheine, wie hier das Westgeld hieß.
»Un wenn it nur die Hälfte is, isset een janzer Haufen Jeld, wa, wat die Vasicherung dann wird zahlen müssen.«
»Nun mal langsam. Das, was die Versicherung dafür zahlen wird, ist ausschließlich deren Sache. Sie können dort nicht erklären: Der von der Polizei hat gesagt, der Klumpatsch sei siebzigtausend Westmark wert, wir tauschen 2 zu 1, macht also die Hälfte in Ostmark. So läuft das nicht. Im Übrigen kann ich mich auch täuschen, ich bin kein Devisenhändler oder Goldschmied, der sich damit auskennt.«