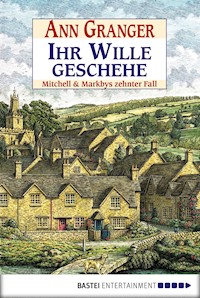9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Viktorianische Krimis
- Sprache: Deutsch
März, 1870. In Piccadilly wird die Leiche einer Frau gefunden. Die Spur führt Inspector Ben Ross nach Yorkshire, während Lizzy, Bens Frau, sich mit einem anderen mysteriösen Fall beschäftigen muss: mit einem geheimnisvollen Mädchen, das die Leute immer wieder in einem Haus auftauchen sehen, von dem aber niemand etwas Genaues weiß - und das dann plötzlich ganz verschwindet. Bald schon weisen Indizien auf eine Verbindung zwischen den Fällen. Und es wird wieder einmal gefährlich für Lizzy und Ben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
ÜBER DAS BUCH
März, 1870. In Piccadilly wird die Leiche einer Frau gefunden. Die Spur führt Inspector Ben Ross nach Yorkshire, während Lizzy, Bens Frau, sich mit einem anderen mysteriösen Fall beschäftigen muss: mit einem geheimnisvollen Mädchen, das die Leute immer wieder in einem Haus auftauchen sehen, von dem aber niemand etwas Genaues weiß – und das dann plötzlich ganz verschwindet. Bald schon weisen Indizien auf eine Verbindung zwischen den Fällen. Und es wird wieder einmal gefährlich für Lizzy und Ben!
ÜBER DIE AUTORIN
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Kriminalromanen »Wer sich in Gefahr begibt« und »Neugier ist ein schneller Tod« knüpft sie mit »Stadt, Land, Mord«, dem ersten Band der Reihe um Inspector Jessica Campbell, wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.
ANN GRANGER
MORD IST EINEHARTE LEHRE
EIN FALL FÜRLIZZIE MARTIN UNDBENJAMIN ROSS
Kriminalroman
Übersetzung aus dem Englischenvon Axel Merz
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Murderer’s Apprentice«
First published in Great Britain in 2019
by HEADLINE PUBLISHING GROUP
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2019 by Ann Granger
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Gerhard Arth
Lektorat: Stefan Bauer
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Einband- / Umschlagmotiv: David Hopkins / Phosphorart
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-7777-4
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Dieses Buch erinnert an Jack Martin. Er reparierte Schuhe in einer Werkstatt, die in einer Garage aus Wellblech eingerichtet worden war. Als Kind verbrachte ich viel Zeit damit, ihm bei der Arbeit zuzusehen. Er erklärte mir genau, was ein gutes Stück Leder von einem minderwertigen unterschied. Ich beobachtete fasziniert, wie er freihändig die Form einer Sohle zeichnete, sie ausschnitt und auf Passgenauigkeit reduzierte. Er erlaubte mir, mithilfe eines großen Magneten heruntergefallene Nägel und Reißzwecken vom Boden aufzusammeln, sie zu sortieren und in Marmeladengläser zu legen. Gelegentlich ließ er mich einer Reparatur den letzten Schliff geben, indem ich mit Polierwachs die Absätze zur glänzenden Perfektion brachte. Ich durfte das nicht sehr oft, weil ich zu viel Material verbrauchte.
Ich denke manchmal, dass das Schreiben eines Buches dem Reparaturprozess sehr ähnlich ist, den ich vor so vielen Jahren beobachtet habe. Die verschiedenen Ideen werden hier aufgegriffen und warten dort im Äquivalent von Marmeladengläsern in meinem Kopf. Der Plan des Buches wird grob skizziert, und dann wird er reduziert, überarbeitet, und wenn er richtig ist, zusammengesetzt und mit einem letzten Schliff abgeschlossen.
Autoren verdanken der mitfühlenden Unterstützung und dem Adlerauge ihrer Redakteure viel. Mein Dank geht an die gegenwärtige Redakteurin Clare Foss für ihre Ermutigung und Unterstützung. Ich hoffe, dieses Buch gefällt Ihnen, Clare!
Ich möchte auch meiner Freundin und Schriftstellerkollegin Angela Arney danken, die mich nach Salisbury gefahren und mich beim Besuch der Stadt begleitet hat.
Eine Anmerkung zur Beschreibung des als Stonehenge bekannten Denkmals auf der Ebene von Salisbury, das Ben Ross im Laufe dieses Buches besucht: Als er Stonehenge 1870 gesehen hat, sah es noch nicht so aus wie nach den umfangreichen Restaurierungsarbeiten im zwanzigsten Jahrhundert. Ich habe Bens Sichtweise auf das Gemälde von John Constable von 1836 gestützt.
Nebel überall. Nebel stromauf, wo der Fluss zwischen Buschwerk und Wiesen dahinfließt; Nebel stromab, wo er sich schmutzig zwischen Reihen von Schiffen und dem Uferunrat einer großen (und dreckigen) Stadt durchwälzt … Die meisten Läden haben zwei Stunden vor der Zeit die Beleuchtung angezündet, und das Gaslicht scheint es zu wissen, denn es sieht schmal und mürrisch aus.
Charles Dickens, Bleakhaus, 1853
Kriminalfälle drehen sich immer wieder um diesen einen Punkt. Ein Mann wird eines Verbrechens verdächtigt, vielleicht Monate, nachdem es begangen wurde. Seine Wäsche oder seine Kleider werden untersucht, und man findet bräunliche Flecken. Sind das Blutflecken oder Lehmflecken oder Rostflecken oder Obstflecken oder was? Das ist eine Frage, über die sich viele Experten den Kopf zerbrochen haben, und warum? Weil es keine zuverlässige Probe gab.
Sherlock Holmes in Eine Studie in Scharlachrot,
Arthur Conan Doyle, 1887
KAPITEL EINS
Inspector Ben Ross
Die Londoner sind zu Recht stolz auf ihre Gasbeleuchtung, die die Straßen nachts so viel sicherer gemacht hat als zu Zeiten ihrer Großväter. Achtbare Londoner, um genau zu sein. Es gibt jedoch auch viele Einwohner, die nicht wollen, dass auf ihre Geschäfte zu viel Licht fällt. Es sind diese Leute, die mich und jeden anderen Polizeibeamten der Stadt interessieren.
Leider gibt es eine Sache, die die Gaslampen fast nutzlos macht und viel Schutz für Untaten jeder Art bietet: Das ist der Londoner Nebel. Als hätte das Böse sein natürliches Milieu gefunden, das sich unbemerkt in jeden Winkel und jede Ritze schleicht. Nebel ist der willige Komplize eines jeden Schurken und der schnell lernende Geselle des Mörders.
Die ersten Monate des Jahres 1870 hatten unser Durchhaltevermögen bis zum Zerreißen auf die Probe gestellt. Es war inzwischen März, doch der Schnee lag noch immer hoch aufgetürmt und rußbeladen in geschützten Ecken. Der bitterkalte Wind zwickte an Nasen und Ohren, und selbst die besten Handschuhe vermochten die kalten Finger nicht zu wärmen. Die Menschen hatten angefangen, wehmütig über den Frühling zu murmeln, als erinnerten sie sich an einen alten verstorbenen Freund. Optimistischere Herzen sprachen davon, dass es sich höchstens noch um ein paar Wochen handeln konnte, zumindest nach dem Kalender.
Als wäre das alles nicht genug, war London in der vergangenen Woche zusätzlich zur Kälte von einer übel riechenden, erstickenden Waschküche heimgesucht worden. Nebel rollte vom Meer flussaufwärts und traf auf den Kohlenqualm, der aus sämtlichen Schornsteinen quoll, seien es die der Häuser oder diejenigen der Fabriken. Die Lokomotiven, die in unsere großen Bahnhöfe hinein- und wieder herausfuhren, trugen ebenso ihren Teil dazu bei, genau wie die Gerüche der riesigen Gasometer, die schädlichen Dämpfe aus der Themse, der Gestank des Flussschlamms bei Ebbe, die verrottenden Müllhaufen in den Hinterhöfen und der namenlose Abfall in den Rinnsteinen. All das zusammen bildete ein ganz spezielles Londoner Gemisch. Es wickelte sich um alles und jeden wie eine schmutzige gelbe Decke, waberte in die Häuser, sobald man eine Tür öffnete, und fand jede Ritze in einem Fensterrahmen. Doch auch darauf sind die Londoner auf eine geradezu perverse Weise stolz. Nebel ist etwas, das sie besser können als jeder andere.
Bettler und Landstreicher erfroren über Nacht auf den Straßen. Betrunkene Nachtschwärmer torkelten aus den Tavernen und schlugen auf dem Kopfsteinpflaster der Länge nach hin. Außerstande, sich selbst zu helfen, und unsichtbar für andere Passanten in der trüben Dunkelheit, wurden ihre steifen Leichen oft erst entdeckt, wenn eine andere Person über sie stolperte.
Wo der Schnee geschmolzen war, hatte er sich in eisigen Matsch verwandelt. Die Pferde hatten Sackleinen über die Hufe gebunden, um ein Ausrutschen zu verhindern, und sicherlich hätten sie in diesen Winterstiefeln einen komischen Anblick geboten – wenn man sie in der Dunkelheit nur hätte sehen können. Wie die Sache jedoch stand, klang das vertraute Klappern ihrer Hufe nur gedämpft durch die Straßen, und man hörte sie nicht immer rechtzeitig kommen. Ein plötzliches Rasseln von Rädern irgendwo da draußen im gräulich gelben Dunst, ein stumpfes Klopfen, vielleicht ein plötzliches nervöses Wiehern, gefolgt von einem warnenden Schrei des Kutschers oder anderen Fahrern. Der Fußgänger musste zur Seite springen, in der Hoffnung, dass er dabei die richtige Richtung wählte. Verständlicherweise waren Unfälle an der Tagesordnung.
Das wirbelnde Monster verhauchte in seinem feuchten, aufdringlichen Atem Krankheit und Tod. Die ganz Jungen und die ganz Alten waren die ersten Opfer, aber niemand war vor ihm sicher. Auf allen Seiten war in der Dunkelheit das Husten und Keuchen der Leidenden zu hören und diente besser als jede Laterne bei der Ortung von Fußgängern. Es schien beinahe so, als wäre der größte Teil der Londoner angeschlagen. Die wenigen Zimmer der Armenhäuser waren voll. Jeden Abend bildeten sich neue hoffnungsvolle Warteschlangen, aber die meisten Bittsteller wurden abgewiesen. Die Kinder der Armen wurden in Leibchen aus wattierter Baumwolle eingenäht, um erst im Frühjahr wieder herausgeschnitten zu werden und wie Motten aus einer Puppe aufzutauchen – wenn sie bis dahin überlebt hatten.
Die Woche hatte bei Scotland Yard an jenem Montagmorgen nicht gut begonnen. Wir hatten unseren angemessenen Anteil an Kranken, bedingt durch Kälte und Feuchtigkeit. Selbst ein scheinbar unerschütterliches Stück Inventar wie Superintendent Dunn war betroffen. Er lag unter den wachsamen Augen von Mrs. Dunn zu Hause im Bett, mit einem Senfumschlag auf der Brust und den Füßen auf einem wärmenden Ziegelstein. Seine Abwesenheit befreite uns von seinen ständigen Forderungen zu erfahren, was jeder Einzelne gerade machte und warum dieser oder jener Verbrecher noch nicht festgenommen worden war. Aber es verlangsamte auch die Entscheidungsfindung. Damit fiel mir viel Tagesgeschäft zu. Es machte mir nichts aus, aber ich fragte mich, was wohl passieren würde, wenn Dunn in den Dienst zurückkehrte, wieder zu Kräften gekommen, und sein Adlerauge auf alles richtete, was ich in seiner Abwesenheit in Gang gesetzt hatte.
Ein weiterer Inspector sowie drei Constables hatten sich krankgemeldet, was meine Arbeit weiter vermehrte. Als wäre das nicht genug, hatte mein getreuer Sergeant Morris, auf den ich mich blind verließ, wie ein Ochsenfrosch zu krächzen angefangen. Er versicherte mir zwar unablässig, dass alles in Ordnung wäre, aber er sah nicht danach aus. Und Constable Biddle hatte ebenfalls eine Erkältung.
Man könnte jetzt denken, dass Biddles Erkältung noch die geringste meiner Sorgen war, doch so verhielt es sich in Wirklichkeit nicht, im Gegenteil. Biddle traf sich regelmäßig mit unserem Mädchen für alles, Bessie. Er war am Abend zuvor in unserer Küche angetroffen worden, den Kopf über einer Schüssel dampfenden Wassers, versetzt mit Friar’s Balsam, und einem Handtuch über allem. Hinter ihm hatte Bessie gestanden, und jedes Mal, wenn er das Handtuch zurückwerfen und das gerötete, schwitzende Gesicht hatte heben wollen, hatte sie seinen Kopf wieder nach vorn gedrückt und das Handtuch erneut darüber gelegt. Seine unterdrückten Hilferufe hatten Lizzie, meine Frau, angelockt, die nachsehen gegangen war und die Szene entdeckt hatte. Sie empfand zwar Mitgefühl für den armen Biddle, doch sie hatte ihn unverzüglich aus dem Haus verbannt, bis seine Erkältung abgeklungen war. »Sonst stecken wir uns noch alle bei ihm an«, hatte sie entschlossen verkündet.
Bessie war untröstlich und Lizzie unnachgiebig gewesen und hatte sie daran erinnert, dass Biddle eine Mutter hatte, die sich um ihn kümmern konnte. Bessies Haare richteten sich jedes Mal auf, sobald Mrs. Biddle erwähnt wurde. Offensichtlich gab es zwischen den beiden Spannungen. Mrs. Biddle behauptete, Bessie wollte ihr den Sohn rauben, ihre einzige Stütze, und sie ganz allein zurücklassen. »Und das bei meinen Knien!«, wie sie dann jedes Mal hinzuzufügen pflegte.
Das war die allgemeine Lage, als eines dunklen Nachmittags um zwei Uhr – sämtliche Gaslampen im Gebäude fauchten bereits – der Officer unten am Empfang von einer durch die Eingangstür platzenden Erscheinung in Schrecken versetzt wurde.
Die Kombination aus einer bis über die Ohren gezogenen Schottenmütze und einem um den Hals geschlungenen dicken roten Schal verbarg das Gesicht des Besuchers. Er war höchst absonderlicherweise in einen abgewetzten, bodenlangen Pelzmantel von beträchtlichem Alter gehüllt. Dampfschwaden und der Gestank nach Rauch stiegen von ihm auf.
»Ich dachte zuerst, er wäre ein Tanzbär auf den Hinterpfoten mit einem Hut auf dem Kopf«, erzählte der Officer vom Empfang später. »Ich habe mich vielleicht erschrocken!«
Wie dem auch sei, der Neuankömmling wand den Schal vom Gesicht und deklarierte in aufgeregtem Ton: »Ich muss einen schrecklichen Mord melden!«
KAPITEL ZWEI
Der Besucher erklärte, dass in der Mülltonne draußen im Hof hinter dem Restaurant, wo er als Küchenhelfer arbeitete, die Leiche einer jungen Frau gefunden worden war. All das war mehr als genug für den Officer vom Dienst. Der Besucher wurde augenblicklich zu mir nach oben gebracht.
Inzwischen hatten sich auch Morris und Biddle mitsamt seiner Erkältung sowie einem Notizbuch zum Niederschreiben einer Aussage in meinem beengten Büro eingefunden.
Nachdem der Informant sich seiner kunterbunten Überbekleidung entledigt hatte, erwies er sich als junger Mann von vielleicht sechzehn oder siebzehn Jahren. Er trug noch seine schmuddelige Schürze, und seine untersetzte Statur ließ vermuten, dass er kurzen Prozess machte mit den Essensresten, die aus dem Lokal in die Küche zurückkamen. Ich war überrascht, dass überhaupt noch irgendetwas in den Mülleimer wanderte. Sein Kopf reichte mir nur bis zum mittleren Westenknopf, und mit seinem großzügigen Leibesumfang und den kurzen Beinen vermittelte er den allgemeinen Eindruck, dass seine Körpermaße mehr oder weniger in sämtliche Richtungen die gleichen waren, wie bei einem Würfel. Sein Name lautete Horace Worth.
»Es ist nicht meine Schuld, Gents!«, jammerte Horace zutiefst betrübt, zum einen, weil man ihn aus der warmen Küche geworfen und auf solch einen Botengang geschickt hatte, und zum anderen, weil er einen Mangel an Mitgefühl von unserer Seite zu spüren vermeinte. »Ich weiß überhaupt nicht, warum jeder mir die Schuld gibt!«
»Wir geben dir keine Schuld, mein Junge«, rumpelte Morris. »Es sei denn natürlich, das alles stellt sich als ein Haufen Unsinn heraus.«
»Ich hab sie nicht da reingeworfen! Ich wusste nicht, dass sie dort war! Hätt’ ich das gewusst, wär ich in der Küche geblieben und hätt’ die Nase nicht aus der Tür gesteckt! Ich schwör’ auf ’nen Stapel Bibeln, ich wusst’ nich’, dass sie dort ist! Es ist nicht meine Schuld, oder? Aber O’Brien, das Erste, was er macht, er haut mir die Suppenkelle über’n Kopf und …«
»Wer ist O’Brian?«
»Das ist der Koch. Er ist ein übellauniger Mist … Er ist ständig schlecht gelaunt. Als ich reingerannt kam und ihm erzählt hab, was für einen grässlichen Schrecken ich bekommen hab – und ich kann Ihnen sagen, ich hab mich zu Tode erschrocken, das könn’ Sie mir glauben! Jedenfalls, er hat mich mit der Kelle geschlagen, auf den Kopf!« Er rieb sich bei der Erinnerung die Stelle an seinem Schädel. »Und dann ist Mr. Bellini gekommen und hat auch noch angefangen! Mr. Bellini ist der Besitzer. Schlimmer noch, dann taucht auch noch Mr. Bellinis Frau auf! Sie ist ein Drachen, das ist sie! Ein richtiger Drachen! … Sie hält ein Auge auf das Geld«, fügte er nach einer kurzen Pause vertraulich hinzu. »Die Händler und Lieferanten fürchten sie, weil sie um jede Kartoffel feilscht.«
»Wie ist der Name dieses Lokals?«
»Wir heißen die Imperial Dining Rooms«, verkündete Horace mit großer Geste. »Wir sind in der New Bond Street und wir sind ein hochklassiges Etablissement. Also Mr. Bellini, er sagt, ich soll zum Scotland Yard. Es ist ihm egal, wie viele Probleme ich hab herzukommen. Man sieht die Hand vor Augen nich’ da draußen, und die halbe Zeit wusst’ ich nich’, ob ich nach Norden oder nach Süden geh’.« Er redete in einem nasalen Ton, der auf eine verstopfte Nase hindeutete.
»Du hättest den ersten Constable anhalten können, dem du begegnet bist, und ihn informieren«, krächzte Morris mitleidslos ob der Mühsal unseres Besuchers. »Er wäre mit dir an deine Arbeitsstelle zurückgekehrt und hätte ein wenig mehr über die Angelegenheit herausgefunden, bevor er einen detaillierten Bericht abgeliefert hätte.«
»Ich hab Ihnen doch schon gesagt, Mr. Bellini hat angeordnet, dass ich zum Yard soll!«, erwiderte Horace würdevoll. »Er hat gesagt, er will nicht, dass ein gewöhnlicher Streifenpolizist seine Nase in unser Lokal steckt und rumschnüffelt. Er will einen Officer, der weiß, was er mit einer Toten machen muss. Ich sollt’ zum Scotland Yard und sonst nirgendwohin. Abgesehen davon hab ich unterwegs keinen Constable gesehen. Ich hab einen gehört, mitten auf der Piccadilly, wo er versucht hat, irgendein Handgemenge zwischen einer Kutsche und einem Straßenhändler zu schlichten. Ich konnt’ ihn nicht sehen, nur brüllen hör’n. Alle ham’ gebrüllt, der Kutscher, der Händler und ein paar andere Leute. Gemüse lag über die Straße verteilt. Ich bin auf einen Pastinak getreten.«
Als Beweis kramte er in seiner Manteltasche und brachte ein zerquetschtes Etwas zum Vorschein, das vielleicht einmal ein Pastinak gewesen war.
»Warum hast du ihn aufgehoben und mit hergebracht?«, wollte Morris mit heiserer Stimme wissen.
»Ich nehm’ ihn mit zurück ins Lokal«, erwiderte Horace. »Er kann in die Suppe.«
»Wo immer dieses Etablissement ist«, murmelte ich an Morris gewandt. »Ich glaube nicht, dass ich Lust habe, dort zu essen.«
Horace hatte scharfe Ohren. »Es ist nichts verkehrt mit unser’m Lokal!«, protestierte er. »Sie können ruhig vorbeikommen und sich in unserer Küche umsehen. Alles ist blitzblank und sauber! O’Brian lässt mich die halbe Zeit putzen und Töpfe und Pfannen und Geschirr spülen und die Tische schrubben. Aber nicht die Böden, wissen Sie?«, fügte er hinzu. »Das macht eine alte Frau, die morgens vorbeikommt. Ich bin nämlich kein Handlanger. Ich lern’ das Kochen. Ich seh’ O’Brian zu. Meistens lässt er mich Kartoffeln schälen oder Sachen umrühren. Wenn er gute Laune hat, erklärt er mir, wie man Gebäck macht und so. Ich werd’ eines Tages selbst ein richtiger Koch.«
»Der Himmel steh uns bei!«, murmelte Morris.
»Erzähle das Ganze dem Constable hier noch einmal, und er schreibt es auf!«, befahl ich, und Biddle machte sich mit seinem Notizbuch und einem Stift bereit. »Wen könnten wir hinschicken?«, fragte ich an Morris gewandt.
»Mullins ist draußen und untersucht einen Einbruch«, informierte Morris mich. »Jessop hat sich heute Morgen zum Dienst gemeldet, aber er hat so furchtbar geschnieft und geniest, dass ich ihn wieder nach Hause geschickt habe. Die anderen sind ebenfalls alle unterwegs, hauptsächlich wegen Überfällen oder Straßenraub. Es ist dieser Nebel, wissen Sie, Sir? Jedes Schlitzohr in ganz London nutzt die Gelegenheit für seine krummen Touren. Wir sind sehr knapp an Personal, Mr. Ross.«
»Constable Biddle?«
Biddle kam hinter einem großen Taschentuch zum Vorschein und blinzelte mich aus wässrigen, rot geränderten Augen an. »Sir?«
Ich seufzte. »Sie bleiben besser hier. Aber informieren Sie einen Polizeiarzt, der uns vor Ort treffen soll, ja? Nun denn, Morris, die Angelegenheit ist an Ihnen und mir, schätze ich!«
Wir benötigten eine gute Weile, um zu dem Lokal zu gelangen. Wir mussten zu Fuß gehen. Horace Worth führte uns. Er rief die ganze Zeit laut nach uns, sodass wir wussten, wo er war, denn der Nebel verschluckte ihn schon nach ein oder zwei Metern. Manchmal konnten wir seine stämmige Gestalt in dem dicken Pelz schemenhaft erkennen, doch die meiste Zeit war er nichts weiter als eine Stimme, die »in die Wildnis rief«, wie Morris in einem düsteren Versuch von Humor bemerkte. Sowohl Morris als auch ich trugen unsere Blendlaternen bei uns. Ihr gelbes Leuchten im Nebel diente dazu, unsere Position anzuzeigen, doch das war auch schon alles. Wir rannten in andere Fußgänger und stolperten über ungesehene Hindernisse. Endlich, nach einer halben Ewigkeit, erreichten wir die Imperial Dining Rooms.
Die Front des Lokals war schmal, doch einmal im Innern stellten wir fest, dass es sich wie ein Schlauch in einer Abfolge von drei kleinen Speiseräumen bis zur Rückseite des Gebäudes zog, was die Mehrzahl im Namen rechtfertigte, auch wenn es derzeit keine Gäste gab, die dort aßen. Hinter den Speiseräumen debouchierten wir in die Küche, wo uns eine willkommene Wärme, eine weniger willkommene feuchte Atmosphäre und ein geradezu feindseliger Empfang entgegenschlugen.
Sie waren drei an der Zahl, und ihre Gesichter glänzten vor Schweiß. Es dauerte nicht lange, und ich spürte unter meinem schweren Uniformmantel selbst den Schweiß zwischen den Schulterblättern herunterrinnen. Schnell fing ich an zu bedauern, das eine Temperaturextrem gegen das andere getauscht zu haben.
O’Brian, der Koch, war ein kleiner Mann mit einer fleckigen weißen Schürze über einer grau karierten Hose und mit einer Kochmütze auf dem Kopf. Er sah uns finster an und fuchtelte mit der Kelle, die er in der Hand gepackt hielt – es war unklar, ob zur Begrüßung oder als Herausforderung. Neben ihm stand ein stämmiger Gentleman, der sich als Mr. Bellini entpuppte, der Besitzer des Etablissements. Er hatte einen prächtigen schwarzen Schnurrbart und sah wie der personifizierte italienische Restaurantbesitzer aus – bis er anfing, in reinstem Londoner Dialekt zu reden. Neben ihm stand Mrs. Bellini, gleichermaßen üppig proportioniert und in schwarzen Bombasin gehüllt. Ihr Gesicht war rot und ihr Haar noch viel röter. Es war in einem komplizierten Berg von Zöpfen arrangiert, die mich an ein Nest von sich windenden Nattern erinnerten. Obenauf saß eine kleine Spitzenhaube mit herabhängenden Bändern, die ihre breiten Gesichtszüge rahmten.
Alles in allem waren wir in der kleinen Küche ziemlich eng zusammengepfercht, und das Gedränge wurde alsbald durch einen Neuankömmling noch vergrößert. Die Hintertür ging auf, und herein kam ein Schwall Nebel zusammen mit einem Constable in einem schweren Übermantel. Er schien über dem Leichnam Wache gestanden zu haben.
»Mitchum, Sir«, informierte er mich, nachdem es ihm gelungen war, sich in den Raum zu quetschen und nachdem Morris und ich uns zu erkennen gegeben hatten. »Dieses Lokal liegt auf meiner Runde.«
»Dann ist man also losgegangen und hat Sie gerufen?«, grollte Morris mit einem finsteren Blick zu Horace Worth.
»Nein, Sir, eigentlich nicht«, erklärte Mitchum. »Ein Passant auf der Straße hat mich angehalten und mir berichtet, dass es hier im Lokal ein Problem gäbe. Er wäre soeben von hier gekommen, sagte er, und in der Küche gäbe es lautes Geschrei. Er konnte nicht genau feststellen, was vor sich ging, aber irgendjemand hätte gerufen, dass draußen im Hof eine Leiche läge. Also dachte ich, ich komme besser her und sehe mir die Sache an. Es ist tatsächlich eine Leiche. Ein Mädchen.«
»Ich wollte, dass sie hier weggeschafft wird!«, schnappte Mr. Bellini. »Ich will sie nicht in meinem Laden haben! Ich kann keine Kundschaft bewirten, solange sie hier ist, und ich verliere mein Geschäft!«
»Ich denke nicht, dass viel Geschäft zu verlieren ist, Sir«, entgegnete Morris. »Nicht bei diesem Nebel.«
»Es gibt immer etwas zu verdienen hier in der Nähe der Piccadilly«, entgegnete Bellini trotzig.
»Wir sind bekannt für unsere Rindfleisch-Pasteten!«, meldete sich Mrs. Bellini zu Wort. »Wir machen die beste Pastete in diesem Teil der Stadt.«
»Ich stehe seit sechs Uhr heute Morgen in der Küche und mache Pasteten«, meldete sich O’Brian zu Wort. »Aber wer soll sie bestellen, wenn Leichen im Laden herumliegen? Jeder kennt die Geschichte von Sweeney Todd, oder? Niemand rührt die Pasteten jetzt noch an, darauf können Sie Ihren letzten Penny verwetten!«
»Dieses Mädchen hat nicht das Geringste mit uns zu tun!«, rief Mrs. Bellini aufgebracht. »Sie ist eine gewöhnliche Prostituierte, das ist sie – oder besser, war sie! Mädchen wie sie enden immer tot in irgendeiner dunklen Gasse. Aber diese dort ist in unserem Hof gelandet, und das ist einfach nicht richtig!«
»Sie wird uns ruinieren, das wird sie!«, lamentierte ihr Ehemann.
»Mitchum, vielleicht könnten Sie uns zu der Leiche bringen?«, wandte ich mich an den Constable. »Alle anderen warten bitte hier. Wir werden Ihre Aussagen später schriftlich festhalten.«
»Was sollen wir schon darüber auszusagen haben?«, rief Mrs. Bellini, deren bereits rote Gesichtsfarbe inzwischen in ein alarmierendes Magenta übergegangen war. »Das alles hat nichts mit uns zu tun! Wir wollen nur, dass sie endlich weggeschafft wird!«
»Das wird sie auch, Madam. Das wird sie irgendwann«, versicherte Morris ihr. »Wir wollen uns nur zuerst umsehen. Warum gehen Sie nicht alle solange in den Speisesaal hinüber?« Er deutete auf die Tür, durch die wir die Küche betreten hatten. »Vielleicht würde eine schöne Tasse Tee helfen, Ihre Nerven ein wenig zu beruhigen.«
Morris’ ruhige Art und seine Besorgnis für ihre Nerven besänftigten Mrs. Bellini, die daraufhin verkündete, sie wäre froh, dass sich jemand um ihre Gefühle sorgte. Anschließend bellte sie O’Brian an, er solle Tee machen. Wir überließen sie sich selbst.
Der Hinterhof war klein und auf drei Seiten von Gebäuden gesäumt. Die vierte Seite hatte ein Holztor in einer hohen Mauer, das hinaus auf eine Gasse führte. Das Tor war verschlossen, um Neugierige fernzuhalten, doch wir konnten auf der anderen Seite aufgeregt flüsternde Stimmen hören, und in der Luft lag der Geruch nach Tabak. Die Nachricht von der Toten hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Gleich neben der Hintertür zur Küche stand eine große Abfalltonne, eingeklemmt zwischen der Hauswand des Lokals und einem morschen Abort. Er sah aus, als wäre er früher als Zisterne benutzt worden. All das konnten wir nur unter Schwierigkeiten im Licht unserer Blendlaternen erkennen. Der Nebel waberte um uns herum und fand seinen Weg in unsere Kehlen. Ich zog meinen Schal enger und bedeckte damit meinen Mund, als ich anfing zu husten.
»Das ist es?«, wandte sich Morris an Mitchum. »Diese Abfalltonne, oder was auch immer?«
»Es ist nur für jene Abfall, die keine Verwendung dafür haben, Sergeant«, entgegnete Mitchum. »Man wirft die Reste aus der Küche hinein. Und dann kommen die Plünderer. Jemand von der Leimfabrik nimmt sämtliche tierischen Überreste mit, Knochen, Haut und so weiter. Dann kommt ein anderer Kerl, der in der Nähe Schweine hält, und er nimmt sämtliche Gemüsereste und alles sonst noch Essbare, was die Leimfabrik dagelassen hat. Wie Sie sicher wissen, fressen Schweine so gut wie alles. Das Lokal muss sich nie darum kümmern, den Behälter zu leeren. Sie werfen immer nur neuen Abfall hinein. Aber als der Junge heute nach draußen kam, um einen Eimer mit Küchenabfällen zu leeren, fand er das da.«
Mitchum hielt seine Laterne über die Abfalltonne, und wir spähten hinein.
Es war ein unglaublich trauriger Anblick. Sie sah kaum älter aus als ein Kind, aber sie war schätzungsweise achtzehn. Wer auch immer sie in dieser dreckigen Ausrede für einen letzten Ruheplatz zurückgelassen hatte, hatte sie dem Aussehen nach einfach hochgehoben und hineingeworfen. Sie war verkrümmt auf der Seite gelandet und sah aus, als würde sie schlafen, außer, dass ihre Augen offen standen und blicklos waren. Ein großer und starker Mann konnte das ohne Hilfe bewerkstelligen, dachte ich. Wären es zwei Kerle gewesen, die sie hochgehoben und hineingeworfen hätten, wäre sie vermutlich mit dem Gesicht nach unten gelandet. Nein, er hatte sie mit den Armen hochgehoben, über den Rand der Tonne, und sie einfach fallen lassen. Ihr Zuhälter vielleicht? Hatte sie versucht, vor ihm zu fliehen? Oder war es ein gewalttätiger Kunde gewesen?
Ihr hochgestecktes Haar hatte sich gelöst und fiel um ihr Gesicht herum, ohne es jedoch vollständig zu verdecken, sodass ich ihre kleine Nase und ihren Mund sehen konnte, der halb offen stand, wie um einen letzten Atemzug zu tun. So viel war im orangefarbenen Lichtschein der Laterne zu erkennen. Die schlechte Beleuchtung veränderte die Farben, und ihr Kleid erschien grau, obwohl es jeden Farbton hätte haben können. Ich bemerkte weder eine Haube noch einen Hut oder ein Tuch.
Für den Tatort eines ernsten Verbrechens hätten die Bedingungen nicht schlechter sein können. Wegen des Nebels war es vollkommen unmöglich, eine Fotografie anzufertigen. Wenigstens waren die Ratten noch nicht bis zu ihr vorgedrungen. Was vermutlich an den glatten Außenseiten dieser Metalltonne lag – die Kreaturen wussten zweifellos, dass sie dort war, doch sie hatten bisher noch keinen Weg gefunden, an sie heranzukommen. Mit genügend Zeit hätte sich das zweifellos geändert. Doch jetzt würde sie fortgeschafft werden, bevor es dazu kommen konnte.
Ich senkte die Laterne. »Schreiben Sie alles so detailliert auf, wie Sie nur können, Morris«, sagte ich. »Machen Sie eine Skizze von diesem Hof mit der Position der Tonne, des Tors und allem anderen, was Sie sonst noch sehen. Wenn Sie sich künstlerisch betätigen wollen, machen Sie eine Zeichnung.«
Ein dumpfes Brummeln von irgendwo im Nebel deutete an, dass Morris sich im Moment nicht besonders künstlerisch fühlte.
»Tun Sie, was Sie können«, redete ich ihm gut zu. »Wo ist dieser Junge?«
»Ich bin hier«, kam eine Stimme aus dem Bündel mottenzerfressenen Fells, das Horace Worth war.
»Um welche Zeit hast du ihren Leichnam gefunden?«
»Das habe ich Ihnen doch schon gesagt!«, erwiderte der Pelzmantel. »Etwas mehr als eine Stunde, bevor ich zu Ihnen gekommen bin. Es muss so gegen halb eins gewesen sein. Normalerweise haben wir um diese Zeit richtig viel zu tun, aber wegen dem Nebel war es leer.«
»Soll das heißen, du hattest vorher keinen Grund, in die Tonne zu sehen?«
»Ich war ein paar Mal draußen und hab Abfälle reingeworfen, aber ich hab nicht richtig reingesehen, könnte man sagen. Ich bin einfach nur so schnell wieder nach drinnen gegangen, wie ich konnte. Dann, beim letzten Mal, hab ich in die Tonne gesehen, und, na ja, da lag sie.«
»Sieht so aus, als müssten wir annehmen, dass sie während der Nacht oder zumindest sehr früh an diesem Morgen hineingeworfen wurde, Sir«, krächzte Morris. »Der Junge mag sie vielleicht vorher nicht gesehen haben, aber entweder er oder dieser Koch hätten sicher bemerkt, wenn jemand eine Leiche hereingetragen und in die Tonne gelegt hätte. Abgesehen davon muss er einen ziemlichen Lärm veranstaltet haben.«
Es war eine logische Schlussfolgerung, und ich pflichtete ihm bei. »Ich gehe nach drinnen und rede mit den Bellinis. Ich möchte wissen, ob sie sie richtig angesehen oder nur einen flüchtigen Blick auf sie geworfen haben. Ich schätze, wenn sie sie richtig ansehen, erkennen sie sie vielleicht. Constable!« Ich drehte mich zu Mitchum um. »Das ist Ihre Runde, sagen Sie? Sicher kennen Sie die meisten Mädchen, die auf diesen Straßen arbeiten, vom Sehen. Sie haben die Tote vorher noch nie bemerkt?«
»Ich denke nicht, Sir.« Mitchum schüttelte den Kopf. »Ich kenne ein paar der Mädchen vom Sehen, genau wie Sie sagen. Aber sie kommen und gehen. Abgesehen davon gibt es so viele von ihnen in der Piccadilly und in der Umgebung.«
Ich kehrte in das Gebäude zurück und fand die Besitzer und das Personal immer noch beieinander an einem der Esstische sitzend. Ein Kellner in mittlerem Alter in einer gestreiften Weste und einer weißen Schürze hatte sich zu ihnen gesellt. Die Oberseite seines Schädels war kahl, und das wenige noch an den Seiten wachsende Haar war sorgfältig über die Glatze nach vorne gekämmt und dort mit Pomade fixiert. Er starrte mich bitter aus tief liegenden Augen an und begrüßte mich mit: »Ich weiß überhaupt nichts von leichten Mädchen! Ich bin Methodist!«
Sie hatten vielleicht mit Tee angefangen – oder wenigstens Mrs. Bellini hatte etwas davon getrunken, denn ihre leere Tasse stand neben ihr –, doch inzwischen waren sie zu stärkeren Sachen übergegangen, denn auf dem Tisch stand eine angebrochene Flasche.
Ich stellte meine Fragen: Hatten sie die Tote gründlich in Augenschein genommen? Und falls nicht, hatten sie Einwände, alle nach draußen zu gehen und sie jetzt gründlich anzusehen? Für den Fall, dass sie sie kannten?
»Sie kennen?« Mrs. Bellini wich zurück, als hätte ich sie körperlich bedroht. »Woher sollten wir eine Dirne wie sie kennen? Das hier ist ein ordentliches Restaurant, kein Bordell!«
»Wenn sie in dieser Gegend gearbeitet hat, ist sie Ihnen vielleicht aufgefallen. Möglicherweise ist sie sogar das eine oder andere Mal mit einem Kunden in Ihr Restaurant gekommen, Sie wissen schon, mit einem Mann, den sie dazu überredet hat, ihr eine Mahlzeit zu spendieren.«
»Ganz bestimmt nicht!«, begehrte Mrs. Bellini empört auf. »Wenn ein Gast eine Dirne wie die da mit hereingebracht hätte, hätten wir ihn auf der Stelle gebeten, sie zu nehmen und wieder zu verschwinden!«
»Eine billige Straßendirne«, sagte der kahle Kellner. »Ich erkenne so was auf den ersten Blick.«
Sie murrten immer noch alle vor sich hin, doch sie ließen sich von mir nach draußen in den Hof führen, wo einer nach dem anderen in die Abfalltonne spähte, während Morris neben ihnen stand und ihnen mit der Laterne leuchtete. Ich griff nach unten und schob der Toten die Haare aus dem Gesicht, sodass mehr von ihr zu sehen war. Meine Finger streiften über ihre Wange. Sie war eiskalt.
Mrs. Bellini warf nur einen flüchtigen Blick in die Tonne und murmelte, dass es wirklich abscheulich wäre, bevor sie hastig zurück ins Lokal flüchtete. Von den anderen zeigte wenigstens O’Brian ein wenig Respekt. Er bekreuzigte sich und wünschte ihr, Gott möge ihrer Seele den ewigen Frieden geben. Doch er klang unbekümmert und philosophisch. Der kahlköpfige Kellner blieb am längsten von allen über der Tonne stehen und starrte auf die Tote hinunter. Ich erwartete ein passendes Bibelzitat, doch er schüttelte nur wortlos den Kopf und schlurfte davon. Sie alle bestritten, die Tote je zuvor gesehen zu haben.
Ich kehrte mit den Bellinis nach drinnen zurück und entdeckte einen Neuankömmling, der auf uns wartete. Er trug einen schweren Ulster und hatte den Hut bereits abgenommen. Darunter waren ein jugendliches Gesicht und ein Schopf roter Haare zum Vorschein gekommen.
»Wir haben geschlossen, Sir!«, erklärte Mr. Bellini in gequältem Tonfall. »Aber wir öffnen später wieder für das Tagesgeschäft – sobald ein kleines Problem geklärt wurde. Ich hoffe doch, wir dürfen mit dem Vergnügen Ihres Besuchs rechnen?«
»Ich bin Dr. Mackay«, antwortete der Neuankömmling mit starkem schottischen Akzent. »Und ich wünsche nichts zu essen. Ich bin der Polizeiarzt.« Er richtete seinen Blick auf mich. »Sind Sie Inspector Ross?«
»Ja, ich bin Ross, und Gott sei Dank, dass Sie da sind. Wir sind draußen im Hof, hinter der Küche, bitte folgen Sie mir!«
Die Bellinis sahen uns mit finsteren Blicken hinterher.
Mackay erwies sich als praktischer Mensch, der keine Zeit verschwendete. Er zog seinen Mantel aus und reichte ihn Morris. Dann kletterte er geschickt in den Abfallbehälter, um die Leiche zu untersuchen. Es dauerte nicht lange, bis er wieder herauskam und seinen Mantel überzog. »Ich hoffe, Sie wollen nicht von mir wissen, wann das Mädchen gestorben ist?«, fragte er, als er hineinschlüpfte.
»Eine grobe Schätzung wäre hilfreich«, antwortete ich ihm.
»Sicher, kann ich mir denken. Die Leichenstarre ist weit fortgeschritten. Unter normalen Umständen würde ich erwarten, dass sie bis morgen Vormittag vorbei ist. Falls sie allerdings schon die ganze Nacht unter Bedingungen nahe dem Gefrierpunkt dort gelegen hat, macht das die Sache kompliziert. Möglicherweise kann ich Ihnen Genaueres sagen, sobald ich sie in ordentlichem Licht untersuchen konnte.«
»Die Leichenschauhäuser sind allesamt voll, Sir«, warf Morris ein. »Wegen des Nebels, wissen Sie?«
»Das denke ich auch«, pflichtete Mackay ihm bei. »Sie könnten es bei den Bestattungsunternehmen versuchen. Es muss doch irgendwo in der Nähe eine Aufbahrungshalle geben. Vielleicht ist der Betreiber einverstanden, dass die Tote einstweilig dort hingeschafft wird.«
»Mitchum! Sie müssen doch wissen, wo in der Gegend die Aufbahrungshallen sind. Vielleicht nehmen Sie Sergeant Morris mit und suchen uns eine.«
Ich beugte mich über den Abfallbehälter, um einen letzten Blick auf das Opfer zu werfen. Als ich mich wieder aufrichtete und umwandte, sah ich, dass Mackay mich beobachtete. »Sie brauchen mich im Moment nicht länger«, sagte er auf seine forsche schottische Art, und mit einem letzten Nicken stapfte er zurück in die Küche und verschwand.
In diesem Moment klopfte es laut und sehr energisch an der verschlossenen Holzpforte auf der Rückseite des Hofs, die in die Gasse führte.
»Kein Zutritt!«, rief Mitchum. »Polizeiangelegenheit.«
»Wenn Sie ein Constable sind«, entgegnete eine ältere, jedoch selbstsichere weibliche Stimme in gebildetem Tonfall, »dann seien Sie doch bitte so freundlich und öffnen diese Tür. Ich möchte mit einem Verantwortlichen reden.«
KAPITEL DREI
»Gehen Sie nachsehen, Constable«, befahl ich.
Mitchum näherte sich vorsichtig der Pforte, öffnete sie einen Spaltbreit und spähte hinaus. Ich hörte ihn leise rufen, dann griff er nach draußen, zog jemanden durch die schmale Lücke und schloss die Tür rasch wieder, bevor jemand anders folgen konnte.
»Ich wusste nicht, dass Sie das sind, Ruby!«, sagte er. »Was machen Sie bei diesem Nebel hier draußen? Sie sollten zu Hause im Warmen sitzen.«
»Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich mit Miss Eldon anreden würden!«, schnappte sein Gegenüber. »Ist ein leitender Officer da? Falls ja, wünsche ich ihn zu sprechen. Ich habe Informationen.«
Mitchum kam zu mir. »Ihr Name ist Ruby Eldon, Sir«, sagte er leise. »Sie wohnt in der Gegend. Sie ist, äh, ein Original, Sir.«
»Bringen Sie sie in die Küche«, ordnete ich an.
Mitchum führte die Besucherin mit einer gewissen Feierlichkeit in die Küche und ließ sie auf einem Holzstuhl Platz nehmen. Sie entpuppte sich als eine Person von außergewöhnlichem Erscheinungsbild, sehr klein, mit der Statur eines vielleicht zwölfjährigen Kindes. Sie war sorgfältig gekleidet, doch in der Mode der 1830er-Jahre, mit Glockenrock und Übermantel mit Ballonärmeln und abfallenden Schultern. Eine große Haube und Ringellöckchen, die unter dem Saum hervorquollen wie Laub aus einem Korb, rahmten ihr Gesicht. Ich nahm an, dass die Löckchen falsch waren, denn sie glänzten und waren von einem satten Rostbraun ohne jede Spur von Grau, und das, obwohl die Besucherin offenkundig in recht fortgeschrittenem Alter sein musste. Ihre Haut war zart und ohne Flecken, doch mit einer Textur wie von zerknittertem Pergament. Sie saß sehr aufrecht und hatte die Hände auf einem vor ihr stehenden Regenschirm gefaltet. Sie musterte mich eingehend aus wachen Augen, und ich fühlte mich an ein Eichhörnchen erinnert. Sie schien auf etwas zu warten, und ich begriff, dass ich mich noch nicht vorgestellt hatte. Ich beeilte mich, mein Versäumnis nachzuholen.
»Sehr gut«, sagte Miss Eldon mit einem graziösen Neigen der Haube und der Locken. »Ich erkenne an Ihrem Tonfall, dass Sie kein geborener Londoner sind. Wer war Ihr Vater?«
»Mein Vater war Minenarbeiter, Ma’am, in Derbyshire.«
»Warum sind Sie dann in London und warum sind Sie Police Officer?«
»Das ist eine lange Geschichte, Ma’am. Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Die Leute da draußen …« Sie nahm eine winzige behandschuhte Hand vom Griff des Schirms und deutete in Richtung des Hofs. »Sie sagen, dass die Leiche einer Frau hier gefunden wurde. Ist das so?«
»Ich fürchte, das ist so, Ma’am. Nicht im Haus, sondern draußen im Hof.«
»Ich möchte sie sehen«, sagte Miss Eldon gefasst.
»Ich glaube kaum, dass das klug wäre, Ma’am, oder sich ziemen würde.«
»Ihre Besorgnis ehrt Sie, Inspector Ross, aber ich möchte die Unglückselige trotzdem sehen. Es wäre möglich, dass ich sie kenne.«
Mitchum war im Raum geblieben und stand wie ein Diener hinter ihrem Stuhl. Er begegnete meinem Blick, hob eine Faust an den Mund und räusperte sich. »Miss Eldon wohnt über der Queen-Catherine-Taverne, ein paar Straßen von hier entfernt. Sie kennt viele der Anwohner, wenigstens vom Sehen.«
Miss Eldon klopfte energisch mit der Schirmspitze auf den gefliesten Boden. »Ich wohne nicht über der Taverne, Constable Mitchum. Ich habe Räumlichkeiten in diesem Gebäude bezogen, im obersten Stockwerk. Der Wirt und seine Familie wohnen über der Taverne, wie Sie es nennen, auf der Etage unter mir.«
Ich zögerte. »Es ist kein schöner Anblick, Ma’am«, sagte ich.
»Ich bin nicht leicht aus der Fassung zu bringen, Inspector Ross.« Sie erhob sich. »Wenn Sie vorausgehen würden?«
»Also schön«, gab ich nach. Mir war klar geworden, dass sie sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen lassen würde.
Ich führte sie in den Hof, wo wir vor einem weiteren Problem standen. Die Lady war zu klein, um über den Rand des Abfallbehälters zu sehen.
»Constable!«, befahl Miss Eldon. »Wenn Sie mir behilflich wären!«
»Jawohl, Ma’am«, sagte Mitchum. Er schlang die Arme um ihre Taille und hob sie hoch wie ein Kind, sodass sie sich vorbeugen und in die Mülltonne sehen konnte. Morris leuchtete mit seiner Blendlaterne.
»Du meine Güte, nein«, sagte Miss Eldon. »Das ist sie nicht. Das ist nicht das Mädchen.«
Mitchum stellte sie behutsam zurück auf ihre eigenen Beine.
»Welches Mädchen meinen Sie?«, beeilte ich mich zu fragen.
»Nicht das, von dem ich dachte, sie könnte es sein. Ich kann Ihnen nicht helfen, Inspector Ross. Constable Mitchum, wenn Sie mir die Pforte öffnen würden? Ich möchte zurück in meine Wohnung.«
»Miss Eldon!«, sagte ich einer Eingebung folgend. »Ich frage mich, ob ich vielleicht jemanden zu Ihnen schicken dürfte … um Sie zu besuchen?«
»Ich empfange keine Herren in meinen Räumlichkeiten«, entgegnete Miss Eldon steif. »Mein Vater war ein Gentleman.«
»Selbstverständlich, Ma’am. Vielleicht dürfte ich meine Frau Elizabeth vorbeischicken, wäre das akzeptabel?«
»Zwischen zwei und vier Uhr nachmittags«, sagte Miss Eldon. Zum ersten Mal erschien sie mir für einen Moment verwirrt. »Die Queen-Catherine-Taverne ist in der Tat ein Lokal. Der Wirt und seine Frau sind anständige Leute, doch das kann man nicht von ihrer gesamten Kundschaft sagen. Mrs. Ross sollte nicht ohne Begleitung kommen.«
»Unser Dienstmädchen wird sie begleiten.«
»Schön, dann habe ich keine weiteren Einwände.« Sie nickte mir gnädig zu, dann wandte sie sich ab und trat durch die Pforte hinaus auf die Gasse, wo sie einen Augenblick später vom Nebel verschluckt wurde.
»Also gut, Constable Mitchum!«, sagte ich. »Vielleicht könnten Sie jetzt mit Sergeant Morris losgehen und jemanden suchen, zu dem wir die Leiche schaffen können.«
»Du möchtest, dass ich zu dieser alten Dame gehe und mit ihr rede?«, fragte Lizzie mich an diesem Abend. Wir saßen vor dem Feuer, und ich hatte ihr soeben die Ereignisse des Tages geschildert. »Ist sie denn noch bei Sinnen?«
»Ich schätze, sie ist sogar vollkommen bei Sinnen, vorausgesetzt, du bist ihr gegenüber offen«, sagte ich. Lizzies Augenbrauen schossen in die Höhe. »Und ich weiß, dass du sehr offen bist«, beeilte ich mich hinzuzufügen.
»Nun gut«, sagte Lizzie nachdenklich. »Ich gehe hin. Ich gestehe, ich bin neugierig, sie zu treffen. Du begleitest mich, Bessie.«
»Jawohl, Missis!«, sagte Bessie von der Tür her, wo sie verweilte, um meinen Bericht mitzuhören.
»Miss Eldon wird dir vermutlich als recht exzentrisch vorkommen, aber sie hat mir nicht den Eindruck gemacht, als wäre sie …« Ich zögerte.
»Verrückt?«, schlug Bessie vor.
»Nicht im Geringsten, nein, nur, wie Constable Mitchum es nannte, ein wenig originell.«
Lizzie konzentrierte sich auf die Flammen, die von den Kohlen auf dem Gitterrost aufstiegen. Das Messingbesteck an seinem Halter neben dem Kamin leuchtete wie Gold. Ich hatte sie zum ersten Mal gesehen, als sie noch ein Kind gewesen war, vor einer Ewigkeit, wie es mir schien, obwohl es in Wirklichkeit nicht mehr als fünfundzwanzig Jahre her war. Die Ereignisse hatten uns getrennt und nach langer Zeit und vielen Veränderungen wieder zusammengebracht. Doch selbst heute noch konnte ich, wenn ich sie so ansah, den Wildfang erkennen, der sie als Kind gewesen war.
»Was genau willst du in Erfahrung bringen?«, fragte sie nun, als sie aufblickte und mich ansah. »Du sagst, sie hätte bestritten, die Tote zu kennen.«
»Und ich glaube ihr. Sie kannte sie nicht. Allerdings vermute ich, dass sie ein anderes Mädchen kennt und Grund hat zu der Annahme, dass es in Gefahr schwebt. Ich bin sogar sicher, dass es so ist. Ich würde gerne herausfinden, was sie vermutet. Mein Eindruck war, dass Miss Eldon alles andere als auf den Kopf gefallen ist.«
»Was ist eigentlich aus der Toten geworden?«, fragte Lizzie unvermittelt.
»Der Leichnam liegt in der Aufbahrungshalle eines Bestatters in der Nähe des Lokals, wo sie gefunden wurde. Die öffentlichen Leichenhallen sind im Moment überfüllt mit Toten. Es ist dieser elende Nebel. Morris war froh, jemanden so nah beim Tatort gefunden zu haben. Ein Polizeiarzt mit Namen Mackay wird morgen Früh eine Autopsie vornehmen, weil niemand anders frei ist. Er denkt, dass es schwierig werden könnte, den exakten Todeszeitpunkt festzustellen, weil der Leichnam für eine unbestimmte Zeit bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt in dieser Mülltonne gelegen hat.«
Wo wir davon redeten, wie kalt und ungemütlich es draußen war, hatte ich das Gefühl, eine Entschuldigung wäre angebracht. »Es tut mir wirklich leid, dich darum zu bitten, Miss Eldon einen Besuch abzustatten, Lizzie, angesichts dieses elenden Wetters da draußen. Du musst mehrere Straßen überqueren, um zur Piccadilly zu gelangen, und du musst wirklich aufpassen. Es hat viele Unfälle gegeben in den letzten Tagen. Ich schlage vor, du nimmst eine Kutsche, aber selbst wenn dein lieber Kutscher Wally Slater dich hinbringt, wäre es im Moment nicht sicherer. Nicht weit von Scotland Yard hat es einen Unfall mit einer Kutsche gegeben, sie war umgekippt und das Pferd hing noch im Gespann. Sie waren gerade dabei, es loszuschneiden, als ich vorbeikam.«
»Besser, man ist auf den eigenen Füßen unterwegs«, beobachtete Bessie altklug. »Keine Sorge, Mr. Ross, Sir, uns passiert nichts.«
»Ah, Bessie – solltest du nicht in der Küche sein und abwaschen?«
Bessie schniefte indigniert und zog sich in die Küche zurück. Kurze Zeit später kündete das laute Klappern von Töpfen und Geschirr davon, dass sie auf ihre eigene energische Weise den Abwasch erledigte.
Lizzie starrte in das Feuer. »Denkst du, das Mädchen hat als Prostituierte gearbeitet?«
»Die Bellinis scheinen nicht daran zu zweifeln. Die Piccadilly Street ist berüchtigt dafür, die Damen der Nacht anzuziehen … und des Tages obendrein. Vermutlich haben die Bellinis recht.«
»Was hatte sie an?«
Ich musste einräumen, dass ich keine Details nennen konnte. »Es war fast nichts zu sehen da draußen im Hof, wegen dem Nebel, und außerdem war es schon beinahe dunkel. Irgendein Kleid, nehme ich an.«
»Was ist mit einem Hut?«
Ich kannte meine Frau gut genug, um zu begreifen, dass sie ihre Fragen nicht ohne Grund stellte, doch diese letzte verwirrte mich.
»Ich habe keinen Hut gesehen. Er muss heruntergefallen sein.«
»Dann müsst ihr ihn suchen. Wenn er heruntergefallen ist, als sie angegriffen wurde, könnte das den genauen Tatort verraten, oder nicht? Ich meine, sie tragen doch alle Hüte, diese Mädchen«, schloss sie.
Sie hatte recht. Sich hübsch zurechtzumachen war ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts. Ich hatte Prostituierte gesehen – die auf die wohlhabendere Kundschaft aus waren –, die gekleidet waren wie Modepuppen. Selbst die armen kleinen Dinger, die sich an den Docks und vor den Hafenkneipen herumtrieben, trugen irgendwelche Hüte, die sie an ihre – falschen oder echten – Locken gepinnt hatten. Ich musste an die Menge denken, die sich bereits hinten in der Gasse bei der Pforte versammelt hatte, als Morris und ich eingetroffen waren, und ich hielt unsere Chance, irgendetwas zu finden, geschweige denn ein so begehrtes Objekt wie einen Hut, für äußerst gering.
»Wahrscheinlich hat ihn irgendjemand entdeckt und mitgenommen«, sagte ich. »Es wäre sinnlos gewesen, in der Dunkelheit und bei dem dichten Nebel danach zu suchen.«
»Was ist mit einem Schal oder einem Tuch?«
»Nein, ich habe keinen Schal gesehen.« Ihre Fragen machten mich allmählich nervös. »Worauf willst du hinaus, Lizzie?«
»Oh«, entgegnete meine Ehefrau vage. »Nichts Besonderes. Ich habe mich nur gefragt, ob sie vielleicht in einem Haus war, als sie ermordet wurde, verstehst du?«
Das gab mir etwas zum Nachdenken. Ich überlegte, ob Morris und ich am Ende noch sämtliche Bordelle abklappern mussten.
KAPITEL VIER
Meine erste Handlung am nächsten Morgen bestand darin, beim Yard vorbeizuschauen und zu fragen, ob jemand eine junge Frau als vermisst gemeldet hatte. Niemand hatte, doch ich war nicht großartig überrascht deswegen. Die Bellinis hatten vermutlich recht, überlegte ich, und die nicht identifizierte Leiche in ihrer Mülltonne war die einer Prostituierten, eines der vielen jungen Mädchen, die in der Gegend arbeiteten. Die Zuhälter und Puffmütter, die den Handel kontrollierten, meldeten den Tod oder das Verschwinden eines ihrer Mädchen nur selten. Allzu oft war das Mädchen entweder durch ihre eigenen Hände oder durch die eines Kunden gestorben. In beiden Fällen waren Fragen der Polizei nicht willkommen. Die Entsorgung der Leiche war für die Verantwortlichen wichtiger. Aber warum im Hof der Bellinis? Warum nicht die Leiche im Schutz des Nebels hinunter zum Fluss schaffen? Junge Frauen wurden mit deprimierender Regelmäßigkeit aus der Themse gefischt.
Als Nächstes ging ich zu dem Bestattungsunternehmer, zu dem die Leiche gebracht worden war, um mich dort mit Dr. Mackay zu treffen. Ich hätte es vorgezogen, wenn Dr. Carmichael vom St. Thomas Hospital die Autopsie durchgeführt hätte, zumal angesichts der Komplikation, dass die Tote so lange in der Kälte gelegen hatte und der Todeszeitpunkt entsprechend schwer festzulegen war. Doch jeder Arzt war seit Tagen auf den Beinen. Abgesehen davon hatte Mackay bei unserer ersten Begegnung einen kompetenten Eindruck bei mir hinterlassen.
Der Nebel hatte sich ein klein wenig gelichtet, doch der Tag war noch jung. Er würde im Verlauf des Tages wieder dichter werden. Die Leichenhalle war, wie angesichts ihrer Lage in der Nähe der Piccadilly zu erwarten, ein beeindruckendes Ding. Marmorsäulen rahmten den Eingang. Ein mit purpurnem Samt umhülltes Bleiglasfenster zeigte eine Anordnung von Wachsblumen unter einer Glaskuppel sowie ein Paar sorgenvoll dreinblickender steinerner Cherubim.
Der Bestatter war ein wohlhabend aussehender Kerl, passend zu seinem Unternehmen. Er hatte einen Backenbart und trug einen hochwertigen Gehrock sowie eine verzierte Seidenweste, beides aus tiefstem Schwarz. Die düstere Farbe der Weste wurde ein wenig abgemildert durch die Pracht der schweren goldenen Albert-Kette, die darüber gelegt war. Allerdings wirkte er deprimiert, und das nicht nur aus beruflicher Sicht. Mr. Protheroe war offensichtlich der Auffassung, dass seiner geschäftlichen Reputation als seriösem Bestatter soeben ein schwerer Schlag versetzt worden war. In dieser Hinsicht ging er mit den Bellinis durchaus konform.
»Sie müssen das verstehen, Inspector Ross«, erklärte er, während er mit einer Hand auf dem Magen vor mir stand wie Napoleon auf dem bekannten Bild und mit der anderen gewichtig gestikulierte. »Sie müssen doch sicherlich um die Peinlichkeit wissen, dass wir hier eine Frau von der Straße haben, die in unserem Vorbereitungsraum auf der Platte liegt!«
Er holte mit der Hand weit nach hinten aus, um die Position der Platte anzuzeigen. »Es ist bester Carrara-Marmor«, fügte er hinzu und vergaß anscheinend für den Moment, dass ich nicht gekommen war, um »Arrangements zu treffen«. »Wir hatten schon sehr bedeutende Verstorbene auf unserer Platte liegen.«
»Wir hätten Sie bestimmt nicht belästigt, Mr. Protheroe, aber es gibt zurzeit einen Mangel an Platz in den öffentlichen Leichenhallen und in den Krankenhäusern.«
»Ah, richtig, der Nebel.« Protheroe nickte weise. »Er hat viele Leute niedergestreckt. Natürlich möchten wir der Polizei behilflich sein. Aber erst vergangene Woche haben wir die letzten Arrangements für Sir Hubert –«
Ich beschloss, weitere Beschreibungen der Details des Arrangements für den bedeutenden Verstorbenen zu unterbinden, und fragte, ob Dr. Mackay bereits eingetroffen wäre.
Der medizinische Gentleman wäre seit etwa einer Stunde bei seinem Geschäft, bestätigte Mr. Protheroe düster und rief einen käsegesichtigen Jüngling herbei, der mich in den hinteren Teil des Instituts führen sollte.
Mackays stämmige Gestalt stand über den Leichnam gebeugt. Er war in Hemdsärmeln; die ausgestreckten Arme und Fäuste ruhten auf der Platte aus Carrara-Marmor. Sein Ulster hing an einem Haken an der Wand. Er sah auf, als ich eintrat, und das Stirnrunzeln in seinem Gesicht verblasste, als er über die Tote hinweg die Hand ausstreckte, um die meine kurz zu schütteln. Im besseren Licht und mit ein wenig mehr Zeit, um ihn zu studieren, schätzte ich ihn auf höchstens dreißig. Er hatte derbe Gesichtszüge und eine sommersprossige Haut, und selbst wenn er nicht die Stirn runzelte, wirkte er streitsüchtig. Dann sahen wir beide auf den Leichnam hinunter. Die Leichenstarre war fast vorüber, wie Mackay bereits angedeutet hatte, und sie lag flach ausgestreckt da. Der Anblick war noch mitleiderregender, jetzt, wo sie ausgezogen war.
»Wie alt, würden Sie sagen, Dr. Mackay?«, fragte ich ihn.
»Siebzehn, vielleicht achtzehn.«
»Nicht älter?«
»Meiner Meinung nach nicht«, entgegnete Mackay knapp.
Eine kurze Pause entstand, und außer dem leisen Fauchen der Gaslaternen war nichts zu hören. Selbst so früh am Morgen war künstliches Licht notwendig in diesem düsteren, trüben Raum. Ich fragte mich, ob Mackay ein Mann weniger Worte war. Falls ja, so war das nicht sonderlich hilfreich für mich. Ich brauchte Informationen.
»Irgendeine Idee, was die Todesursache angeht?«
»Sie hat einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf erhalten. Unter dem Haar ist verklebtes Blut …« Er deutete auf die Stelle. »Außerdem ist ihr Genick gebrochen.«
»Könnte ein Sturz auf das Pflaster für die beiden Verletzungen verantwortlich sein?«, wollte ich wissen.
»Die Kopfwunde könnte durch einen Sturz verursacht worden sein. Falls dem so ist, ist sie nach hinten gefallen. Das allein mag nicht ausreichend gewesen sein, um sie zu töten, obwohl es nicht vollkommen unwahrscheinlich ist. Das gebrochene Genick hingegen war tödlich. Ich werde es in meinem Bericht als Todesursache festhalten.« Mackay zögerte. »Als Student habe ich die übliche Zahl von Autopsien besucht, und seit damals habe ich in meiner Zeit als Polizeiarzt selbst eine ganze Reihe durchgeführt, aber die wirklich interessanten Fälle gibt man unsereinem ja nicht. Die werden nach St. Thomas geschickt oder in ein ähnliches Institut.«
»Damit sich Dr. Carmichael darum kümmert?«
»Er ist der Experte«, räumte Mackay ein wenig melancholisch ein, um sodann, in einem Anflug von Vertraulichkeit, zu gestehen: »Ich für meinen Teil interessiere mich für Blut – und ganz besonders für Blutflecken.«
»Blutflecken!«, rief ich aus.
Zum ersten Mal schien sich Mackay für etwas zu begeistern. »O ja, Blutflecken sind ein faszinierendes Studienobjekt! Wir wissen immer noch so wenig darüber. Dort draußen auf den Straßen Londons laufen Mörder frei herum, weil wir einen Fleck nicht zweifelsfrei als Blutfleck identifizieren können, insbesondere nicht, wenn er alt ist, eingetrocknet und möglicherweise degradiert. Die Methoden, die wir heute einsetzen – sicher kennen Sie den Guajak-Test –, sind nicht zuverlässig. Es gibt Forschungen, insbesondere auf dem Kontinent und in Amerika. Ich bin recht zuversichtlich, dass ich aufgrund meiner eigenen Arbeiten zweifelsfrei feststellen kann, ob ein getrockneter Fleck Blut ist oder nicht, selbst wenn das Blut bereits degradiert ist.«
Mackay klatschte in die Hände. »Nun denn, hier ist, was ich Ihnen sagen kann. Nachdem sie getötet wurde, hat man sie – das heißt, die Leiche – auf einer flachen Oberfläche in eine sitzende Lage gebracht, vermutlich auf dem Fußboden. Ihre Knie wurden unter das Kinn gezogen und die Hände zu beiden Seiten von ihr auf den Boden gelegt.«
Vielleicht hatte ich ihn verblüfft angesehen wegen dieses überraschenden Schwalls von plastischen Details. Mackay interpretierte meine Überraschung als Zweifel. Er ging zur nächsten Wand, ließ sich nieder und setzte sich mit dem Rücken dagegen, die Knie unter das Kinn gezogen und die Hände locker zu beiden Seiten auf dem Boden, genau wie er es zuvor beschrieben hatte. »So etwa, verstehen Sie?«
Er rappelte sich hoch und kam zu der Toten auf der Marmorplatte zurück. Er drehte sie behutsam auf die Seite. »Nun, Mr. Ross, sehen Sie hier, ja? Unübersehbare Druckstellen auf den Pobacken, weiß vor dem umgebenden Purpur. Ähnliche Stellen finden sich an den Handflächen und den Fußsohlen, insbesondere an den Zehen, was daher kommt, dass sie Stiefel mit hohen Absätzen getragen hat.« Er deutete auf einen Tisch an der gegenüberliegenden Wand. »Sie stehen dort drüben. Die purpurnen Verfärbungen zeigen uns, wie sich das Blut nach dem Tod abgesetzt hat, die weißen, in welcher Lage sich der Leichnam dabei befand«, fuhr er fort. »Am wichtigsten jedoch, die Tote blieb für, warten Sie, sieben oder acht Stunden in dieser sitzenden Position. Wäre es nicht so, würde sich das Muster verändert haben und wäre nicht so deutlich. Außerdem hat während dieser Zeit die Totenstarre eingesetzt. Und der Leichnam war während der gesamten Zeit an einem sehr kalten Ort. Erst danach wurde er bewegt und in diesen Müllbehälter geschafft, wo man ihn schließlich fand.«
»Sind Sie sich dessen sicher, Doktor? Sie sind sehr präzise mit Ihren Angaben.«
»O ja«, entgegnete Mackay selbstbewusst. »Weil die Leichenflecken genügend Zeit hatten, sich so deutlich herauszubilden. Mehr noch, die Tote wurde in dieser sitzenden Position steif. Wer auch immer sie fortgeschafft hat, es ist ihm nicht gelungen, sie gerade zu biegen. Sie war in dieser zusammengekauerten Haltung, in der Sie und ich sie gesehen haben, als man sie in den Behälter geworfen hat.« Er hielt inne. »Ich könnte mir denken, dass es den Abtransport der Leiche erschwert hat. Der Abfallbehälter muss dem Täter als geradezu ideal erschienen sein.«
»Ich danke Ihnen, Dr. Mackay«, sagte ich, als er geendet hatte. »Sie haben ein sehr deutliches Szenario entworfen. Als ich die Tote zum ersten Mal in dem Müllbehälter gesehen habe, hatte ich den Eindruck, sie hätte sich auf der Seite zusammengerollt. Ich dachte, sie wäre auf eine Weise hineingeworfen worden, die diese Position verursacht hat. Jetzt sagen Sie mir, dass dem nicht so ist, sondern dass sie bereits steif war, mit gebogenen Hüften und Knien. Wäre der Leichnam früher bewegt worden, sagen wir, ein oder zwei Stunden nach ihrem Tod …«
»Wäre sie vermutlich noch nicht steif und die Leichenflecken wären noch nicht fixiert gewesen. Deswegen bin ich sicher, dass die Körperhaltung so war, wie ich sie Ihnen beschrieben habe, bevor man die Tote in den Müllbehälter warf. Man hat sie sehr schnell nach ihrem Ableben in diese Position gebracht, in der sie für die von mir erwähnte Zeit blieb, vielleicht sogar für weniger. Leichenflecken können sich innerhalb von sechs Stunden manifestieren, genau wie Leichenstarre.«
Mackay holte Luft. »Aber es kommt selten vor, dass man so präzise sein kann, wie die Polizei es gerne hätte! Und wie ich bereits erwähnte, die niedrigen Temperaturen erschweren das Problem. Sie wurde am Montagmorgen gefunden. Sie wurde vermutlich in der Nacht zuvor bewegt. Aus diesem Grund ist sie am Sonntag gestorben – viel mehr kann ich nicht sagen, nicht mit Bestimmtheit. Also fragen Sie mich nicht nach der Uhrzeit, zu der der Mörder zugeschlagen hat.«
Er hatte mir auch so eine Menge zum Nachdenken gegeben. Ich beschloss, einen neuen Ansatz zu verfolgen. »Sie erscheint mir wohlgenährt«, stellte ich fest.
»O ja, das ist richtig«, pflichtete er mir bei, um in einem weiteren Anfall von Schwatzhaftigkeit hinzuzufügen: »Und das war sie von Kindesbeinen an.«
Ich drängte auf weitere Details. »Die Mädchen, die auf der Straße arbeiten, sind normalerweise kleiner, weil sie aus ärmlichen Verhältnissen kommen oder aus dem Waisenhaus.«
»Dieses Mädchen hat nicht als Prostituierte gearbeitet!«, entgegnete Mackay. Er blickte auf und sah mich direkt an. Sein Kinn war trotzig vorgereckt. Er erwartete wohl meinen Widerspruch.
Ich war verblüfft, und er schien es mir anzusehen, denn er entspannte sich ein wenig und grinste schief. »Sie haben angenommen, sie wäre eine Prostituierte«, stellte er fest. »Nun ja, eine Tote in einer dunklen Seitengasse … es ist nicht weiter überraschend.«