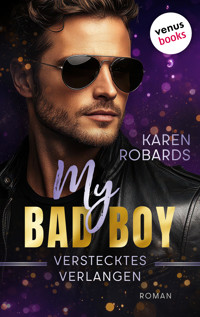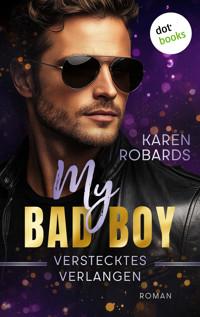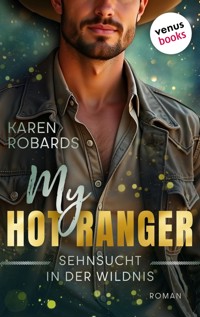
3,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: venusbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein heißer Guide. Ein gefährlicher Trip. Und eine unwiderstehliche Anziehung, die tödlich enden könnte… Eigentlich wollte Emma Hart nur ihre Tochter zurückgewinnen – doch der Abenteuerurlaub in der Wildnis ist eigentlich so gar nichts für die erfolgreiche Moderatorin, die weder Natur noch Nähe erträgt. Schon gar nicht, wenn der Trekkingführer aussieht wie die Sünde auf zwei Beinen: Nate ist wortkarg, unverschämt sexy – und viel zu nah. Und Emma hasst ihn dafür, dass sie nachts an ihn denkt und tagsüber kaum den Blick von ihm abwenden kann. Als ein Felssturz sie, ihre Tochter und Nate von der Gruppe trennt, beginnt ein gefährlicher Überlebenskampf – gemischt mit kaum zu verbergender Begierde. Denn in der Einsamkeit wächst nicht nur die Angst, sondern auch die wilde Versuchung… Spicy Romance im Western-Setting für Fans von Linda Howard und Sylvia Day
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eigentlich wollte Emma Hart nur ihre Tochter zurückgewinnen – doch der Abenteuerurlaub in der Wildnis ist eigentlich so gar nichts für die erfolgreiche Moderatorin, die weder Natur noch Nähe erträgt. Schon gar nicht, wenn der Trekkingführer aussieht wie die Sünde auf zwei Beinen: Nate ist wortkarg, unverschämt sexy – und viel zu nah. Und Emma hasst ihn dafür, dass sie nachts an ihn denkt und tagsüber kaum den Blick von ihm abwenden kann. Als ein Felssturz sie, ihre Tochter und Nate von der Gruppe trennt, beginnt ein gefährlicher Überlebenskampf – gemischt mit kaum zu verbergender Begierde. Denn in der Einsamkeit wächst nicht nur die Angst, sondern auch die wilde Versuchung…
eBook-Neuausgabe August 2025
Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »Heartbreaker« bei Delacorte Press, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Geliebter Schuft« bei Heyne.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1997 by Karen Robards
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2025 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Motives von © abu / Adobe Stock sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (mm)
ISBN 978-3-96898-333-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des venusbooks-Verlags
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.venusbooks.de
www.facebook.com/venusbooks
www.instagram.com/venusbooks
Karen Robards
My Hot Ranger – Sehnsucht in der Wildnis
Roman
Aus dem Amerikanischen von Sonja Funke
venusbooks
Dieses Buch ist meinem jüngsten Sohn gewidmet, John Hamilton Robards, der am 16. November 1995 geboren wurde. Ebenso widme ich es von Herzen Doug, Peter und Christopher.
Prolog
19. Juni 1996 15 Uhr
»Seid ihr bereit zu sterben?«
Jess Feldman wechselte einen Blick mit seinem Bruder Owen und versuchte an dem wild dreinschauenden Mann vorbeizukommen, der sich ihnen plötzlich in den Weg gestellt hatte.
»Ich habe gefragt, seid ihr bereit zu sterben?« Der Mann blieb an ihnen dran, und seine Stimmlage stieg um eine Oktave. Er gehörte zu einer Gruppe schildertragender Demonstranten vor dem Flughafen von Salt Lake City, war in den Vierzigern, sein Haar begann sich zu lichten, und er trug einen billigen grauen Polyesteranzug, ein vergilbtes weißes Hemd sowie einen gestrig wirkenden schwarzen Schlips.
»Verzieh dich«, sagte Jess grob, während Owen ihn am Ärmel seines karierten Flanellhemdes erwischte und hinter sich herzog.
»Bereut!« kreischte der Mann hinter ihnen her. »Das Ende der Welt naht!«
»Ach ja?« stieß Jess hervor. Über seine Schulter sah er zu dem Demonstranten zurück, während Owen ihn unerbittlich weiterzog. »Und wann?«
»Am 23. Juni 1996! Um neun Uhr morgens!«
Ein Polizeiwagen mit Blaulicht hielt mit kreischenden Bremsen an. Der düstere Prophet wandte sich ab.
»Das nennt man genaue Angaben«, sagte Jess zu seinem Bruder. »Ich möchte mal wissen, was mit den Burschen passiert, wenn sie eine solche Vorhersage machen und die Welt dann nicht planmäßig untergeht.«
Owen zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich machen sie noch mal ’ne Vorhersage. Komm jetzt, wir wollen nicht zu spät zu unseren Gästen kommen. Vergiß nicht, die Gruppe ist von einer protzigen Mädchenschule in Chicago.«
»Genau das richtige für mich«, sagte Jess grinsend.
Während Owen ihn durch die Doppeltüren zog, warf Jess einen Blick zurück. Zwei uniformierte Polizisten sprachen mit den Demonstranten. Eines ihrer Schilder war ihm zugewandt. Jess las die Aufschrift:
Bereut!
Das Ende
der Welt
ist nah!
Unter dieser Warnung war ein blutrotes, entzwei gebrochenes Herz zu sehen, dessen eine Hälfte zur Seite gekippt war. Unter dem Herz standen die Worte DIE LIEBE HEILT.
»Ein Haufen Schwachsinniger«, murmelte Jess kopfschüttelnd. Dann schlossen sich hinter ihm die großen gläsernen Flügeltüren, und er vergaß sie.
Kapitel 1
Juni 1996 23 Uhr 45
»Draußen ist jemand.«
Die 16-jährige Theresa Stewart ließ den Saum des verschlissenen gelben Gingam-Vorhangs fallen und wich vom Fenster zurück. Ihre Stimme klang gepreßt, ängstlich. Die riesige wilde Bergwelt, welche die drei verfallenen Hütten umgab, schien von der Nacht verschluckt. Tief in den Bergen des Uinta National Forest von Utah verborgen, hatten sie in dem verlassenen Gräberlager eine Zuflucht gefunden. Mehr als einmal hatte Theresa mitbekommen, wie ihr Vater der Mutter versichert hatte, daß sie hier unauffindbar seien.
Zum ersten Mal, seitdem die Stewarts vor acht Monaten hierhergezogen waren, waren nun draußen Fremde aufgetaucht. Im Mondlicht waren ihre Umrisse kurz zu sehen gewesen, als sie aus dem Wald in die Lichtung getreten waren, die das Lager umgab. Theresa hatte drei Schemen unterschieden, möglicherweise mehr.
»Wahrscheinlich ein Bär.« Theresas Mutter Sally sah von dem Schaukelstuhl auf, wo sie Elijah, das jüngste der sieben Stewart-Kinder, stillte. Elijah war sechs Monate alt, ein rundes, glückliches Baby, und Sally war dabei, ihn abzustillen. Aber sie gab ihm immer noch gern die Brust, bevor sie ihn zur Nacht schlafen legte. So schlief er besser, sagte sie.
»Mutter, das ist kein Bär. Ich habe Männer aus dem Wald kommen sehen.«
»Dann wahrscheinlich ein paar Camper. Es ist ja Sommer. Wir haben den Wald jetzt nicht ganz so für uns wie in der kalten Jahreszeit.«
Sally setzte sich vor das Feuer, die einzige Wärme- und Lichtquelle in der Hütte. Trotz ihrer beruhigenden Worte klang ihre Stimme unterschwellig gespannt. Sie, Theresa, und die vier jüngsten Kinder waren in der Hütte allein. Ihr Mann Michael hatte die beiden älteren Jungen mitgenommen nach Provo, wo er Geschäfte zu erledigen hatte und Nahrungsmittel besorgen wollte. Er würde nicht vor morgen zurück sein.
»Ich glaube, das sind keine Camper.« Theresa sprach mit unterdrückter Stimme, während sie zu ihrer Mutter ging. Die Hütte war klein, unten zwei Zimmer und darüber ein Schlafraum. Theresa stand fast in der Mitte des großen vorderen Zimmers, das plötzlich voll lebendiger Schatten schien, und ballte ihre Hände an den Seiten zu Fäusten. Nackte, primitive Angst stieg in ihrem Hals auf wie Galle.
Theresa wußte nicht, wieso sie wußte, wer draußen war. Sie wußte es einfach.
»Dann eben Kyle. Oder vielleicht Alice, oder Marybeth. Oder eins der Kinder, die vielleicht den Schuppen benutzen müssen.« Marybeth und Alice waren Michaels Schwestern. Kyle war Alices Mann. Sie und ihre elf Kinder, die zwischen acht und 18 Jahre alt waren, bewohnten die anderen beiden Hütten. Seit das Lager in den späten 1800er Jahren erbaut und verlassen worden war, hatte es niemals über Inneninstallationen verfügt. Wer ein Bedürfnis hatte, benutzte einen Schuppen in der Nähe des Eingangs zur alten Silbermine, der extra zu diesem Zweck umgewandelt worden war. Oder verzog sich in den Wald.
»Es sah aus wie ein Mann. Wie Männer. Mehr als einer. Sie kamen aus dem Wald.« Theresas Stimme brach.
»Bist du sicher?«
Theresa nickte.
Sally löste das schlafende Baby von ihrer Brust und stand auf, wobei sie ihre Bluse zuknöpfte. »Theresa, Schatz, sie können es nicht sein. Das ist unmöglich.«
»Mutter ...«
Ein Klopfen an der Tür unterbrach sie. Theresa und ihre Mutter rückten instinktiv näher zusammen und starrten beide auf die grob behauene Holztür. Das Baby wimmerte, als ob es ihre Angst spürte. Sally drückte es fester an ihre Brust.
Sally wußte ebenso gut wie Theresa, daß keiner ihrer Verwandten je so klopfen würde. Es war ein leises Klopfen, so leise, daß es schon unheimlich war.
»Psst jetzt«, flüsterte Sally zum Baby hin. Dann reichte sie es Theresa und fügte hinzu: »Bring ihn in das Hinterzimmer.«
Die Anweisung machte Theresa Angst. Sie merkte, daß auch ihre Mutter das Böse hinter der Tür spürte. Sie nahm das Baby und drückte es fest an ihren Busen. Vage fühlte sie sich durch seinen milchigen Duft, seine Wärme, die Bewegung seines kleinen Kopfes unter ihrem Kinn getröstet, als der Kleine sich auf der Suche nach einer bequemen Lage in ihre Kleider wühlte.
»Mach schon«, sagte Sally und gab Theresa einen Stoß. »Es sind wahrscheinlich irgendwelche verirrten Camper, aber trotzdem ...«
Mit ein paar Schritten war Theresa in dem kleinen dunklen Raum, der als Küche und Vorratskammer diente. Dann drehte sie sich um und vergaß, was sie eben hatte sagen wollen, als sie sah, wie Sally die doppelseitige Axt ergriff, die in einer Ecke des vorderen Zimmers stand.
Elijah fest an sich gedrückt, wich Theresa tief in den Schatten zurück, während ihre Mutter vor der Tür stand und die Axt hob.
Es gab einen Stoß, einen Knall, das Kreischen von splitterndem Holz und zerbrochenen Angeln, als die Tür eingetreten wurde.
Während Theresa in Deckung kroch, Elijah fest im Arm, hörte sie einen Kampf und den Schrei ihrer Mutter.
Dann vernahm sie eine Stimme – eine Stimme, die sie erkannte, eine Stimme direkt aus dem Alptraum, den sie immer wieder zu vergessen versucht hatte, aber vergeblich.
Es war die Stimme des Todes, die flüsterte: »Es ist Zeit.«
Kapitel 2
Juni 1996 17 Uhr
Ihr Hinterteil tat weh.
Lynn Nelson unterdrückte ein Stöhnen und rieb sich die schmerzende Stelle mit beiden Händen. Nicht, daß die improvisierte Massage ihr sehr geholfen hätte. Der Schmerz ließ nicht nach.
Als Lynn merkte, wie komisch ihre Tätigkeit wirken mußte, ließ sie die Hände sinken, wobei sie verlegen um sich blickte, um festzustellen, ob irgendjemand sie beobachtete.
Ihre Mitreisenden – eine Gruppe von zwanzig 14- und 15-jährigen Mädchen, zwei Lehrern und zwei weiteren aufsichtführenden Müttern wie sie selbst – schienen allesamt fröhlich mit dem Aufbau des Nachtlagers beschäftigt zu sein. Keine Beobachter in Sicht. Und auch kein weiterer Hinternreiber.
Hatten sie alle Hinterteile aus Stahl?
Offensichtlich. Niemand sonst schien herumzulaufen, als ob ihm ein Maiskolben an der Stelle säße, wo die Sonne nie hinscheint. Keiner außer ihr, der auch nur hinkte.
»Haben Sie schon herausgefunden, was ihn gestört hat?« Der Sprecher war ein drahtiger Pony-Cowboy Mitte Zwanzig, dessen Name, so glaubte Lynn, Tim war. In Jeans und Stiefeln, den Cowboyhut tief über seine kurzen blonden Locken gezogen, sah Tim hundertprozentig so aus, als sei er im Freien auf der Weide zu Hause. Was – darauf war Lynn schon gekommen – wohl auch beabsichtigt war.
»Noch nicht.« Lynn blickte voller Abscheu den Grund ihres Elends an, ein zottiges Gebirgspony namens Hero. Dann nahm sie den Metallstab wieder vom Boden auf, wohin sie ihn vor kurzem gelegt hatte, als sie sich für ein dringenderes Bedürfnis zurückgezogen hatte. Sie packte das Tier am Vorderbein, wie Tim es ihr gezeigt hatte, und versuchte einen schlammigen Huf vom Boden hochzuzerren.
Ihr sicherlich tausend Kilo schweres, schweißtriefendes, stinkendes Pferd lehnte sich freundschaftlich gegen sie. Sein Atem, der nach verfaultem Gras roch, strich heftig an ihrer Wange entlang.
Igitt. Lynn wußte, warum sie Pferde haßte.
»Laß mich, du«, murmelte sie, drückte das Tier mit der Schulter fort und wurde mit einem sanften Stüber belohnt.
Obwohl sie mit aller Kraft zog, bewegte sich der Huf keinen Zentimeter.
»Hier.« Grinsend kam Tim ihr zu Hilfe, nahm ohne die geringste Mühe den Huf auf und reichte ihn ihr.
»Danke.« Lynn konnte es nicht ändern, daß sie sauer klang. Sie fühlte sich sauer – und wund.
Fast bis zum Boden gebeugt, hielt sie ein haariges, schmutziges Tierbein hoch und stieß wieder ihren Stab in den schlammverkrusteten Huf, der zwischen ihren Knien steckte.
Hero lehnte sich gegen sie. Lynn erwog Pferdemord.
»Stoßen Sie noch etwas tiefer hinein, ich wette, Sie finden einen Stein«, sagte Tim.
Sie werden lernen, sich um Ihr eigenes Pferd zu kümmern, hatte der Werbeprospekt für diesen Ausflug versprochen.
Als Lynn sich daran erinnerte, dachte sie: Juchhe!
Sie bohrte noch mal, und der Klumpen brach aus dem Huf heraus. Ein Stein, wie angekündigt, der in einer dunklen Substanz steckte, die zu schrecklich roch, um nur Erdschlamm zu sein. Lecker.
»Gut gemacht.« Tim tätschelte ihr anerkennend die Schulter (oder vielleicht war »schlagen« das treffendere Wort). Lynn verlor das Gleichgewicht, taumelte zurück und ließ Huf und Stock fallen. Das Pony stampfte mit dem Fuß auf, schnaubte laut und wandte den Kopf zu ihr um. Wäre das Tier ein Mensch gewesen, Lynn hätte geschworen, es habe gekichert.
»Oh, Entschuldigung«, sagte Tim. Sein Spaß war allzu offensichtlich, als er den Stock aufhob. »Wir werden noch eine Pferdefrau aus Ihnen machen. Warten Sie nur ab.«
»Ich kann’s gar nicht erwarten.«
»Hier, geben Sie ihm das, und er wird Sie ewig lieben.«
»Hab’ ich ein Glück.« Unter Tims Aufsicht befestigte Lynn unbeholfen einen Futtersack um Heros Hals. Das Pony zuckte mit den Ohren zu ihr hin und fing an zu fressen.
»Nun streicheln Sie ihn«, wies Tim sie an. Streicheln war nicht unbedingt das, was Lynn mit dem zottigen Vieh am liebsten gemacht hätte, aber sie schluckte ihre weniger zivilisierten Impulse herunter und tat wie geheißen. Heros ungepflegtes Fell fühlte sich rauh an, als sie ihm einen pflichtgemäßen Klaps gab. Sie drehte ihre Hand um und blickte mit Abscheu auf die schmutzigen, rotbraunen Haare, die an ihren Fingern klebten.
»Gut gemacht.« Tim nickte und ging dann weiter, an der Reihe der angebundenen Ponys entlang.
Endlich in Ruhe gelassen, stieß Lynn ihre Faust heftig gegen die schmerzende Stelle an ihrem Rücken und versuchte nicht daran zu denken, daß dies erst der zweite Tag ihres zehntägigen Wildnis-»Urlaubs« war. Und sie versuchte auch, nicht mehr ihr Hinterteil zu massieren.
Welcher Dämon hatte sie nur getrieben, hierher zu kommen?
Rory, gestand sich Lynn ein, während sie auf eines der kleinen Lagerfeuer zuhumpelte, die Schutz – ha! – vor den Stechmücken bieten sollten. Ihre 14-jährige Tochter hatte sie nicht gebeten, an diesem Klassenausflug teilzunehmen. Ganz im Gegenteil hatte Rory aufgestöhnt, als Lynn ihr sagte, sie habe sich gemeldet. Aber Lynn war der Meinung, daß Rory sie brauchte. Und sie ihrerseits brauchte Zeit, um die Beziehung zu ihrer Tochter zu festigen, die in letzter Zeit zu bröckeln schien.
Wie auch immer, der Werbeprospekt hatte diesen Ausflug als erzieherisch, vergnüglich und als Erfahrung fürs Leben dargestellt – alles inklusive.
Daher hatte sie sich zwei Wochen von der täglichen Schinderei der Fernsehsendungen freigenommen, ihr erster richtiger Urlaub seit drei Jahren, und hier war sie also gelandet, an einem gottverlassenen Gebirgshang in der abgeschiedenen Wildnis des Utah Uinta Range, und schleppte sich auf einer Teenager-Traumreise zu Pferde voran.
Die Frage war: Vergnügte sie sich schon?
Die Antwort lautete entschieden: Nein!
Lynn ließ sich auf einen Heuballen nahe beim Lagerfeuer fallen, der zu genau diesem Zweck dort abgelegt worden war, und versuchte das Leben von seiner positiven Seite zu sehen. Rorys Begeisterung für den Aufenthalt im Freien nachzugeben war zumindest besser, als mit ihrer eskalierenden Verrücktheit nach Jungs fertig zu werden. Dieser Ausflug – Rorys Belohnung dafür, daß sie es ein ganzes Jahr im Kollegiat ausgehalten hatte, einer exklusiven Akademie ausschließlich für Mädchen – hatte ein Vermögen gekostet, aber der Urlaub war zum Glück männerfrei.
Abgesehen von den Führern: sechs, allesamt männlich und – natürlich – alle attraktiv. So lief das nun mal im Leben. Sie hätte daran denken sollen.
Genauso wie sie es sich hätte denken können, daß ihre neuen Reitstiefel drücken, ihr Hinterteil schmerzen und die Sonne ihre Nase verbrennen würde, trotz der dicken Schicht Sonnenschutzcreme und des breitrandigen Hutes, den sie den ganzen Tag getragen hatte. Und sie hätte sich denken können, daß ihre Haut – sogar dort, wo sie gar nicht zu sehen war – sich anfühlen würde, als müßte sie ordentlich durchgeklopft werden, damit der Dreck abfiel.
Sie haßte Reiten.
Lynn veränderte ihre Lage, stöhnte auf und rieb die Knöchel ihrer Fäuste kräftig gegen die Schenkel. Es kam ihr so vor, als würde jeder Muskel unterhalb ihrer Hüfte steif.
»Das könnte helfen.« Der Mann, der sich neben sie kniete – ja, knien war das richtige Wort; Männer in Utah fielen wirklich auf die Knie –, hielt ihr eine flache goldene Dose hin.
Doc Grandview’s Pferdebalsam, war auf dem Deckel in schwarzen Buchstaben zu lesen. Ganz genau, dachte Lynn. Da sogar die Salbe, die man ihr anbot, aussah, als könnte sie Wyatt Earp gehört haben, war ihre Skepsis endgültig geweckt. Alles an diesem Ausflug, von den Veranstaltern selbst bis hin zu den Fliegen, die um die Pferdeohren summten, hätte vollkommen in den guten alten Wilden Westen gepaßt. Lynns Urteil war: Viel zu touristisch.
»War ich so deutlich?« Lynn bekam trotzdem ein Lächeln hin, als sie die Dose nahm und in ihrer Hand drehte. Owen Feldman und sein jüngerer Bruder waren die Inhaber von Adventure Inc., dem Unternehmen, das die Reise geplant hatte und nun durchführte. Owen war groß, breitschultrig und schmalhüftig, mit dichtem tabakbraunem Haar, einem kantigen Gesicht mit kräftigen Kieferknochen und strahlend blauen Augen, für die man sterben konnte. Vielleicht ein paar Jahre älter, als sie selbst mit ihren 35 Jahren war. Angeblich stammte er durch und durch aus Utah, war hier geboren und aufgewachsen und kannte die Uinta-Wildnis so gut wie kaum jemand sonst. Laut Prospekt war er ehrlich, kompetent und vollkommen zuverlässig – ein wirklicher Cowboy.
Bereits zwei Tage nach Reisebeginn hatte Lynn herausgefunden, daß sie Cowboys haßte. Besonders die Angeber. Jedes Mal, wenn sich die Feldmans und ihre Mannschaft in den Sattel schwangen, war sie halb darauf gefaßt, ein verstecktes Orchester die Titelmelodie von Bonanza spielen zu hören.
Rory war allerdings vollkommen hingerissen. Sie hatte schon darauf hingewiesen, daß Owen ein möglicher Gefährte für ihre Mom war. Sie selbst, sagte Rory, zog den jüngeren Bruder Jess vor.
Bei diesem Gedanken runzelte Lynn die Stirn. Wo war Rory eigentlich? Und wo war Jess?
»Viele Leute werden am ersten Tag vom Sattel wund«, sagte Owen, der ihren grimmigen Gesichtsausdruck offenbar dem Kummer darüber zuschrieb, daß sie ein solcher Waschlappen war. »Reiben Sie das einfach auf Ihren ... äh, die betroffene Stelle, dann geht es Ihnen morgen früh viel besser.«
»Ja, danke.« Lynn schob die schuhputzcremegroße Dose in die Tasche ihrer knallig orangefarbenen Windjacke – neu für die Reise, mit einer Farbe, die herumziehende Jäger davon abhalten sollte, sie für einen Elch zu halten – und stand auf. Die Innenseiten ihrer Knie schrien protestierend auf. Die Hinterseiten ihrer Schenkel weinten. Ihr Po tat immer noch weh. Lynn versuchte, kein noch so kleines Schmerzgeräusch von sich zu geben, und blickte sich im Lager um. »Haben Sie Rory gesehen? Oder Ihren Bruder?«
Owen lächelte. Die braune Haut um seine Augen wies gerade so viele Fältchen auf, wie man das von der braunen Haut um die Augen eines Cowboys erwartete. Er stand ebenfalls auf und überragte ihre ein Meter sechzig um fast dreißig Zentimeter. Selbst mit einem großen Casting hätte man die Rolle nicht besser besetzen können, dachte Lynn trocken.
»Rory ist Ihre Tochter, stimmt’s? Die kleine Blonde? Sie und ein paar andere Mädchen wollten lernen, wie man die Angel auswirft. Jess war bereit, es ihnen vor dem Essen zu zeigen.«
»Oh, toll.« Lynn konnte ihren sarkastischen Tonfall nicht unterdrücken. Owen hatte offenbar kein Problem damit, daß sein Bruder allein mit einem Schwarm leicht zu beeindruckender Mädchen loszog; Lynn schon. Jess Feldman war nicht aus demselben Holz geschnitzt wie sein älterer Bruder. Das Prädikat »vollkommen zuverlässig« traf auf ihn nicht mal ansatzweise zu. »Wo entlang sind sie gegangen?«
Sie versuchte einen humorvollen Ton anzuschlagen, was ihr aber nicht ganz gelang. Owens Blick wurde schärfer.
»Kommen Sie. Ich zeig’s Ihnen«, sagte er.
»Ich möchte Sie nicht von irgendwas abhalten, das Sie gerade tun wollen.« Auch wenn ihre Antwort ein Körnchen Wahrheit enthielt, war es doch hauptsächlich so, daß Lynn sich einfach nicht wohl fühlte, wenn sie auch nur einen kleinen Gefallen von irgendjemandem annahm. Sie war schon so lange allein in ihrem Kampf um ein besseres Leben für sie und Rory, daß sie sich längst daran gewöhnt hatte. Verlaß dich niemals auf andere, war ihr Motto.
Vor allem nicht auf falsche Cowboys.
»Bob und Ernst bereiten das Essen vor. Tim kümmert sich um die Pferde. Es gibt für mich im Moment nichts zu tun.« Owen lächelte sie an. »Kommen Sie.«
Lynn erwiderte widerstrebend sein Lächeln und paßte sich seinem Schritt an. Nebeneinander liefen sie durch das Lager auf den dichten Nadelwald zu, der den steilen Abhang am anderen Ende der Lichtung bedeckte. Hohe Kiefern hatte jahrzehntelang so viele Nadeln verloren, daß der Boden unter den Füßen ganz weich war. Lynn kam es vor, als liefe sie auf einem knöcheltiefen Teppich.
Die meisten Mädchen saßen auf sackleinernen Stapeln in einem Halbkreis zusammen und sangen. Pat Greer und Debbie Stapleton, die anderen begleitenden Mütter, blickten von ihrer selbstgewählten Aufgabe, einen improvisierten Gesang zu leiten, auf, als Lynn mit Owen vorbeiging.
»Zehn grüne Milchflaschen hängen an der Wand.
Aber wenn eine von ihnen runterfällt,
hängen nur noch neun Milchflaschen an der Wand.« Milch.
Lynn riß sich zusammen, um nicht loszulachen. Das entschlossen fröhliche und noch entschlossener drittklassige Geträller fand sie grauenhaft. Pat und Debbie waren die reinsten Tipper-Gore-Klone: Nie hätten sie ihre kleinen Schützlinge von etwas singen lassen, das so wenig altersgemäß war wie Bier.
Lynn mochte Bier. Hätte sie ein Glas zur Hand gehabt, hätte sie es auf der Stelle heruntergestürzt, nur um die anderen Mütter zu ärgern.
Weil die sie ärgerten mit ihrer Fröhlichkeit, ihrer Neugier und ihrer perfekten Mütterlichkeit.
Lynn spürte förmlich den Druck ihrer gebündelten Blicke, die ihren Rücken durchbohrten, als sie vorbeiging. Aufgedonnerte Vorstadtmatronen, die ein angenehmes Leben an der Seite erfolgreicher Ehemänner führten: Pat und Debbie schienen ihr instinktiv zu mißtrauen. Als alleinerziehende berufstätige Mutter, die von Kaffee und Zigaretten lebte und einen anspruchsvollen, qualifizierten Beruf hatte, erschien sie ihnen – Lynns Meinung nach – wahrscheinlich als ein Wesen von einem anderen Stern.
Und wahrscheinlich, so vermutete sie etwas widerstrebend, hatten sie sogar recht.
»Haben Sie noch andere Kinder?« fragte Owen, als er anhielt, um für sie einen Ast zur Seite zu schieben, damit sie vor ihm in den Wald gehen konnte.
»Nur Rory.« Lynn strengte sich an, ihre Laune ebenso wie ihre Stimme zu heben, als sie an ihm vorbei auf den zertrampelten Pfad trat. Unter den Bäumen war es düster und drei Grad kälter. Moos überzog alles, Steine, Baumstämme und den Pfad. Es roch feucht, wie in einem Keller. »Mein einziges Kind.«
»Sie sieht genauso aus wie Sie. Ich hätte sie überall als Ihre Tochter erkannt.«
Lynn lief direkt in ein kaum sichtbares Spinnennetz, das sich über den Weg spannte. Schaudernd wischte sie die klebrigen Fäden aus dem Gesicht und ging weiter.
»Ja, nicht wahr?« Sie konzentrierte sich darauf, Owen eine intelligente Antwort zu geben, und versuchte, nicht an die Spinne zu denken, die sie zusammen mit dem Netz weggewischt hatte. Sie haßte Spinnen. Es stimmte, sie und Rory sahen gleich aus. Sie beide hatten blonde Haare – auch wenn Lynn zugegebenermaßen etwas nachhalf, um den hellen Ton ihrer kinnlangen Mähne zu erhalten –, eine helle Gesichtsfarbe und große, unschuldig blickende blaue Augen. Beide waren nicht gerade groß (sie haßte das Wort kurz), doch ihre schlanke Figur machte die kleine Statur wett. Der Unterschied war nur, daß sich Lynn in den letzten Jahren mehr anstrengen mußte, um ihr Gewicht zu halten, während Rory immer noch mühelos schlank blieb. »Armes Kind«, sagte sie zu Owen.
»Das würde ich nicht sagen.« Er war hinter ihr. Lynn konnte sein Gesicht nicht sehen, aber sein Ton verriet, daß er ihr Aussehen bewunderte. Lynn verzog das Gesicht. Sie hoffte, er würde sich nicht an sie heranmachen. Gutaussehend oder nicht, er würde enttäuscht werden, wenn er es versuchte. Sie hatte kein Interesse an einer Urlaubsliebschaft und träumte auch nicht davon, mit einem Möchtegern-Cowboy ins Bett zu gehen.
»Haben Sie Kinder?« fragte Lynn, nur um etwas zu sagen. Der Pfad schlängelte sich nach oben und führte sie von dem Felsplateau weg, wo sie die Nacht verbringen würden. Wurzeln und die aufragenden Kanten halb verborgener Steine zwangen sie darauf zu achten, wohin sie trat. Vor sich konnte Lynn das Plätschern von Wasser hören. Rascheln, Knacken, Zirpen von allem möglichen Lebendigem, worüber sie lieber nicht so genau nachdenken wollte, waren noch näher.
»Nee.« In Owens Ton schwang ein Lächeln mit. »Auch keine Frau. Mein Bruder sagt, bei mir hält’s keine aus. Wenn Frauen mich erst einmal kennengelernt haben, werfen sie mich schließlich doch wieder weg.«
Lynn war so überrascht, daß sie über die Schulter zurücksah. »So schlimm sind Sie sicher nicht.«
Owen zwinkerte ihr zu. »Finde ich auch. Aber Jess ist da ziemlich entschieden.«
Lynn lief weiter. In diesem reuigen Blick lag etwas, das sie vorsichtig machte. Er war zu bezaubernd, fast wie eingeübt. Ein Teil der Tour. Genausogut mochte er sie auch anlügen: Sie konnte sich vorstellen, daß der Bursche vielleicht verheiratet war und ein Dutzend Kinder hatte.
Nicht, daß ihr etwas daran läge, ob Owen Feldman verheiratet war oder nicht. Aber es irritierte sie, daß er möglicherweise dachte, sie wäre dumm genug, einem Lächeln, blauen Augen und einem Cowboyhut zu erliegen. Sie hatte ihre Fehler, aber Dummheit gehörte nicht dazu.
Ein plötzlicher heller Lichtstreifen vor ihr zog Lynns Aufmerksamkeit auf sich. Durch einen Rahmen aus schwingenden Ästen wurde Sonnenlicht von der Oberfläche silbrigen Wassers reflektiert. Während sie auf das Licht zuging, verbreiterte sich die Sicht auf einen weiten Strom, einen Streifen sonnigen Himmels und die braungrüne Wand des Waldes, der sich direkt hinter dem gegenüberliegenden Ufer den Berg hinaufzog. Eine wohlgenährte Bisamratte saß mit zitternden Barthaaren auf einem glatten grauen Felsen, der sich aus dem Strom erhob, und starrte auf etwas, das die Menschen nicht sehen konnten. Lynn beobachtete, wie sie unter die Oberfläche tauchte, und ihr geschmeidiger brauner Körper entschwand ihrer Sicht, ohne mehr als ein leichtes Kräuseln zu hinterlassen.
Verzaubert von dieser Vorstellung, trat Lynn unter dem überhängenden Dach aus Ästen hervor in eine Szene von atemberaubender Schönheit. Ein breiter Fluß mit dunkelgrünem Wasser floß über glatte Steine auf eine Felstreppe in gut dreißig Meter Entfernung zu. Dort stürzte er fast vier Meter in die Tiefe, in eine laute, neblige weiße Gischt, bevor er seine ruhige Reise den Berg hinab fortsetzte.
Auf großen Felsbrocken, von denen aus man den Wasserfall überblicken konnte, saßen zwei schlanke Teenagermädchen in Jeans. Mit gespreizten Beinen stand eine dritte – blond, zierlich und lachend – bis zu den Schenkeln mitten im Fluß oberhalb des Wasserfalls. Ihr mit einem blauen T-Shirt bekleideter Rücken ruhte sicher an der weißen T-Shirt-Brust eines hübschen, bronzehäutigen jungen Mannes mit goldbrauner Mähne.
Rory und Jess Feldman. Lynns Augen wurden schmal. Entgegen allem Anschein – Rory war nun eine Spur größer als Lynn, und ihre kindliche Drahtigkeit begann weiblicheren Kurven zu weichen – war sie immer noch ein erst 14-jähriges Kind. Ein nach Jungen verrücktes Kind.
Jess Feldman war jedoch kein Junge mehr. Er mußte mindestens dreißig sein. Und dieser Taugenichts hatte unglaublicherweise seine Arme um ihre Tochter gelegt.
Kapitel 3
Einen Augenblick lang tat Lynn nichts, sie sah nur schweigend zu, während sie die Hände an ihren Seiten zu Fäusten ballte.
Jess Feldmans große braune bedeckten Rorys kleinere Hände. Er führte sie, während sie langsam einen Bogen über ihrem Kopf beschrieb und dann einen dünnen Angelstock aus Bambus sausen ließ. Die neongrüne Leine sprang und summte, als sie sich von der Spule abwickelte. Mit einem Platsch traf der Senker auf das Wasser, ungefähr sieben Meter von dem Paar entfernt, und versank sofort.
Die Mädchen auf dem Fels applaudierten. Lachend wandte sich Rory in Jess’ Armen um, um ihm etwas zu sagen, erblickte ihre Mutter am Ufer und erstarrte. Jess folgte ihrem starren Blick, entdeckte Lynn und seinen Bruder und winkte.
Nonchalant. Freundlich und beiläufig. Als ob es nichts gäbe, was die Mutter des unschuldigen Kindes in seinen Armen aufregen müßte.
»Jess kann gut mit Kindern umgehen«, sagte Owen gelassen zu ihr.
Lynn nahm diese Bemerkung ungläubig zur Kenntnis, außerstande, die Augen von dem Paar im Wasser abzuwenden. »Gut mit Kindern umgehen« war nicht der Ausdruck, mit dem sie Jess Feldmans Verhalten beschrieben hätte.
»Rory – und die anderen Mädchen – sind keine Kinder. Es sind Teenager. Junge Frauen«, sagte Lynn scharf und machte ihrer Tochter ein Zeichen.
Rorys Gesicht verfinsterte sich. Lynn wappnete sich für eine unangenehme Szene, die kaum zu vermeiden war, wenn sie darauf bestand, daß Rory aus dem Wasser kam. Wie schon so oft in letzter Zeit fragte sie sich, wann genau dieses so fürchterlich zur Selbstzerstörung neigende Nymphchen ihre süße, liebe Tochter ersetzt hatte.
Die Veränderung war über Nacht gekommen, wie es schien. Wenn Lynn darüber nachdachte, stiegen in ihr manchmal Bilder aus dem Film Die Körperfresser kommen auf. Vielleicht hatte sich ein Alien in Rorys Körper eingenistet, während das Kind schlief.
Die Vorstellung hatte fast etwas Tröstliches. Zumindest befreite sie Lynn von jeglicher Schuld.
Der Lärm von Metall, das auf Metall aufschlug, drang aus der Ferne zu ihnen: die Triangel, die zum Essen rief. Lynn hatte gesehen, wie einer der Männer sie zuvor ausgepackt hatte.
»Essen fassen!« Owen legte die Hände an den Mund, um seinen Bruder zu rufen, der grinste, ihm den Daumen senkrecht entgegenreckte, etwas zu Rory sagte und geschickt seine Leine einzog. Er legte die Angelrute auf seine Schulter und hielt Rory über dem Ellbogen am Arm fest, während das Paar aus dem Wasser stapfte. Lynn ging zu ihnen, gefolgt von Owen.
»Danke, Jess«, sagte Rory mit einem bewundernden Blick nach oben, als sie das Ufer erreichten. Die anderen Mädchen – Rorys beste Freundin Jenny Patoski und ihre zweitbeste Freundin Melody James – rutschten von ihrem Sitz herunter und umringten die beiden. Jenny war größer als Rory, mit lockigem schwarzem, schulterlangem Haar, großen Schokoladenaugen und feinen Gesichtszügen. Sie war ein hübsches Mädchen, hübscher als Melody, deren hellbraunes Haar so lang und glatt war wie Rorys, die aber leider mit einer großen Nase und eher kleinen Augen gesegnet war. Doch nicht einmal Jenny war, wie Lynn gerechterweise dachte, so hübsch wie Rory – besonders dann nicht, wenn Rory strahlte wie in diesem Moment.
»Gern geschehen.« Jess schenkte Rory das Lächeln eines geübten Herzensbrechers, dann wandte er seine Aufmerksamkeit den anderen Mädchen zu, die darum wetteiferten, von ihm wahrgenommen zu werden. Er hielt eine Hand empor, um Ruhe zu erbitten. »Euch Damen werde ich später noch fangen. Jetzt laßt uns essen gehen.«
Der gleiche geblendete Ausdruck zeigte sich auf allen drei jungen Gesichtern, als die Mädchen ihm zusahen, wie er seine Angel zur Seite legte und nach einem Flanellhemd griff, das über einem Fels in der Nähe ausgebreitet lag.
Als er es mit absichtlicher Langsamkeit und tänzelnden Muskeln anzog, lief ihnen praktisch der Sabber aus den Mündern.
Lynn mußte sich zusammenreißen, um nicht einen sarkastischen Pfiff hinter ihm herzuschicken.
Nicht, daß sie keine Ahnung hätte, was in den Mädchen vor sich ging. Im Gegenteil verstand sie nur allzu gut. Mit 14 Jahren wäre auch sie von Jess Feldman geblendet gewesen. Er war sexy, das mußte sie zugeben, aber er war es zu absichtsvoll. Allerdings waren die Mädchen noch etwas jung, um eine so subtile Feststellung zu treffen. Er trug sein braunes Haar mit goldenem Schimmer als schulterlange Mähne (es hätte sie nicht überrascht, falls sich herausstellen sollte, daß die blonden Strähnchen genauso künstlich waren wie die ihren), hatte breite Schultern, einen geschmeidigen, muskulösen Körper und genug braune Haut, um eine Couch damit aufzupolstern. Wenn man noch den Appeal der schmalen Hüften und langen Beine in engen, bis zu den Oberschenkeln nassen Jeans hinzunahm, außerdem die gleichen strahlend blauen Augen wie sein Bruder und ein schiefes, verschmitztes Lächeln, dann war er durchaus die Verkörperung des Traummannes vieler junger Mädchen. Nur eine erwachsene Frau konnte die Verlogenheit dieser Verpackung erkennen. Alles von seinen schulterlangen Locken bis zu den engen Jeans schien dafür berechnet, Frauen in Aufregung zu versetzen.
Lynn fragte sich, ob die Letzte-Cowboys-Tour der beiden Brüder mehr Touristen anzog. Wahrscheinlich, nahm sie an.
Zumindest Touristinnen.
Auch wenn Jess die verzückte Aufmerksamkeit der Teenager scheinbar nicht mitbekam, während er sein Hemd zuknöpfte, konnte er unmöglich den Aufruhr übersehen, den er in ihrer verletzlichen Libido heraufbeschwor: Ihre Herzen (oder was auch immer) zeigten sich in ihren Augen. Lynn zweifelte nicht daran, daß er sie absichtlich reizte.
Wahrscheinlich versetzte es ihm einen Kick, sie so zu erregen. Lynn war überzeugt, daß er zu dieser Sorte Größenwahnsinniger gehörte. Sie war diesem Typus schon zu oft begegnet. Wahrscheinlich hielt er sich für einen Zuchthengst und bewies so oft wie möglich, daß er diesen Ruf zu Recht genoß. Bei dem Gedanken verengten sich ihre Augen.
Nicht mit ihrem Mädchen, o nein!
»Wo ist deine Jacke?« fragte sie Rory, fast ohne beim Sprechen die Lippen zu öffnen. Das blaue T-Shirt mit seinem zähnefletschenden Bulldoggen-Emblem klebte zu eng an Rorys knospenden Brüsten. Die kühle Luft sowie ihre nassen Jeans machten Rory so sehr frösteln, daß ihre Brustspitzen hart geworden waren und sich deutlich sichtbar durch den dünnen Stoff drückten.
Zumindest hoffte Lynn, daß die Reaktion durch die Kälte hervorgerufen war.
Das Kind trug keinen BH.
»Ich habe meine Jacke im Camp gelassen. Es ist warm. Ich jedenfalls brauche keine.« Lynn sah ihre Tochter genau an. Rory erwiderte den Blick voller Interesse.
»Und deinen BH auch?« Lynn stellte ihre Frage zuckersüß, mit so leiser Stimme, daß die anderen sie nicht hören konnten.
Rorys Stimme und auch ihre Haltung spiegelten deutlich ihre Abneigung wider. »Laß mich in Ruhe, Mutter.«
»Jetzt hör mir mal zu, junge Dame ...« Lynn registrierte, wie ihre Stimme lauter wurde, und unterbrach sich selbst, indem sie sich auf die Lippe biß. Wenn sie sich auf einen Schreiwettbewerb mit Rory einließ, würde es ihr am Ende nur peinlich sein, das wußte sie aus Erfahrung. Das Debakel würde damit enden, daß Rory in lautes Heulen ausbrechen und Lynn sich fühlen würde, als hätte ihr jemand in den Magen geboxt.
Sie mußte eine andere Möglichkeit finden, mit ihrer Tochter fertig zu werden. Aber sie wußte einfach nicht, welche.
Wieder war der metallene Schlag zu hören. Rorys Blick wanderte von ihrer Mutter zu Jess hinüber und wurde sofort wieder anhimmelnd. Lynn knirschte mit den Zähnen.
»Wenn wir nicht zurückgehen, kriegen wir nichts mehr«, sagte Owen zu seinem Bruder. Jess grinste.
»Bob wird uns genug übriglassen. Immerhin sind wir die Bosse. Diese Damen allerdings ... Traurig, es zu sagen, aber für sie gilt das leider nicht.«
Sie machten sich jetzt auf den Weg zum Camp, wobei Owen sie antrieb. Die Mädchen protestierten im Chor angesichts der Aussicht, eine Mahlzeit zu verpassen, während Owen galant die Wogen glättete, die sein Bruder mit seinen Neckereien aufgewühlt hatte.
Lynn hörte der sich anschließenden Unterhaltung nicht zu. Nachdem sie sich direkt vor Owen, der das Schlußlicht bildete, in die Prozession eingegliedert hatte, erwog sie still das Für und Wider eines Vortrags über die Gefahren, die von gefräßigen älteren Männern ausgingen. Sollte sie Rory einen solchen Vortrag halten, sobald sie eine Chance bekam, mit ihrer Tochter allein zu sein? Sinnlos, lautete ihr Urteil, als sie die hochgezogenen Schultern und den tänzelnden Rücken ihrer Tochter erblickte. Die Ansichten ihrer Mutter waren Rory ohnehin bekannt. Lynn merkte das an der Art, wie das Kind lief.
Und Rory war auf herausfordernde Weise entschlossen zu tun, was ihr paßte. Auch das konnte Lynn bemerken.
Sie seufzte. Als Rory ein Baby war, hatte Lynn geglaubt, daß es für Mütter einfacher würde, wenn das Kind älter wurde. Hatte sie eine Ahnung gehabt!
Als sie im Lager ankamen, war der Lobgesang auf die Milch zum Glück vorbei. Die Zurückgebliebenen wuschen sich gerade die Hände und stellten sich dann mit ihren Zinntellern zum Essenfassen auf. Mit einem fröhlichen Ruf zu ihren Freundinnen hinüber hüpfte Rory davon, um ihre nassen Jeans zu wechseln.
Lynn und die anderen beiden Mädchen gingen hinüber, um sich die Hände in dem dafür vorgesehenen Eimer zu waschen. Die Feldman-Brüder gingen gemeinsam irgendwo hin.
Gut, daß sie die los war, dachte Lynn.
»Ist Jess nicht süß?« sagte Jenny zu Melody, die hinter ihr in der Schlange stand. Lynn mußte sich beherrschen, um nicht die Augen zu verdrehen.
»Unglaublich männlich«, stimmte Melody zu. Sie wandte sich um zu Lynn und fragte: »Finden Sie nicht auch, Mrs. Nelson?«
»O ja, unbedingt«, sagte Lynn trocken. Erleichtert sah sie, daß Rory, nun in trockenen Jeans und mit einem grauen Reißverschluß-Sweatshirt über die Lichtung zu ihnen kam. Die sechs oder sieben hellgelben Zelte standen eng beieinander, und es schien nur zu naheliegend, daß Jess Feldman in eines hineingegangen war, um auch seine nasse Jeans auszuziehen. Die Vorstellung, daß sich ihre von Hormonen getriebene Tochter in nächster Nähe zum Gegenstand ihrer neuesten Verliebtheit befand, während beide sich umzogen, hatte gelinde gesagt nicht gerade zur mütterlichen Ruhe beigetragen.
»Worüber sprecht ihr gerade?« erkundigte sich Rory bei ihren Freundinnen, als sie sich ihnen anschloß.
»Jess Feldman«, sagte Melody. »Deine Mutter findet ihn absolut süß.«
»Ah ja?« Rory richtete ihren Blick auf Lynn, während Jenny den Eimer ergriff, um ihre Hände zu waschen.
Lynn konnte nicht mehr. Dieses Mal verdrehte sie die Augen. »Oh, ein prächtiges Mannsbild.«
»Ich finde das auch«, sagte Rory und hob das Kinn. Lynn wußte, daß Rory ihre Mutter für hoffnungslos alt, hoffnungslos doof und überhaupt für hoffnungslos hielt. Die anderen Mädchen bedachten Rory mit mitleidigen Blicken.
»Glaubt ihr nicht, daß er ein bißchen zu reif für uns ist?« fragte Melody ihre Freundinnen, als sie dran war mit Händewaschen. Dieser Beweis von Vernunft und Einsicht hätte Lynn beeindruckt, wenn die drei Mädchen nicht Blicke getauscht, im selben Atemzug »Nein!« ausgerufen und laut losgekichert hätten.
»Ihr Mädchen beeilt euch besser mal, wenn ihr noch was zu essen haben wollt!« rief Pat Greer ihnen vom Kopf der Essensschlange aus zu. Das Essen und andere notwendigen Dinge war ihnen in einem Jeep mit Vierradantrieb gebracht worden, einem roten Grand Cherokee, um genau zu sein. Das Fahrzeug, das auf einer anderen, vermutlich leichteren Strecke zum Lager gekommen war, hatte bereits gewartet, als sie eingetroffen waren. Nun verströmten über dem größten Feuer aufgehängte Kessel verführerische Gerüche von Gegrilltem und gebackenen Bohnen.
»Wir kommen!«
Melody reichte Lynn die Seife, dann jagten sie und Jenny davon. Lynn gab die Seife an Rory weiter, da sie sich die Hände erst waschen wollte, nachdem Rory fertig war.
Allein mit ihrer Mutter, seifte sich Rory die Finger ein und warf Lynn einen verstohlenen Blick zu. Lynn erwiderte ihn, ohne zu sprechen.
»Ja, Mutter?« sagte Rory mit einer vor Sarkasmus triefenden Stimme.
Bis zu diesem Jahr noch hatte Rory sie Mom oder Mommy genannt, in warmem, liebevollem Tonfall, von dem Lynn sich nie hätte vorstellen können, daß er sich einmal ändern würde. Die Art, wie Rory nun »Mutter« sagte, war kalt und absichtlich verletzend. Lynn haßte es zuzugeben, daß dieser Ton weh tat, aber es war so.
»Weißt du, es könnte wirklich leicht passieren, daß ihr Mädchen Jess Feldman einen falschen Eindruck vermittelt«, sagte Lynn sanft. Indem sie »ihr Mädchen« statt »du« sagte, hoffte sie die Feindseligkeit zu zerstreuen, die darauf folgen mußte.
»Das bezweifle ich.« Rory legte die Seife hin und tauchte ihre Hände in den Eimer, um sie abzuspülen. »Ich habe ihm nämlich schon gesagt, daß ich ein Baby von ihm will.«
»Du hast was zu ihm gesagt?« Wie Lynn wußte, war es genauso fatal, Rory ihre mütterliche Verblüffung zu zeigen, als wenn sie gegenüber einem knurrenden Hund Angst gezeigt hätte, aber sie konnte nicht anders: Es brach einfach aus ihr heraus.
»Ich habe ihm gesagt, ich will ein Baby von ihm«, wiederholte Rory mit bösartigem Vergnügen.
»Rory Elizabeth«, sagte Lynn und konnte kaum ein Keuchen unterdrücken, während sie sich von diesem körperlichen Schlag zu erholen suchte. »Das hast du nicht gesagt.«
»Du bist so lahm, Mutter.« Rory trocknete sich die Hände ab. Die blauen Augen, die Lynns eigenen so ähnlich waren, blitzten vor Feindseligkeit. »Du hältst doch Owen für süß, oder nicht? Du solltest wirklich was mit ihm anfangen, solange wir hier sind. Schließlich lebst du nur einmal, Mutter, und du hast es schon lange nicht mehr getrieben.«
»Rory!« Vor Schock verschlug es Lynn den Atem. Rory grinste, unverkennbar zufrieden mit dem Ergebnis ihres Attentats. Sie warf das Papierhandtuch weg, schnappte sich einen Teller von dem Stapel nahe beim Eimer und sprang davon, um sich zu ihren Freundinnen in die Essensschlange zu stellen. Geschockt beobachtete Lynn, wie Rory in einer Geste, die für sie seit ihrer frühesten Kindheit typisch war, ihr langes blondes Haar zu einem Seil über einer Schulter verdrehte, während sie Jenny etwas ins Ohr sagte. Melody gesellte sich dazu, und die drei Mädchen flüsterten hin und her. Lynn fragte sich, worüber sie wohl so angeregt sprachen.
Sie kam zu dem Schluß, daß sie es gar nicht wissen wollte.
Als sie sich genügend erholt hatte, um ihre Hände in den Eimer zu tauchen, betete Lynn, daß Rory sie angelogen hatte. Bestimmt hatte sie nicht etwas so Ungeheuerliches zu Jess Feldman gesagt. Bestimmt war sie vernünftiger.
»Und, wie lange ist es also her?« überraschte sie eine männliche Stimme hinter ihr, als sie sich die Hände an einem Papierhandtuch trocknete.
Aus ihren Gedanken aufgeschreckt, blickte Lynn über die Schulter und sah Jess Feldman, ausgerechnet! Die Flanellhemdsärmel bis zu den Ellbogen aufgerollt, tauchte er seine Hände in das seifige Wasser. Er trug jetzt trockene Jeans und ein anderes, überwiegend blaues Hemd, aber er sah immer noch wie Brad Pitt aus, der für die Darstellung des Marlboro-Mannes vorsprach.
Grauenhafte Bilder von Rory, wie sie ihm erzählte, sie wolle ein Baby von ihm, spulten sich in Lynns Kopf ab.
»Wie lange ist was her?« fragte sie gleichmütig und bemühte sich, die Fassung zu bewahren, solange sich das Durcheinander in ihrem Kopf noch nicht geklärt hatte.
»Daß Sie es zuletzt getrieben haben«, sagte er und grinste.
Kapitel 4
»Das geht Sie doch wohl wirklich nichts an, oder?«
Wenn Lynn feindselig klang, so einzig deswegen, weil es genau ihre Stimmung wiedergab. Er hatte sich die falsche Zeit für einen Annäherungsversuch ausgewählt. Sie hatte Lust, ihm den nächstbesten stumpfen Gegenstand auf den Kopf zu schlagen. Sie zerknüllte das Papierhandtuch, zielte damit auf einen nahestehenden Eimer, der für den Abfall aufgestellt war, und wünschte sich, das zerknüllte Tuch wäre ein Stein und der Eimer sein Kopf.
Die Papierkugel traf mit vorbildlicher Genauigkeit ihr Ziel. Die drei Jahre, in denen Lynn in ihrer High-School die Starwerferin des Softballteams gewesen war, hatten ein dauerhaftes Kennzeichen hinterlassen: Sie traf fast immer, worauf sie gerade zielte.
»He, ich möchte nur Bescheid sagen, daß Sie mich wahrscheinlich herumkriegen könnten, falls Sie sich nach Freiwilligen umsehen.« Jess grinste sie immer noch an, während er seine Hände einseifte. Offensichtlich hatte ihre Feindseligkeit keinen Eindruck auf ihn gemacht. Lynn fragte sich, ob er zu dumm war, Ablehnung als solche zu erkennen, selbst wenn sie ihn mitten ins Gesicht traf.
Wahrscheinlich. Hübsche Jungs waren gewöhnlich dumm.
»Das kann ich mir gut vorstellen.« Kalt blickte sie ihn von oben bis unten an. »Lassen Sie Ihre Hose zu, Romeo, Sie sind nicht mein Typ.«
Ihre Stimme wurde leise, ihr Gesichtsausdruck tödlich, als er sich die Hände abspülte und nach einem Papierhandtuch griff. »Und wenn wir schon beim Thema sind: Sie sind auch nicht der Typ meiner Tochter. Sie ist erst 14, nur für den Fall, daß Sie das nicht wußten. Verführung Minderjähriger. An Ihrer Stelle würde ich das nicht vergessen.«
»Sie ist ein süßes kleines Mädchen.« Amüsiert leuchteten seine Augen auf.
Lynn spürte, wie Zorn in ihr aufstieg. Nur mit Mühe wahrte sie ihre ohnehin schwankende äußere Coolness. »Lassen Sie die Hände von ihr. Ich warne Sie.«
»Wenn Sie schon so besorgt sind, könnten Sie mich von ihr ablenken.« Er knüllte sein Papierhandtuch zusammen und warf es zum Abfalleimer hinüber. Der Wurf ging daneben, und Lynn lächelte gehässig. Er war nie ein Starwerfer gewesen, soviel stand fest. Er lächelte sie wieder an, sowohl von ihrer Feindseligkeit als auch von seinem danebengegangenen Wurf anscheinend ungerührt. »Ihre Kleine ist süß. Sie aber sind scharf.«
»Und Sie sind widerlich.«
»Finden Sie?« Jess ging hinüber, hob das Papierknäuel auf und warf es in den Eimer, dann wandte er sich wieder zu ihr um, wobei er die Hände in seine Jeanstaschen steckte. »Sie sollten wissen, daß Owen gerade eine ziemlich schlimme Ehe hinter sich hat. Er ist zur Zeit sehr verletzlich, und das letzte, was er gebrauchen kann, ist eine sexhungrige Touristin, die ihn für eine Urlaubsliebschaft benutzt. Ich hingegen habe kein gebrochenes Herz, bin frei von falschen Vorstellungen und verfügbar, um jeden Ihrer Wünsche zu erfüllen. Widerlich oder nicht, an Ihrer Stelle würde ich mich für mich entscheiden.«
»Sexhungrig ...« Lynn traute ihren Ohren nicht. »Meinen Sie das ernst?«
»Todernst. Rory sagt, sie glaubt, Sie hätten keinen Sex mehr gehabt, seit Sie sich von ihrem Dad getrennt haben, als sie noch ein Baby war. Sie glaubt, daß Sie nur deshalb ständig schlechtgelaunt seien.«
»Das hat sie nie und nimmer gesagt!«
»Nein?« Er grinste aufreizend.
»Nein!« Lynn fürchtete, daß Rory es tatsächlich gesagt hatte, genauso wie das mit dem Baby von ihm. In letzter Zeit war Sex eines von Rorys Hauptgesprächsthemen.
»Lynn! Wenn Sie noch was essen wollen, sollten Sie jetzt besser kommen. Du auch, Jess!« rief Pat Greer. Sie war ein mütterlicher, naturverbundener Typ, mit lockigem dunklem Haar und einem runden Apfelbäckchengesicht, und hatte bereits die Rolle der Leitmutter dieser Expedition übernommen. In ihren Jeans, die an ihrem Hinterteil eine Spur zu stramm saßen, und dem in der Taille zusammengeknoteten Baumwollhemd sah Pat genauso aus wie die Sorte Mutter, die Vorsitzende des Eltern-Lehrer-Verbandes war, jeden Abend liebevoll gekochte Mahlzeiten auf den Tisch stellte und ihren Kindern gegenüber nie ein böses Wort fallen ließ. Die Art Mutter also, wie Rory sie sich wünschte.
Die Art Mutter, das spürte Lynn, wie sie eine sein sollte und doch nicht war.
»Halten Sie sich von meiner Tochter fern«, sagte sie warnend zu Jess Feldman. Dann drehte sie ihm den Rücken zu und ging zum großen Lagerfeuer und zu ihrem Abendessen.
Trotz all der frischen Luft, der harten körperlichen Betätigung und dem reichlichen Essen hatte Lynn keinen großen Appetit. Sie pickte an einem zu scharf gegrillten Fleischstück und zähen gebackenen Bohnen herum, kratzte sich an den Stichen im Nacken, wo tückischerweise fast unsichtbare Stechmücken die dicken Schichten von Insektenschutzmitteln auf ihrer Haut durchbohrt hatten, blinzelte im Rauch des Lagerfeuers und hatte insgesamt genau die Art von Urlaubseindrücken, die in der glänzenden Werbebroschüre von Adventure Inc. versprochen worden waren.
Wenn Sie an einem knisternden Lagerfeuer sitzen, werden Sie zum Abendessen die echte Westernküche genießen und dabei eins sein mit der Natur.
Sie konnte nicht behaupten, daß man sie belogen hatte, das mußte Lynn zugeben. Sie tat genau all das, was der Prospekt versprochen hatte – aber es hatte entschieden nach mehr Spaß geklungen, als sie in ihrem bequemen Wohnzimmer davon gelesen hatte.
Caveat emptor. Möge der Käufer auf der Hut sein. Sie wußte das ja. Was hatte sie erwartet? Ein mobiles Ritz-Carlton mit Pferdefimmel in der Wildnis?
Schließlich gab Lynn die »echte Westernküche« auf und warf ihren Teller mitsamt Essensresten in eine Spülschüssel. Sie blickte sich nach ihrer Tochter um. Wenn sie doch nur ein paar richtig gute Stunden mit Rory verbringen könnte, hätte sich der Ausflug – trotz allen dazugehörigen Elends – gelohnt. Wenn sie nur genug miteinander sprechen würden, könnten sie den riesigen Abgrund, der sich zwischen ihnen immer weiter zu verbreitern schien, vielleicht überbrücken.
Lynn hoffte das. Sie wollte ihre kleine Tochter wiederhaben.
Rory saß mit einem halb geleerten Teller auf dem Schoß inmitten einer Gruppe Freundinnen. Lynn ging auf sie zu.
»Hast du Lust auf einen Spaziergang, wenn du fertig bist?« Lynn legte von hinten versöhnlich eine Hand auf Rorys Schulter. Rory blickte zu ihr auf.
»Klar doch«, sagte Rory, dann verdarb sie es mit einer Geste, die den Mädchenkreis einschloß. »Mit ihnen. Wir werden den Wald erforschen. Jess sagt, es ist ganz ungefährlich, solange wir viel Krach machen, damit die Bären oder was auch immer uns kommen hören. Und solange wir nicht zu weit gehen.«
»Bären?« fragte Lynn und zwang sich zu einem Lächeln. Ich meinte einen Spaziergang mit mir, dachte sie, nur wir zwei allein, und das weißt du auch. Aber Rorys Augen waren hell und herausfordernd, und es war klar, daß sie nicht die Absicht hatte, ihre Pläne zu ändern, um ihrer Mutter einen Gefallen zu tun.
Lynn würde nicht darauf bestehen. Das wäre, wie sie spürte, kontraproduktiv. Aber es tat weh, daß Rory die Gesellschaft ihrer Freundinnen der ihrer Mutter vorzog.
»Sie sind da draußen, Mrs. Nelson. Wahrscheinlich beobachten sie uns gerade jetzt. Deshalb müssen wir abends sorgfältig alle Lebensmittel wegräumen«, sagte Melody ernst.
»Na, dann viel Spaß. Seid vorsichtig«, sagte Lynn und strich noch einmal über Rorys Haar. Es war eine automatische Geste, so wie sie sie schon seit Jahren machte. Rory drehte heftig ihren Kopf weg und warf ihrer Mutter einen ungeduldigen Blick zu.
»Sorry«, formte Lynn mit dem Mund, da sie wußte, wie sehr Rory es haßte, vor ihren Freundinnen als kleines Kind zu erscheinen. Lynn hatte schmerzhaft erfahren, daß jede liebevolle mütterliche Geste diese Wirkung hervorrief.
»Hau ab«, zischte Rory mit einem kurzen Aufschimmern ihrer weißen Zähne zurück (deren Begradigung ein Vermögen gekostet hatte), das offenbar für ein Lächeln gehalten werden sollte. Bevor Lynn etwas erwidern könnte, hatte Rory sich wieder ihren Freundinnen zugewandt.
Lynn hatte einen Tadel wegen dieser Unverschämtheit schon auf den Lippen, aber sie schluckte ihn herunter. Was auch immer mit Rory los war – ob es »die Sache mit der Pubertät« war, wie Lynns Mutter sich ausdrückte, oder etwas Ernsteres –, ein Streit vor ihren Freundinnen wäre nicht hilfreich.
Ironisch verzog Lynn die Lippen, nachdem sie so entlassen worden war. In gewisser Weise war es komisch: In jeder anderen Hinsicht hatte sie Erfolg in ihrem Leben, sowohl nach ihrem eigenen Maßstab wie nach dem anderer Leute. Wie konnte sie als Mutter nur so versagen?
Da Rory es bestimmt nicht mochte, wenn sie sich in der Nähe herumtrieb, entfernte sich Lynn. Sie sah, daß sich Debbie Stapleton mit der pausbäckigen, stämmigen Irene Holtman, einer der Lehrerinnen, unterhielt. Lucy Johnson, die andere Lehrerin, eine Frau in den Sechzigern mit modisch kurzem silbrigem Haar, ging gerade mit einem braunhaarigen Mädchen mit Pferdeschwanz auf die Zelte zu. Das Mädchen war offensichtlich am Rande der Tränen, und Lynn vermutete, daß sie Heimweh hatte. In der letzten Nacht, der ersten dieser Reise, hatte es zwei andere Mädchen ähnlich erwischt. Da sie die Nacht in dem schuppenähnlichen Schlafsaal auf der Feldman-Ranch verbracht hatten, bekam die ganze Gruppe diesen Jammer mit.
Rory wäre nicht krank vor Heimweh, wenn ihre Mutter nicht mitgekommen wäre, da war Lynn sich ganz sicher. In letzter Zeit schien sich Rory überall dort, wo nicht ihr Zuhause war, besonders wohlzufühlen.
Vier Mädchen, die an diesem Abend zum Küchendienst eingeteilt waren, wuschen mit Gummihandschuhen das Geschirr ab. Pat Greer räumte das Lager auf und sammelte Abfall ein, befreite ein vergessenes Sweatshirt aus einem Baum und half den Begleitern Bob und Ernst, die für das Abendessen verantwortlich waren, übrig gebliebene Lebensmittel in den Jeep zu räumen. Pats Tochter Katie blieb an der Seite ihrer Mutter und half ihr – fröhlich. Natürlich, da Pat ja die perfekte Mutter war, hatte sie mit ihrer Tochter keine Probleme.
Lynn sah wieder zu Rory hinüber und spürte die schon bekannten Schläge aus Hilflosigkeit und Überforderung. Sie liebte ihr Kind verzweifelt und hatte alles getan, um eine gute Mutter zu sein, aber irgendwie hatten sie sich auseinanderentwickelt. Sie hatte gehofft, daß dieser Ausflug zwischen ihnen wieder alles in Ordnung bringen würde. Aber anstatt sich zu verbessern, hatte ihr Verhältnis sich nur noch verschlechtert.
Sie brauchte dringend eine Zigarette, ein Laster, über das Rory sich beklagte, das Lynn aber einfach nicht aufgeben konnte. Eine über zwanzigjährige Gewohnheit ließ sich nicht so einfach abstellen, hatte Lynn gemerkt. Außerdem half das Rauchen ihr, schlank zu bleiben.
Jedes Mal wenn sie an die zwanzig Pfund dachte, die sie sicher zunehmen würde, wenn es ihr gelang aufzuhören, zündete sie sich eine neue Zigarette an. Bei ihrer Art von Arbeit war Rauchen die reinste Selbstverteidigung.
Sie lief am Rand der Lichtung entlang, getrieben von der Sorge, daß sie, falls Pat sie erblickte, in irgendein Projekt einbezogen würde. Gerade jetzt fühlte sie sich nicht in der Lage, eine Show fröhlicher Geschäftigkeit abzuziehen. Lynn fand einen einsamen Heuballen und ließ sich darauf niedersinken. Zu sitzen tat weh – aber nicht zu sitzen auch. Es schmerzte nur woanders.
Lynn versuchte die bequemste Lage zu finden und saß schließlich auf der Kante des Ballens, die Beine an den Knien gekreuzt. Nicht, daß diese Stellung nicht geschmerzt hätte, es tat so nur etwas weniger weh.
Sie nahm ihr Feuerzeug und Zigaretten aus der Tasche ihrer Windjacke, zündete sich eine Zigarette an und sog den Rauch ein.
»Wie geht’s den müden Muskeln?«
Lynn sah auf und erblickte Owen, der vor ihr aufragte. Es war nun völlig dunkel, und die Luft hatte sich drastisch abgekühlt, obwohl es die dritte Juniwoche war. Sie zog noch einmal an ihrer Zigarette und fing an, sie auszudrücken. Dann überlegte sie es sich und machte herausfordernd noch einen Zug. Warum sollte sie sich wegen des Rauchens schuldig fühlen, zumal hier im Freien? Einzig die Stechmücken wurden durch den Rauch gefährdet, und sie konnte nur hoffen, daß sie daran ersticken würden.
»Müde«, sagte sie und lächelte. Als ob ihr Lächeln eine Einladung bedeutete, setzte er sich neben sie. Lynn wollte und brauchte nur eines: daß man sie in Ruhe ließ. Aber Owen war wohl ein ganz netter Kerl, auch wenn er ein Ekel als Bruder hatte. Höflichkeit würde sie nicht umbringen, beschloß sie.
»Haben Sie schon die Salbe benutzt?« Owens in einer Jeansjacke steckende Ellbogen ruhten auf seinen Bluejeans-Knien. Er blickte sie an. Das orangefarbene Licht des Feuers reichte noch einen Meter weiter; tanzende Schatten machten es ihr schwer, seinen Gesichtsausdruck zu erkennen. Irgendwo in der Dunkelheit wieherte ein Pony und stampfte mit dem Fuß auf, worauf die anderen Ponys ihm nacheinander wiehernd antworteten. Der Wald raschelte ununterbrochen. In der Luft lag der Geruch von Spareribs und Rauch.
»Noch nicht. Ich wollte mich vor dem Schlafengehen einreiben.« Lynn klopfte auf die urige Dose in ihrer Tasche.
»Gute Idee. Das Zeug hilft besser als jedes Insektenschutzmittel gegen alles, was da kreucht und fleucht.«
»Was genau kreucht und fleucht denn so?« Die Vorstellung von krabbelnden Viechern in der Dunkelheit, während sie schlief, machte Lynn unruhig.
»Wahrscheinlich alles, was Sie sich vorstellen können.« Owen grinste. »Was ist schon ein Campingausflug ohne Wanzen, Spinnen, Schlangen und ...«
Lynn hob die Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen. »Das würde ich liebend gern selbst herausfinden.« Sie zog wieder an ihrer Zigarette.
»Kann ich von Ihnen eine Zigarette schnorren?«
»Sie rauchen?« Lynn sah ihn überrascht an.
»Mhm.« Er nahm Zigaretten und Feuerzeug, die sie ihm reichte, und zündete sich eine an. »Ich hab’ vor Jahren aufgehört. Nach ... vor ein paar Monaten hab’ ich wieder angefangen. Ich kann mich so besser entspannen.«
»Ich auch.«
»Gefällt Ihnen der Ausflug bisher?« Er gab ihr Päckchen und Feuerzeug zurück. Lynn steckte sie in ihre Tasche.
»Oh, ich liebe jede einzelne Minute.«
Owen lachte. »Warum werde ich den Eindruck nicht los, daß das Leben im Freien nicht Ihre Sache ist?«
»Vielleicht, weil das zutrifft.«
»Jess sagte, man sieht Sie im Fernsehen. Sie sollen da einen ziemlich tollen Job haben.«
Lynns Augen verengten sich, während sie langsam den Rauch ausstieß. »Ich weiß nicht, woher Jess ... oh, Rory vermutlich ... aber ich mache die Nachrichtenkoordination für WM AQ in Chicago. Sie können mir glauben, es ist kein Traumjob.«
»Machen Sie das schon lange?«
»Vier Jahre.«
»Aha? Wie sind Sie an einen solchen Job gekommen?«
»Ich habe an der Indiana-Universität einen Abschluß in Kommunikationswissenschaften gemacht. Schon als ich noch zur Schule ging, habe ich für einen Sender in Indianapolis gearbeitet. Nach meinem Abschluß bekam ich eine Stelle als Reporterin für einen Sender in Evansville. Von da ging ich als Wochenendnachrichtensprecherin nach Peoria und von da nach Chicago, wo ich für WMAQ arbeite. Voilà.« Es war eine häufig gestellte Frage. Lynns knappe Antwort hatte sich im Laufe der Jahre auf das Wesentliche abgeschliffen.