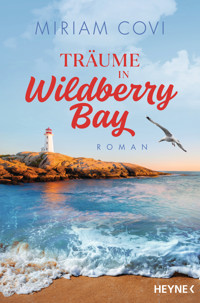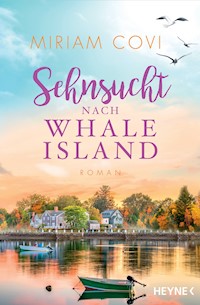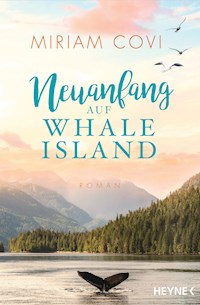
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Whale-Island-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Aller Neuanfang ist schwer
Restaurantmanagerin Stella Minetti hofft auf einen gelungenen Neustart für sich und ihre 13-jährige Tochter Feli in der Cameron Lodge auf Whale Island. Doch von einer entspannten Atmosphäre ist in dem charmanten Inselhotel zunächst wenig zu spüren, denn die temperamentvolle Halbitalienerin gerät immer wieder mit dem ebenso hitzigen Chefkoch Aidan Cameron aneinander. Dass sie sich trotz allem zu ihm hingezogen fühlt, macht alles noch viel komplizierter. Dann taucht plötzlich der attraktive Sänger Jackson auf und macht Stellas Gefühlschaos perfekt. Auch Feli, die ein großer Fan von ihm ist, scheint sich gut mit ihm zu verstehen. Doch warum sucht Jackson hier auf der abgeschiedenen Insel Zuflucht? Und für wen wird sich Stellas Herz entscheiden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 658
Ähnliche
ZUMBUCH
Restaurantmanagerin Stella Minetti hofft auf einen gelungenen Neustart für sich und ihre dreizehnjährige Tochter Feli in der Cameron Lodge auf Whale Island. Doch von einer entspannten Atmosphäre ist in dem charmanten Inselhotel zunächst wenig zu spüren, denn die temperamentvolle Halbitalienerin gerät immer wieder mit dem ebenso hitzigen Chefkoch Aidan Cameron aneinander. Dass sie sich trotz allem zu ihm hingezogen fühlt, macht alles noch viel komplizierter. Dann taucht plötzlich der attraktive Sänger Jackson Porter auf und macht Stellas Gefühlschaos perfekt. Doch warum sucht er hier auf der abgeschiedenen Insel Zuflucht? Und wie wird sich Stellas Herz entscheiden?
ZURAUTORIN
Miriam Covi wurde 1979 in Gütersloh geboren und entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für zwei Dinge: Schreiben und Reisen. Ihre Tätigkeit als Fremdsprachenassistentin führte sie 2005 nach New York. Von den USA aus ging es für die Autorin und ihren Mann zunächst nach Berlin und Rom, wo ihre beiden Töchter geboren wurden. Nach vier Jahren in Bangkok lebt die Familie nun in Brandenburg. Zur zweiten Heimat wurde für Miriam Covi allerdings die kanadische Ostküstenprovinz Nova Scotia, in der sie viele Sommer ihrer Kindheit und Jugend verbringen durfte und wo sie heute auch immer wieder Inspiration für neue Romane findet.
MIRIAMCOVI
ROMAN
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 07/2022
Copyright © 2022 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Diana Mantel
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
unter Verwendung von Plainpicture
(Design Pics/Robert Postma), FinePic®, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-27608-9V001
www.heyne.de
Wale sind das Gedächtnis der Erde und Hüter der Zeit.
Wenn es die Wale nicht mehr gibt,
sind die Tage der Menschen gezählt.
Indigenes Sprichwort
Für all unsere wunderbaren Freunde,
die dazu beigetragen haben, dass meine Familie und ich
in Bangkok so glücklich waren.
Aber besonders für Nunu.
1
Ja, Greta hatte erwähnt, dass es auf Whale Island zwar wunderschön, allerdings auch hin und wieder nebelig ist. Aber muss denn schon bei unserer Ankunft so eine dicke graue Suppe über dem Atlantik hängen? Ich ziehe meinen bunt gemusterten Kaschmirschal, den ich mir auf dem Chatuchak-Markt in Bangkok gekauft habe, enger um mich. Der Schal war schon auf unserer schier endlosen Reise hierher mein treuer Begleiter. Auf diesem ganzen langen Weg, von unserem alten Lebensabschnitt in einen unbekannten neuen, hat er mich warm gehalten: Heute, am frühen Morgen, am Frankfurter Flughafen, als ich übernächtigt fröstelnd an einem schlechten Coffee to go genippt habe; dann auf dem Flug nach Halifax, an Kanadas Ostküste, in der Maschine mit der viel zu kalt eingestellten Klimaanlage. Und schließlich in dem schwankenden kleinen Propellerflugzeug, das uns vom Internationalen Flughafen in Halifax zum winzigen Flughafen von Sydney, im Norden der kanadischen Atlantik-Provinz Nova Scotia, gebracht hat. Bei unserer Pinkelpause zwei Stunden hinter Sydney, an einer Tankstelle irgendwo im Nirgendwo, hat mich der Schal vor dem scharfen Wind geschützt – und mir Trost gespendet. Trost, den ich angesichts der weiten Wälder und des endlos langen Highways, der noch vor uns lag, wirklich gebrauchen konnte. Und auch jetzt, auf dem Deck dieser Fähre, als ich meinen vertrauten Schal enger um mich wickele, bin ich dankbar für dieses bisschen Halt.
Dass mir ein Schal, den ich ausgerechnet in Bangkok gekauft habe, Trost spendet, ist allerdings ein wenig ironisch, überlege ich, während ich fröstelnd über die Reling auf die weißen Wellenkämme hinabstarre. Ansonsten verbinde ich kaum noch etwas Positives mit dieser Stadt, die ein paar Monate lang unser Zuhause war.
Nicht zurückschauen, ermahne ich mich selbst. Immer nach vorn sehen. Und so richte ich den Blick entschlossen auf den Horizont, den ich hinter den Nebelschlieren vermute, während sich die Fähre stoisch vorwärtsarbeitet, unserem Ziel entgegen. Der Nebel treibt in feuchtkalten Schlieren über das Meer und hat das Festland mit seinen Bäumen und wenigen Häusern, das wir erst vor wenigen Minuten hinter uns gelassen haben, bereits vollständig verschluckt. Es wundert mich, dass die Fährkapitänin, bei der ich vorhin unsere Passage bezahlt habe, überhaupt genug sieht. Ob diese Fähre oft ausfällt, wenn der Nebel noch dichter ist als jetzt? Nachdenklich löse ich meinen Blick vom Atlantik und betrachte die anderen Fahrzeuge, die sich außer unserem Mietwagen an Deck befinden: Sechs Autos, darunter ein schwarzer Pick-up-Truck, sind hinter- und nebeneinander geparkt. Den meisten Platz nimmt allerdings ein gelber Schulbus ein, worüber ich mich etwas wundere. Ich hätte nicht gedacht, dass der Bus mit der Fähre bis nach Whale Island übersetzt! Hatte Greta nicht erwähnt, dass die Schulkinder der Insel zu Fuß auf die Fähre gehen und der Bus erst am Festland auf sie wartet, um sie zur Schule zu bringen? Aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Es war alles so viel in den letzten Wochen, da habe ich bestimmt einiges vergessen. Und zum Glück haben wir ja noch Zeit, bevor es mit der Schule wieder losgeht. Noch liegt der ganze Sommer vor uns.
Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob das gut oder schlecht ist. Beklommen mustere ich die Windschutzscheibe unseres Mietwagens. Ich kann Feli dahinter nicht erkennen, sondern sehe nur das Grau des Nebels, der sich in der Scheibe spiegelt. Mit einem tiefen Seufzer wende ich mich der Fahrertür zu und steige wieder ins Auto.
»Willst du nicht auch mal frische Luft schnappen?«, erkundige ich mich und versuche, mir weder meine bleierne Müdigkeit nach dieser unendlich langen Reise noch meinen stillen Frust wegen des feuchtkalten Wetters anmerken zu lassen. Es wird hier ganz sicher nicht nur nebelig sein! Sonst hätte sich meine liebe Freundin Greta nicht so Knall auf Fall in diese Insel verliebt. Wobei da natürlich ein bestimmter Mann eine genauso große Rolle gespielt hat. Aber egal – Greta hat geschrieben, dass es hier traumhaft schön ist. Und traumhaft schön sah es auch auf den Fotos aus, die sie mir geschickt hat. Darum versuche ich, Zuversicht zu verströmen – selbst dann, als mich meine Tochter jetzt genervt ansieht und fragt: »Da draußen? In dieser grauen Suppe? Nein, danke!«
»Die Meeresluft ist herrlich«, beharre ich stur. »Es geht wirklich nichts über den Duft nach Salzwasser und …«
»… Fisch«, motzt Feli und rümpft die Nase. »Es stinkt da draußen. Und es ist mir zu windig.«
»Wenn man sich warm einpackt, erfrischt der Wind wunderbar. Komm schon, Feli, sei kein Frosch.«
»Nein, Mama! Ich will nicht! Außerdem siehst du aus, als wärst du in einen Taifun geraten!«
Mit einem leisen Seufzer klappe ich die Sonnenblende hinab und betrachte mich im Spiegel. Meine Tochter hat natürlich mal wieder recht. Leider. Meine schwarzen Locken kringeln sich noch wesentlich wilder als unter normalen Umständen, der Luftfeuchtigkeit sei Dank. Und der Wind hat dazu beigetragen, dass ich tatsächlich aussehe, als hätte mich ein Taifun ordentlich durchgewirbelt. Trotz meiner Erschöpfung und trotz der Angst, die mir seit Wochen in den Knochen sitzt und mich nicht zur Ruhe kommen lässt, bahnt sich ein albernes Kichern seinen Weg aus meiner Kehle hinaus in diesen grauen Nachmittag. Halbherzig versuche ich, meine Locken mit beiden Händen zurechtzuzupfen, bevor ich aufgebe und Feli mit einem breiten Grinsen ansehe.
»Du hast recht, mein Schatz. Ich sehe aus wie nach einem Taifun. Oder, hier in Ostkanada, müsste man wohl Hurrikan sagen. Ja, ich sehe aus wie nach einem Hurrikan.«
Das amüsierte Blitzen in Felis dunkelbraunen Augen entgeht mir nicht, aber es erlischt so schnell wieder, dass ich keine Chance habe, mehr aus meiner Tochter herauszukitzeln. Ein richtiges Lachen zum Beispiel. Wie lange habe ich sie nicht mehr wirklich lachen gehört? Ich muss daran denken, wie wir früher gelacht haben. Richtiges Gelächter, bis uns die Bäuche wehtaten und unsere Gesichter tränennass waren. Wie wir herumgealbert haben. Früher, als wir die Minetti-Girls waren. Nur sie und ich, ein eingeschworenes Team, das die Welt erobert hat – ganz wortwörtlich. Von einem Land ins nächste, die Abenteuerlust im Gepäck. Ich habe immer versucht, meiner Tochter das Schöne an meinem Beruf zu vermitteln: die ewigen Ortswechsel, die zwar kräftezehrend sein können und durchaus Abschiedsschmerz mit sich bringen, aber eben auch so viel Aufregendes bereithalten. Und es gab mal Zeiten, da konnte ich Feli bei jeder Ankunft an einem neuen Ort für das Unbekannte begeistern.
Diese Zeiten sind wohl wirklich vorbei, wird mir mal wieder klar, aber ich verdränge diese negativen Gedanken und sage betont fröhlich: »Du wirst sehen, cara mia: Wenn es hier nicht nebelig ist, ist es wunderschön. Und eigentlich finde ich es sogar im Nebel schön. Sieht das da draußen nicht irgendwie wildromantisch aus? Und geheimnisvoll? Glaub mir, Whale Island wird uns beiden …«
»… guttun, ich weiß!« Jetzt ist es eindeutig Frust, der in Felis Augen aufblitzt, und sie verschränkt ihre Arme vor der Brust und starrt wütend aus dem Beifahrerfenster.
»Ja«, beharre ich stur. »Das wird es. Ganz bestimmt.«
»Ich wüsste nicht, wem auf dieser Welt diese vernebelte Insel irgendwo im Nirgendwo guttun sollte!«
»Feli …«, seufze ich leise. »Es kann auf jeden Fall nur besser werden als in Bangkok. Da sind wir uns doch einig, oder?«
Felis Kopf wirbelt zu mir herum, sie sieht mich mit einer Mischung aus Wut, Verzweiflung und Angst an, die mein Mutterherz in tausend Stücke zu zerreißen droht. Ich würde sie so gern in meine Arme ziehen, möchte ihr den Schmerz nehmen, den sie mit sich herumträgt – aber ich kann nicht. Denn sie lässt mich nicht. Und ich ertrage es nicht, einmal mehr von ihr weggeschoben zu werden.
»Woher willst du wissen, ob es auf dieser Insel besser wird als in Bangkok? Hmm? Woher, Mama? Und an meiner neuen Schule? Warum sollten mich die anderen Schüler da mögen? Ich bin immerhin nach wie vor dieselbe, egal, an welchen neuen Ort du mich schleppst!«
Zitternd hole ich Luft und versuche verzweifelt, die Fassung zu wahren. Die Starke zu bleiben. Zuversichtlich. Unerschütterlich. Es fällt mir so verdammt schwer.
»Ja, mein Schatz, du bist noch dieselbe. Und dafür danke ich dem Himmel, weißt du das? Und es lag nicht an dir, dass das in Bangkok alles so aus dem Ruder gelaufen ist. Das lag an den anderen Schülern. Und hier, auf Whale Island …«
»… da wird nichts besser!« Feli schreit plötzlich, und ich zucke vor Schreck zusammen. Sie atmet heftig ein und aus, ihr rundes Gesicht wird von roten Flecken überzogen. »Nichts wird hier besser, Mama! Weil ich dieselbe dicke, fette Loserin bin wie eh und je!«
»Du bist keine Loserin!« Jetzt schreie auch ich. Aufgebracht sehe ich Feli an, will meine Hand ausstrecken, ihr eine der Locken, die so schwarz und unbändig sind wie meine, aus der Stirn streichen, aber sie schlägt meine Finger wütend weg. »Du bist meine wunderschöne Tochter«, sage ich mit bebender Stimme. »Und ganz bestimmt keine Loserin.«
»Aber fett bin ich. Das kannst du ja wohl echt nicht schönreden, oder?« Herausfordernd sieht mich meine Tochter an, und ich weiß einen Moment lang nicht, wie ich reagieren soll. Denn dass Feli in den letzten Monaten stark zugenommen hat – mehr als dass es noch im grünen Bereich wäre –, das wissen wir beide.
»Feli, hör auf, dich als fett zu bezeichnen«, bitte ich inständig, »und hör auf, dich so fertig zu machen! Du bist wunderschön und du …«
»Ach, du hast doch keine Ahnung, Mama!« Feli verschränkt die Arme vor der Brust und starrt wütend aus dem Beifahrerfenster. Verzweiflung schnürt mir die Kehle zusammen. Ich möchte ihr klarmachen, dass sie das absolut Beste in meinem Leben ist und dass ich es niemals zulassen werde, dass ihr noch einmal so wehgetan wird, aber zum einen weiß ich, dass all meine Worte auf taube Ohren stoßen würden.
Und zum anderen hupt jemand hinter mir.
Überrascht sehe ich in den Rückspiegel, als Feli schon ungeduldig sagt: »Mann, Mama, du hältst alles auf!«
Erst jetzt wird mir klar, dass wir bereits angelegt haben und dass sich die Autos vor mir in Bewegung setzen. Der Schulbus ist als Erstes von Deck gerollt, er fährt schon über einen Pier, erkenne ich jetzt, bevor der gelbe Schimmer vom Nebel verschluckt wird. Ein wenig hektisch starte ich den Motor, schalte auf »Drive« und gebe Gas.
Als ich merke, dass ich zu schwungvoll auf die abschüssige Rampe fahre, die zum Pier hinabführt, ist es schon zu spät: Obwohl ich panisch auf die Bremse steige, komme ich auf der schrägen Rampe nicht rechtzeitig zum Stehen und kollidiere mit der Stoßstange des schwarzen Pick-up-Trucks vor mir.
»Mama!« Feli sieht mich so entgeistert an, dass ich sicher lachen müsste, wenn ich nicht selbst so entsetzt wäre.
Und wenn jetzt nicht ein Mann aus dem Pick-up steigen und fassungslos in meine Richtung starren würde.
Ein extrem gut aussehender Mann. Das realisiere ich innerhalb von Sekundenbruchteilen, obwohl mein Gehirn immer noch versucht zu begreifen, was gerade geschehen ist.
»Merda«, murmele ich.
»Sagt man nicht«, bemerkt Feli leise. »Auch auf Italienisch wird ›Scheiße‹ nicht besser.«
Aber gerade ist mir meine Sprache völlig egal. Mit zitternden Fingern schnalle ich mich ab und steige aus. Der Mann ist bis zur Rückseite seines Pick-ups gegangen und starrt auf die Delle in der Stoßstange, die wohl von mir stammt. Allerdings erkenne ich da noch ein paar andere Dellen, und die können unmöglich alle von mir sein. Außerdem einige rostige Stellen. Ja, dieser Pick-up ist zum Glück schon in die Jahre gekommen, und man sieht ihm an, dass er im salzigen Klima dieser Insel gefahren wird, was dem Lack nicht unbedingt guttut.
Trotzdem liegt mir natürlich eine Entschuldigung auf den Lippen, aber da sieht mich der Mann schon entgeistert an und fragt ungehalten: »Musste das sein?«
Diese Formulierung lässt etwas in mir durchbrennen. Ich kann es nur auf die Müdigkeit schieben. Und auf die extreme Anspannung der letzten Wochen. Auf meine blank liegenden Nerven, nach all den zermürbenden Diskussionen mit meiner Tochter. Bevor ich mich bremsen kann, herrsche ich den Fremden an: »Ob das sein musste? Nein, das musste es nicht! Aber so ist es nun mal im Leben, oder? Manche Tage sind einfach ein Griff ins Klo! Ach, was sage ich, nicht nur Tage – Monate! Jahre!«
Der Kerl starrt mich ungläubig an. »Ein simples ›Tut mir leid‹ hätte echt genügt«, sagt er langsam und verschränkt die Arme vor der Brust, während er mich mit hochgezogenen Augenbrauen mustert.
»Das hätte ich auch noch gesagt – wenn Sie mich nicht gleich so blöd angeblafft hätten!«
»Was habe ich? Ich habe nur gefragt ›Musste das sein?‹! Das wird man doch wohl fragen dürfen, wenn einem eine Touristin volle Kanne ins Auto knallt!«
»Als wenn eine Delle mehr oder weniger einen Unterschied gemacht hätte, bei der Stoßstange!« Wütend recke ich mein Kinn, um den Größenunterschied wettzumachen, denn der Mann überragt mich ein ganzes Stück.
»Bitte, was …?«, beginnt der Fremde ungläubig, aber da schiebe ich schon trotzig hinterher: »Außerdem bin ich keine Touristin!«
»Na, eine Einheimische sind Sie auch nicht, sonst wüssten Sie, dass man nicht in so einem Tempo auf die Rampe der Fähre brettert!«
»Ähm, entschuldige, Aidan …« Die Fährkapitänin ist aufgetaucht und wirft einen kritischen Blick auf unsere Stoßstangen – leider fällt die Delle bei meinem Mietwagen sehr viel mehr auf als bei dem ollen Pick-up. »Wenn niemand zu Schaden gekommen ist, könntet ihr die Details dann bitte auf dem Pier klären? Ihr haltet den Verkehr auf.«
»Ja, klar. Sorry, Dottie.« Der Mann sieht die noch recht junge Kapitänin mit den rötlichen Locken an, plötzlich fast freundlich, bevor er wieder mich anstarrt und wirkt, als würde er mich gern in Stücke zerreißen.
Dann fallen mir zwei Dinge gleichzeitig auf: seine geradezu unverschämt hellblauen Augen. Diese hellblauen Augen habe ich schon einmal gesehen.
Und – wie hat die Kapitänin ihn gerade genannt? Aidan.
Porca miseria!
»Ähm«, sage ich und räuspere mich, als hinter uns ein Auto hupt. Der Mann sieht an mir vorbei und winkt dem Autofahrer zu, will sich dann abwenden. Rasch stoße ich hervor: »Sie … Sie sind nicht zufällig Aidan Cameron?«
Er hält in der Bewegung inne und sieht mich überrascht an. Unter seiner dunkelblauen Baseballmütze ist schwarzes Haar zu sehen. Sein Zehntagebart verleiht ihm, in Kombination mit seinen zerschlissenen Bluejeans und dem Holzfällerhemd, das er offen über einem weißen T-Shirt trägt, einen rauen Charme. Ich schlucke schwer, denn in diesem Moment nickt der Mann und sagt langsam: »Ja, der bin ich. Woher wissen Sie …? Ach.«
Er bricht ab und betrachtet mich sichtlich überrascht. Seine hellblauen Augen weiten sich ein wenig. Völlig klar, diese Augen habe ich schon einmal gesehen: auf dem Foto, das mir Greta geschickt hat. Da hat er keine Baseballmütze getragen, darum habe ich ihn nicht sofort erkannt. Aber eigentlich hätten mir diese Augen reichen müssen. Die muss man doch sofort wiedererkennen, wenn man nicht blind ist!
»Sie sind … Stella?«
Ich nicke und zwinge mich zu einem schiefen Lächeln, als ich ihm die Hand reiche und sage: »Genau, die bin ich. Stella Minetti.«
Aidan schüttelt meine Hand und murmelt: »Halleluja, das kann ja was werden.«
Hinter uns hupt der Autofahrer erneut, und ich denke fassungslos: Wie um alles in der Welt habe ich es bloß geschafft, es mir schon vor Betreten dieser verflixten Insel mit meinem Kollegen und – noch schlimmer! – mit dem Sohn meiner neuen Arbeitgeber zu verderben?
2
Feli mustert mich erschüttert, als ich wieder ins Auto steige und den Motor anlasse.
»Und? Was passiert jetzt?«, fragt sie, und ihre Stimme bebt vor Anspannung. Mitleid mit ihr, wegen der ganzen Aufregung dieses Tages, will in mir aufwallen, aber da schiebt sie schon hinterher: »Das ist sowas von peinlich, Mama, echt!«, und jegliches Mitleid macht wieder purer Erschöpfung Platz – und Wut. Wut auf mich, Wut auf mein zickiges Kind, Wut auf meinen Fuß, der zu spät auf die Bremse getreten hat, und Wut auf diesen Aidan Cameron. Obwohl der am wenigsten dafürkann, ist mir klar, aber ich will trotzdem wütend auf ihn sein. Weil er zu gut aussieht. Er hat schon auf dem Foto, das Greta mir geschickt hatte, attraktiv gewirkt – aber die Realität toppt das Bild bei Weitem. Was vermutlich daran liegt, dass ich auf dem Foto nicht sehen konnte, wie groß er ist. Wie breitschultrig. Wie seine hellblauen Augen aufblitzen, wenn er sich ärgert. Wie tief seine Stimme ist, und …
»Mama!«
»Was denn?« Ich fühle mich sehr ertappt, als ich Feli flüchtig von der Seite ansehe, bevor ich wieder konzentriert durch die Windschutzscheibe schaue, um bloß dem schwarzen Pick-up vor mir nicht noch einmal zu nah zu kommen, als wir nun die Rampe hinabrollen. Außerdem merke ich genau, dass Feli tiefer in den Beifahrersitz sinkt, weil auf dem Pier ein paar Leute stehen, die uns beim Vorbeifahren neugierig mustern.
»Was hat er gesagt?«
Ich seufze tief auf. »Dass er mein neuer Kollege ist«, brumme ich schließlich, setze den Blinker und folge dem Pick-up, der jetzt auf eine ungeteerte Straße biegt.
»Was? Wie?« Feli starrt mich so entsetzt an, dass ich trotz dieser ganzen blöden Umstände kurz auflachen muss.
»Yep«, stöhne ich. »So habe ich ihn auch gerade angeschaut.«
»Welcher Kollege denn?«
»Das da vorn im Pick-up ist Aidan Cameron. Seinen Eltern gehört die Cameron Lodge. Und er ist der Küchenchef.«
»Ach du Scheiße.«
»Feli! Ausdrucksweise!«
»Du hast gerade selbst Scheiße gesagt, Mama – beziehungsweise merda!«
Ich werfe meiner Tochter einen entnervten Blick zu und behaupte: »Wenn man einen Auffahrunfall hat, dann darf man das sagen.«
»Und wenn die eigene Mutter einen schon bis auf die Knochen blamiert hat, bevor man auch nur einen Fuß auf diese gottverlassene Insel am Arsch der Welt setzen konnte, dann genauso!«
Feli verschränkt die Arme vor der Brust, und zu meiner Bestürzung erkenne ich Tränen in ihren Augen, als ich ihr einen flüchtigen Blick zuwerfe. »Schau doch mal nach draußen! Das hier ist doch ein Witz, Mama!«
Ich weiß, was sie meint, denn wir rollen gerade durch den »Ortskern« von Whale Island. Das zumindest vermute ich, weil es hier zwei Geschäfte gibt, die ich durch die Nebelschlieren hindurch vage erkennen kann: In dem graublauen Haus befindet sich dem Schild zufolge ein Souvenirladen und im gelben Holzgebäude daneben – ah, ja, das muss der berühmt-berüchtigte »Inselladen« sein, von dem Greta mir in einer E-Mail geschrieben hat! Das Sortiment soll ein Sammelsurium an Notwendigem für das Leben auf dieser Insel sein, von Lebensmitteln über Gartengeräte bis hin zu unsexy Unterwäsche (Gretas Beschreibung). Außerdem sind die örtliche Poststelle und ein kleiner Imbiss in dem gelben Haus untergebracht, und vor dem Gebäude gibt es eine Zapfsäule, weil es sich bei dem Laden auch um die »Inseltankstelle« handelt. Das weiß ich ebenfalls dank Gretas Beschreibung, denn klar erkennen kann ich die Zapfsäule in dem ganzen Nebel nicht.
»Aber das ist doch wirklich charmant hier«, versuche ich verzweifelt, diese Insel Feli und mir schönzureden, als wir an einer Holzkirche vorbeikommen, deren Turm schemenhaft und unheimlich aus den Nebelschwaden ragt.
»Nee, Mama. Ist es nicht!«
»Schau mal, da!« Ich zeige auf ein großes und sehr neu wirkendes Schild, das dicht am Straßenrand – und darum gerade noch klar zu erkennen – mit den geschwungenen Worten »The Cameron Lodge is waiting for you« in die Richtung weist, in die ich gerade dem Pick-up folge. Unter dem Schild ist ein zweites angebracht, auf dem in leuchtend roten Lettern »Große Wiedereröffnung im August!« zu lesen ist.
»Fahren wir deshalb dem Pick-up hinterher? Weil er auch zu diesem Hotel will?«, fragt Feli ungehalten. Die Art, wie sie »Hotel« sagt, macht deutlich, wie viel sie von meiner neuen Arbeitsstätte hält. Ich kann es ihr nicht verübeln. Mein Kind ist immerhin in 5-Sterne-Hotels in warmen Regionen aufgewachsen. Eine rustikale Lodge auf einer nebeligen Insel im Nordatlantik ist für sie ein völlig fremdes Territorium. Und für mich genauso.
»Genau, deshalb fahren wir Aidan Cameron hinterher«, seufze ich. Und ich wünschte wirklich, dass das anders wäre.
Konzentriert lenke ich den Mietwagen die holprige Straße entlang, und bei jedem Schlagloch merke ich, wie die Stimmung auf dem Beifahrersitz weiter sinkt. Der Nebel trägt wirklich nicht dazu bei, dass sich das ändert, denn anstatt sich endlich zu lichten, werden die grauen Schlieren immer dichter und undurchdringlicher.
»Porca miseria«, fluche ich leise vor mich hin, als ich mit dem rechten Vorderrad über das Gras des Straßenrands fahre, weil ich die Kurve im Nebel nicht rechtzeitig wahrgenommen habe.
»Echt schön hier, Mama«, ätzt Feli neben mir. »Wirklich, diese fantastische Aussicht! Ich freue mich auf unser neues Zuhause!«
»Weißt du was, Felicitas? Es reicht!« Ich trete auf die Bremse und starre meine Tochter aufgebracht an. »Ja, das hier wird anders werden als die Hotels, in denen wir bisher gewohnt haben. Aber selbst wenn Greta mir letzten Herbst nicht von diesem Job in der Cameron Lodge geschrieben hätte: Wir hätten nicht in Bangkok bleiben können, und das weißt du. Ein Neuanfang war also leider unvermeidlich. Und, ja, diesmal wird unser Neuanfang hier stattfinden, auf Whale Island!«
Feli erwidert meinen Blick mit einer Mischung aus Teenager-Überheblichkeit und mühsam verborgener Überraschung, weil ich jetzt doch laut werde. Bisher habe ich mich sehr zusammengerissen und mir immer wieder gesagt, dass es für Feli alles andere als leicht ist. Dass ich Geduld und Nachsicht haben muss. Aber ich kann nicht immer die perfekte, verständnisvolle Mutter sein. Ich bin müde und ausgebrannt. Und ich mache mir furchtbare Sorgen.
Außerdem bin ich eben dem Sohn meiner neuen Brötchengeber in die Stoßstange gerauscht!
»Tut mir leid, Mama.« Sie hören sich nett an, diese Worte, aber die Art, wie Feli sie sagt, macht mir deutlich, dass sie mal wieder zynisch gemeint sind. »Tut mir leid, dass ich dir solche Probleme bereite. Dass du wegen mir schon wieder umziehen musstest. Du hättest mich einfach nicht bekommen sollen.«
Ungläubig sehe ich Feli an, die ihren Blick abwendet und mit verschränkten Armen in den Nebel hinausstarrt.
»Sag das nie wieder, hörst du?« Meine Stimme bebt, als ich diese Worte hervorstoße. »Nie wieder!«
Ich trete aufs Gas, während in meinem Kopf Felis Worte immer wieder abgespult werden. »Du hättest mich einfach nicht bekommen sollen.«
Mit einem Mal sehe ich wieder den Schwangerschaftstest vor mir. Wie ich vor vierzehn Jahren auf der Angestelltentoilette des hübschen Boutique-Hotels auf Capri gesessen und abwechselnd auf das Muster aus gelben Zitronen auf den Kacheln und dann wieder ungläubig auf die zwei roten Streifen des Urinteststäbchens gestarrt habe, ratlos, wie es weitergehen sollte. Vor allem, als mein Freund Enzo entsetzt gemeint hat, dass er das nicht könne. Vater sein. Dass er zu jung sei. Seine Karriere ihm zu wichtig sei.
Dass ich abtreiben solle.
Damals habe ich Enzo eine Ohrfeige gegeben und unsere Beziehung beendet. Und habe nie wieder Kontakt zu ihm gehabt. Der Feigling hat seine Stelle als Souschef des Restaurants, das direkt neben dem Hotel lag, in dem ich damals gearbeitet habe, ziemlich schnell gekündigt und ist weitergezogen. Erst nach Spanien. Später nach New York, wie ich dank gelegentlicher Internet-Recherchen weiß. Ich habe Enzo nie erzählt, dass ich meine Stelle auf Capri kündigen musste und unser Baby an einem regnerischen Frühlingstag in meiner Heimatstadt Offenburg in Baden-Württemberg zur Welt gebracht habe.
»Du hättest mich einfach nicht bekommen sollen.«
Zitternd hole ich tief Luft, während ich wieder das schrumpelige rosa Baby vor mir sehe, das mir damals, im Krankenhaus, auf meine Brust gelegt worden ist und mein ganzes Leben von Grund auf komplett umgekrempelt hat. Von der Minute an war ich nicht mehr die alte Stella Minetti, die gedankenlos durch die Welt gezogen war, immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Die alte Stella, die Bungee-Jumping ausprobiert hat, die ohne Furcht vor Haien an Australiens Ostküste schnorcheln gegangen und auf Capri ohne Helm mit dem Motorroller herumgebraust ist. In der Minute, als mich das süßeste Baby des Universums zur Mutter gemacht hat, wurde ich eine neue Person. Eine Person mit zahllosen Ängsten. So viel konnte passieren: Meinem Kind konnte alles Mögliche zustoßen – es war so winzig und hilflos und völlig von mir abhängig! Und mir konnte etwas zustoßen. Dieses zauberhafte Wesen hatte doch nur mich, seine Mama – denn der Papa wusste nicht einmal, dass Feli an diesem Frühlingstag ihren ersten lauten Schrei ausstieß (und noch viele, viele Schreie danach ausstoßen würde …). Mit einem Schlag wurde mir meine Verantwortung voll bewusst: Mir durfte nichts passieren, denn mein Kind brauchte mich. Von jetzt an für mindestens die nächsten achtzehn Jahre. Auch wenn es liebende Großeltern hatte, so war ich doch das einzige Elternteil dieses kleinen Wunderwesens. Und so schwor ich mir damals, noch während meine Mutter, die im Kreißsaal an meiner Seite war, die Nabelschnur durchtrennte, dass ich ab sofort sehr gut auf mich selbst aufpassen würde, damit ich für mein Kind da sein konnte. Und dass ich dieses entzückende Baby Zeit meines Lebens verteidigen würde. Es beschützen und behüten würde, bis zu meinem letzten Atemzug.
Das war die Geburtsstunde der Minetti-Girls. Und ich habe es jede Minute der letzten Jahre so sehr geliebt, Teil dieses besonderen Duos zu sein. So schwer es als Alleinerziehende auch oft ist – es ist trotz allem etwas Besonderes, wenn man zu zweit als eingeschweißtes Team unterwegs ist. Aber wo ist nur meine fröhliche, unbeschwerte Teampartnerin geblieben? Meine sonnige Feli, die ich nur ansehen musste, und jeglicher Stress im Job oder Ärger über ein paar Pfunde zu viel auf der Waage oder Kummer, weil aus einem Date wieder nicht mehr geworden war, verblasste augenblicklich?
Tränen schießen in meine Augen. Zusammen mit immer dichter waberndem Nebel ist das keine gute Kombination, wenn man versucht, einen fremden Mietwagen über holprige Straßen zu lenken. Aber ich kann nicht anders, ich kann nicht mehr stark sein.
»Vorsicht, Mama!«
Als Feli laut aufschreit, ist es schon zu spät. Aidan hat, im Gegensatz zu mir, sogar die Nebelschlussleuchte eingeschaltet, aber das hilft nicht mehr. Der schwarze Pick-up ist plötzlich direkt vor uns, er muss gehalten haben. Und weil ich gerade dabei war, mir ärgerlich Tränen von den Wangen zu wischen und meine Fassung wiederzugewinnen, bremse ich nicht schnell genug.
Mit einem satten »Rumms« krachen wir zum zweiten Mal an diesem verdammten Tag in die Stoßstange von Aidan Cameron.
3
»Mama!« Feli starrt mich absolut fassungslos an. »Bist du bescheuert?«
»Nein!«, schreie ich zurück. »Nein, bin ich nicht! Ich bin müde, Feli! Und … und … mit den Nerven am Ende! Verdammt noch mal, ich bin nicht perfekt, okay?«
Feli schnaubt und schnallt sich ab. »Nein, perfekt bist du echt nicht, Mama. Du bist so was von peinlich!« Und sie verlässt den Wagen mit einem theatralischen Schluchzer.
Verdammt, ich möchte jetzt auch heulen. Ich bin versucht, meine Stirn auf das Lenkrad sinken zu lassen und einfach so zu tun, als wäre ich nicht hier, aber als ich den Umriss eines Mannes aus dem Pick-up steigen und auf meinen Mietwagen zukommen sehe, ahne ich, dass der Plan nicht aufgehen wird.
Langsam steige auch ich aus. Aidan wirft nur einen flüchtigen Blick auf seine Stoßstange, dann sieht er mich ungläubig an.
»Ich weiß«, sage ich mit belegter Stimme. »Ich bin bescheuert. Das hat mir meine Tochter gerade schon klargemacht. Feli, sag bitte Hallo.«
Ich merke, dass Aidan die Gestalt auf der anderen Seite des Mietwagens noch gar nicht wahrgenommen hat. Er schaut zu meiner Tochter hinüber, die mit verschränkten Armen neben der Motorhaube unseres geschundenen Autos steht und sich offensichtlich weit wegwünscht.
Den Wunsch hat nicht nur sie.
»Hallo«, sagt sie tonlos.
»Hi.« Aidan zögert, dann geht er an mir vorbei, wirft mir einen flüchtigen – und sehr ernsten – Blick zu, bevor er sich durch die schmale Lücke zwischen seinem und meinem Wagen schiebt. Ich sehe, wie er Feli die Hand reicht.
»Ich bin Aidan Cameron.«
Diese kleine Geste, trotz des ganzen Malheurs, das ich verschuldet habe, rührt mich sehr. Er ist nett zu meinem Kind.
»Ich bin Feli«, höre ich Felis Stimme. Sie klingt überrascht. Vielleicht hat sie damit gerechnet, dass dieser Mann uns den Kopf abreißt. Zumindest mir. Dabei bin ich ja schon kopflos genug.
»Freut mich. Du bist dreizehn, habe ich gehört?«
Sie nickt anscheinend, sehen kann ich sie nicht – wegen des Nebels und weil Aidans breiter Rücken mir die Sicht versperrt. Allerdings habe ich gerade gar nichts dagegen einzuwenden, einfach seinen Rücken anzustarren. Er hat einen schönen Rücken. Und es ist leichter, als in seine wutfunkelnden Augen zu sehen, die noch dazu so verwirrend blau und sexy sind.
»Meine Tochter Isla ist auch gerade dreizehn geworden. Sie ist momentan in Halifax, bei den Eltern ihrer Mom, aber sie freut sich schon darauf, dich bald kennenzulernen.«
»Hoffentlich freut sie sich nicht zu früh«, kommt die gebrummte Antwort meiner Tochter.
»Felicitas!«, kann ich mir nicht verkneifen. Was soll das denn bloß? Warum muss sie auf diesem Selbstzerstörungskurs durch ihr Leben brettern?
Ich merke, wie mich Aidan flüchtig über seine Schulter ansieht, dann wendet er sich wieder Feli zu, und ich höre zu meiner Überraschung ein Lächeln in seiner Stimme. »Dreizehn ist ein herausforderndes Alter. Keine Sorge, Isla ist auch ziemlich oft ziemlich unausstehlich. Ich glaube, ihr zwei werdet euch gut verstehen.«
Ohne auf Felis Reaktion zu warten, dreht er sich zu mir um und kommt wieder zwischen unseren eng an eng stehenden Fahrzeugen hindurch auf mich zu. Weil ich seinen intensiven Blick nicht aushalte, starre ich auf die Stoßstange seines Pick-ups. Soweit ich das in diesem dichten Nebel erkennen kann, ist die neueste Delle nun doch ziemlich tief. Meinen Mietwagen sehe ich mir lieber gar nicht näher an. Wie ich das der Leihwagenfirma erklären soll, weiß ich wirklich nicht.
Aidan ist vor mir stehen geblieben und hat die Arme verschränkt. Weil er die Ärmel seines Holzfällerhemds hochgeschoben hat, fällt mir das Tattoo auf seinem Unterarm auf: »Isla« steht dort in geschwungenen Buchstaben. Santo cielo. Ein Mann, der den Namen seiner Tochter auf der Haut trägt. Ich wünschte wirklich, das würde mir nicht so gut gefallen.
Zum Glück verhindert Aidans nächste Bemerkung, dass ich mich an Ort und Stelle in ihn verknalle, nur weil er nett zu meiner unmöglichen Tochter ist und seine eigene Tochter offensichtlich über alles liebt: »Schon mal an einen Sehtest gedacht?«
»Meine Augen sind sehr gut«, fauche ich ihn aufgebracht an und schaue ihm nun doch ins Gesicht. Zwischen seinen schwarzen Augenbrauen hat sich eine tiefe Falte gebildet.
»Den Eindruck habe ich nicht.«
»Es ist mir völlig egal, was du für einen Eindruck hast, Aidan Cameron.«
»Du entschuldigst dich schon wieder nicht? Nicht einmal für die zweite Delle?« Er fragt dies so ehrlich ungläubig, dass ich fast lachen müsste, wenn er nicht so todernst wäre. Und wenn nicht Felis Stimme von der anderen Seite der Motorhaube käme – diesmal natürlich nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, damit Aidan ebenfalls alles versteht: »Also ICH muss mich auch immer für alles entschuldigen, Mama!«
Ich hole tief Luft und schließe kurz meine Augen.
»Entschuldigung«, sage ich heiser und weiche Aidans Blick aus. »Ich … war abgelenkt.«
»Wegen mir. Eigentlich bin ich mal wieder schuld«, meldet sich Feli erneut zu Wort. »Wie immer!«
»Ach, nun halt doch einfach mal den Mund, Felicitas!«, fahre ich sie an, bevor ich mich zusammenreißen kann. Ich habe mich in den letzten Wochen so oft zusammengerissen. Jetzt geht nichts mehr, das wird mir klar. »Du warst nicht schuld«, schiebe ich mit bebender Stimme hinterher und wende mich dann rasch ab, damit Aidan nicht merkt, wie aufgewühlt ich bin. »Ich bezahle das natürlich. Beziehungsweise – meine Versicherung.«
»Das will ich doch hoffen«, höre ich Aidan hinter mir brummen, aber ich beachte ihn nicht mehr. Mir reicht es für heute einfach. Ich bin es so leid, mich ständig in alle Richtungen verteidigen zu müssen!
»Ist es noch weit bis zur Lodge?«, frage ich dann doch noch, als ich die Fahrertür bereits geöffnet habe.
»Wir stehen quasi auf dem Parkplatz«, bemerkt Aidan trocken und deutet hinter sich. »Der dunkle Kasten da im Nebel ist die Cameron Lodge. Ich kann euch erst einmal zu eurem Cottage bringen, wenn ihr wollt.«
»Ja, danke. Das … wäre nett.« Bemüht freundlich nicke ich Aidan zu. Er kann ja nichts dafür, dass ich ihm zweimal hinten reingefahren bin. Im Grunde genommen hat er sich unter diesen bescheuerten Umständen echt nett verhalten. Es gibt bestimmt Leute, die mir beim zweiten Mal wirklich den Kopf abgerissen hätten.
»Du kannst da vorn parken. Wir müssen zu Fuß zum Cottage gehen. Versuch bitte, auf den paar Metern keine anderen Autos zu demolieren, wenn’s irgendwie geht, ja?«
»Idiot«, murmele ich leise, während ich mich auf den Fahrersitz sinken lasse.
»Das habe ich gehört. Ich habe nämlich gute Augen UND gute Ohren!«, bemerkt Aidan von draußen, bevor er mit langen Schritten zu seinem Pick-up geht.
»Wer von uns benimmt sich jetzt eigentlich wie eine Dreizehnjährige?«, fragt Feli spitz, während sie auch wieder einsteigt und ihre Tür dramatisch zuknallen lässt.
»Ich«, fauche ich. »Dafür könntest du dich dann zur Abwechslung mal wie eine Fünfunddreißigjährige benehmen, wie wär’s damit?«
»Nee, danke. Mein Leben ist so schon öde genug.«
»Ach, Schatz, nichts baut mich so auf wie eine Unterhaltung mit dir«, schnaube ich und fahre dem Pick-up im Schritttempo hinterher, bevor ich so vorsichtig in eine Parklücke rangiere, als hätte ich gerade meine erste Fahrstunde.
»So, das wäre geschafft«, seufze ich erleichtert und stelle den Motor aus.
»Halleluja«, brummt Feli.
Aidan kommt schweigend auf unseren Mietwagen zu und greift ungefragt nach zwei Koffern. Ich will sagen, dass wir das selbst schaffen, immerhin habe ich in den letzten Jahren immer alles ohne jegliche männliche Hilfe geschafft, und darauf bin ich wirklich stolz. Aber die Erschöpfung hängt bleiern an mir, und darum murmele ich nur ein »Danke« und greife nach meinem Handgepäck, während sich Feli ihren vollgepackten Rucksack auf den Rücken schwingt. Wir haben auch noch unbegleitetes Fluggepäck auf die Reise nach Whale Island geschickt, das müsste hoffentlich in den nächsten Tagen ankommen. Während sich in unseren Koffern nur die nötigsten Klamotten und Kosmetika befinden, sind in den Kisten, die noch kommen, weitere Anziehsachen und Schuhe, Bilderrahmen, Fotoalben, Bücher, Felis Puppen und Stofftiere, meine Nähmaschine und all die persönlichen Dinge, die man sonst noch so im Laufe seines Lebens ansammelt.
Langsam und vorsichtig folgen wir Aidan durch den Nebel, der sich kühl und feucht auf meine Haut hinabsenkt und irgendwie seltsam beruhigend wirkt. Gar nicht unheimlich, was eigentlich merkwürdig ist, immerhin dröhnt in regelmäßigen Abständen das melancholische Heulen des Nebelhorns über die Insel, was in Kombination mit den schemenhaften Umrissen des Hotels vor uns wie bei Stephen King wirken könnte. Aber ich fühle mich eigenartig geborgen an diesem Ort, obwohl ich quasi blind einem fremden Kerl hinterherstapfe, der allen Grund hat, wirklich wütend auf mich zu sein. Aber Aidan Cameron macht, trotz seiner rauen Schale, nicht den Eindruck, als wolle er mich im Nebel von der nächsten Klippe schubsen.
Außerdem braucht er mich. Ich bin seine neue Restaurantmanagerin.
Bei dem Gedanken, dass er und ich bald Tag für Tag Seite an Seite werden arbeiten müssen, wird mir ein wenig übel. Das könnte aber auch am Hunger liegen. Ich habe seit der Landung auf dem Provinzflughafen von Sydney, Nova Scotia, nichts mehr gegessen, und das ist schon etliche Stunden und zwei Auffahrunfälle her.
Wir gehen an dem Hotel vorbei, wo uns ein paar erleuchtete Fenster durch den Nebel zuzuzwinkern scheinen, und folgen Aidan einen Weg entlang, der über Gras führt. Der würzige Duft nach Wald steigt mir in die Nase und mischt sich mit dem Geruch nach Meer, der uns schon begleitet, seit wir auf die Fähre gerollt sind. Das gleichmäßige Rauschen der Brandung sagt mir, dass der Atlantik ganz in unserer Nähe sein muss. Als ich mich frage, ob Aidan mich doch geradewegs auf irgendwelche Klippen zuführt, spüre ich unter meinen Füßen weiche Nadeln und merke, dass wir in ein Wäldchen hineingehen. Der Duft nach Kiefernharz hüllt mich ein und lässt mich genüsslich einatmen. In Bangkok hat es nach Abgasen und dem fauligen Wasser des Chao-Praya-Flusses direkt vor dem Hotel gerochen, hin und wieder auch nach exotischen Blumen im Hotelgarten, aber niemals so sauber und … wunderbar wie hier!
Wir kommen an mehreren Schatten im Nebel vorbei, die nach kleineren Häusern aussehen. Alle liegen dunkel und still da, niemand scheint in diesen Häuschen zu wohnen. Allerdings weiß ich, dass zur Cameron Lodge einige Cottages gehören, in denen Gäste unterkommen können – und diese Gäste sind ja noch nicht da. Das sogenannte »Soft Opening« beginnt erst kommende Woche: eine Art Übergangsphase, in der die völlig neu renovierte Lodge die ersten Gäste zu einem Probelauf empfangen wird, bevor es in etwas mehr als drei Wochen, wenn dann hoffentlich die gröbsten Fehler ausgemerzt werden konnten, richtig losgehen wird.
Ich merke, dass Feli hinter mir über eine Wurzel stolpert, und will mich ihr helfend zuwenden, aber sie schnaubt nur ungeduldig: »Schon okay, Mama! Ich kann allein laufen. Und zwar besser, als du fahren kannst.«
»Ha, ha«, gebe ich gekränkt zurück und frage mich einmal mehr, wo das süße Mädchen geblieben ist, das mir zum Muttertag selbst gemalte Karten mit vielen Herzen und »Mom I love you!«-Schwüren geschenkt hat.
Dass ich im nächsten Augenblick in den Mann vor mir hineinlaufe, hilft nicht wirklich, um Felis spitze Bemerkung zu entkräften.
Aidan dreht sich zu mir um, und ich stehe so dicht vor ihm, dass ich seinen warmen Atem auf meinem Gesicht spüre, als er mit unüberhörbarem Sarkasmus in der Stimme leise fragt: »Vielleicht doch mal zum Sehtest gehen?«
»Es ist hier so nebelig, dass nicht einmal ein Adler die Hand vor Augen sehen kann«, fauche ich gekränkt und versuche, das ironische Schnauben meiner Tochter auszublenden.
»Adler haben keine Hände«, erwidert Aidan trocken, bevor er sich abwendet und sagt: »Wir sind da. Hier ist euer Cottage.«
Langsam und mit reichlich Sicherheitsabstand folge ich ihm auf einen weiteren dunklen Kasten im Nebel zu, taste mich vorsichtig drei Stufen auf eine Veranda hinauf und bleibe stehen, während Aidan eine Tür öffnet und plötzlich Licht angeht – sowohl im Haus als auch draußen, wo eine Laterne an der Außenwand einen goldenen Schein in den Nebel wirft.
»Hereinspaziert«, murmelt er und hält die Tür auf. Beim Hineingehen wird mir klar, dass es sich genau genommen um zwei Türen handelt: eine äußere, die nur aus einem mit Mückennetz bespannten Rahmen zu bestehen scheint, und eine richtige Haustür.
Ich betrete das Cottage, stelle meinen kleinen Kabinenkoffer ab und sehe mich aufmerksam um: Im vorderen Teil des Raums kann man bis nach oben in den offenen Giebel hinaufsehen, wo sich mehrere Querbalken von einer Hüttenwand bis zur gegenüberliegenden erstrecken. In diesem Teil des Wohnraums befindet sich eine gemütliche Sofaecke mit einem Schaukelstuhl, der nahe dem offenen Kamin aus Natursteinen zum Lesen einlädt. Dort sehe ich mich schon sitzen, an nebeligen Tagen wie diesem, wenn ich nicht gerade im Hotelrestaurant bin. Der hintere Teil dieses großen Zimmers hat eine abgehängte Decke, darunter befindet sich die Essecke mit einem rustikalen Holztisch und passenden Stühlen. Man kann von dort in eine offene Küche gehen, wo ich Herd und Kühlschrank erkenne, außerdem ein Regalbrett entlang der Wand, auf dem sich viele bunte Tassen und Teller in der Gesellschaft anderer Küchenutensilien befinden. An der Seite der Küchenecke führt eine rustikale Holztreppe hinauf in das Loft unter dem Dachgiebel, und dort, über der abgehängten Decke im hinteren Teil des Cottages, befindet sich ein Schlafzimmer. Das weiß ich schon von Greta, denn sie hat hier in den letzten Monaten mit ihrem Schatz Duncan gewohnt. Oben steht ein rustikales Ehebett, was ich ebenfalls von den Fotos weiß, die meine Freundin mir geschickt hat, und man kann vom Bett aus durch ein Fenster bis zum Meer schauen – wenn es nicht gerade nebelig ist wie heute. Eigentlich wollten Greta und ihr Liebster auch nach der Geburt ihres Babys in diesem Cottage bleiben, und deshalb haben Duncan und Aidan mithilfe ihres Vaters, Graham Cameron, ein weiteres Zimmer an das Häuschen angebaut. Das ist das Praktische an Holzhäusern, hat mir Greta in einer Mail geschrieben: Man kann sie problemlos erweitern, wenn man möchte. Und so ist mir klar, dass die Tür, die von der Essecke aus abgeht, in Felis neues Zimmer führt. Das Zimmer, das eigentlich das Zimmer von Gretas und Duncans Baby werden sollte – bis sie sich vor wenigen Monaten doch entschieden haben, noch vor der Geburt in ein größeres Haus ganz in der Nähe umzuziehen. Zwar wohnt Duncan, der General Manager ist, nun nicht mehr auf dem Hotelgelände, aber das Haus liegt so nah an der Cameron Lodge, dass er mit dem Fahrrad in zehn Minuten hier sein kann.
»Das ist wirklich schön«, sage ich jetzt, mehr zu mir selbst als zu Aidan und Feli, und lasse mich mit einem Seufzen in den Schaukelstuhl sinken. Ich habe das Gefühl, an Ort und Stelle einschlafen zu können, wenn man mich ließe.
»Wo ist mein Zimmer?«, fragt Feli und klingt nicht einmal ansatzweise so angetan von unserem neuen Heim wie ich. Wirklich, viele der Hotelsuiten oder Angestelltenunterkünfte, in denen wir in den letzten Jahren gewohnt haben, waren nicht einmal halb so groß wie dieses Cottage! Außerdem – riecht sie nicht diesen wunderbaren Duft nach frischem Holz? Es ist das erste Mal, dass ich in einem Holzhaus wohne – okay, wenn man von dem Häuschen im Angestelltenbereich des Hotels auf Koh Samui mal absieht, aber da roch es eher nach dem ständig undichten Abwasserrohr als nach dem termitenzerfressenen Holz der Wände.
»Die Tür da vorn«, sage ich und deute in die Richtung der Essecke. Als ich Aidans überraschten Blick wahrnehme, erkläre ich: »Greta hat mir ein paar Fotos per E-Mail geschickt.«
»Ah. Ja.« Er nickt und schiebt die zwei Koffer weiter in den Raum hinein, bevor er seine Baseballmütze abnimmt und sich einmal über den Kopf fährt. Sein Haar ist pechschwarz und sehr kurz geschnitten, nur an den Schläfen schimmert eine Spur Grau. Aidan müsste sechsunddreißig sein, wenn ich mich recht erinnere.
»Greta wollte dich eigentlich unbedingt selbst von der Fähre abholen, aber … sie und Duncan haben im Moment alle Hände voll mit dem kleinen James zu tun«, sagt er dann, und für einen kurzen Augenblick schleicht sich ein fast zärtlicher Ausdruck auf sein Gesicht, der mich überrascht den Atem anhalten lässt. »Der Kleine hat die ganze letzte Nacht mal wieder durchgeschrien, weil er Koliken hatte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie Duncan das mit dem Soft Opening schaffen will.«
Er starrt zwei Sekunden lang ins Leere, dann scheint er sich einen Ruck zu geben und sieht mich an. »Ähm … Gretas Telefonnummer hast du bestimmt?«
Ich nicke rasch. »Ja, klar. Sie hatte mir heute schon getextet, dass sie es nicht zur Fähre schafft und mich morgen treffen will. Ich werde mich gleich bei ihr melden.«
»Gut.« Aidan nickt und wendet sich ab. »Na dann, kommt erst einmal an. Im Kühlschrank sind übrigens die nötigsten Lebensmittel für den Anfang – Greta hat mich beauftragt, euch ein paar Dinge zu besorgen.«
»Oh, das ist nett, vielen Dank«, sage ich überrascht. Dass Aidan für uns einkaufen würde, hätte ich nicht gedacht.
»Kein Problem. Wie gesagt, es ist nur das Nötigste. Der Inselladen hat zwar noch geöffnet, aber …« Er wirft einen Blick aus dem Fenster und bemerkt dann trocken in meine Richtung: »… an deiner Stelle würde ich das Auto heute nicht mehr vom Fleck bewegen.«
»Hatte ich nicht vor«, erwidere ich mit einem Augenrollen.
»Sehr gut. Ich hoffe also, dich morgen heil im Restaurant begrüßen zu können.« Aidan wendet sich ab und greift nach dem Türknauf, aber ich frage schnell: »Warte mal … morgen schon?«
Erstaunt sieht er mich an. Seine Augenbrauen wandern leicht in die Höhe. »Hattest du vor, erst einmal Urlaub zu machen?«
Irritiert schlucke ich. »Nein, das nicht. Aber … ein freier Tag, um erst einmal anzukommen, einzukaufen, die Insel zu erkunden und so weiter … das wäre wirklich nett.«
Aidan holt tief Luft. Ich sehe ihm an, dass auch er müde ist. Dass sein Tag ebenfalls lang war. Aber mein Mitleid hält sich gerade wirklich in Grenzen. »Ich hatte schon vor einigen Wochen mit dir gerechnet, Stella Minetti. Duncan wollte dich doch eigentlich zu Mitte Juni einstellen, sobald die Schule für Feli vorbei war. Dann hätten wir genügend Zeit gehabt, um alles vorzubereiten. Jetzt ist schon Mitte Juli, und das Soft Opening beginnt in ein paar Tagen, verdammt!«
Er ist ein wenig lauter geworden, und ich merke ihm die Anspannung mehr als deutlich an. Ich verstehe durchaus, was für einen Stress es bedeutet, ein Hotel und ein Restaurant ganz neu zu eröffnen. Da liegen die Nerven immer blank. Aber, porca miseria, ich hatte wirklich gute Gründe, warum ich nicht früher kommen konnte!
»Ich weiß das«, sage ich daher ruhig. »Und ich wäre gern schon Mitte Juni gekommen. Aber … es ist etwas Dringendes dazwischengekommen.«
»Ja, das hat Greta schon gesagt«, grollt Aidan und wendet sich wieder der Tür zu.
»Was … was hat sie genau gesagt?«, hake ich schnell nach, und mir schlägt das Herz bis zum Hals. Ich hatte meine Freundin eindringlich gebeten, nicht zu erzählen, was in Bangkok passiert ist und warum wir Mitte Juni noch nicht kommen konnten!
»Nur, dass etwas Privates dazwischengekommen ist und ihr erst vier Wochen später kommen könnt«, brummt Aidan und wirft mir einen flüchtigen Blick zu. »Es geht mich auch nichts an, was los war. Aber jetzt bist du endlich hier, Stella, und es gibt noch unfassbar viel im Restaurant zu organisieren. Darum sehe ich dich morgen um 10 Uhr zu einer ersten Besprechung drüben im Hotel.«
Das ist keine Frage, das ist ein Befehl. Und während mir noch die spitze Bemerkung auf den Lippen liegt, dass er nicht mein Chef ist, öffnet Aidan energisch die Haustür. Bevor er sie hinter sich schließt, reckt er noch einmal kurz seinen Kopf ins Zimmer und sagt: »Falls ihr Hilfe braucht: Ich wohne zwei Cottages weiter.«
Diese Vorstellung hört sich für mich gerade nicht so beruhigend an, wie sie vermutlich klingen soll.
4
Die Morgensonne weckt mich und lässt mich irritiert blinzeln. Wo bin ich? Ein paar verschlafene Sekunden lang starre ich ratlos an die Dachschräge über meinem Kopf, die aus breiten Holzbrettern besteht.
Holz. Richtig.
Mit einem Schlag bin ich hellwach. Ich bin in Kanada! Auf einer kleinen Insel im Nordatlantik, um genau zu sein. Und ich habe in diesem breiten, ebenfalls aus Holz gezimmerten Ehebett im Loft unseres neuen Heims sehr gut geschlafen. Allerdings hätte ich heute Nacht vermutlich überall gut geschlafen – die Anstrengung der langen Reise hat mich gestern Abend fast ohnmächtig auf die Matratze sinken lassen. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist der beruhigend gleichmäßige Klang des Nebelhorns, der mich wie ein Schlaflied ins Reich der Träume befördert hat.
Das gleichmäßige Heulen ist heute Morgen nicht mehr zu hören, fällt mir jetzt auf – und, richtig, der Sonnenschein, der mich geweckt hat, erklärt auch warum: Es ist nicht länger nebelig!
Neugierig setze ich mich auf und starre geradeaus, über das Fußende des Betts hinweg, direkt hinaus auf den tiefblauen Atlantik, der zwischen einigen Kiefern und Ahornbäumen hindurchschimmert. Ich habe gestern Abend keinen Gedanken mehr an die schweren Vorhänge verschwendet, die ich vor dem bodentiefen Fenster in der Längsseite des Dachgiebels hätte zuziehen können – und so fällt das Licht dieses jungen Morgens nun strahlend hell zu mir hinein und lässt mich begeistert blinzeln. Mein Gott, ist das ein schöner Ausblick! Jetzt verstehe ich, warum Greta eigentlich gar nicht aus diesem Cottage ausziehen wollte, bevor der kleine James geboren wurde. Sie hätte hier als frisch gebackene Mutter gern noch ein wenig gewohnt, hat sie mir geschrieben, aber dann ist ein Haus in der Nähe zum Verkauf angeboten worden, das mehr Platz geboten hat, und Duncan wollte unbedingt diese Chance ergreifen und hat das Haus für seine kleine Familie erstanden. Ich vermute, er wollte auch einfach mehr Privatsphäre für seine Lieben und sich haben. Das kann ich sehr gut verstehen, nach so vielen Jahren in diversen Hotels. Fast überall habe ich bei meinen bisherigen Jobs auf dem jeweiligen Hotelgelände gewohnt. Immer umgeben von Kolleginnen und Kollegen und, weitaus schlimmer, auch von Gästen. Selten kann man wirklich abschalten, selbst an seinen freien Tagen nicht, weil der Job immer in Reichweite ist. Darum war ich anfangs ebenfalls nicht wirklich begeistert, als ich von dem Cottage auf dem Hotelgelände der Cameron Lodge gehört habe, in dem Feli und ich unterkommen sollten. Doch Greta hat mir in ihrer E-Mail erklärt, dass die Auswahl an freien Häusern auf Whale Island nicht groß und das Cottage wirklich zauberhaft sei und ich genügend Privatsphäre haben würde. Und, ja, beim Blick aus meinem Bett hier oben muss ich sagen: Greta hatte recht.
Während ich meinen Blick über die malerische Landschaft jenseits meines Dachfensters schweifen lasse, muss ich über Felis und meine Stationen in den letzten dreizehn Jahren nachdenken. In den ersten drei Lebensjahren meiner Tochter haben wir bei meinen Eltern in meinem ehemaligen Kinderzimmer gewohnt. Als meine Kleine gerade zwei Jahre alt war, konnte ich endlich einen Platz bei einer Tagesmutter ergattern und habe wieder angefangen, halbtags zu arbeiten – als Zimmermädchen in einem verschlafenen Hotel in Offenburg. Zwar haben meine Eltern mir versichert, dass sie mich voll und ganz unterstützen würden und ich deshalb noch bei Feli zu Hause bleiben könnte, aber ich wollte finanziell unbedingt auf eigenen Füßen stehen. Es wurmte mich schon genug, dass ich plötzlich die junge, alleinstehende Mutter war, die wieder in ihrem alten Kinderzimmer wohnte. Arbeitslos würde ich nicht auch noch länger als unbedingt nötig sein, das hatte ich mir geschworen! Als ich dann, kurz nach Felis drittem Geburtstag, eine Stellenanzeige des JW-Marriott-Hotels in Kuala Lumpur gesehen habe, dachte ich: Jetzt oder nie. Ich war damals wild entschlossen, meinen Traum, die weite Welt zu sehen, zu verwirklichen – auch als Alleinerziehende. Enzo Cappanelli würde mir diesen Traum nicht zerstören! In Baden-Württemberg hatte ich schließlich nie bleiben wollen.
Italien, das war nach der Ausbildung als erster Schritt gedacht gewesen – mit Heimvorteil, immerhin kommt mein Vater aus Rom. Er ist Mitte der Siebzigerjahre als Bauingenieur nach Deutschland gezogen, hat sich in meine Mutter verliebt und ist in meinem Heimatort hängen geblieben. Ich bin zweisprachig aufgewachsen: Papa hat darauf bestanden, dass ich seine Muttersprache lerne, unter anderem damit ich mich mit seinen Eltern in Rom unterhalten konnte, wenn wir nonna und nonno in ihrer wunderschönen Dachwohnung mit Blick auf den Petersdom besuchten.
Ja, deshalb war es nicht verwunderlich, dass mich meine erste Stelle im Hotelbusiness nach Italien gezogen hatte, nach Capri. Und es war genauso wenig verwunderlich, dass ich Enzos Charme erlag, denn südländische Männer haben es mir schon immer besonders angetan. Nachdem sich Enzo dann allerdings als so egozentrisches Arschloch herausgestellt hatte, habe ich mir geschworen, die Finger von zu gut aussehenden dunkelhaarigen Männern zu lassen.
Und so kam es also, dass ich, fünf Jahre, nachdem ich voller Elan meine erste Stelle auf Capri angetreten hatte, unsere sieben Sachen und Klein-Feli packte und nach Kuala Lumpur zog. Meine Eltern waren natürlich nicht angetan davon. Sie wollten ihre Enkelin gern weiterhin bei sich in der Nähe haben – oder zumindest wieder irgendwo in Italien, wo sie uns leicht hätten besuchen können. Ich aber wollte die Welt sehen, nicht nur Italien – deshalb war ich ja Hotelfachfrau geworden: um überall auf diesem Globus arbeiten zu können!
Die Stelle in Kuala Lumpur war allerdings lediglich möglich, weil ich mir dort, in Malaysia, eine Nanny für Feli leisten konnte. Die gute Nunu holte meine Kleine nachmittags aus ihrem englischsprachigen Kindergarten ab und betreute sie in unserem winzigen Angestelltenapartment der weitläufigen Hotelanlage, während ich im Restaurant tätig war. Da ich oft sogar abends und am Wochenende arbeiten musste, hätte ich es ohne Nunu niemals geschafft. Auch mein nächster Job ging nur mit Nanny, diesmal war es Khun Lek, die Feli während unserer Zeit auf Koh Samui nach der Schule betreute. Ich hatte auf der Insel im Golf von Thailand meine erste Stelle als Food & Beverage Manager ergattern können, in einem 5-Sterne-Hotel einer thailändischen Hotelkette. Von Thailand aus gingen wir für zwei Jahre nach Abu Dhabi, als Feli bereits zehn war und zum Glück nach der Schule keine Betreuung mehr brauchte. Und dann bekam ich noch einmal ein spannendes Jobangebot aus Thailand, vom Anantara Riverside Hotel in Bangkok, der anstrengenden Mega-City mit schwülheißem Klima. Und mit unschönen Erinnerungen an die Internationale Schule, die Feli besucht hat.
Ich hätte Nein zu dem Job sagen sollen. Dann wäre alles anders gekommen.
Aber gut, die Vergangenheit lässt sich leider nicht ändern. Dafür habe ich Ja zu diesem Job auf Whale Island gesagt – und heute Morgen, so ganz ohne Nebel, habe ich das Gefühl, dass diese Entscheidung absolut richtig war! Ich rücke näher ans Fußende und schaue mir die Landschaft draußen genauer an, betrachte neugierig die Bäume und Sträucher, die Klippen, die zum Meer abfallen. Sehe nach links, wo der Weg zwischen den Bäumen verschwindet und wohl Richtung Hotel führt, wenn mich mein Orientierungssinn nicht verlassen hat. Dann sehe ich nach rechts und betrachte das Cottage, das einige Meter entfernt liegt. Ob da jemand wohnt? Aidan hatte erwähnt, dass er zwei Häuser weiter lebt. Also nicht direkt neben mir. Zum Glück! Ich lehne mich vor, presse mein Gesicht an die Scheibe und schiele angestrengt an meinem Nachbarcottage vorbei – denn da der Weg eine Kurve macht, kann ich durch ein paar Sträucher und Kiefernstämme hindurch tatsächlich eine Ecke der Veranda des Hauses dahinter erkennen. Und dort habe ich gerade eine Bewegung wahrgenommen. Etwas, das hin und herschwingt. Oh – ein Sandsack. Jemand scheint darauf einzuhauen. Zwar kann ich nicht erkennen, wer das ist, aber denken kann ich es mir schon.
Fasziniert verfolge ich die Bewegungen des Sandsacks, bis dieser nicht länger von Schlägen getroffen wird und langsam ausschwingt. Dafür tritt jetzt ein Mann in mein Blickfeld. Aidan. Mit nacktem Oberkörper und nur in Shorts. Atemlos starre ich seine Brust und seinen flachen Bauch an. Die sehnigen Arme und breiten Schultern. Er streift sich gerade seine Boxerhandschuhe von den Händen und greift dann nach einer Wasserflasche. Während er in langen Zügen trinkt, geht er die Stufen seiner Verandatreppe hinab und nähert sich somit ein wenig mehr meinem Cottage. Auf einer sonnenbeschienenen Stelle des Teppichs aus Kiefernnadeln bleibt er stehen, reckt seine Arme über den Kopf und streckt sich, immer noch die Wasserflasche in einer Hand. Ich komme mir vor wie ein Spanner, als ich ihn so beobachte, mit weit aufgerissenen Augen an meiner Fensterscheibe klebend, wo das Glas auf Höhe meiner Lippen langsam beschlägt.
Und im nächsten Moment komme ich mir mal wieder vor wie der größte Idiot aller Zeiten, als sich Aidan plötzlich umdreht und durch die Baumstämme hindurch direkt zu meinem Dachfenster hinaufspäht, ganz so, als ob er genau gemerkt hätte, dass er beobachtet wird. Erschrocken weiche ich von der Scheibe zurück, in der verzweifelten Hoffnung, dass er mich aus der Entfernung nicht erkannt hat.
Verdammt, Stella, musste das sein? Mit einem unterdrückten Stöhnen rutsche ich möglichst weit vom Fenster fort und stehe erst auf, als ich sicher bin, dass Aidan mich von unten nicht länger sehen kann. Prompt stoße ich mir den Kopf an der Dachschräge an. Ächzend reibe ich mir den Hinterkopf. Wirklich fantastisch, wie reibungslos mein erster Tag im neuen Job beginnt! Aber es kann ja hoffentlich nur besser werden.
Habe ich das wirklich gedacht? Dass es besser wird? Mit einer Teenager-Tochter, die sich hartnäckig weigert aufzustehen – selbst dann, als ich ihr vom herrlichen Wetter draußen vorschwärme?
»Ist mir egal, ob nun Nebel oder Sonne! Ich bleibe im Bett!«, kommt ihre Stimme dumpf unter dem Deckenberg hervor.
»Feli, ich möchte, dass wir zusammen frühstücken. Und dann gehen wir gemeinsam in die Lodge rüber, damit du alle kennenlernen kannst.«
»Nein! Das ist DEIN Job, Mama! Ich will die Leute gar nicht kennenlernen!«
»Aber ich möchte, dass die Leute meine zauberhafte Tochter kennenlernen.«
»Ich bin nicht zauberhaft!«
»Doch. In letzter Zeit merkt man das nur nicht wirklich. Komm schon, ich mache uns Spiegeleier.«
Aber nicht einmal die Aussicht auf Spiegeleier, sonst Felis absolutes Lieblingsfrühstück, lassen mein pubertierendes Streitmonster kampflos aufstehen. Mein Mund fühlt sich trocken an vom vielen Diskutieren, das irgendwann unweigerlich in Schimpfen übergegangen ist, als wir gefühlte Stunden später unser Cottage verlassen. Vor lauter Anstrengung, meine Tochter davon zu überzeugen, etwas zu essen und sich anzuziehen, habe ich nur noch die Kraft für ein sehr rudimentäres Make-up gefunden und mein unordentliches Haar beim Verlassen des Hauses kurzerhand blitzschnell am Hinterkopf zu einem Messy Bun gebunden – wobei meine wilden Locken sowieso immer nach Messy Bun aussehen, ob ich nun viel Arbeit in die Frisur investiere oder nicht. Prüfend zupfe ich an meiner weißen Bluse herum, die ich zu Blue Jeans trage, stelle fest, dass ich ein wenig Eidotter neben dem zweitobersten Knopf habe und verreibe leise fluchend Spucke auf dem Stoff. War ja klar, dass ich gleich an meinem ersten Arbeitstag bekleckert auftauche! Am besten lasse ich den Knopf einfach offen, dann klappt der Kragen so zur Seite, dass man den Fleck nicht sieht. Ja, das ist die beste Lösung, denn zum Umziehen habe ich keine Zeit mehr, es ist schon kurz vor zehn, und ich werde Aidan nicht das Vergnügen bereiten, dass er mir einen Vortrag über Pünktlichkeit halten kann!
»Mama, das ist voll peinlich wie du aussiehst! Man sieht die Rille zwischen deinen du-weißt-schon-was!«
Erstaunt sehe ich Feli an. »Sag nur, du sprichst wieder mit mir. Guten Morgen, cara mia. Und das hier …« Ich lege demonstrativ beide Hände um meine von der Natur recht üppig ausgestattete Oberweite »… das sind Brüste. Das Wort kann man aussprechen, Feli, dabei fällt einem nicht die Zunge ab. Und deine wachsen auch noch, warte ab.«
»Mama!«
»Was denn?« Ich grinse sie an und lasse meine Brüste herausfordernd auf und ab wippen. »Eine Frau zu sein ist nicht peinlich, Feli, lass dir das niemals einreden.«
»Aber du bist peinlich. So was von!« Meine Tochter sieht mich mit hochrotem Gesicht an, dann starrt sie betreten an mir vorbei, und mein Herz setzt vor Schreck einen Schlag aus.
Nein. Bitte nicht.
Langsam drehe ich mich in die Richtung des Waldweges jenseits unserer kleinen Veranda um, und, natürlich, nur wenige Schritte von unserem Cottage entfernt steht Aidan und weiß offensichtlich nicht, wohin er schauen soll. Allerdings merke ich genau, dass es ihm nicht gelingt, NICHT