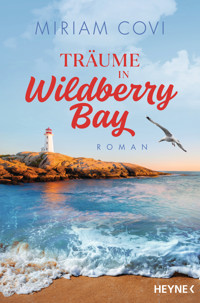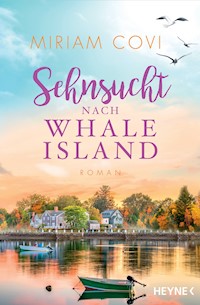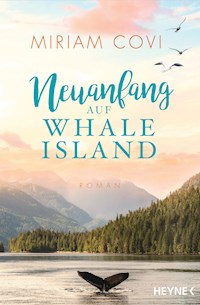Whale Island Band 1-3: Heimkehr nach Whale Island / Neuanfang auf Whale Island / Sehnsucht nach Whale Island (3in1-Bundle) E-Book
Miriam Covi
23,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der Frauen, drei Brüder, eine sturmumtoste Insel und die ganz große Liebe.
Die große Sehnsuchtsreihe von SPIEGEL-Bestsellerautorin Miriam Covi – Die komplette Trilogie in einem E-Book!
Band 1: Heimkehr nach Whale Island
Greta Lorenz soll ihren Chef, den attraktiven aber unnahbaren Hotelmanager Duncan Sommerset, auf eine Geschäftsreise nach Kanada begleiten. Auf Whale Island, wo die Brandung an die schroffe Küste donnert und Buckelwale ihre Kreise ziehen, betreibt seine Familie ein kleines Hotel. Als Greta für Duncans Ehefrau gehalten wird, und er sie bittet, das Spiel mitzuspielen, bekommt die Reise eine ganz neue Wendung. Umgeben von herzlichen Menschen und atemberaubender Natur wird die wilde kleine Insel für Greta schnell zu dem Zuhause, nach dem sie sich schon ihr Leben lang gesehnt hat. Längst sind ihre Gefühle für Duncan echt. Doch empfindet er auch so für sie? Und warum hat er die Insel vor Jahren so überstürzt verlassen?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Band 2: Neuanfang auf Whale Island
Restaurantmanagerin Stella Minetti hofft auf einen gelungenen Neustart in der Cameron Lodge auf Whale Island. Doch von einer entspannten Atmosphäre ist in dem charmanten Inselhotel zunächst wenig zu spüren, denn die temperamentvolle Halbitalienerin gerät immer wieder mit dem ebenso hitzigen Chefkoch Aidan Cameron aneinander. Dass sie sich trotz allem zu ihm hingezogen fühlt, macht alles noch viel komplizierter. Dann taucht plötzlich der attraktive Sänger Jackson Porter auf und macht Stellas Gefühlschaos perfekt. Doch warum sucht er hier auf der abgeschiedenen Insel Zuflucht? Und wie wird sich Stellas Herz entscheiden?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Band 3: Sehnsucht nach Whale Island
Bloggerin Viola lebt jeden Tag als könnte es ihr letzter sein – schließlich hat in ihrer Familie noch keine Frau ihren 35. Geburtstag gefeiert. Während einer Rucksacktour durch Kanada hat sie einen Unfall. Doch als sie im Krankenhaus erwacht, ist sie tatsächlich 35 und die Zukunft liegt plötzlich vor ihr. Krankenschwester Skye Cameron lädt sie ein, sich bei ihr auf Whale Island zu erholen. Auf der kleinen Insel inmitten des tosenden Atlantiks fühlt sich Viola so wohl wie noch nie zuvor. Liegt das nur an der faszinierenden Natur? Oder auch an Skyes jüngstem Bruder Glenn, dem schüchternen, aber attraktiven Schriftsteller? Viola ahnt nicht, dass sie mehr mit Whale Island verbindet, als sie sich je hätte vorstellen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2002
Sammlungen
Ähnliche
DIEREIHE
Vor der Küste der kanadischen Provinz Nova Scotia liegt eine Insel, die das Schicksal der Familie Cameron bestimmt: Whale Island. Wirklich loskommen kann keiner der drei Cameron-Söhne von der wilden Schönheit im Nordatlantik – und als der Zufall Greta, Stella und Viola dorthin führt, ist nichts mehr so, wie es vorher war …
Die große Sehnsuchtsreihe von SPIEGEL-Bestsellerautorin Miriam Covi in einem Band
DIEAUTORIN
Miriam Covi wurde 1979 in Gütersloh geboren und entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für zwei Dinge: Schreiben und Reisen. Ihre Tätigkeit als Fremdsprachenassistentin führte sie 2005 nach New York. Von den USA aus ging es für die Autorin und ihren Mann zunächst nach Berlin und Rom, wo ihre beiden Töchter geboren wurden. Nach vier Jahren in Bangkok lebt die Familie nun in Brandenburg. Zur zweiten Heimat wurde für Miriam Covi allerdings die kanadische Ostküstenprovinz Nova Scotia, in der sie viele Sommer ihrer Kindheit und Jugend verbringen durfte und wo sie heute auch immer wieder Inspiration für neue Romane findet.
MIRIAMCOVI
Whale Island
Heimkehr nach Whale Island
Neuanfang auf Whale Island
Sehnsucht nach Whale Island
Die komplette Trilogie
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Trotz intensiver Recherche konnte der Verlag nicht alle Rechtegeber ermitteln. Bitte wenden Sie sich gegebenenfalls an den Wilhelm Heyne Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Die Originalausgaben erschienen 2022
Copyright © 2022 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright dieser Ausgabe © 2023 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Diana Mantel
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, nach einer Vorlage von
UNO Werbeagentur, München,
unter Verwendung von HUBERIMAGES (Susanne Kremer),
Plainpicture (Design Pics/Robert Postma), FinePic®, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-30989-3V001
www.heyne.de
DASBUCH
Greta Lorenz soll ihren Chef, den attraktiven aber unnahbaren Hotelmanager Duncan Sommerset, auf eine Geschäftsreise nach Kanada begleiten. Auf Whale Island, wo die Brandung an die schroffe Küste donnert und Buckelwale ihre Kreise ziehen, betreibt seine Familie ein kleines Hotel. Als Greta für Duncans Ehefrau gehalten wird, und er sie bittet, das Spiel mitzuspielen, bekommt die Reise eine ganz neue Wendung. Umgeben von herzlichen Menschen und atemberaubender Natur wird die wilde kleine Insel für Greta schnell zu dem Zuhause, nach dem sie sich schon ihr Leben lang gesehnt hat. Längst sind ihre Gefühle für Duncan echt. Doch empfindet er auch so für sie? Und warum hat er die Insel vor Jahren so überstürzt verlassen?
DIEAUTORIN
Miriam Covi wurde 1979 in Gütersloh geboren und entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für zwei Dinge: Schreiben und Reisen. Ihre Tätigkeit als Fremdsprachenassistentin führte sie 2005 nach New York. Von den USA aus ging es für die Autorin und ihren Mann zunächst nach Berlin und Rom, wo ihre beiden Töchter geboren wurden. Nach vier Jahren in Bangkok lebt die Familie nun in Brandenburg. Zur zweiten Heimat wurde für Miriam Covi allerdings die kanadische Ostküstenprovinz Nova Scotia, in der sie viele Sommer ihrer Kindheit und Jugend verbringen durfte und wo sie heute auch immer wieder Inspiration für neue Romane findet.
MIRIAMCOVI
HEIMKEHR NACH WHALE ISLAND
Teil 1 der Whale-Island-Reihe
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
The ache for home is in all of us.The safe place where we can goas we are and not be questioned.
Maya Angelou, All God’s Children Need Traveling Shoes
Für Virginia, in Erinnerung an New York
1
Die Hitze dieses Augusttages hängt schon am frühen Morgen wie eine Glocke über New York City, als ich durch den Central Park gehe. Die Hochhäuser, die Manhattans grüne Oase säumen, scheinen wie würdevolle Herrschaften hinabzublicken, auf all die Jogger, die Dog Walker und auf die New Yorker, die zur Arbeit eilen. So wie ich. Für diesen Spaziergang verlasse ich den Bus jeden Morgen schon am Columbus Circle, um durch den Central Park bis zur 5th Avenue zu laufen. So gut es mir inzwischen auch in Manhattan gefällt, ich brauche diese Mini-Auszeit mit Vogelgezwitscher und dem Duft nach frisch gemähtem Gras, sodass ich mich vorübergehend gar nicht mehr wie mitten in einer Millionen-Metropole fühle.
Doch das Grün lichtet sich viel zu bald, lässt die Hochhausschluchten vor mir auftauchen. Am Kaffeewagen kurz hinter dem Parkausgang hole ich mir meinen üblichen Cappuccino. Mit dem Pappbecher in der Hand beschleunige ich meinen Schritt, um mich dem normalen Tempo der zur Arbeit Eilenden um mich herum anzupassen. New Yorker gehen niemals langsam. Alles in dieser Stadt scheint unter Strom zu stehen, zu vibrieren, einen mitzureißen. Die Touristen, die hier und da viel zu langsam gehen, die Köpfe in den Nacken gelegt, um an den Hochhausfassaden emporschauen zu können, sie fallen auf in diesem Meer aus zügig eilenden Anzugträgern. Auch ich, in meinem dunkelblauen Kostüm, marschiere nun schnellen Schritts die 62. Straße hinauf. Da ich mich schuhtechnisch längst an die New Yorkerinnen angepasst habe, trage ich zum Business-Kostüm natürlich praktische Sneakers, die ich im Hotel gegen Pumps tauschen werde.
Der rote Baldachin vor dem Eingang des Sommerset Boutique Hotels schimmert mir bereits entgegen, und ich erkenne in der Ferne Lennox, einen unserer Bellboys, der gerade Koffer aus einer schwarzen Limousine wuchtet und auf den golden glänzenden Gepäckwagen lädt. Eiligen Schritts überhole ich ein kleines Grüppchen Touristen, offensichtlich eine Familie mit zwei Teenagern. Im Vorbeigehen schnappe ich ein paar französische Worte auf, und als ich den Vater flüchtig von der Seite betrachte, erinnert mich sein dunkles Haar, das ihm lässig in die Stirn fällt, einen wehmütigen Herzschlag lang an Olivier.
Dieser fremde Franzose lenkt mich ein paar Schritte lang so sehr ab, dass ich vergesse, rechtzeitig die Straßenseite zu wechseln. Noch bin ich damit beschäftigt, das Gesicht von Olivier zu verdrängen, das beharrlich in meiner Erinnerung auftauchen will, als ich plötzlich aus dem Augenwinkel eine Wiege mit weiß gerüschtem Betthimmel sehe. Entsetzt wende ich mich ab. Ein schwarzhaariger Franzose UND ein Babybett auf wenigen Metern, das ist zu viel am frühen Morgen. Es hat schon seinen Grund, warum ich sonst immer penibel darauf achte, vor dem Geschäft mit den entzückenden pastellfarbenen Strampelanzügen im Schaufenster rechtzeitig auf die andere Straßenseite zu wechseln!
Rasch vergewissere ich mich, dass kein gelbes Taxi angeschossen kommt, und überquere dann hastig die Straße. Schweiß rinnt meinen Rücken hinab, die Hitze hängt schon um diese frühe Uhrzeit drückend zwischen den Hochhausschluchten. Ich wünsche mich wirklich zurück in den Central Park!
Erst recht, als ich das Quietschen von Fahrradbremsen höre, gefolgt von einem aufgebrachten »Hey, sind Sie blind?«.
Erschrocken sehe ich auf, als dicht vor mir ein Fahrradfahrer mit einem Schlingern zum Stehen kommt und mich fassungslos anstarrt. Sprachlos starre ich zurück – in die hellgrauen Augen meines Chefs, die normalerweise immer ziemlich kühl wirken. In diesem Augenblick allerdings funkeln Duncan Sommersets Augen so aufgebracht, dass ich automatisch einen halben Schritt zurückweiche, bis mich das Hupen eines vorbeibrausenden Taxis schockstarr auf dem Fleck verharren lässt.
Ich möchte wirklich zurück in den Central Park.
»Ach, Sie sind das«, höre ich den Eisblock jetzt grollen. Ja, Eisblock. So nennen meine Kollegin Bridget und ich ihn heimlich, denn dieser Mann verströmt tatsächlich so viel Wärme wie die Arktis. Seine grauen Augen sind schmaler geworden, während er mich von oben bis unten mustert, was mich innerlich um mindestens einen Zentimeter schrumpfen lässt. Ich hatte schon jede Menge schwierige Vorgesetzte, immerhin habe ich bereits in Hotels in vier Ländern gearbeitet. Eigentlich dachte ich, dass mich niemand mehr so leicht aus der Fassung bringen kann.
Aber da kannte ich Duncan Sommerset noch nicht. Es reicht nicht, dass er die Kühle eines Eisschranks ausstrahlt, nein, noch dazu muss er leider verdammt gut aussehen. Auch jetzt, als er dicht vor mir steht, mit einem Fuß auf der Bordsteinkante, halb auf dem Sattel seines Mountainbikes, wirkt er so sexy, wie ein Chef einfach nicht wirken sollte. Besonders ein Chef, der verheiratet ist – und zwar zu allem Überfluss mit der Tochter des Gründers und CEOs der Sommerset-Boutique-Hotel-Gruppe. Da kann sein Haar noch so pechschwarz in der Morgensonne schimmern (wenn auch leider zurückgegelt, wie immer, da er sonst vermutlich Locken hätte, die er wohl zu unterdrücken versucht – das zumindest sagt mir die vorwitzige Strähne, die sich im Fahrtwind aus der strengen Gelfrisur gelöst hat und sich frech in die Höhe kringelt). Und sein maßgeschneiderter Anzug kann noch so verdammt gut sitzen, der oberste Hemdknopf offen sein, weil er die Krawatte erst im Büro anlegt …
»Hallo, Ms. Lorenz?« Als er meinen Namen sagt, zucke ich erschrocken zusammen. Obwohl ich seit knapp sechs Monaten an der Rezeption des Hotels, dessen General Manager er ist, arbeite, hat er mich bisher nicht ein einziges Mal mit meinem Namen angesprochen. Oder überhaupt angesprochen.
Mir wird klar, dass ich ihn einfach nur stumm angestarrt habe, zu keiner Reaktion fähig. Ganz schön bescheuert für eine Vierunddreißigjährige, ich weiß. Bescheuert – und absolut unprofessionell, für seinen Chef zu schwärmen! Gerade ich, die ich in meinem ganzen bisherigen Berufsleben immer hundertprozentig professionell war!
»Ms. Lorenz?« Ich könnte schwören, dass der Eisblock eine winzige Spur besorgt klingt. Rasch rücke ich von ihm und seinem Mountainbike ab und mache einen Schritt auf die Sicherheit des Bordsteins zu, um nicht doch noch von einem Taxi überfahren zu werden.
»Entschuldigen Sie bitte, ich habe Sie nicht kommen sehen!«, stoße ich eilig hervor, ohne ihn noch einmal anzuschauen.
»Wenn Sie weiterhin so blind durch Manhattan laufen, werden Sie wirklich noch überfahren!«, höre ich den Eisblock hinter mir fast ungläubig sagen, während ich mich mit einem letzten schnellen »Tut mir leid!« abwende und auf das Hotel zueile.
Ich merke, wie er mich auf seinem Rad überholt und könnte schwören, dass er mich von der Seite betrachtet, aber ich halte meinen Blick konzentriert auf Lennox in seiner roten Uniform gerichtet. Als Duncan Sommerset kurz vor meinem Kollegen nach rechts schwenkt und in die Einfahrt des Hotels biegt, um wenige Meter weiter in die Tiefgarage hinabzurollen, nickt Lennox ihm höflich zu und tippt sich an die rote Kappe seiner Bellboy-Uniform. Doch sobald der Chef außer Sichtweite ist, grinst er mir breit entgegen und fragt mit einem amüsierten Lachen: »Hattest du etwa gerade eine Kollision mit einem Eisberg?«
»Hör bloß auf«, stöhne ich und reibe mir über die Stirn, als könnte ich die unangenehme Erinnerung wegwischen. »So was Peinliches!«
»Ach, komm, es ist doch gar nichts passiert«, meint Lennox und knufft mich freundschaftlich gegen meinen Oberarm. Er ist fast zwei Meter groß, und wenn er lacht, entblößt er die weißesten Zähne, die ich je gesehen habe. Eigentlich wollte Lennox Profi-Basketballer werden, aber den Traum musste er nach einer Knieverletzung an den Nagel hängen, und nun ist er hier. Und er macht seinen Job fantastisch. Lennox ist, außer Bridget, mein Lieblingskollege im Hotel. Jetzt funkeln mich seine dunklen Augen vergnügt an, und er raunt mir zu: »Du findest ihn doch bestimmt heiß, oder nicht?«
»Wen?«, frage ich erschrocken, und Lennox lacht schallend auf.
»Ach komm, tu nicht so unschuldig. Alle weiblichen Angestellten finden ihn heiß!«
»Und woher weißt du das?«
»Weil sie sich alle mir anvertrauen«, meint er mit einem schelmischen Lächeln und zwinkert mir zu.
»Ja, klar«, erwidere ich und grinse amüsiert, bevor ich an der Seite des Hotels entlangeile, zum Mitarbeitereingang.
Ich habe die Umkleidekabine der Frauen, wo ich meine Tasche in den Spind gestellt und meine Sneakers gegen Pumps getauscht habe, gerade verlassen, als Bridget mit großen Augen auf mich zukommt. Ihre runden Wangen sind rosig gefärbt, sie fächelt sich vor Aufregung mit einer Hand Luft zu.
»Guten Morgen! Was ist denn mit dir los?«, frage ich erstaunt.
»Greta! Du sollst zum Chef kommen!«, haucht sie.
Entgeistert starre ich sie an. Warum um alles in der Welt will mich der Eisblock denn plötzlich sprechen? Hat er festgestellt, dass er sich bei unserem Beinahe-Zusammenstoß verletzt hat und will mir mitteilen, dass er mich nach guter amerikanischer Art auf Schadensersatz verklagt? Werde ich gefeuert, weil ich ihn fast vom Mountainbike geholt hätte? Oder … habe ich bei der Arbeit etwa irgendeinen Fehler gemacht? Aber ich kann mich an keinen bedeutungsschweren Fehler erinnern, der mir passiert wäre, seit ich vor sechs Monaten hier angefangen habe! Okay, in meiner dritten oder vierten Woche habe ich einem Gast eine falsche Auskunft gegeben, weil ich die Richtungen verwechselt habe, als ich ihm den Weg zum Kaufhaus Bergdorf Goodman erklären wollte, aber der ältere japanische Tourist hat es mit Humor genommen. Er war mir sogar regelrecht dankbar, als er von seiner Odyssee zurückkam, weil er dadurch zwischen Park Avenue und Lexington Avenue einen fantastischen französischen Bäcker entdeckt hätte, meinte er. Das war aber auch der einzige größere Fauxpas, an den ich mich erinnern kann. Ich mache selten Fehler, dafür bin ich viel zu perfektionistisch. Wenn ich etwas nicht kann oder verstehe, dann vertiefe ich mich solange darin, bis ich es beherrsche. So war es schon in meiner Kindheit, als ich es beim Ballett zu Beginn nicht geschafft habe, bei den Stretch-Übungen an der Stange mit der Nase mein Knie zu berühren, wie die anderen Ballerinas. Ich habe geübt und geübt, bis ich es geschafft habe.
So bin ich auch heute noch, mit vierunddreißig Jahren. Zwar mache ich schon lange kein Ballett mehr, bin aber nach wie vor relativ gelenkig. Und weil ich, wie gesagt, außerdem perfektionistisch bin und mir selbst Fehler nur schwer verzeihe, kann ich ausschließen, dass der Eisblock mich wegen eines groben Schnitzers sehen will. Aber was könnte es sonst sein? Ich bin immer freundlich zu den Gästen, bin immer wie aus dem Ei gepellt, wie es sich gehört, wenn man am Empfang arbeitet, komme nie zu spät.
»Ähm … Hat er gesagt, was er will?«
Bridget schüttelt den Kopf. »Er kam eben an der Rezeption vorbei und hat mich ignoriert, wie immer, aber dann hat er von seinem Büro aus plötzlich am Empfang angerufen. Er meinte nur, ich solle dir sagen, dass du gleich in sein Büro kommen sollst.«
Ich schlucke. Was auch immer der Eisblock mir zu sagen hat, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nichts Gutes sein kann.
2
Meine Knie sind unangenehm weich, als ich vor dem Büro von Duncan Sommerset stehen bleibe. Sehnsüchtig werfe ich einen kurzen Blick über die Balustrade, die von der offenen Galerie im ersten Stock den Blick in die Lobby hinunter zulässt. Als ob sie gemerkt hätte, dass ich mich zu ihr an die Rezeption wünsche, sieht Bridget hinauf und lächelt mir aufmunternd zu, bevor sie sich wieder dem älteren Ehepaar zuwendet, das gerade auscheckt. Ich kann mich gut an die beiden erinnern, denn als sie vor drei Tagen bei mir eingecheckt haben, hat es keine viertel Stunde gedauert, bis sie wieder vor mir standen und sich darüber beschwert haben, dass der Wasserdruck in der Dusche zu schwach und die Klimaanlage zu zugig und der Verkehrslärm draußen zu laut sei. »Welcome to Manhattan«, hätte ich am liebsten gesagt, es aber natürlich nicht getan, denn in der Hotellerie bekommt man von der ersten Ausbildungsstunde an eingetrichtert, dass der Kunde IMMER der König ist, ganz egal wie kompliziert. Und jeder noch so komplizierte Gast wäre mir jetzt tausend Mal lieber als Duncan Sommerset.
Ich starre auf das dunkle Holz der Tür und atme tief durch. Dann straffe ich meine Schultern, klopfe an und betrete sein Vorzimmer, wo Eloise, seine Assistentin, mich über ihre schwarze Lesebrille hinweg streng ansieht. Eloises kastanienbraunes Haar ist heute zu einer kunstvollen Hochsteckfrisur aufgetürmt, und ihre Lippen leuchten korallenrot.
»Ah, Greta«, sagt sie in ihrer üblichen genervten Art. Ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen wendet sie sich wieder ihrem Computerbildschirm zu. »Geh durch, er erwartet dich.«
»Danke«, murmele ich.
Fast hatte ich gehofft, dass Eloise mich abwimmeln, mir erklären würde, dass ihr Chef nun doch keine Zeit habe und ich ein anderes Mal wiederkommen solle. Oder noch besser: Dass es sich um ein Missverständnis handelt und Duncan Sommerset mich gar nicht sprechen will. Aber Eloise sagt nichts weiter, sondern haut in die Tastatur, ohne mich weiter zu beachten.
Langsam trete ich an die halb offen stehende Tür zum Büro des General Managers heran und sehe Duncan Sommerset an seinem Schreibtisch sitzen. Der Eisblock scheint in ein paar Unterlagen und Fotos vor sich auf der Schreibtischoberfläche vertieft zu sein. Er hat einen Ellbogen aufgestützt und massiert sich mit seinen Fingern die Stirn, als habe er Kopfschmerzen oder denke angestrengt nach. Oder es ist einfach eine Angewohnheit von ihm, wer weiß. Ich kenne den Mann schließlich überhaupt nicht. Immer, wenn Duncan Sommerset in den letzten sechs Monaten etwas von uns an der Rezeption brauchte – eine Gästeliste, eine Keycard, eine Auskunft –, hat er sich an eine meiner Kolleginnen gewandt, die schon länger im Hotel arbeiten. Oder direkt an unsere Empfangschefin. So nah wie eben, bei unserem Beinahe-Zusammenstoß, bin ich ihm noch nie gekommen. Und in seinem Büro war ich auch noch nie. Mein Vorstellungsgespräch vor acht Monaten hat über Skype stattgefunden, weil ich damals noch am anderen Ende der Welt gewohnt habe – bei meinen Eltern auf Bali. Und das Interview war ohnehin nicht mit dem Eisblock selbst, sondern mit der Personalchefin und mit Ashley Bolton, der Empfangschefin, deren Vertreterin ich jetzt bin. Den Eisblock habe ich zum ersten Mal gesehen, als ich an meinem ersten Arbeitstag gerade ein paar Buchungsunterlagen zusammentackern wollte und mir prompt die Tackernadel in den Zeigefinger gejagt habe, weil Duncan Sommerset in dem Moment an der Rezeption vorbeigegangen ist und mich der intensive Blick aus seinen kühlen Augen fast umgehauen hat.
Doch wenn sie nur kühl gewesen wären, diese Augen, dann hätte ich ihn vermutlich als arrogant und unnahbar abgetan und mich nicht weiter für diesen Mann interessiert. Aber – da war noch mehr. In dem kurzen Moment, als er mich an jenem Morgen angesehen hat und meine Welt flüchtig stehen geblieben ist, da habe ich in Duncan Sommersets Blick eine unbestimmte Verlorenheit erkannt, die mich nicht mehr losgelassen hat.
Und dieser Blick kam mir sehr bekannt vor – ich sehe ihn, wann immer ich in den Spiegel schaue.
Bridget ist mir damals rasch mit Wundspray und einem Pflaster zur Hilfe gekommen und hat mir nach Feierabend bei einer Pizza anvertraut, dass sie regelmäßig unpassende Fantasien hatte, die den Eisblock betrafen – und das, obwohl sie in einer festen Beziehung ist. Seit diesem Tag sind wir befreundet und werfen uns immer wissende Blicke zu, wenn Duncan Sommerset durch die Lobby rauscht wie ein kühler Nordwind.
Neugierig lasse ich meinen Blick jetzt über den graublauen Teppichboden und die Wände mit den großen, in Silber gerahmten Fotografien von schwarz-weißen Küstenaufnahmen wandern. Auf einem Sideboard steht, unübersehbar, ein Bild von Duncan Sommersets Frau Catherine. Trotz ihres strahlenden Lächelns wirkt sie auch auf dieser Aufnahme merkwürdig unterkühlt. Bildschön, aber unnahbar, so wie alle Angestellten des Sommerset Hotels die Eisprinzessin kennen.
»Warum stehst du denn immer noch da wie festgefroren?« Eloises ungeduldige Stimme fährt mir von hinten regelrecht in den Nacken und lässt mich schuldbewusst zusammenzucken. Noch ehe ich etwas sagen kann, hebt Duncan Sommerset den Kopf und sieht mich fragend an. Wie immer geht mir der intensive Blick aus seinen hellgrauen Augen durch und durch. Er sagt nichts, sondern mustert mich nur schweigend, und die Intensität seines Starrens lässt mich unruhig am Kragen meiner Uniformjacke nesteln. Endlich stoße ich hervor: »Ähm, Sie wollten mich sprechen, Mr. Sommerset?«
Augenblicklich ärgere ich mich darüber, dass ich so klinge wie eine Schülerin, die zum Schulleiter zitiert worden ist. Aber genauso fühle ich mich leider auch, und die gefurchte Stirn des Eisblocks macht dieses Gefühl kein bisschen besser. Verdammt, Greta, reiß dich zusammen! Ich atme tief durch und recke mein Kinn ein wenig, um zu demonstrieren, dass dies nicht mein erstes Gespräch mit einem schwierigen Vorgesetzten ist und mich das Ganze völlig kalt lässt. Hoffentlich nimmt er mir das ab.
Duncan Sommerset mustert mich noch immer, als wüsste er überhaupt nicht, wer ich bin und was ich hier will. Ich bin kurz davor, ihm mit einem »Ich bin Greta Lorenz von der Rezeption« auf die Sprünge zu helfen, als er endlich sagt: »Ja, kommen Sie rein.«
Zögernd gehe ich auf seinen Schreibtisch zu und lasse mich in einen der zwei grauen Besuchersessel sinken. Als der Eisblock die Fotografien auf seinem Schreibtisch zusammenschiebt, betrachte ich die Bilder flüchtig. Das, was ich für Sekundenbruchteile zu sehen bekomme, gefällt mir spontan, ohne dass ich überhaupt weiß, wo diese Landschaft aufgenommen worden ist. Könnte Skandinavien sein, überlege ich, als ich das Foto betrachte, das mein Chef nun ganz oben auf den Stapel schiebt: Nadelwald und raue Felsenküste, ein paar farbenfrohe Häuser. Schön, denke ich, bevor sich eine Hand mit Ehering auf die oberste Aufnahme legt. Ertappt schnellt mein Blick nach oben und begegnet dem ernsten Starren aus den hellgrauen Augen des Eisblocks.
»Sie sprechen Deutsch?«
Seine Frage – natürlich auf Englisch – überrascht mich dermaßen, dass ich meinen Chef zwei Sekunden lang sprachlos ansehe, bevor ich nicke. »Ähm … ja. Ich … ich bin Deutsche.«
»Gut.« Mit einer schnellen Handbewegung schiebt er die Aufnahmen in einen Umschlag. Verstohlen starre ich auf die Schrift, die ich auf dem weißen Papier erkenne: Whale Island.
»Gut?«, frage ich ratlos und sehe ihn wieder an, aber mein Chef hat sich abgewandt und starrt konzentriert auf seinen Laptopbildschirm. Bekommen wir womöglich eine deutsche Reisegruppe? Falls ja, muss sich das eben erst angekündigt haben, denn ich habe gerade gestern Abend die bisherigen Buchungen für die restliche Woche durchgesehen und …
»Sie müssen mit mir auf eine Geschäftsreise kommen«, sagt der Eisblock, und ich bin froh, dass ich sitze, denn meine Beine fühlen sich plötzlich merkwürdig weich an. Fassungslos starre ich ihn an, aber er würdigt mich keines Blickes, sondern tippt jetzt mit raschen Bewegungen auf seine Laptoptastatur ein. Er hat schmale, lange Finger, stelle ich fest, was jetzt überhaupt nicht von Bedeutung ist.
»Ähm … nach … Deutschland?«, hake ich nach.
»Nein.« Seine kurz angebundene Antwort ärgert mich plötzlich. Himmel noch mal, ich fühle mich zwar gerade wie eine Schülerin, aber das gibt ihm noch lange kein Recht, mich auch so zu behandeln!
»Sondern?« Ups, die Frage kam jetzt vielleicht etwas zu spitz heraus. Der Eisblock lässt von seiner Tastatur ab und sieht wieder mich an. Erneut vergehen ein paar Sekunden, in denen er mich schweigend mustert. Fast kommt es mir so vor, als versuche er, mich einzuordnen. Oder er überlegt gerade, ob er nicht doch lieber jemand anderen mitnehmen will. Ja, das wäre sicher besser.
Hilfe, eine Geschäftsreise, mit dem Eisblock!
»Nach Kanada«, grollt mein Chef endlich hörbar schlecht gelaunt. »Es geht um ein potenzielles neues Hotel für die Sommerset-Gruppe. Mehr müssen Sie momentan nicht wissen. Die nötigen Infos zur Reise folgen noch. Eloise wird sie Ihnen mailen. Sie können jetzt gehen.«
»Ähm … aber …« Ich räuspere mich und straffe meine Schultern, als ich irritiert nachhake: »Es wäre hilfreich, wenigstens zu wissen, wann die Reise losgeht. Ich habe durchaus ein Privatleben, Mr. Sommerset.«
Und ich habe in ein paar Tagen Geburtstag, füge ich im Stillen hinzu. Nicht dass das so wichtig wäre, oder dass mich irgendjemand feiern würde. Obwohl – doch, Bridget würde mir bestimmt einen Kuchen mitbringen, so wie ich es bei ihrem Geburtstag im April gemacht habe. Bridget verspricht tatsächlich, die beste Freundin zu werden, die ich seit Stella Minetti während unserer gemeinsamen Ausbildungszeit in München hatte. Aber trotz Bridgets eventuellem Kuchen ahne ich schon, dass ich an meinem Geburtstag ziemlich allein sein werde, denn nach Feierabend fährt Bridget nach New Jersey, wo sie mit ihrem Freund zusammenwohnt. Ich wäre an meinem Geburtstag also vermutlich genauso einsam wie an allen anderen Tagen.
Der Eisblock wollte sich gerade wieder seinem Laptop zuwenden, aber mitten in der Bewegung hält er inne und starrt mich erneut an. Es ist eindeutig, dass er nicht mit so einer Reaktion gerechnet hat. Etwas flackert im hellen Grau seiner Augen auf, und ganz kurz glaube ich, dass es Belustigung ist, aber dann fürchte ich sofort, dass er vielmehr verärgert ist. Dieser Mann ist wirklich ein wandelndes Rätsel, und flüchtig denke ich, wie spannend eine Geschäftsreise mit ihm sein könnte – vielleicht würde ich dann endlich mehr über diesen geheimnisvollen Kerl erfahren?
»So«, sagt er langsam. »Haben Sie das.«
»Bitte?« Verdammt, ich habe den Faden verloren.
»Ein Privatleben.«
Ich befeuchte meine Lippen und bin sehr froh, dass er nicht wissen kann, dass ich allein in meiner schuhkartongroßen Wohnung an der Upper West Side hause und nicht einmal eine Katze habe, die ich irgendwo unterbringen müsste, bevor ich verreise. Oder Topfpflanzen. Bisher besitze ich nur eine Kaktee, und die überlebt locker bis zu zwei Wochen ohne mich. Aber diese Geschäftsreise wird doch bestimmt keine vierzehn Tage dauern, oder? Oh Gott, vierzehn Tage mit dem Eisblock!
»Ja«, bestätige ich, und meine Finger verkrampfen sich um den kühlen Satin der Armlehnen. »Also, es ist zwar nicht so, dass zu Hause jemand auf mich wartet – ähm, keine Katze oder so, die ich versorgen müsste – nur ein Kaktus …«
Himmel, Greta, warum um alles in der Welt erzählst du ihm das? Der Eisblock starrt mich an, als würde er sich gerade genau dasselbe fragen. Für den Bruchteil einer Sekunde glaube ich, dass es um seine Mundwinkel amüsiert zuckt. Rasch recke ich mein Kinn ein wenig höher und presse meine Lippen entschlossen aufeinander, um nicht noch mehr Blödsinn von mir zu geben.
»Gut, jetzt, da ich weiß, dass Sie keine Katze versorgen müssen: Ich würde gern übermorgen losfliegen, wenn es Ihnen recht ist, Ms. Lorenz«, sagt der Eisblock jetzt, und der betont freundliche Klang seiner Stimme macht die Ironie seiner Worte überdeutlich. Denn was würde schon passieren, wenn es mir nicht recht wäre? Als ob er dann seine Reisepläne verschieben würde!
»Hmm, übermorgen … ja, das passt.« Innerlich stöhne ich auf. Habe ich das gerade wirklich laut gesagt? »Wie lange werden wir weg sein?«
»Das ist noch nicht sicher. Höchstens ein paar Tage. So lange dürfte der Kaktus ohne Sie überleben. Also, dann bis übermorgen.«
Und damit bin ich entlassen. Ich bin versucht, noch nachzuhaken, warum er wissen wollte, ob ich Deutsch spreche, wohin in Kanada wir genau wollen und warum zum Teufel ich, seine stellvertretende Empfangschefin, überhaupt mit auf diese Geschäftsreise kommen soll. Doch der Eisblock greift jetzt nach seinem Smartphone und beginnt, darauf herumzutippen, ohne mich noch einmal anzusehen, und macht somit sehr deutlich, dass das Gespräch für ihn beendet ist. Also stehe ich auf und verlasse rasch das Büro, wobei ich mir sicher bin, seinen durchdringenden Blick in meinem Rücken zu spüren, durch den festen Stoff meiner Uniformjacke, durch die dünne Baumwolle meiner Bluse, bis auf meine nackte Haut.
»O mein Gott!« Fast fürchte ich, dass Bridget gleich in Ohnmacht fällt. Mit einer Hand fächelt sie sich hektisch Luft zu, während sie mich aus weit aufgerissenen Augen anstarrt. »Du gehst mit dem Eisblock auf Geschäftsreise?«
»Hmpf«, mache ich leise, weil ich es selbst immer noch nicht fassen kann. Hat das surreale Gespräch eben in seinem Büro wirklich stattgefunden? Und habe ich tatsächlich eingewilligt, mit Duncan Sommerset nach Kanada zu reisen? Bin ich denn völlig irre? Ich hätte ganz einfach Nein sagen sollen! Hätte mir eine Ausrede einfallen lassen sollen, irgendeine wichtige Einladung, einen Arzttermin, auf den ich Monate warten musste, irgendetwas!
»O mein Gott!«, wiederholt Bridget und quietscht leise vor sich hin.
»Reiß dich zusammen«, zische ich unterdrückt, weil sich in diesem Moment eine vierköpfige Familie der Rezeption nähert, um auszuchecken. »Ahh, Mrs. und Mr. Morgan, Sie müssen uns heute schon verlassen, nicht wahr? Hoffentlich war alles zu Ihrer Zufriedenheit?«
Ich bin froh darüber, dass mir die Arbeit hilft, mich von lästigen Gedanken rund um den Eisblock und die ominöse Reise nach Kanada abzulenken. Professionell wie immer kümmere ich mich um unsere Gäste, drucke die Rechnung aus, lasse Mr. Morgan einmal darüberschauen, bevor ich seine Kreditkarte mit der Summe belaste. Dann plaudere ich noch ein wenig mit ihm und seiner Frau, lasse mir ihre Urlaubshighlights erzählen und frage auch die Kinder nach ihren schönsten Erlebnissen. Als Lennox mir signalisiert, dass der Wagen, der die Morgans zum Flughafen bringen wird, vorgefahren ist, verabschiede ich mich freundlich und winke der kleinen Tochter noch hinterher, als alle vier beschwingt die Lobby verlassen.
»Du musst deine schönste Unterwäsche einpacken!« Bridgets Flüstern bringt mich zurück in die verwirrende Realität.
»Wie bitte?« Ich weiß nicht, ob ich entsetzt oder amüsiert sein soll. Fragend starre ich sie an. »Das ist nicht dein Ernst, oder?«
»Natürlich ist es das! Am besten gehen wir heute noch schnell einkaufen. Zu Victoria’s Secret, die haben doch gerade SALE!«
»Bridget!« Rasch vergewissere ich mich, dass niemand in Hörweite ist, dann sage ich leise, aber bestimmt: »Er nimmt mich mit auf eine Geschäftsreise. Nicht mehr, und nicht weniger. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit schöner Unterwäsche zu tun!«
»Das werden wir ja noch sehen.« Bridget besitzt die Unverschämtheit, mich anzüglich anzugrinsen. Mit einem genervten Augenrollen gebe ich ihr einen kleinen Knuff gegen den Oberarm und wende mich dann dem PC zu.
»Ich habe übrigens die Eisprinzessin auffällig lang nicht mehr durch die Lobby stolzieren sehen«, flüstert mir Bridget noch rasch zu, als sich schon die nächsten Gäste nähern. »Meinst du, es gibt sie überhaupt noch im Leben vom heißesten Eisblock der Welt?«
»Natürlich gibt es sie noch«, knurre ich, während ich gleichzeitig mein Lächeln anknipse und den Gästen erwartungsvoll entgegensehe. »In seinem Büro thront ein riesiges Bild von ihr!«
Allerdings frage auch ich mich im Stillen, warum wir Catherine Sommerset so lange nicht gesehen haben, während ich mich um das Check-out der nächsten Gäste kümmere.
3
Ratlos stehe ich am Abend des nächsten Tages vor meinem aufgeklappten Koffer und starre die sauber gefalteten Klamotten an, die sich auf meinem Bett stapeln. Es ist mir wirklich unangenehm, wie lange ich brauche, um mich zu entscheiden, was ich auf diese ominöse Geschäftsreise mitnehmen soll. Eloise hat mir noch gestern, nur wenige Stunden nach meinem kurzen Gespräch mit dem Eisblock, die Reisedetails geschickt. Somit bin ich zwar immer noch ziemlich ahnungslos, warum ausgerechnet ich auf diesen Businesstrip mitkommen soll, aber immerhin weiß ich jetzt, dass es für meinen Chef und mich im Privatflieger der Sommerset Hotelgruppe in den Norden der kanadischen Atlantikprovinz Nova Scotia gehen wird, die von New York aus in der kleinen Cessna in circa zweieinhalb Flugstunden zu erreichen ist. Zwar hatte ich schon von der Provinz mit dem unaussprechlichen Namen gehört, aber ich war noch nie dort und musste erst einmal googeln, um zu wissen, wie warm es im Sommer dort sein wird. Durchaus warm, weiß ich nun. Zwar nicht tropisch-heiß wie zeitweise in Manhattan, aber das Thermometer kann sogar in Atlantik-Kanada auf über dreißig Grad steigen. Allerdings regnet es auch häufig in Nova Scotia, und es ist oft nebelig und die Nächte werden kühl, weshalb ich klamottentechnisch unsicher bin, was ich denn nun einpacken muss. Außerdem weiß ich ja gar nicht, was für Termine auf unserer Agenda stehen. Leider hat Eloise sich nicht dazu äußern können (oder wollen), als ich zaghaft nachgehakt habe. Mein Kenntnisstand beschränkt sich darauf, dass ich morgen früh um neun von einer Limousine abgeholt und zum Flughafen gebracht werde. Zum General Aviation Terminal des JFK Airport, um genau zu sein. Das ist der Teil, wo die Privatmaschinen abheben. Mir wird ein wenig schlecht vor Aufregung – vor allem, als ich mich an Bridgets aufgeregtes Quieken erinnere, nachdem ich ihr den Teil mit der Privatmaschine erzählt habe: »OH! MEIN! GOTT! Das wird ja immer besser! Greta, das ist ja …« An dieser Stelle musste sie sich mit einem unserer Hotelprospekte Luft zufächeln, »… das ist ja wie bei Fifty Shades of Grey!«
Ich musste mühsam versuchen, ein Lachen zu unterdrücken, weil gerade ein älterer Herr auf die Rezeption zukam. »Ist es nicht!«, habe ich entschieden gewispert. »Erstens fliegt der Eisblock das Flugzeug mit Sicherheit nicht selbst, sondern lässt fliegen. Und zweitens … war das bei Fifty Shades of Grey nicht ein Hubschrauber?«
»Ist doch völlig egal! Du und der Eisblock, allein in luftiger Höhe, auf dem Weg nach Kanada …«
»Allein mit dem Piloten, hoffe ich doch«, habe ich geknurrt und dann dem Gast entgegengestrahlt, der inzwischen bei uns angekommen war. »Herzlich willkommen im Sommerset Hotel! Haben Sie eine Reservierung?«
»Ganz egal, Greta, mein Bauchgefühl sagt mir, dass sich da was anbahnt, was E. L. James in Verzückung versetzen würde!«
Irritiert sah ich Bridget an, während der ältere Herr seinen Reisepass über den Tresen schob.
»Ich hoffe doch sehr, dass ich zurück nach New York kommen werde, ohne ausgepeitscht worden zu sein!«, flüsterte ich ihr noch zu, was meine Kollegin leise prusten ließ.
Damit war das Thema für mich erledigt.
Bis jetzt, als ich vor meinem Koffer stehe und zum hundertsten Mal überlege, welche Blusen ich einpacken soll, ob ich Röcke oder Hosen mitnehme, was für Schuhe ich in Kanada brauche. Und, ja, ich zerbreche mir wirklich den Kopf darüber, was für Unterwäsche ich mitnehmen soll, Bridget sei Dank.
Du bist bescheuert, Greta Lorenz, sage ich schließlich im Stillen zu mir selbst und werfe resolut einige meiner unschuldig geblümten Wäschesets in den Koffer, in dem bereits mein Ein und Alles liegt, das immer als Erstes eingepackt wird: mein Tagebuch. Ohne dieses Notizbüchlein, in dem ich diszipliniert jeden Abend die wichtigsten Gedanken zum vergangenen Tag festhalte, reise ich nirgendwo hin. In meiner viel zu kleinen Wohnung gibt es eine viel zu große Kiste, in der sich all die Tagebücher der letzten vierundzwanzig Jahre stapeln – angefangen bei meinem allerersten Tagebuch, einem pinken Büchlein mit Vorhängeschloss, das ich zu meinem zehnten Geburtstag bekommen habe.
Beim Blick auf mein aktuelles Tagebuch, das zwischen der Unterwäsche aus dem Koffer hervorlugt, frage ich mich beklommen, was ich in den nächsten Tagen wohl aufschreiben werde.
Später an diesem Abend liege ich schlaflos im Bett, hellwach vor lauter Nervosität. Ruhelos hole ich mir schließlich ein Glas Wasser und öffne die Tür zu meinem winzigen Balkon. Für Manhattan befinde ich mich in sehr bescheidener Höhe, nämlich nur im 10. Stock, aber das reicht, um einen fantastischen Ausblick zu haben, in den ich mich vom ersten Tag an verliebt habe – beziehungsweise von der ersten Nacht an, denn im Dunkeln ist dieser Blick einfach phänomenal: Um mich herum glitzern und funkeln die Lichter Hunderter Hochhäuser. Die Nachtluft ist nach wie vor viel zu warm, es riecht nach Abgasen und vollen Mülleimern, deren Klappern mich morgen in aller Frühe aus dem Schlaf reißen wird, wenn die Müllabfuhr kommt. Wobei ich gerade wirklich bezweifele, dass ich heute Nacht überhaupt Schlaf finden werde, so nervös wie ich bin. Ich nippe an meinem Wasser und lasse meinen Blick in Richtung des Central Parks wandern, den ich zwar nicht sehen kann, von dem ich aber weiß, dass er nur wenige Blocks entfernt zu meiner Linken liegt. Auf der anderen Seite des Central Parks, an der noblen Upper East Side, liegt jetzt der Eisblock vermutlich neben der Eisprinzessin im Bett, in dem schicken Apartment, das Richard Sommerset seiner Tochter angeblich mal zum Geburtstag geschenkt hat. Ratlos frage ich mich erneut, was das Ganze mit Kanada soll. Und warum mein Herz so unangebracht nervös vor sich hin wummert, wenn ich auch nur an die kühlen hellgrauen Augen meines Chefs denke.
Benommen schlucke ich und wende mich von den Hochhäusern ab, die meinen Blick gen Central Park versperren. Stattdessen betrachte ich noch ein wenig das Glitzern der Großstadtlichter in Midtown Manhattan, rings um das majestätisch aufragende Empire State Building, das mir in einsamen Nächten wie dieser wie ein stummer Freund erscheint, der zu mir herübersieht. Ich muss an die anderen Ausblicke denken, die ich im Laufe meines Lebens schon hatte: An die Skylines von Hongkong und Dubai, Tokyo und Singapur. Der beleuchtete Eiffelturm. Die grünen Lichter der Tintenfisch-Boote auf dem nächtlichen Meer vor Phuket. Die Lichterketten am Strand von Bali. Stationen meines Lebens, das mich schon durch so viele Hotels geführt hat. Überall zu Hause. Und nirgendwo. Die Einsamkeit nagt leicht an meinem Herzen, wie sie es so oft tut, seit ich wieder allein wohne. Eigentlich erstaunlich, wie einsam man sich inmitten dieses Meers aus Hochhäusern fühlen kann, überlege ich. Überall um mich herum sind Menschen, so viele Menschen. Acht Millionen New Yorker. Mein Blick wandert zu einer hell erleuchteten Wohnung im Brownstone-Building nebenan, in die ich öfter von meinem Balkon aus schaue. Ein Pärchen sitzt auf einer Couch, er hat einen Arm um ihre Schulter gelegt, auf dem Flachbildschirm ist George Clooney zu sehen. Mein Blick wandert zum dicken Bauch der Frau. Ich habe schon vor einigen Wochen bemerkt, dass meine Nachbarin, deren Namen ich nicht kenne, aber von der ich weiß, dass sie eine Schwäche für Grey’s Anatomy und Take-Away-Essen vom Chinesen an der Ecke hat, ein Baby bekommt. Ja, bald werden meine Nachbarn zu dritt auf ihrem Sofa sein, fährt es mir durch den Kopf. Und ich weiterhin allein auf meinem.
Rasch wende ich mich ab und kehre in die wohltuende Kühle meiner klimatisierten Wohnung zurück. Warum ich dann, auf dem Weg zu meinem Bett, im Vorbeigehen mein schwarzes Spitzen-Wäscheset aus der obersten Kommodenschublade angele und in den nach wie vor aufgeklappten Koffer werfe – darüber will ich lieber nicht näher nachdenken.
Als ich am nächsten Morgen vor meinem Wohnhaus stehe und auf die schwarze Limousine warte, nestele ich unruhig am Kragen meines Businesskostüms herum, schiebe die Haarnadeln tiefer in meinen üblichen strengen Nackenknoten und vergewissere mich zum x-ten Mal, dass mein Pass in meiner Handtasche steckt. Man sollte ja meinen, dass jemand, der schon so viele tausend Flugmeilen hinter sich gebracht hat wie ich, inzwischen abgebrüht jeder Reise entgegensieht. Aber bei mir ist das nicht der Fall – ich bin auf Flugreisen jedes Mal wieder nervös, vor allem, seit es mir einmal passiert ist, dass sich das Datenblatt beim Check-in am Flughafen aus meinem Pass gelöst hat und mir gesagt wurde, dass ich so, mit beschädigtem Pass, nicht reisen könne. Das war vor zwei Jahren in Hongkong, als Olivier und ich für ein langes Wochenende nach Bangkok fliegen wollten. Er ist dann ohne mich geflogen, immerhin war es sein bester Freund, den wir dort besuchen wollten. Trotzdem habe ich mich im Stich gelassen gefühlt, bin allein in unsere Wohnung zurückgekehrt und habe eine Runde geheult, bevor ich beim deutschen Generalkonsulat einen neuen Pass beantragt habe. Den habe ich natürlich erst bekommen, als Olivier längst zurück in Hongkong war.
Vielleicht war das damals der Anfang vom Ende meiner Ehe, überlege ich jetzt, als ich aus dem angenehm kühlen Schatten meines Wohnhauses hervor den vorbeikriechenden Verkehr der Rush Hour beobachte und nach der Sommerset-Limousine Ausschau halte. Vielleicht habe ich Olivier nie wirklich verzeihen können, dass er einfach so ohne mich geflogen ist, unter dem Vorwand, dass sein Freund sich schon so gefreut hatte. Vielleicht haben ihn meine stummen Vorwürfe nach seiner Rückkehr mehr genervt, als er mir je gesagt hat.
Aber vielleicht hatte all das auch gar nichts mit dem Scheitern unserer Liebe zu tun, schließlich ist am Ende so viel mehr passiert als lediglich ein vermasseltes Wochenende in Bangkok. Ich starre in den blauen Himmel hinauf, zu den Schäfchenwölkchen, die ich zwischen den Hochhäusern erkenne, und überlege wie so oft, ob sie dort oben sitzen und auf mich hinuntersehen.
Die Limousine taucht so plötzlich vor mir auf, dass ich erschrocken zusammenzucke. Kaum hat sie auf meiner Höhe am Bordstein gehalten, als schon Eddy, der Fahrer von Richard Sommerset, herausspringt. Er tippt sich höflich an die schwarz glänzende Mütze seiner Uniform und ruft in seinem breiten Queens-Akzent: »Guten Morgen, Greta!«
»Guten Morgen, Eddy.«
Ich lächele ihn so unbeschwert wie möglich an, während ich mir verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel wische. Dass mir das immer noch passiert, ärgert mich ein wenig. Eddy nimmt mir meinen Koffer ab und öffnet schwungvoll die hintere Wagentür.
Mit einem Dank steige ich ein – und erstarre. Ich hatte gedacht, Eddy würde erst mich abholen und dann zur Upper East Side fahren, um unseren Chef abzuholen. Doch Duncan Sommerset sitzt bereits in der Limousine und sieht mich schweigend über den oberen Rand der New York Times hinweg an, die er auseinandergefaltet in seinen Händen hält.
»Gu … guten Morgen«, sage ich rasch, während Eddy die Wagentür hinter mir zuschlägt und wir plötzlich allein sind.
»Guten Morgen«, sagt mein Chef ruhig. Hoffentlich hat er nicht gesehen, dass ich mir gerade eine Träne wegwischen musste! Benommen sehe ich aus dem verdunkelten Seitenfenster nach draußen. Als ich wieder verstohlen den Eisblock anschaue, merke ich, dass auch er nachdenklich nach draußen blickt, offensichtlich den Eingang zu meinem Wohnhaus mustert. Ich versuche, mein Gebäude mit seinen Augen zu sehen und komme zu keinem guten Ergebnis. Im Vergleich mit dem teuren Apartmentgebäude, in dem er mit der Eisprinzessin lebt, gleicht mein Haus fast einer Bruchbude. Allerdings einer trotz allem sündhaft teuren Bruchbude, wie in Manhattan üblich. Als ich eine Ratte zwischen den Mülltonnen an der Hauswand hervorflitzen sehe, unterdrücke ich ein Seufzen und sehe verstohlen wieder zum Eisblock. Der hat sich jedoch erneut in die New York Times vertieft und würdigt mich keines Blickes mehr.
So bleibt es, bis wir am Flughafen ankommen. Kurz vorm JFK Airport bekommt Duncan Sommerset einen Anruf, und er redet nach wie vor mit dem Manager eines anderen Hotels der Sommerset-Gruppe, als wir am General Aviation Terminal aussteigen und das klimatisierte Gebäude betreten. Eddy bringt unsere Koffer, und ich danke ihm herzlich, während unser Chef nur kurz nickt, nach seinem Gepäck greift und sich abwendet, immer noch das Smartphone am Ohr.
Ich lächele Eddy tapfer zu, fast versucht, ihm einfach wieder zum Auto zu folgen und zurück nach Manhattan zu fahren. Aber natürlich kann ich das nicht tun, natürlich werde ich mich zusammenreißen und die Professionalität an den Tag legen, die ich mir in den vergangenen Jahren im Hotelbusiness angeeignet habe.
Oh. Mein. Gott. Mein Herzschlag setzt einen Moment aus, als ich Duncan Sommerset in den Wartebereich folge, wo ein paar Leute gelangweilt in einer Sitzgruppe hocken, alle in ihre Telefone vertieft. Nur einer von der Gruppe schaut jetzt auf und lächelt mich flüchtig an. Das ist doch … Michael Bublé! Ungläubig starre ich den Musiker an, lächele schief zurück und folge dem Eisblock dann kopflos bis ans Ende des Warteraums, um eine Ecke herum – und fast hinter ihm her durch die Tür zur Männertoilette. Im letzten Moment bleibe ich wie angewurzelt stehen, aber da hat mein Chef schon gemerkt, dass ich ihm blind hinterhergedackelt bin. Auch er bleibt stehen, die Tür halb geöffnet, und sieht mich mit leicht hochgezogenen Augenbrauen fragend an.
»Oh … ähm, Entschuldigung«, stammele ich und mache rasch einen Schritt rückwärts, sehe mich verlegen nach der Tür zur Damentoilette um. »Ich … da saß gerade Michael Bublé mit seiner Band im Wartebereich!«
Duncan Sommerset schaut mich regungslos an. Seine grauen Augen wirken heute Morgen besonders kühl, finde ich. Vielleicht wird ihre Farbe durch die silbergraue Krawatte betont, die er zum dunkelblauen Anzug trägt.
»Und?«, fragt er jetzt langsam, und ich glaube, eine Spur Amüsiertheit aus seiner Stimme herauszuhören. »Wollen Sie sich ein Autogramm holen?«
»Nein«, sage ich rasch und fühle mich einmal mehr wie ein alberner Teenie. »Ich war nur überrascht, das ist alles.«
»Mhm«, macht Duncan Sommerset, und zu meinem Erstaunen sehe ich ein winziges Schmunzeln um seine Lippen zucken, das allerdings genauso schnell wieder verschwindet, wie es gekommen ist. »Darf ich jetzt auf die Toilette gehen?«
»Äh … na klar«, stoße ich hervor und flüchte mich auf die Damentoilette, wo ich erst einmal Deo nachlege, weil ich jetzt schon schweißgebadet bin. Und dabei haben wir New York noch nicht einmal verlassen!
In der kleinen Cessna Citation wird nichts besser, im Gegenteil. Verkrampft umklammere ich die Armlehnen meines Sitzes, als die Maschine sich schwankend in die Höhe arbeitet. Unter uns erstreckt sich das endlose Häusermeer von Queens, bevor das Flugzeug Richtung Nordosten schwenkt, Kanada entgegen. Es ist mein erster Flug in so einer kleinen Maschine, und während ich sonst überhaupt kein Problem mit Flugangst habe, fühle ich mich in diesem Privatflugzeug plötzlich regelrecht schutzlos. Ein rascher Blick zu Duncan Sommerset hinüber zeigt mir, dass er an diese kleine Maschine gewöhnt zu sein scheint. Ausdruckslos starrt er aus dem Fenster, bis der Pilot sich über die Lautsprecher aus dem Cockpit meldet und sagt, dass man elektronische Geräte wieder einschalten darf, woraufhin der Eisblock sofort seinen Laptop aufklappt.
Ich hingegen beschränke mich darauf, aus dem Fenster zu sehen. Zum einen kann ich so den Eisblock auf der anderen Gangseite ausblenden, und zum anderen finde ich es wirklich spannend, die Landschaft von oben zu betrachten. Der Himmel ist wolkenlos, und da wir nicht in so hoher Höhe fliegen, wie die großen Passagiermaschinen, kann ich die Bundesstaaten Connecticut und Rhode Island von oben bewundern, sehe eine Ortschaft nach der anderen unter uns vorbeiziehen, bis wir nahe Cape Cod die Küste erreichen und plötzlich der endlos erscheinende Atlantik in der Sonne glitzert. Fasziniert starre ich auf das blaue Wasser hinab, sehe hin und wieder ein Schiff, während wir Nova Scotia entgegenfliegen. Als ich wieder Festland unter uns erkenne, haben wir den Osten Kanadas schon erreicht. Seit meiner Google-Suche weiß ich, dass Nova Scotia eine Halbinsel ist, die als südöstlichste Provinz Kanadas in den Atlantik hineinragt. Der Flughafen von Sydney, den wir ansteuern, liegt ganz im Norden der Provinz, auf einer Insel namens Cape Breton, wie ich recherchiert habe. Warum wir ausgerechnet dorthin wollen, ist mir allerdings immer noch ein Rätsel. Nun schieben sich doch ein paar Wolken in mein Blickfeld, aber hier und da kann ich dennoch das Land unter uns erkennen, sehe dunkle Wälder, ab und zu von einem glitzernden See oder einem gewundenen Flusslauf unterbrochen.
Da ich so von der Landschaft unter uns fasziniert bin, merke ich kaum, wie die Zeit vergeht, sodass ich mich erst dann überrascht vom Fenster abwende, als wir plötzlich schon zum Sinkflug ansetzen. Mein Blick gleitet zu Duncan Sommerset auf der anderen Seite des schmalen Mittelgangs, und zu meiner Verwunderung stelle ich fest, dass er mich nachdenklich ansieht. Regelrecht ertappt zuckt er zusammen und senkt rasch den Blick, starrt auf seinen Laptop, merkt dann anscheinend, dass er den für die Landung bereits wieder zugeklappt hat und schaut stattdessen aus seinem eigenen Fenster nach draußen. Die Tatsache, dass der Eisblock mich offensichtlich beobachtet hat, während ich meinerseits nach draußen gesehen habe, lässt mich ein wenig unruhig an meiner Frisur herumnesteln. Warum auch immer. Soll er doch starren. Mein Nackenknoten sitzt noch erfreulich gut.
Plötzlich muss ich daran denken, wie Olivier mich immer ein wenig mit meiner strengen Frisur aufgezogen hat. »Du siehst aus wie meine Lehrerin aus der 5. Klasse«, hat er einmal gemeint, und, als ich ein wenig pikiert war, weil ich dachte, seine Lehrerin wäre so eine konservative grauhaarige Dame gewesen, augenzwinkernd hinzugefügt: »Ich war damals in Mademoiselle Dupont verknallt, wie so ziemlich alle Jungs der Schule.«
Nein, jetzt nur nicht an Olivier denken. Es ist auch so alles schon aufwühlend genug. Da der Eisblock sich immer noch in Schweigen hüllt, wende auch ich mich wieder meinem Fenster zu und beobachte, wie die ersten Häuser von Sydney, Nova Scotia unter uns auftauchen.
4
Das Schweigen meines Chefs geht mir langsam aber sicher wirklich auf den Zeiger. Ich würde mich ja bemühen, Small Talk zu halten, aber seine kühle Ausstrahlung macht mich so nervös, dass ich meinerseits stumm wie ein Goldfisch bin, während wir das Gebäude des kleinen Flughafens betreten, wo eine freundliche Beamtin unsere Pässe kontrolliert. Zu meiner Überraschung sieht sie den Eisblock an, lächelt breit und sagt: »Herzlich willkommen in der Heimat!«
»Danke«, murmelt Duncan Sommerset, während die Beamtin ihren Stempel in seinen Pass knallen lässt und dann nach meinem greift.
Er geht bereits vor, und sobald ich meinen Pass eingesteckt habe, folge ich ihm zügig und versuche, diese Information zu verdauen.
Heimat? Ich muss an die endlosen Wälder denken, über die wir geflogen sind, und dieses Bild passt so gar nicht zu dem Geschäftsmann in seinem maßgeschneiderten Anzug, der jetzt den Mietwagenschalter erreicht hat und der Blondine dahinter seine Kreditkarte reicht. Auch die Tatsache, dass er ein Auto mietet, um selbst zu unserem ominösen Ziel zu fahren, überrascht mich. Natürlich ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber irgendwie passt zum Eisblock die Limousine seines Schwiegervaters mit Fahrer viel besser. Andererseits fährt er ja in Manhattan viel mit dem Mountainbike. Warum sollte er also jemand sein, der sich nur herumkutschieren lässt? Als ich ihn verstohlen beobachte, wird mir klar, dass ich eigentlich überhaupt nichts über diesen Mann weiß.
»Danke«, murmelt mein Chef mit einem flüchtigen Lächeln Richtung Blondine, greift nach seiner Kreditkarte und dem Autoschlüssel und wendet sich ab. Als er merkt, dass ich ihn verblüfft mustere, zieht er fragend die Augenbrauen in die Höhe.
»Warum sehen Sie mich so an, als hätte ich zwei Köpfe? Oder steht Michael Bublé hinter mir?«
Ich bin so verblüfft darüber, dass der Eisblock tatsächlich so etwas wie einen Witz gemacht hat, dass ich zunächst keine Antwort finde. »Also …«, stammele ich hastig und folge ihm rasch, da er schon mit langen Schritten dem Ausgang zustrebt. »Ich wusste nicht, dass …«
Ich breche ab, als wir aus dem Flughafengebäude nach draußen treten und uns ein frischer Wind begrüßt, der mich, nach der Sommerhitze in Manhattan, erschaudern lässt. Ich bin so damit beschäftigt, mich neugierig umzusehen, dass ich zunächst gar nicht merke, wie der Eisblock ein wenig verlangsamt und mir einen fast amüsierten Blick zuwirft.
»Sie wussten nicht, dass ich aus Nova Scotia komme? Ist es das?«
»Äh … ja«, antworte ich wahrheitsgemäß.
»Ist das so unglaublich?«
»Nein … natürlich nicht«, beeile ich mich zu sagen. Andererseits … hinter dem Parkplatz, auf den der Eisblock jetzt zusteuert, ist nur Wald zu sehen. Bäume, wohin man sieht. Duncan Sommerset wirkt wie jemand, der sein ganzes Leben in Manhattan verbracht hat, umgeben von Asphalt und Luxushotels. Aber doch nicht hier! Vielleicht ist er schon früh nach New York gezogen? Bereits in seiner Kindheit? Anders kann ich mir das nicht erklären.
»Sind Sie festgewachsen?«, holt mich die Stimme des Eisblocks zurück in die Realität, und ich setze mich rasch mit meinem Koffer in Bewegung, überquere ebenfalls die Parkplatzfläche, wo Duncan Sommerset schon in unserem Mietwagen Platz genommen hat und den Motor startet.
»Wie lange werden wir unterwegs sein?« Nervös falte ich meine Hände im Schoß und starre aus dem Beifahrerfenster. Nachdem wir zunächst durch bewohntes Gebiet gefahren sind, wird es nach den letzten Gebäuden der Stadt Sydney schnell einsamer. Zwar ist der Trans-Canada-Highway, auf dem wir nun unterwegs sind, nach wie vor in jede Richtung zweispurig, aber links und rechts der Straße sieht man bald nur noch Wälder, Wälder, nichts als Wälder. Plötzlich fühle ich mich regelrecht ausgeliefert. Dieser Mann am Steuer ist doch eigentlich ein Wildfremder für mich!
»Sagen Sie nicht, dass Sie jetzt schon eine Pause brauchen«, murmelt der Eisblock, und ich werfe ihm einen überraschten Blick zu.
»Nein, das meinte ich überhaupt nicht. Ich wollte nur wissen …« Es reicht. Ich hole Luft, fasse kurz an meinen Nackenknoten – eine Geste, die ich automatisch mache, als würde mich meine tadellos sitzende Frisur irgendwie bestärken – und straffe meine Schultern, bevor ich betont ruhig sage: »Da Sie ja nach wie vor ein großes Geheimnis daraus machen, wohin wir unterwegs sind, habe ich leider keinen blassen Schimmer davon, ob wir nur bis in den nächsten Ort fahren oder weiter bis nach … Neufundland.«
»Neufundland?«
Ich ärgere mich über mich selbst, weil das die erstbeste kanadische Provinz ist, von der ich weiß, dass sie sich ebenfalls irgendwo hier in der Nähe befindet, an der Ostküste Kanadas. Aber natürlich ist auch mir klar, dass Neufundland eine Insel ist. »Ja, bis zur Fähre zum Beispiel«, versuche ich stur, mich zu retten, selbst wenn ich gar nicht weiß, ob es wirklich eine Fähre von Nova Scotia nach Neufundland gibt.
»Und Sie meinen nicht, dass es dann leichter gewesen wäre, mit dem Flugzeug direkt nach Neufundland zu fliegen? Die sollen dort auch Flughäfen haben.«
Verdammt. Ich versuche, seinen spöttischen Tonfall zu ignorieren. »Sie wollen es wirklich spannend machen, oder?« Mit verschränkten Armen sehe ich ihn an. Er erwidert meinen Blick flüchtig, bevor er wieder auf den breiten Highway schaut. Doch dieser rasche Blick reicht, um mich ein wenig tiefer in meinen Beifahrersitz sinken zu lassen. Zwar sind die hellgrauen Augen des Eisblocks durch seine Sonnenbrille im Pilotenstil verborgen, aber ich glaube trotzdem, ihre kühle Intensität überdeutlich auf mir zu spüren, sobald er in meine Richtung sieht.
»Keine Sorge, wir fahren nicht bis Neufundland weiter«, sagt er jetzt ruhig. »Aber eine Weile müssen Sie noch durchhalten. In ungefähr drei Stunden dürften wir in Scott’s Harbour sein.«
Scott’s Harbour. Aha. Verstohlen zücke ich mein Telefon, um diesen Ort zu googeln. Aber ich habe keinen Empfang. Natürlich. Wir befinden uns ja auch irgendwo in der Wildnis, weit ab von jeglicher Zivilisation.
Dieses Gefühl verstärkt sich noch einmal um ein Vielfaches, als wir eine knappe Stunde später den breiten Trans-Canada-Highway mit seinen zahlreichen riesigen Lkw verlassen und dem schmaleren Cabot Trail folgen, einer Straße, die sich offensichtlich nahe der Küste entlang windet. Hin und wieder sehe ich in der Ferne ein Stückchen blauen Meeres vorbeifliegen, aber meistens schiebt sich schnell wieder dichter Wald in mein Blickfeld. Ich bin nicht daran gewohnt, so viele Bäume zu sehen. Bäume, nichts als Bäume! Natürlich, meinen morgendlichen Abstecher in den Central Park liebe ich und dort gefallen mir die Bäume auch sehr, aber ich sehe ja gleichzeitig immer am Rande des Parks die vertrauten Hochhäuser, ich höre in der Ferne die Autos, ich weiß, dass ich nicht weit vom nächsten Starbucks oder Sushi-Restaurant entfernt bin. Aber hier … hier ist ja nichts, wirklich nichts! Also, außer Bäumen natürlich. Und meinem griesgrämigen Chef. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Eisblock hier, in der Einsamkeit Cape Bretons, mit jeder zurückgelegten Meile noch ernster wird.
Die Namen der Orte, die wir passieren, tragen nicht wirklich dazu bei, dass ich mich hier weniger fremd fühle: »Wreck Cove« und »Keltic Lodge« lese ich auf Straßenschildern und frage mich, ob wir tatsächlich nur wenige Flugstunden von New York City entfernt sind. Fast könnte ich schwören, dass wir wie durch ein Wunder den Atlantik überquert haben und in Schottland gelandet sind, so wild und so schottisch klingt hier vieles. Aber irgendwie erklärt diese Tatsache auch den Namen dieser Provinz, denke ich, denn Nova Scotia bedeutet »Neuschottland«, das habe ich irgendwo gelesen.
Der Eisblock versucht auf dem Cabot Trail noch ein paar Meilen lang, einen Radiosender zu finden, was in der Nähe von Sydney kein Problem war. Aber jetzt scheint es eines zu sein, denn jedes Mal, wenn für ein paar kurze Augenblicke Musik oder ein Wortbeitrag unser Auto erfüllen und mich hoffen lassen, dass wir den Rest dieser Fahrt nicht in unangenehmem Schweigen hinter uns bringen müssen, bricht der Empfang mit der nächsten Kurve schon wieder ab.
»Verfluchte Provinz«, knurrt mein Chef unterdrückt, und ich sehe ihn neugierig an.
»Seit wann wohnen Sie denn nicht mehr hier?«, frage ich zaghaft.
»Schon lange nicht mehr«, kommt die knappe Antwort.
»Und … wir sehen uns hier ein Hotel an? Oder ein Grundstück, auf dem eines gebaut werden könnte?«
Ich weiß, dass die Sommerset-Hotelgruppe immer mal wieder neue Häuser eröffnet, demnächst in New Orleans. Aber … hier? Ratlos starre ich aus dem Fenster in den dichten Wald hinaus.
»Ja«, kommt die mal wieder sehr ausführliche Antwort des Eisblocks. Fast muss ich lachen. So beherrscht wie möglich hake ich nach: »›Ja‹ … ein Hotel oder ›ja‹… ein Grundstück?«
Ich merke genau, dass der Seitenblick, den er mir flüchtig zuwirft, eine Spur irritiert ist.
»Sowohl als auch«, erwidert mein Chef endlich, und die Art, wie er das sagt, macht mir klar, dass er wirklich nicht weiter über das Thema reden will.
Bitteschön. Ich kann auch schweigen. Sehr gut sogar! Ein paar Minuten lang starre ich stumm aus dem Beifahrerfenster, bevor ich mich überrascht aufrechter hinsetze: Zu meiner Rechten lichtet sich der Wald hinter einer Kurve plötzlich und gibt den Blick auf den Atlantik frei. Die Küste fällt über dramatische Klippen zum Meer hin ab, die Brandung schäumt um die Felsen, graue Wolken jagen sich bis an den Horizont.
»Wenn das Wetter gut ist, ist das hier eine echt schöne Strecke.«
Die Worte des Eisblocks lassen mich überrascht den Blick vom Fenster lösen. Oho, er spricht tatsächlich mit mir! Kurz sehe ich ihn an, bevor ich wieder auf den Atlantik schaue und sage: »Also, ich finde es auch bei bewölktem Himmel wunderschön!«
Ein leises Schnauben ist die Antwort, und ich glaube fast, dass er tatsächlich noch etwas sagen will, aber im nächsten Moment stößt er ein lautes »Fuck!« aus und steigt so stark in die Bremsen, dass unser Mietwagen zu schlingern beginnt.
Vor unserem Auto steht ein Elch auf der Straße. Seelenruhig sieht er uns durch die Windschutzscheibe an, sein Kinnbärtchen zittert leicht, als er den Unterkiefer kreisend bewegt, weil er offensichtlich ein paar Blätter oder Grashalme kaut. Starr vor Schreck sehe ich den Elch an. Das darf doch alles nicht wahr sein!
»Welcome to Cape Breton«, brummt mein Chef, und als der Elch mit staksigen Schritten würdevoll von der Fahrbahn marschiert und im Gebüsch verschwindet, schauen wir ihm nach. Zu meiner grenzenlosen Überraschung lacht der Eisblock auf. Er lacht! Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das erlebe, und ich muss sagen, das Lachen steht ihm. Es macht ihn sogar noch attraktiver, wenn das überhaupt möglich ist. »Gott, was habe ich diesen verdammten Landstrich vermisst!«
Er tritt wieder aufs Gas, noch immer die Spur eines amüsierten Schmunzelns um die Lippen, und ich verbringe die nächste Stunde damit, mich zu fragen, ob er diese Aussage sarkastisch oder ernst gemeint hat, und warum mein Magen so unangebracht flau wird, wenn der Eisblock lacht.
5
Ich weiß nicht, was ich von dem Ort Scott’s Harbour erwartet habe, aber mehr als eine Ansammlung von ungefähr fünfzig Häusern plus Tankstelle und Supermarkt dann doch. Ratlos sehe ich aus dem Fenster, während wir das Örtchen erschreckend schnell passieren, und als sich schon wieder Bäume in mein Sichtfeld schieben, hake ich besorgt nach: »War das nicht … ich meine, wollten wir nicht …?«
»Nach Scott’s Harbour? Ja.« Der Eisblock lenkt unseren Mietwagen eine kurvige Straße entlang, die, wie ich nach einer Biegung feststelle, direkt zum Meer hinabführt. Der Atlantik schimmert orangerot in der Abendsonne, die tief über den Wäldern im Westen steht, und einen Moment lang bin ich sprachlos vor Entzücken. Das weite Meer, das sich plötzlich vor uns auftut, haut mich wirklich um. Einfach wunderschön!
»Wir wollen streng genommen zum Fährhafen von Scott’s Harbour«, erklärt der Eisblock jetzt und macht mit seinem Kinn eine leichte Bewegung durch die Windschutzscheibe. Tatsächlich, jetzt erkenne auch ich, dass die Straße in einem Schotterplatz mündet, der bis ans Wasser führt. Und dort ist eine Hafenmole, wo ein paar Fischkutter festgemacht liegen. Neben einem Schuppen sind etliche käfigartige Holzboxen übereinandergestapelt, und ich vermute, dass das Hummerkörbe sind. Aber weder Menschen noch andere Autos sind zu sehen. Auch keine Fähre.
»Ähm«, mache ich und fahre mit einer Hand an meinen Nackenknoten. »Und die Fähre … die bringt uns dann doch nach Neufundland?«
Duncan Sommerset lacht heiser auf. Dieses Lachen kommt so unerwartet, dass ich ihn fast schockiert anstarre. Vermutlich auch, weil mir dieses Lachen durch den ganzen Körper schießt, bis in Regionen, die ich eigentlich streng von meinem Chef fernhalten sollte. Verdammt.
Zu allem Überfluss nimmt er jetzt seine Sonnenbrille ab, die er wegen der tief in unserem Rücken stehenden Sonne auch wirklich nicht mehr braucht, und sieht mich an. Wir haben nahe der Hafenmole gehalten. Atemlos erwidere ich den Blick aus diesen hellgrauen Augen, die mir in diesem Moment eine Winzigkeit weniger kühl erscheinen als noch heute Vormittag, am JFK Flughafen. Mein Gott, war das wirklich heute? Seit wir stundenlang immer tiefer in diese Wildnis hineingefahren sind, erscheint es mir fast so, als ob ich das letzte gelbe New Yorker Taxi in einem früheren Leben gesehen hätte.
»Nein, nicht nach Neufundland.« Er ist plötzlich wieder ernst, und für einen kurzen Moment scheint er mein Gesicht aufmerksam zu studieren. Das macht mich so nervös, dass meine Hand erneut zu meinem Knoten im Nacken schnellt. Sein Blick flackert kurz dorthin, zu meiner immer noch tadellos sitzenden Frisur, bevor er mit einem Seufzer nach draußen sieht. »Wir nehmen die Fähre nach Whale Island.«