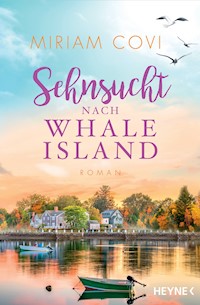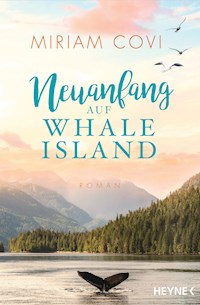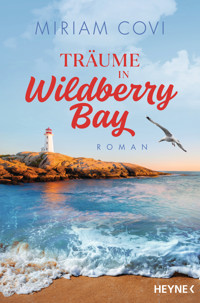
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wildberry-Bay-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Wo wilde Beeren wachsen und das Rauschen der Wellen Geschichten erzählt, liegt die Bucht unserer Träume – Willkommen in Wildberry Bay!
Ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag überrascht Florentine Schiller ihren Verlobten Jay inflagranti mit seinem Trauzeugen. Erschüttert flieht sie mit Jays Bruder Raven nach Wildberry Bay, um sich von dem Schock zu erholen. Hier haben sie und die beiden Brüder schon als Kinder gemeinsam ihre Ferien verbracht, bis zu einem schicksalshaften Tag, der ihre Familien auseinanderriss. Während Florentine in dem gemütlichen Fischerdorf mit Ravens Hilfe zur Ruhe kommt, wird ihr klar, dass sie und Jay nie mehr als beste Freunde waren. Und sie muss sich fragen, ob sie all die Jahre nicht gesehen hat, was sie Raven bedeutet hat und vielleicht noch immer bedeutet. Doch Raven ist bereits vergeben. Hat ihre Liebe überhaupt noch eine Chance?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 657
Ähnliche
Das Buch
»Mein Herz fühlt sich an, als hätte es jemand ausgepresst wie eine Zitrone und achtlos auf den Boden des Fischkutters geworfen. Ich werde nie mehr unseren Hochzeitsgästen gegenübertreten können, weil ich mich in Grund und Boden schäme. Immerhin habe ich nicht kapiert, dass mein Verlobter gar nicht auf Frauen steht!
Eine Welle führt dazu, dass ich das Gleichgewicht verliere und in Raven, den Bruder meines Bräutigams, hineintaumele.
›Du musst dich festhalten, Florentine‹, sagt er ruhig und legt einen Arm um meinen Oberkörper. Schweigend stehen wir nebeneinander, sehen auf den Horizont, wo sich die Uferlinie der Aspotogan-Halbinsel abzuzeichnen beginnt. Mein Blick gleitet über das tiefe Blau des Atlantiks und dann über das dunkle Grün der Küstenlinie in der Ferne.
›Wohin fahren wir?‹, frage ich, obwohl eigentlich klar ist, wohin. Und Raven bestätigt meine Vermutung: ›Nach Wildberry Bay.‹«
Die Autorin
Miriam Covi wurde 1979 in Gütersloh geboren und entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für zwei Dinge: Schreiben und Reisen. Ihre Tätigkeit als Fremdsprachenassistentin führte sie 2005 nach New York. Von den USA aus ging es für die Autorin und ihren Mann zunächst nach Berlin und Rom, wo ihre beiden Töchter geboren wurden. Nach vier Jahren in Bangkok lebt die Familie nun in Brandenburg. Zur zweiten Heimat wurde für Miriam Covi allerdings die kanadische Ostküstenprovinz Nova Scotia, in der sie viele Sommer ihrer Kindheit und Jugend verbringen durfte und wo sie heute auch immer wieder Inspiration für neue Romane findet.
Lieferbare Titel
978-3-453-42213-1 – Sommer in Atlantikblau
978-3-453-42271-1 – Sommer unter Sternen
978-3-453-42375-6 – Träume in Meeresgrün
978-3-453-42374-9 – Sehnsucht in Aquamarin
978-3-453-42569-9 – Heimkehr nach Whale Island
978-3-453-42570-5 – Neuanfang auf Whale Island
978-3-453-42571-2 – Sehnsucht nach Whale Island
MIRIAM COVI
TRÄUME IN
Roman
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 04/2024
© 2024 by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Diana Mantel
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München,unter Verwendung von © Huber Images (Pietro Canali),FinePic®, München, Getty Images (pranchai himakoon)
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-30639-7V001
www.heyne.de
Ich will nicht alles sagen
Nicht so viel erklären
Nicht mit so viel Worten
Den Augenblick zerstören
Aber eines gebe ich zu
Das was ich will bist du
Aus »Ohne Dich (schlaf’ ich heut Nacht nicht ein)«von Münchener Freiheit
Für Barbara (aka Babs oder Tante Barbie)
Danke für deine Freundschaft
Wer ist wer in Wildberry Bay
Florentine Schiller
Eltern Regina & Bernd Schiller
Brüder Raven & Jay Leblanc
Eltern Fern & Steve Leblanc
Gwendolyn Hobbs, geb. Walker
Eltern Debbie & Bob Walker
Neil McIntosh
Schwester Zoe McIntosh & ihr Sohn Elliott
Vater Jimm McIntosh, Pfarrer & Betreiber des Blue Gables Bed & Breakfast
Brüder Luke & Blake Cabot
Eliza Baker, Besitzerin des Bayview Diners & ihr Bruder Carl Baker
Noah Miller, Yogalehrer & Ferns Freund
Wildberry Bay WhatsApp-Gruppe
Freitag, 6. Juli 2018
Eliza Baker:Nicht vergessen, ihr lieben Wildbeeren: Heute bleibt ab 12 Uhr die Küche im Bayview Diner kalt. Wie die meisten von euch wissen, musste Brenda aus familiären Gründen ein paar Tage nach Calgary, und ich werde heute Nachmittag bei der Hochzeit von Jay und Florentine in Peggy’s Cove sein. Habt einen wunderschönen Freitag!
Harriet White:Wer sind Jay und Florentine?
Steve Leblanc:Jay ist mein Sohn, und Florentine ist seine deutsche Verlobte.
Harriet White:Ahh – danke, Steve. Ich habe deinen jüngeren Sohn ewig nicht hier gesehen. Habt eine tolle Hochzeitsfeier!
Pete O’Donell:Hilfe, wo bekomme ich dann heute Nachmittag meinen Blueberry Pie?
Zoe McIntosh:Pete, keine Sorge – es geht nur um die warme Küche. Blueberry Pie bekommst du wie gewohnt von mir. Bis später
1
Florentine
Die salzige Seeluft schlägt mir kühl entgegen, als ich das Lighthouse Inn verlasse. Eilig gehe ich die knarzenden Treppenstufen der Veranda hinab und trete auf den Bürgersteig der Küstenstraße. Auf der anderen Straßenseite bleibt eine Gruppe asiatischer Touristen stehen und fängt an, aufgeregt zu tuscheln und auf mich zu zeigen. Handys und Kameras werden gezückt, ich fühle mich wie ein Promi, den die Paparazzi entdeckt haben. Mit einem schiefen Lächeln wende ich mich ab, raffe mein Brautkleid mit beiden Händen hoch und beginne, im Laufschritt den Bürgersteig hinabzueilen. Wohin ich eigentlich will, kann ich nicht sagen. Vor mir erkenne ich das knallrote Holzhaus mit dem Eiscremeschild, vor dem sich eine Schlange aus Wartenden bis auf den Bürgersteig zieht. Da kann ich nicht vorbei, auf keinen Fall.
Was für eine Schnapsidee, hier draußen herumzuirren und meinen Bräutigam zu suchen! Eilig wende ich mich nach links, ich verlasse den Bürgersteig und haste über Gras und vereinzelte glatte Felsplateaus, die es überall im Fischerdorf von Peggy’s Cove gibt. Der Wind zerrt an meinem Schleier, lässt ihn hinter mir wie ein Segel wehen, sich aufblähen, tanzen. Mit den glatten Sohlen meiner Pumps komme ich auf einer abschüssigen Felsplatte beinahe ins Straucheln, schlittere ein paar Schritte mehr, als dass ich laufe, während ich mit meinen Armen rudernd versuche, das Gleichgewicht zu halten. Jetzt bloß nicht mit meinem weißen Kleid stürzen!
Erst als ich einen der hölzernen Piers erreiche, die an mehreren Stellen in die Meeresbucht des Fischerhafens von Peggy’s Cove hineinragen, halte ich an und ringe nach Atem. Die salzige Luft hat meinen flatternden Magen zwar ein wenig beruhigen können, aber dafür rast mein Herz jetzt nervös in meinem Brustkorb. Als der Wind eine Locke aus meiner Frisur zerrt, wird mir klar, dass selbst die Unmengen an Haarspray, in die die Friseurin mich eben eingenebelt hat, nichts gegen die Kräfte der Natur hier am Atlantik werden ausrichten können.
Aber momentan ist es mir völlig egal, ob meine Frisur noch perfekt sitzt oder nicht. Hastig sehe ich auf mein Telefon, beginne mit zittrigen Fingern, Jays Nummer zu wählen. Es klingelt. Es klingelt sehr lange. Aber niemand antwortet. Ich schlucke, beende den Anruf und gehe ein paar Schritte, nicht auf den Pier hinaus, sondern weiter am Ufer entlang, über die flachen Felsen. Vor mir erkenne ich ein paar der typischen Bootshäuser der Fischer von Peggy’s Cove. Sie sind aus Zedernholz gebaut, das mit den Jahren seine charakteristische Graufärbung annimmt, und an ihren Außenwänden trocknen Netze, während sich Berge aus bunten Bojen neben den Eingängen auftürmen. Der Geruch nach Fisch mischt sich mit dem nach Seetang und Ozean, und mein Magen muckt wieder ein wenig auf. Ich bleibe stehen, will nicht noch näher an die Netze und ihren Geruch herangehen. Erneut halte ich mir mein Telefon an mein Ohr, lausche auf das Freizeichen.
Bitte, geh ran, flehe ich Jay im Stillen an. Er wird doch nicht … Er würde mich doch nicht wirklich vor dem Altar – oder vor dem Leuchtturm – sitzen lassen, oder? Das würde Jay doch niemals machen?
Eine Möwe fliegt kreischend vorbei, ich sehe ihr hinterher und will den Anruf erneut mit einem frustrierten Seufzer beenden, als ich etwas höre. »… can’t fight this feeling anymore …«
Das ist Jays Klingelton! Eindeutig – den 80er-Jahre Softrock-Hit von REO Speedwagon liebt er!
Gedämpft wird der Song zu mir herübergetragen – aus der Richtung der Bootshäuser. Mein Herz hämmert noch schneller gegen meinen Brustkorb, als ich das Handy sinken lasse und mich den kleinen Hütten mit ihren Netzen und Bojen nähere. Was zum Teufel geht hier vor sich?
Ich habe Mühe, mein bauschiges, wolkenähnliches Brautkleid hochzuraffen und gleichzeitig nicht auf den rutschigen Felsen die Balance zu verlieren, während der Wind ausgelassen mit meinem Schleier spielt.
Als ich das erste der Bootshäuser fast erreicht habe, kommt ein Mann um die Hausecke. Sobald er mich erblickt, zuckt er regelrecht zusammen, bevor er wie angewurzelt stehen bleibt und mir schweigend entgegenstarrt.
Es ist Raven, Jays älterer Bruder. Und er sieht mich an, wie er mich schon seit unserer Kindheit so oft angesehen hat: mit dieser tiefen Furche zwischen seinen dichten schwarzen Augenbrauen, den Mund zu einer schmalen Linie zusammengepresst, die Kiefermuskulatur angespannt, als habe er Mühe, sich in meiner Gegenwart dazu durchzuringen, zivilisiert und halbwegs nett zu sein. Dass Raven mich nicht leiden kann, ist ihm stets so deutlich auf das Gesicht geschrieben, dass es fast komisch wirken könnte.
Aber jetzt gerade ist mir so gar nicht nach Lachen zumute. Raven zögert nur zwei Sekunden, dann geht er weiter, marschiert mit langen Schritten auf mich zu. Verstohlen mustere ich ihn, wie er sich nähert. Verdammt, Raven im schwarzen Anzug sieht noch besser aus als Raven in seinen sonst üblichen Bluejeans plus T-Shirt. In diesem Outfit, in Kombination mit seinem kurzen, leicht gelockten schwarzen Pferdeschwanz und dem wie üblich düsteren Gesichtsausdruck, den er stets für mich reserviert hat, erinnert er mich flüchtig an einen Mafiaboss. An einen schlecht gelaunten Mafiaboss.
»Was willst du hier?«, ruft er mir über den Wind entgegen, noch ehe er mich erreicht hat – oder ich ihn, wobei ich wesentlich langsamer über die Felsen vorankomme als Raven.
»Ist das echt das Erste, das du zu mir sagst, wenn du mich als Braut siehst?«, frage ich entrüstet, für einen Augenblick vom eigentlichen Thema abgekommen. Dieser Mann hat mich schon immer in den Wahnsinn getrieben – und zwar nicht im guten Sinne.
»›Was willst du hier‹?« Mit verschränkten Armen bleibe ich stehen und sehe ihm entgegen.
Raven hat mich erreicht und starrt mich so gut gelaunt an, als wäre ich seine Zahnärztin und er stünde kurz vor der Wurzelbehandlung. In seinen grünen Augen flackert etwas auf, das ich nicht einordnen kann, bevor sein Blick flüchtig über mein Kleid wandert. Seine Kiefermuskulatur arbeitet sichtbar, er atmet tief ein und aus. Als er mir wieder ins Gesicht schaut, sagt er betont ruhig, mit leicht gepresster Stimme: »Schönes Kleid. Komm bitte mit.«
Und ehe ich weiß, was er da tut, packt er meine Hand und will mich mit sich ziehen, fort von den Bootshäusern, zurück Richtung Pension.
»Nein!« Empört stemme ich mich gegen ihn, versuche entschlossen, auf der Stelle stehen zu bleiben, was wegen meiner rutschigen Schuhe und Ravens starkem Griff nicht so einfach ist. »Spinnst du eigentlich? Aua!«
Raven hält inne und lockert seinen Griff ein wenig, aber er lässt mich nicht los. Es gab Zeiten in meinem Leben, da hätte ich alles dafür getan, Ravens Hand halten zu dürfen. Aber jetzt gerade ist mir wirklich nicht nach Händchen halten zumute. »Ich suche Jay«, stoße ich aufgebracht hervor. »Weißt du, wo er ist?«
Raven antwortet nicht, doch seine Kiefermuskulatur spannt sich erneut an. Ernst mustere ich ihn. »Raven, bitte! Ich muss Jay finden und ihn sprechen!«
»Warum?«
»Warum?«, wiederhole ich fassungslos und deute erneut auf mein Wolkenkleid. »Darum! Weil ich ihn in …«, ich sehe kurz auf mein Telefondisplay und schnappe hektisch nach Luft, »in zehn Minuten am Leuchtturm treffen sollte. Um ihn zu heiraten – und er ist nicht auffindbar! Außerdem muss ich ihn vor der Trauung dringend sprechen, aber er geht nicht an sein verdammtes Telefon!«
Kurz halte ich inne, weil mir wieder klar wird, warum ich überhaupt dichter zu den Bootshäusern wollte. Raven, in seinem Mafioso-Outfit, hat mich für einen Moment völlig aus der Bahn geworfen. Mal wieder. Wann hört das endlich auf?
Fast triumphierend schwenke ich das Telefon in meiner freien Hand und verkünde: »Ich habe eben Jays Klingelton gehört! Da, bei den Bootshäusern. Er muss dort sein.«
Ich will erneut auf das erste der kleinen, grau geschindelten Häuser zugehen, doch Raven verstärkt wieder seinen Griff um mein Handgelenk und bleibt unerbittlich stehen. Als ich ihn ungläubig ansehe, erwidert er meinen Blick schweigend und noch ernster als sonst.
Da endlich verstehe ich. Vermutlich hat mir mein Wolkenkleid zu sehr die Luft abgeschnürt, als dass ich klar hätte denken können. Für einen Moment kehrt die Übelkeit mit voller Wucht zurück, ich schließe meine Augen und ringe nach Luft. Dann sehe ich Raven an und stoße hervor: »Du weißt, wo er ist, oder? Was ist mit ihm? Was verheimlichst du mir?«
Ich sehe genau, wie es in Raven arbeitet. Seine Kiefermuskulatur bewegt sich, seine Nasenflügel blähen sich leicht, die Linie seiner Lippen wird noch schmaler. Ravens Griff um mein Handgelenk verstärkt sich noch einmal.
»Lass mich los, du tust mir weh«, wispere ich tonlos. Sein Blick flackert zu meinem Handgelenk, und sofort lockert er seinen Griff wieder.
»Komm bitte mit, wir …«, setzt er an, ohne auf meine Fragen einzugehen. Da drehe ich mich blitzschnell um, entreiße meinen Arm seiner Hand und stoße ihn rückwärts, damit er mich gehen lässt. Raven starrt mich verblüfft an, rudert mit den Armen und versucht, auf den glatten Felsen nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Ich nutze dieses Überraschungsmoment und renne los. Fast hätte ich selbst das Gleichgewicht verloren und wäre gefallen, aber ich fange mich und eile über die Felsplateaus, so schnell es meine Pumps zulassen. Mein Schleier fühlt sich an, als würde ich ein Segel hinter mir herziehen, und ich bin überzeugt davon, dass die Haarnadeln jeden Moment aufgeben und der Spitzenstoff vom Wind davongetragen wird.
»Florentine!«, höre ich Ravens aufgebrachte Stimme hinter mir, begleitet von seinen Schritten auf den Felsen. Er ist so ziemlich der Einzige der Kanadier in meinem Leben, der mich immer bei meinem vollen Namen nennt, allerdings spricht er ihn Englisch aus, sodass es wie Florentein klingt. Ich versuche immer wieder zu ignorieren, wie gut es mir gefällt, Florentein zu sein.
Entschlossen renne ich schneller, taumele und haste in einer Wolke aus Stoff vorwärts. Am ersten Bootshaus will ich schon die Tür aufreißen, doch dann kommt mir ein Gedanke: Raven ist um die Ecke dieses Häuschens marschiert, als ich ihn gesehen habe – das heißt, er war im Haus schräg dahinter.
Dort muss auch Jay sein. Mein Herz hämmert mit einer Mischung aus Entschlossenheit und wachsender Panik gegen meinen Brustkorb, während ich die letzten Meter zum nächsten Bootshaus zurücklege. Doch ich schaffe es nicht. Raven erreicht mich kurz vor der Tür zum zweiten Bootshaus. Seine Arme schlingen sich von hinten um mich, er hält mich in einem eisernen Griff fest, und ich höre seine Stimme dicht an meinem Ohr: »Tu das nicht. Bitte.«
Tränen schießen mir in die Augen, während ich nach Luft ringe.
»Ist er mit einer Frau da drinnen?«, frage ich und klinge fast etwas hysterisch, den Blick starr auf das Bootshaus vor uns gerichtet. »Ist Jay mit einer Frau da drinnen?«
»Nein«, wispert Raven an meinem Ohr. Ich finde es erstaunlich, dass mein Körper in dieser Situation die Zeit findet, eine Gänsehaut zu bekommen. Mein Körper kann es sich einfach nicht abgewöhnen, so auf Raven zu reagieren. Ich hoffe sehr, dass er irgendwann begreift, dass Raven nicht das Objekt meiner Sehnsüchte sein kann. Und ich hoffe sehr, dass ich nicht auch noch als alte Frau nachts aus einem erotischen Traum hochschrecke und zu meinem Entsetzen feststelle, dass ich schon wieder von dem Mann geträumt habe, der mich wie ein lästiges Insekt behandelt.
»Nein?«, wiederhole ich leise und drehe mich so, dass ich Raven ansehen kann. Er weicht meinem Blick aus, aber sein Kiefer ist jetzt so angespannt, dass klar wird, wie er sich fühlt.
Er verheimlicht etwas vor mir. Er schützt seinen Bruder.
»Lass uns gehen, Florentine«, sagt er leise.
Ich starre Raven an. Aus dieser Nähe erkenne ich deutlich seine dichten schwarzen Wimpern und den dunklen Rand um das tiefe Grün seiner Iris. Raven kann mich nicht ansehen, er starrt stur geradeaus, auf die geschlossene Tür.
»Was ist in dem Haus?«, frage ich mit bebender Stimme. Ravens linkes Augenlid zuckt ein wenig.
»Fischernetze«, sagt er leise.
Da brennt eine Sicherung bei mir durch. Die Wut verleiht mir ungeahnte Kräfte – und Raven hat ganz offensichtlich nicht damit gerechnet, zum zweiten Mal an diesem Tag so von mir zurückgestoßen zu werden. Er taumelt einen Schritt nach hinten, während ich nach vorne schieße und die Tür zum Bootsschuppen aufreiße.
Ja, da sind Fischernetze. Sie liegen aufgerollt auf dem Boden, der fischige Geruch verschlägt mir für einen Moment den Atem.
Aber da ist auch Jay, mein Beinahe-Ehemann. Und während ich Jay ungläubig anstarre, wünsche ich mich zurück in die Honeymoon Suite im Lighthouse Inn, wo meine Welt gerade eben noch relativ in Ordnung war.
2
Ungefähr eine halbe Stunde vorher
Ich sehe aus wie ein fluffiger Wolkenberg, denke ich, als ich in den bodentiefen Spiegel der Honeymoon Suite im Lighthouse Inn blicke. Immerhin wie ein Berg aus Gute-Wetter-Wolken in strahlendem Weiß, aber eben auch fluffig. Zu fluffig – zumindest, wenn man, wie ich, eher klein ist. Und nicht unbedingt gertenschlank. Warum mir das erst jetzt aufgeht, eine knappe halbe Stunde bevor ich in diesem Wolkenkleid Richtung Leuchtturm schreiten werde, kann ich beim besten Willen nicht sagen.
Als ich dieses Kleid in der kleinen Brautmodenboutique in meiner Heimatstadt München anprobiert habe, war ich überzeugt davon, dass es mein Traumkleid ist. Ich wusste auch sofort, dass Jay es lieben würde. Mein Verlobter wird dieses Kleid auf keinen Fall zu fluffig finden. Und der Spitzenschleier, der sich über meine nackten Schultern bis auf den glänzenden Holzfußboden ergießt, wird ihm garantiert nicht zu pompös sein – nicht so wie mir mit einem Mal. Und die kleinen Rosenblüten aus hellrosa Seide, die die Friseurin vor einer Stunde in meine kunstvoll hochgezwirbelten hellblonden Locken gesteckt hat, sind genau nach Jays Geschmack. Immerhin liebt er dieses Rosa, weshalb ich meine Nägel in derselben Farbe (»Ballettschuh«) lackiert habe, und auch mein Brautstrauß besteht aus wunderschönen Rosen in diesem Farbton.
Warum also bin ich trotzdem so unsicher, jetzt, da ich mich im bodentiefen Spiegel zum ersten Mal als Braut mit allem Drum und Dran betrachte? Wenn ich doch genau weiß, dass Jay mich so, wie ich aussehe, wunderschön finden wird – warum finde ich selbst mein Wolkenkleid dann mit einem Schlag absolut katastrophal und habe das Gefühl, in dem eng anliegenden Stoff keine Luft mehr zu bekommen? Der Schleier zieht schwer und unangenehm an den Haarnadeln in meinen Locken, und meine neuen weißen Satinpumps fühlen sich viel unbequemer an als noch vor wenigen Wochen, beim Anprobieren in dem Münchener Schuhgeschäft. Sogar der Duft der Rosen, den ich sonst über alles liebe, ist mit einem Mal zu viel für mich. Ich muss mich von der Vase mit dem Brautstrauß, die neben dem Spiegel auf einer Kommode steht, abwenden und kurz die Augen schließen, um die aufsteigende Übelkeit zu bekämpfen.
Meiner Mutter entgeht das natürlich nicht. Sie mustert mich mit forschendem Blick und fragt sanft: »Aufgeregt?«
Ich nicke und ringe mir ein gequältes Lächeln ab. Aufgeregt. Ja, das wird es sein. Haben nicht alle Bräute kurz vor dem großen Moment furchtbares Lampenfieber? Immerhin werde ich vor vielen versammelten Menschen – vor unseren Familien, einigen Freunden und ganz sicher zahlreichen neugierigen Touristen – über die dramatischen Felsplateaus von Peggy’s Cove schreiten, auf den berühmten Leuchtturm zu, der stolz am Ufer des rauen Atlantiks aufragt. Eben weil dieser Leuchtturm ein so bekanntes Reiseziel an der kanadischen Ostküste ist, werden garantiert Dutzende Urlauber aus aller Welt beobachten, wie ich dort, am Fuß des Leuchtturms, meinem geliebten Jay das Jawort gebe.
Die Übelkeit wird stärker, und ich habe das dringende Gefühl, frische Luft schnappen zu müssen.
»Ja, ganz schön aufgeregt«, murmele ich und zwinge ein weiteres Lächeln auf meine Lippen. Mama nickt mir aufmunternd zu. Sie strahlt so viel Ruhe aus, wie sie in ihrem knielangen Kleid aus meeresgrüner Seide neben dem Bett steht und meine Klamotten, die ich gegen das Brautkleid getauscht habe, faltet. Ganz so, als wäre dies ein völlig normaler Sommertag an Kanadas Atlantikküste.
»Alle Bräute sind wahnsinnig aufgeregt, bevor es zum Altar geht«, sagt sie in ihrem sanften Tonfall, den ich noch von früher kenne, wenn ich nachts nach einem Albtraum in das Ehebett meiner Eltern geflüchtet bin. »Oder, in deinem Fall, bevor es zum Leuchtturm geht.«
Lachend legt Mama meine gefaltete Jeans auf einen Stuhl neben dem Bett und sieht mich dann an. »Als ich deinen Vater damals geheiratet habe, hatte ich kurz vor der Kirche das Gefühl, mich übergeben zu müssen.«
Sie streicht sich eine ihrer Locken, die sich aus ihrer Hochsteckfrisur gelöst hat, aus der Stirn. Mein Haar habe ich ganz und gar von Mama geerbt: Hellblond und unbändig, wobei ihres inzwischen von viel Grau durchwebt wird. Dafür komme ich figürlich leider nicht nach ihr, denn meine Mutter ist einen guten Kopf größer als ich und sehr schlank (ihr würde mein Wolkenkleid hervorragend stehen!). Sie überragt nicht nur mich, sondern auch meinen Vater, von dem ich meine Statur geerbt habe.
»Ja, so geht es mir auch«, gestehe ich erleichtert. Mama versteht mich tatsächlich wie keine andere. »Ich habe auch das Gefühl, mich jeden Moment übergeben zu müssen.«
»Wobei ich ja damals kurz nach der Hochzeit gemerkt habe, dass das nicht die Nerven waren, sondern dass du unterwegs warst«, fügt Mama hinzu und wirkt mit einem Mal beinahe melancholisch, während sie mein gefaltetes T-Shirt auf die Jeans legt.
Richtig. Als meine Eltern geheiratet haben, war Mama bereits mit mir schwanger, ohne es zu ahnen. Ich lache auf, doch als sie plötzlich ganz ernst wird und ihr Blick zu meiner Taille huscht, vergeht mir das Lachen.
»Nein!«, erkläre ich vehement. »Ich bin nicht schwanger. Wirklich nicht.«
Das weiß ich tatsächlich ganz genau. Mamas Augenbrauen wandern leicht in die Höhe, und sie mustert mich amüsiert. »Das habe ich auch gar nicht gesagt«, schmunzelt sie. »Wobei Verhütungsmittel natürlich durchaus mal versagen können, also, wer weiß …«
»Doch, ich weiß es«, beharre ich stur und starre wieder in den Spiegel. Schräg hinter mir sehe ich das Spiegelbild meiner Mutter, die sich vom Stuhl mit meinen Klamotten abgewandt hat und schon wieder skeptisch meine Mitte in Augenschein nimmt. Nein, ich habe nicht unbedingt einen flachen, durchtrainierten Bauch. Aber ich bin trotzdem nicht schwanger.
Und dann rutscht mir unser Geheimnis heraus. Das Geheimnis, das zwischen Jay und mir bleiben sollte – aus gutem Grund. Ich schiebe es auf meine angespannten Nerven, dass mir die Worte einfach so über die Lippen gleiten. Auf die Übelkeit und auf die Tatsache, dass ich in dem Wolkenkleid zu wenig Luft bekomme. Akuter Sauerstoffmangel im Hirn, ja, das wird es sein.
»Jay und ich … wir haben noch nicht miteinander geschlafen.«
Als mein Blick im Spiegel dem meiner Mutter begegnet und ich die Fassungslosigkeit darin erkenne, wird mir wieder voll bewusst, warum Jay und ich niemandem davon erzählen wollten: Weil wir befürchtet haben, dass es niemand versteht. Und dass diese Befürchtung berechtigt war, merke ich an der Art, wie Mama versucht, nicht allzu entsetzt zu wirken. Ich kenne sie zu gut, als dass mir das entgehen würde.
»Ihr … hattet noch nie … Sex?«, hakt sie vorsichtig nach, und ihre Wangen färben sich rosig.
»Ähm. Nein.« Ich räuspere mich. »Also – natürlich hatten wir schon Sex! Aber eben nicht … miteinander.«
»Ach du meine Güte.« Mama lässt sich langsam auf das blau gemusterte Sofa neben dem bodentiefen Spiegel sinken. Ich lache nervös auf.
»Komm schon, jetzt tu bitte nicht so, als wäre das etwas ganz Furchtbares!«, sage ich betont munter, obwohl die Übelkeit auf einmal so stark wird, dass ich mir am liebsten das Kleid vom Leib reißen würde, um tief durchatmen zu können. »Früher war es normal, dass man vor der Hochzeit nicht miteinander ins Bett gegangen ist!«
»Früher war es auch normal, dass man Wäsche von Hand waschen musste und an Scharlach gestorben ist!«
Bei Mamas Worten lache ich erneut auf, aber sie bleibt immer noch ernst.
»So, hier ist dein Getränk«, höre ich da Gwendolyns Stimme, und meine Freundin und Brautjungfer kommt ins Zimmer. Richtig, als ich ihr gegenüber erwähnt habe, dass mir schummerig war, hat sie sofort angeboten, bei der netten Wirtin nach einer kalten Coca-Cola zu fragen. Strahlend hält sie mir nun die rote Dose entgegen, und erst, als ich nicht sofort reagiere, scheint sie zu realisieren, dass die Stimmung nicht mehr wirklich entspannt ist. Fragend sieht sie von mir zu Mama und wieder zu mir.
»Ist alles okay?«
»Ja, alles okay«, versichere ich rasch. »Mir ist inzwischen einfach richtig übel, du weißt schon, vor lauter Aufregung … und da dachte Mama, ich sei vielleicht schwanger …« Eilig presse ich meine Lippen aufeinander, doch die Worte sind schon darübergerutscht. Betroffen mustere ich meine Freundin. Gwen lächelt mich tapfer an, so wie sie immer alles wegzulächeln versucht. Dass das Thema Schwangerschaft sie sehr mitnehmen dürfte, merkt man ihr nicht an, als sie mir weiterhin geduldig die Cola-Dose entgegenhält und sagt: »Na, dann trink mal ein bisschen, vielleicht hilft das gegen die Übelkeit. Zumindest durfte ich als Kind immer Coke trinken, wenn ich Magen-Darm hatte. Aber ganz vorsichtig, kleckere bloß nicht!«
Besorgt mustert Gwen mein blütenweißes Wolkenkleid. »Warte, ich schenke dir lieber ein Glas ein.«
Natürlich weiß sie genau, dass ich nicht die geschickteste Person auf diesem Planeten bin. Vermutlich sollte ich das Risiko, in diesem Kleid Coca-Cola zu trinken, tatsächlich nicht eingehen. Es ist ohnehin ein Wunder, dass ich bisher noch so makellos aussehe.
Mama mustert mich nach wie vor schweigend vom Sofa aus, und mein Magen wird immer nervöser. Dankbar greife ich nach dem Glas, als Gwen es mir vorsichtig reicht, und nehme einen großen Schluck. Kurz schließe ich die Augen und lasse das kalte Getränk prickelnd meine Speiseröhre hinabrinnen, bevor ich Mama wieder ansehe und mit Nachdruck sage: »Jay ist mein bester Freund, und ich liebe ihn von ganzem Herzen. Nur weil wir uns den Sex bis nach der Hochzeit aufheben, heißt das doch nicht, dass wir keinen Sex haben wollen!«
Mamas Augenbrauen wandern ein wenig in die Höhe, ihre Wangen werden noch rosiger. Gwen stellt die Cola-Dose auf dem Schminktisch ab, wo ich vorhin gesessen habe, als die Friseurin die Rosenknospen in mein Haar gesteckt hat. Aus weit aufgerissenen hellblauen Augen starrt mich meine Freundin an.
»Wie jetzt?«, flüstert sie und sieht sich zur Tür um, als fürchte sie, dass jeden Moment weitere Hochzeitsgäste hereinkommen könnten. »Ihr habt noch nie …?«
Mit einem tiefen Seufzen rolle ich die Augen gen Zimmerdecke und schüttele den Kopf. »Nein. Haben wir noch nicht. Wir wollten, dass es nach der Hochzeit etwas ganz Besonderes wird. Darum habe ich ja auch so sexy Spitzenwäsche unter diesem Kleid an und quäle mich mit halterlosen Seidenstrümpfen herum, die sich bestimmt über meine Schenkel abwärtsrollen, während ich auf den malerischen Leuchtturm von Peggy’s Cove zulaufe!«
Ich habe gehofft, dass die beiden lachen würden. Aber das tun sie nicht. Mama und Gwen sehen aus, als wüssten sie nicht wirklich, was sie sagen sollen. Mein Magen meldet sich schon wieder mit Nachdruck zu Wort. O Gott, hoffentlich spucke ich am Ende nicht tatsächlich mein Wolkenkleid voll! Wenn ich nicht wüsste, dass ich nicht schwanger sein kann, würde ich es glatt selbst glauben.
»Flo«, sagt Gwendolyn jetzt sanft und tritt neben mich. Stumm starre ich meine Kindheitsfreundin im bodentiefen Spiegel an. Genau wie Mama überragt mich auch Gwen um einen guten Kopf und ist wesentlich schlanker als ich – was heute noch einmal dadurch betont wird, dass der luftige Chiffonstoff ihres mauvefarbenen Brautjungfernkleides sie schmeichelhaft umfließt und wie eine Elfe aussehen lässt. Neben ihr wirke ich wie ein kleiner Wattebausch. Gwens Haar, das von der Friseurin zu einem eleganten Nackenknoten gesteckt worden ist, glänzt wie eine Kastanie. Schon seit meiner Kindheit haben mich die schönsten Exemplare der Kastanien, die ich im Herbst in München aufgesammelt habe, immer an das Haar meiner kanadischen Freundin erinnert.
»Flo«, sagt sie noch einmal und mustert ernst mein Spiegelbild. Ich hole tief Luft.
»Ja?«
»Bist du dir ganz sicher, dass Jay und du … das Richtige tun?«
»Ja!« Ich drehe mich zu Gwen um und sehe sie aufgebracht an. »Fragst du das jetzt wirklich nur, weil wir noch keinen Sex hatten?«
»Wer hatte noch keinen Sex?«
Mit einem leisen Stöhnen schaue ich an Gwen vorbei zur Zimmertür, die gerade schwungvoll aufgeht. Fern kommt herein und mustert mich neugierig. Wenn ich in diesem Moment jemanden nicht sehen will, dann ist es meine Fast-Schwiegermutter.
»Niemand«, will ich rasch das Schlimmste verhindern, doch es ist zu spät. Jays Mutter hat Lunte gerochen, und mir ist klar, dass sie nicht lockerlassen wird. »Kannst du bitte die Tür zumachen? Sonst sieht mich Jay noch vor der Trauung«, bitte ich sie nervös und muss mich sehr zusammenreißen, um nicht an meinen Fingernägeln zu nagen und meinen wunderschönen »Ballettschuh«-Nagellack zu ruinieren.
»Es wäre ja nett, wenn Jay hier auftauchen würde, dann wüssten wir wenigstens, wo er ist«, bemerkt Fern trocken und schiebt die Zimmertür mit ihrer Hüfte zu. Ratlos starre ich sie an.
»Jay ist weg?« Okay, jetzt muss ich mich echt jeden Moment übergeben!
3
»Ach du meine Güte, nein, natürlich nicht ›weg‹ – nur eben nicht da, wo er sein sollte«, meint Fern so nervtötend tiefenentspannt, dass ich schreien könnte. »Du siehst übrigens wunderhübsch aus, Flo. So wolkig.«
Ich kann jetzt nicht über mein Kleid nachdenken, sondern hake atemlos nach: »Jay ist noch nicht auf dem Weg zum Leuchtturm?«
Fern schüttelt den Kopf. »Noch nicht. Nein. Aber jetzt reg dich bloß nicht auf. Bestimmt ist er auch nervös und macht einen kleinen Spaziergang, um den Kopf freizubekommen.«
Sie mustert mich eingehend. Ihr graues Haar, früher schwarz wie das ihrer Söhne, ist zu zwei langen Zöpfen geflochten, und ihre großen bunten Ethnoohrringe in Kombination mit ihrem bodenlangen Kleid aus roséfarbenem Batikstoff lassen sie auch mit über sechzig wie einen Bilderbuch-Hippie wirken.
»Jetzt wird mir auch klar, warum ihr zwei so extrem angespannt und nervös seid.«
Fragend sehe ich Fern an, während ich einen weiteren Schluck Cola nehme.
»Sex-Entzug ist nicht gut für die Nerven, meine Liebe.«
Überrascht huste ich los. Leider habe ich meine Cola noch nicht ganz runtergeschluckt, was dazu führt, dass ich eine Fontäne aus kleinen braunen Tropfen versprühe, bevor ich mir panisch beide Hände vor das Gesicht schlage und versuche, meinen Hustenreiz unter Kontrolle zu bekommen.
»Ist das Kleid dreckig?«, fiepe ich zwischen meinen Fingern hindurch und wage es nicht, nach unten zu schauen.
»Nein«, lügt Mama hektisch. Ich höre sofort, wenn sie nicht die Wahrheit sagt, sondern stattdessen versucht, mich mit einer Notlüge abzuspeisen. Ehe ich die Chance habe, nach unten zu sehen und den Schaden zu begutachten, ist sie schon dabei, mit einem feuchten Taschentuch über meine Brust zu rubbeln. Ich lasse meine Hände sinken und starre Gwen an, die meinen Blick stumm erwidert. Fern scheint noch nicht fertig zu sein. Sie schnalzt mit der Zunge und sagt: »Und dieses süße Teufelszeug, das du da in dich hineinkippst, ist auch tödlich für die Nerven! Aber auf mich hört ja keiner.« Mit einem Kopfschütteln sieht sie mich an. »War das Jays Idee oder deine?«
»Die Coke?«, hake ich schwach nach, während meine Mutter immer noch den Stoff bearbeitet. Fern rollt mit den Augen. »Nein, der ›Wir-warten-bis-zur-Hochzeitsnacht‹-Blödsinn!«, erwidert sie und spielt mit dem guten Dutzend Holzperlenarmbändern an ihrem Handgelenk. Mein Blick fällt flüchtig auf das filigrane Tattoo eines Farnblatts, das sich von ihren Pulsadern über ihren linken Unterarm bis in die Ellenbeuge zieht. Ihren Namen – Fern – hat sie sich wegen ihrer Lieblingspflanze selbst gegeben. Eigentlich heißt Jays Mutter Angela, aber ich habe noch nie gehört, dass sie so genannt wurde. Ihre Liebe zur Natur und ihr Hippie-Lebensgefühl zeigen sich auch in den Namen, die sie ihren Söhnen gegeben hat (nachdem deren nicht ganz so hippiemäßiger Dad davon überzeugt worden war): Sie sind beide nach Vögeln benannt. Jay nach den Blau- und Eichelhähern dieser Region – im Englischen »Canada Jay« beziehungsweise »Blue Jay« genannt – und Raven nach den Raben, und dieser Name passt so gut zu ihm, mit seinem pechschwarzen Haar.
Aber um Raven geht es momentan gar nicht.
»Das war … Jays Idee«, sage ich leise.
Wobei … im Grunde genommen haben wir es beide so gewollt. Er war nur derjenige, der es laut ausgesprochen hat. Wenn man so lang gut befreundet ist wie wir, ist es nun einmal schwierig, von der platonischen Ebene auf eine sexuelle zu wechseln.
Das war auch der Grund, warum viele in unserem Umfeld so skeptisch reagiert haben, als wir ihnen von unseren Hochzeitsplänen erzählt haben: unsere lange Freundschaft.
Jay und ich sind befreundet, seit wir vier Jahre alt waren. Mit dreißig haben wir auf Gwens Hochzeit in betrunkenem Zustand den Pakt geschlossen, dass wir, wenn wir mit fünfunddreißig noch Single wären, heiraten würden.
Anfang dieses Jahres haben wir uns deshalb verlobt, denn wir waren inzwischen beide fünfunddreißig, allein und frustriert. Ich wollte kein einziges erstes Date mehr ertragen, und Jay ging es auch so. Noch dazu hat meine biologische Uhr seit meinem dreißigsten Geburtstag immer lauter und penetranter getickt, was mich zunehmend verzweifelt nach einem Partner hat suchen lassen – nicht unbedingt die beste Voraussetzung für entspanntes Dating, und darum war daran irgendwann natürlich rein gar nichts mehr entspannt. Jay möchte auch Kinder haben, und wir verstehen uns mit fünfunddreißig immer noch so gut wie damals als Vierjährige und wie in all den Jahren danach.
Warum also nicht heiraten und gemeinsam eine Familie gründen? Es gibt doch wirklich blödere Voraussetzungen für eine Ehe, oder? Wenn man zum Beispiel nur heiratet, weil man so scharf aufeinander ist, glaube ich kaum, dass man glücklich bleibt, bis man alt und grau ist. Zumindest nicht, wenn man nicht noch andere Gemeinsamkeiten findet als nur Sex.
Und, ja, Jay und ich haben Gemeinsamkeiten. Wir lieben dieselben Netflix-Serien, können über dieselben blöden Witze lachen, bis wir heulen, gehen beide gern zum Chinesen und teilen uns dort grundsätzlich unsere Gerichte, weil wir die Dinge, die der andere bestellt, auch liebend gern essen. Wir ergänzen uns also perfekt, ja, wir gehen sogar gern zusammen Klamotten shoppen, und wer kann das schon von seinem Verlobten behaupten?
Doch jetzt gerade ist mir völlig klar, dass Fern nicht an Gemeinsamkeiten wie chinesisches Essen, Netflix und Shopping denkt. Der Blick aus ihren wachen grünen Augen scheint mich zu durchbohren.
»Und du findest das normal? Dass zwei erwachsene und nicht besonders religiöse Menschen mit einem gesunden Sexualtrieb im 21. Jahrhundert auf die Idee kommen, bis nach ihrer Hochzeit enthaltsam zu bleiben?«
»Fern, bitte«, wirft meine Mutter ein und richtet sich auf. Mein Blick flackert nach unten, und zu meiner Erleichterung stelle ich fest, dass nur ganz schwach ein paar hellbraune Sprenkel zu erkennen sind. Die sieht man bestimmt nicht, wenn man nicht gerade mit der Nase an meiner Brust klebt.
»Aber es ist doch wahr!« Fern zwirbelt einen ihrer langen Zöpfe um ihre Finger. »Sex ist gesund! Und er gehört in eine Liebesbeziehung! Wie kannst du meinen Sohn heiraten, ohne zu wissen, wie er im Bett ist?«
»Fern!« Mamas Gesicht wird immer rosiger. Sie fängt an, sich Luft zuzufächeln. »Findest du nicht auch, dass es etwas spät für diese Unterhaltung ist? Die zwei können ja wohl kaum jetzt noch testen, ob sie im Bett gut zusammenpassen! Keine zwanzig Minuten vor der Trauung!«
Keine zwanzig Minuten mehr? Ach du meine Güte! Hektisch nehme ich einen weiteren Schluck Cola.
»Na ja, ich vermute mal ganz stark, dass sie nach all der Enthaltsamkeit weit weniger als zwanzig Minuten brauchen würden«, murmelt Fern mit einem süffisanten Grinsen. Ich starre meine Fast-Schwiegermutter fassungslos an.
»Du bist nicht hilfreich«, bemerkt Gwendolyn und fixiert Fern streng. »Wir sollten die arme Flo beruhigen und nicht noch nervöser machen, als sie ohnehin schon ist!«
Meine geliebte Freundin sieht mich an und sagt mit Nachdruck: »Flo, du kennst Jay schon ewig, ihr zwei gehört zusammen – und er sieht blendend aus, wieso sollte der Sex mit ihm nicht gut sein? Habe ich recht?«
Erleichtert nicke ich und lächele meine Freundin dankbar an. »Genau. Du hast recht. Alles wird gut. Und an unsere Hochzeitsnacht werden wir uns auf jeden Fall erinnern!«
Fern schnalzt leise mit der Zunge, schweigt jedoch. Irritiert sehe ich sie an. »Wolltest du noch etwas sagen?«
Sie sieht mich mit einem nachsichtigen Lächeln an. »Mir ist nur gerade mein erster Freund eingefallen. Max Miller. Ein Bild von einem Mann. Aber eine Katastrophe im Bett.«
»Fern!«
Meine Mutter und Gwen rufen ihren Namen im Chor, und ich muss fast lachen, trotz meiner erneut aufflammenden Übelkeit.
»Willst du nicht, dass ich deinen Sohn heirate, Fern?«, frage ich stattdessen ernst. Sie erwidert meinen Blick, ebenso ernst.
»Ich bin wirklich nicht sicher, ob ich will, dass du Jay heiratest«, sagt sie dann langsam, und ihre Ehrlichkeit haut mich um. Sprachlos starre ich sie an.
»Wie bitte?«, hakt Gwen für mich nach. »Was soll das? So kurz vor der Trauung?«
Fern sieht meine Freundin nicht an, sondern mustert nur mich eingehend. »Wenn ihr zwei euch ganz sicher seid, dass ihr absolut verrückt nacheinander seid, dass ihr nicht ohne einander leben und atmen könnt und dass ihr bis ans Ende eures Lebens gemeinsam durch dick und dünn gehen wollt und nicht die Finger voneinander lassen könnt – dann habt ihr meinen Segen, Flo.«
»Danke«, stoße ich matt hervor. »Das … ja. Danke.«
Ich will sie fragen, warum sie das erst jetzt so gesagt hat. Ob sie mich wirklich dazu bringen will, mich auf mein Wolkenkleid zu übergeben. Doch ich komme nicht dazu, weil es an der Tür klopft und schon das nächste vertraute Gesicht hereinschaut.
»Mom«, sagt Gwen und macht einen Schritt auf die Tür zu. »Wir sind gleich so weit.«
»Ähm, mhhm«, macht Debbie, und ich höre sofort heraus, dass etwas nicht in Ordnung ist.
»Debbie?« Ich wende mich von Fern ab und sehe Gwens Mutter fragend an.
»Ähm, ich wollte eigentlich Fern sprechen«, windet sich Debbie. Ihr nach wie vor dunkelbraun gefärbtes Haar, das eigentlich wohl grau wie Ferns wäre, ist wie immer zu einem makellosen Bob geföhnt. Ihr korallenrotes, ärmelloses Cocktailkleid betont ihre durchtrainierten Oberarme und ihre braun gebrannten Beine. Man sieht Debbie an, dass sie eigentlich in Florida lebt und dort den lieben langen Tag mit ihrem zweiten Ehemann Tennis und Golf spielt. Als Kosmetikerin hat sie schon ewig nicht mehr gearbeitet, weil sie dank ihres ziemlich wohlhabenden Gatten längst nicht mehr arbeiten muss.
»Ja, ich komme schon«, sagt Fern und will auf die Tür zugehen, doch ich bin schneller. Mit raschelndem Wolkenkleid schiebe ich mich zwischen Fern und Debbie und frage: »Ist es wegen Jay? Wo ist er?«
Debbie kaut auf ihrer ebenfalls korallenrot geschminkten Unterlippe herum und sagt hilflos: »Ähm … wir suchen ihn …«
Da reicht es mir. Das ist alles zu viel. Die Nervosität, das mich einschnürende Wolkenkleid, das Entsetzen der anderen, weil wir noch keinen Sex hatten, und jetzt ist Jay weg? Ich muss aus diesem Zimmer raus. Muss an die frische Luft, muss versuchen, meine Übelkeit und meine wild in mir hochwallenden Ängste in den Griff zu bekommen.
Ich muss Jay finden, um mit ihm zu sprechen. Ich bin mir sicher, dass alles gut sein wird, wenn er mich in die Arme nimmt und mir versichert, dass wir das Richtige tun. Wir werden gemeinsam darüber lachen, und dann werden wir zum Leuchtturm gehen und uns das Jawort geben. So, wie wir es uns schon so oft ausgemalt haben.
Immerhin bin ich extra wegen Jay vor gerade mal zwei Wochen endgültig nach Kanada gezogen, in seine Wohnung in Halifax, der Hauptstadt der kanadischen Atlantikprovinz Nova Scotia. Vor einem Monat habe ich meine Arbeitserlaubnis bekommen, und kurz nach unserer Hochzeit werde ich meine Stelle als Konditorin in einer Bäckerei in Halifax antreten. Alles läuft nach Plan – und unsere Hochzeit wird da ganz sicher keine Ausnahme bilden!
»Wo willst du hin?«, fragt mich Gwen überrascht, als ich mir mein Telefon schnappe, das noch auf dem Schminktisch liegt, und mich der Tür zuwende.
»Ich muss an die frische Luft«, erkläre ich hastig und öffne die Tür weiter. Debbie macht rasch einen großen Schritt zur Seite, um Platz für mein ausladendes Kleid zu schaffen.
»Du bist wunderschön, Flo«, haucht sie fast ehrfürchtig, und da muss ich gegen ein paar aufsteigende Tränen ankämpfen.
»Danke dir«, murmele ich und wende mich der Treppe zu, die von dem schmalen oberen Flur der kleinen Pension in die Diele hinabführt. Hier, im Lighthouse Inn, sollen heute nicht nur Jay und ich unsere Hochzeitsnacht verbringen, sondern auch Gwen und ihre Mutter werden in einem Doppelzimmer ein Stockwerk über uns schlafen, neben ihnen meine Eltern und ein Zimmer weiter Fern und ihr viel zu junger Freund Noah. Morgen wollen wir alle gemeinsam frühstücken, bevor Jay und ich in unsere Flitterwochen nach New York City aufbrechen werden. Alles ist so wunderbar durchgeplant und organisiert! Meine größte Sorge war in den letzten Tagen, dass uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen würde: Dass wir weder am Leuchtturm unter freiem Himmel würden heiraten, noch den Fototermin auf den Felsen und den Sektempfang auf dem geschmückten Fischerboot – inklusive kurzer Tour aufs offene Meer hinaus – würden realisieren, noch im Garten des kleinen Lokals am Meer hier in der Nähe würden feiern können.
Doch das Problem ist ausnahmsweise nicht das eher unbeständige Wetter in Nova Scotia, denn draußen scheint die Sonne von einem strahlend blauen Juli-Himmel. Richtiges Hochzeitswetter.
Nein, das Problem ist, dass ich mir plötzlich nicht mehr sicher bin, warum Jay und ich bisher keinen Sex hatten.
Und dass ich nicht weiß, wo Jay steckt.
Hinter mir höre ich meine Mutter und Debbie aufgeregt tuscheln, während ich mein Kleid hochraffe und vorsichtig den Abstieg ins Erdgeschoss der kleinen Pension beginne.
»Warte, ich komme mit«, sagt Gwen hinter mir, aber ich sehe sie über meine nackte Schulter hinweg entschuldigend an und erwidere: »Bitte, lass mich kurz allein, ja? Ich muss einfach einen klaren Kopf bekommen. Und ich werde versuchen, Jay zu erreichen.« Ich halte das Telefon hoch und lächele meine Freundin schief an. Gwen ringt sich ebenfalls ein Lächeln ab.
»Okay«, sagt sie und nickt mir zu.
Natürlich laufe ich im Erdgeschoss in die drei Musketiere hinein.
Die drei Musketiere, das sind mein Papa, Gwens Vater Bob und Steve, der Vater von Jay und Raven. Sie kennen sich seit Studienzeiten, und nach einer längeren Pause hat Papa nun, durch meine Hochzeit, endlich wieder Kontakt zu seinen besten Freunden von damals. Ich mustere die drei, wie sie in ihren schicken dunklen Anzügen nebeneinander in der Lobby stehen und nicht unterschiedlicher sein könnten: Mein Vater ist klein und ein wenig untersetzt, mit schütterem grauem Haar, Vollbart und einer verhängnisvollen Vorliebe für Socken in Sandalen, wenn er nicht gerade auf eine Hochzeit geht (heute trägt er zum Glück schwarze Lederschuhe). Steve – auch ein pensionierter Lehrer, wie meine Eltern – ist hingegen groß und hager, mit einem Kopf voll wilder grauer Locken, während Bob inzwischen eine Glatze hat. Er war seit jeher der modischste der drei Musketiere, und auch heutzutage sieht er sehr nach dem erfolgreichen Architekten aus, der er geworden ist, mit einer schicken schwarzen Brille von Calvin Klein und einer Vorliebe für dunkle Designerklamotten. Bob liebt alles, was mit Design zu tun hat, und obwohl er in Rente ist, schreibt er hin und wieder noch Gastbeiträge für Zeitschriften wie Architectural Digest, was Gwen sehr stolz macht.
Die drei Musketiere stehen in der Diele der Pension und haben offenbar gerade über etwas diskutiert. Und ich ahne auch, worüber, denn als Steve mich die Treppe herabkommen sieht, verstummt er sofort und macht eine rasche Geste, die die anderen zum Schweigen bringen soll, während er mich mit offenem Mund anstarrt.
»Wow«, macht er, und ich erkenne sofort, dass seine Unterlippe zu beben beginnt, wie immer, wenn ihn etwas rührt.
Mein Vater und Bob drehen sich zur Treppe um und schauen mich überrascht an. Während Bob ebenfalls »Wow« wispert, starrt Papa mich einfach nur wortlos an. Ich ringe mir ein schiefes Lächeln ab und bewältige die letzten Treppenstufen glücklicherweise tatsächlich, ohne mich in meinem Kleid oder Schleier zu verheddern.
»Hi«, sage ich und grinse hilflos in die Runde. Irgendwie habe ich es mir anders vorgestellt, als Braut zum ersten Mal Familie und Freunden gegenüberzustehen. Da ich eine hoffnungslose (und leider oft ziemlich naive) Romantikerin bin, habe ich mir immer ausgemalt, wie auf Wolke sieben meinen Hochzeitsgästen – und natürlich meinem Zukünftigen – entgegenzuschweben. Aber in diesem Moment in der Diele habe ich nur das Gefühl, jeden Augenblick in Ohnmacht zu fallen.
»Oh, Florentine.« Endlich sagt mein Vater etwas. Er macht eine unbeholfene Geste in die Richtung meines Kleides, und ohne Vorwarnung verzieht sich sein Gesicht zu einer Grimasse. Im ersten Moment bin ich geschockt, weil ich glaube, dass er entsetzt ist. Aber dann begreife ich: Mein Vater ist kurz davor, vor lauter Rührung die Fassung zu verlieren. Und da das meinem Vater überhaupt nicht ähnlich sieht, macht mich diese Tatsache ziemlich fertig.
»Paps«, sage ich und merke, dass meine Stimme zittrig und belegt klingt.
»Du … du bist eine wunderschöne Braut, Flo«, wispert mein Vater, während er offenbar mühsam versucht, nicht in Tränen auszubrechen.
»Das stimmt«, schluchzt Bob, der den Kampf gegen die Rührung längst verloren hat, und putzt sich lautstark die Nase. Ich sehe ihn an und muss grinsen, trotz meiner Nervosität.
»O ja«, bestätigt Steve. »Wunderschön!«
»Ihr findet nicht, dass ich an einen Wolkenberg erinnere?« Befangen streiche ich über mein Kleid. Die drei Männer schütteln vehement ihre Köpfe.
»Wolkenberg? Ich bitte dich!«, schnaubt Papa entrüstet. »Eine Sahnehaube höchstens. Eine ganz entzückende Sahnehaube.«
Okay, das finde ich nicht wirklich besser als Wolkenberg, aber ich muss trotzdem kurz auflachen.
»Flo, das Kleid ist wunderschön – Vera Wang hatte letztes Jahr ein ganz ähnliches in ihrer Kollektion!«, erklärt Bob in einem Tonfall, der keinen Widerspruch duldet, und sofort bin ich ein wenig beruhigt, denn wenn einer Ahnung von Mode hat, dann Gwens Dad.
»Danke dir«, sage ich, bevor mir wieder einfällt, warum ich überhaupt auf dem Weg nach draußen gewesen bin. Unruhig schaue ich an den Männern vorbei zum Hauseingang. Durch das Fenster in der Tür kann man die Küstenstraße sehen, die sich Richtung Leuchtturm windet. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt die andere kleine Pension, in der sich Jay und sein Trauzeuge Trevor gemeinsam mit Raven, Neil und Luke sowie Bob und Steve umgezogen haben. Die meisten von ihnen – außer Jay – werden auch dort übernachten, weil hier, im Lighthouse Inn, nicht genug Platz für die ganze Hochzeitsgesellschaft ist.
»Ähm … Ihr habt nicht zufällig Jay gesehen?«, frage ich und nestele an der Spitze meines Schleiers herum.
Dass die drei Männer nervöse Blicke wechseln, entgeht mir natürlich nicht. Mir ist völlig klar, dass sie über Jay geredet haben, als ich die Treppe hinabgekommen bin.
»Wir suchen ihn noch«, erklärt mein Vater und räuspert sich. »Wir … waren gerade hier hereingekommen, um deine Mutter oder Gwen zu fragen, ob sie eine Ahnung haben, wo er …«
»Haben sie nicht, nein«, unterbreche ich ihn ungeduldig. »Habt ihr versucht, ihn anzurufen?«
»Natürlich«, brummt Steve und starrt mit gefurchter Stirn auf seine blank polierten Schuhe hinab. Man merkt, dass es ihn sehr frustriert, nicht zu wissen, wo sein jüngerer Sohn steckt.
»Wann und wo habt ihr ihn denn zuletzt gesehen?«, hake ich nach und beginne nun doch, nervös am Nagel meines Ringfingers zu nagen, Ballettschuh-Rosa hin oder her.
»Vor ungefähr einer Stunde, in seinem Zimmer drüben in der Pension«, erwidert Bob bedrückt. »Er hat sich umgezogen, genau wie wir alle. Dann sind wir raus, haben ihn alleingelassen, weil wir noch einmal beim Boot vorbeigehen wollten, um nach dem Rechten zu sehen. Als wir zurückgekommen sind, fehlte jede Spur von ihm.«
»Und was ist mit Trevor und der Gang?«
»Trevor ist auch verschwunden«, antwortet mein Vater leise. »Neil, Luke und Raven sind noch einmal losgegangen, durch den Ort, um die beiden zu suchen.«
Ein wenig erleichtert atme ich auf. Wenn mein Verlobter mit seinem besten Freund Trevor unterwegs ist, dann bedeutet das doch bestimmt, dass die zwei vor der Trauung einfach noch einmal irgendwo einen Happen essen wollten oder sonst etwas machen, vielleicht um die Nerven zu beruhigen.
Aber warum er dann nicht an sein Telefon geht, kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen.
»Habt ihr es auch auf Trevors Telefon versucht?«
Betretenes Nicken der drei Musketiere. Ich seufze tief auf.
»Muss ein bisschen frische Luft schnappen«, erkläre ich und ringe mir ein tapferes Lächeln ab. »Ihr drei seht übrigens auch wahnsinnig gut aus, wisst ihr das?«
Sichtlich verlegen zupfen die Männer an ihren dunklen Anzügen herum. Papa wischt sich verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel. Rasch beuge ich mich vor und drücke ihm einen Kuss auf die Wange. Dann gehe ich eilig, so schnell es Kleid, Schleier und Pumps zulassen, auf die Haustür zu. Dort muss ich noch ein paar erstaunte Worte der resoluten Wirtin über mich ergehen lassen, die zu bedenken gibt, dass mich mein Bräutigam womöglich vor der Trauung sehen wird, wenn ich jetzt durch den kleinen Fischerort marschiere. Aber ich lächele nur höflich und murmele etwas von »nicht schlimm«, während ich die Haustür aufreiße und in Gedanken hinzufüge: Hauptsache, ich finde meinen Bräutigam überhaupt!
4
Tja, und jetzt, da ich ihn tatsächlich gefunden habe, wünschte ich fast, ich wäre nicht zu diesem verdammten Bootshaus gekommen. Ja, ich wünschte, ich wäre noch so ahnungslos wie vorhin, in der Honeymoon Suite des Lighthouse Inn. Ich hätte dortbleiben sollen, um noch ein wenig mit Gwen zu plaudern und meine kalte Coke zu trinken. Hätte meinen Kopf in den Sand stecken und so tun sollen, als wäre alles in bester Ordnung.
Doch dass gar nichts in bester Ordnung ist, das wird mir in dem Moment klar, als die Tür zum Bootshaus auffliegt und ich in den halbdunklen Raum starre.
Jay und Trevor schnellen zum Eingang herum und sehen mich so entsetzt an, dass es fast komisch wirken könnte – wenn nicht mein gesamter Lebensplan in diesem Moment in tausend Splitter bersten würde. Jay war offenbar gerade dabei, sichtlich aufgewühlt sein Hemd zuzuknöpfen – während sein Trauzeuge Trevor, ebenfalls mit offenem Hemd, eilig in seine Hose steigen wollte.
O Gott. Was passiert hier? Ist das mein geliebter Jay? Das kann nicht sein! Mein Gehirn weigert sich, diese Entwicklungen zu begreifen.
»Flo!« Jay macht ein paar Schritte auf den Eingang zu, während Trevor so wirkt, als würde er am liebsten in Tränen ausbrechen. Ich fühle mich genauso.
»Was … was machst du hier, Jay?«, stammele ich fassungslos. Ich erkenne meine eigene Stimme kaum wieder, während ich ein wenig zurückweiche. Dabei verheddert sich mein Absatz in meinem verdammten Wolkenkleid, und ich gerate ins Straucheln. Zwei Hände greifen von hinten nach meinen Armen, stützen mich kurz, lassen mich dann wieder los. Raven. Ich kann ihn jetzt nicht ansehen. Ich starre nur meinen Verlobten an. Den Mann, dem ich gleich vor dem Leuchtturm von Peggy’s Cove das Jawort geben wollte. Den Mann, der so unfassbar gut aussieht, mit seiner schwarzen Smokinghose und den auf Hochglanz polierten Schuhen, auch wenn sein dunkles Haar völlig zerwühlt und das Hemd schief geknöpft ist. Seine Fliege hängt nur als schwarzes Band lose und irgendwie kraftlos um den gestärkten Hemdkragen. Mein Blick flackert flüchtig zu der dunklen Jacke, die auf einem der Fischernetze liegt. Die gute Smokingjacke, auf einem stinkenden Fischernetz! Die Ansteckblume im Knopfloch – eine Rose in Ballettschuh-Rosa – schimmert mir aus den Stofffalten entgegen und versetzt meinem Herzen einen Fausthieb. Ausgerechnet die Smokingjacke auf dem Fischernetz macht mir mit einem Schlag klar, dass es keine Hochzeit geben wird. Weil Jay niemals nach Fisch stinkend heiraten würde. Den Rest dieser Situation kann und will ich immer noch nicht begreifen.
»Flo, ich …« Jay fährt sich mit beiden Händen über das Gesicht, bevor er heiser aufschluchzt und hervorstößt: »Verdammt, ich wollte das nicht! Ich wollte das nicht, das musst du mir glauben!«
Hinter ihm gibt auch Trevor ein unterdrücktes Schluchzen von sich.
»Was wolltest du nicht, Jay?«
Ich starre ihn an, warte auf eine Erklärung. Mein Gehirn weigert sich nach wie vor, das zu begreifen, was hier geschehen ist. Ich muss die Worte hören.
»Das hier …« Er macht eine hilflose Handbewegung, die Trevor und seine Smokingjacke auf dem Fischernetz einbezieht. »Ich … ich wollte es mir lange nicht eingestehen, verstehst du?«
Jay schluchzt erneut auf, kommt mit verzerrtem Gesichtsausdruck ein paar weitere Schritte näher, weshalb ich noch mehr zurückweiche und rücklings in Raven hineinlaufe. Ich spüre seinen Körper hinter mir, doch ich mache keinen Schritt zur Seite, und er verharrt ebenfalls auf der Stelle, ist wie eine Mauer in meinem Rücken.
»Was wolltest du dir nicht eingestehen, Jay?« Meine Stimme steigt um eine Oktave, wird ein wenig schriller. Ich höre mich zunehmend hysterisch an, aber ich finde, ich darf mich in diesem Moment hysterisch anhören. Jetzt schießen auch mir heiße Tränen in die Augen. Tränen der Wut. Tränen der Enttäuschung. Tränen der Fassungslosigkeit.
Alles vorbei, hallt es in meinem Kopf wider. Es ist alles vorbei.
»Dass … dass …«, stammelt Jay und zerwühlt sich verzweifelt sein ohnehin schon zerzaustes Haar. Ich muss daran denken, wie gut sein Haar sich immer zwischen meinen Fingern angefühlt hat.
»Dass er schwul ist«, sagt da plötzlich Trevor mit brüchiger Stimme hinter ihm. Jay zuckt ein wenig zusammen und sieht über seine Schulter auf seinen besten Freund, der sich jetzt mit zittrigen Fingern sein Hemd zuknöpft. Die beiden starren sich einen Moment an, dann dreht sich Jay wieder zu mir um und mustert mich mit gequältem Gesichtsausdruck.
Da sind sie, die Worte. Die Worte, die ich hören musste. Auch wenn sie von Trevor kommen, so sagt mir Jays Blick doch, dass es die Wahrheit ist.
Ich fühle mich, als würde ich fallen. In die Tiefe stürzen, ohne Netz, ohne doppelten Boden. Alles, woran ich geglaubt habe, löst sich in Sekundenbruchteilen in Luft auf. Wie kann das sein?
Mühsam ringe ich nach Atem, hake mit bebender Stimme nach: »Das … das ist doch nicht wahr, oder?«
Jay sieht mich an, Tränen rinnen über sein Gesicht. Auch ich schluchze jetzt gequält auf, presse mir eine Hand vor die Lippen. Als mein Verlobter – nein, wohl Ex-Verlobter – nichts sagt, stoße ich mühsam hervor: »Wie … wie kannst du mir das hier antun, Jay? Wie kannst du mich in diesem … diesem …« Ich mache einen Schritt von Raven fort, greife nach meinem Kleid und schüttele es einmal auf, als wäre es ein Kopfkissen. »Wie kannst du mich in diesem affigen Aufzug hier herumrennen und wie eine Irre nach dir suchen lassen? Warum hast du mir nicht vorher etwas gesagt? Bevor …« Erneut schluchze ich gegen meinen Willen auf, ringe wütend nach Luft und werde lauter: »Bevor ich unsere fucking Hochzeit bis ins Detail geplant, mich durch zig bescheuerte, nutzlose Diäten gequält und mir diesen Tag in den schönsten Bonbonfarben ausgemalt habe?«
Jay starrt mich ein paar Herzschläge lang wie vom Donner gerührt an, bevor sich sein Gesicht zu einer gequälten Grimasse verzieht, und er wispert: »Flo, das Kleid ist nicht affig! Du bist wunderschön, weißt du das? Die schönste Braut, die ich je gesehen habe, und du hättest auch keine einzige blöde Diät nötig gehabt.« Er schluchzt erneut auf, schlägt sich eine Hand vor den Mund. Trotz seiner offensichtlichen Verzweiflung muss ich wütend auflachen, während ich beginne, mir meinen wunderschönen Verlobungsring – zeitloses Weißgold mit einem kleinen, eleganten Diamanten in Solitärfassung – vom Finger zu zerren.
»Verdammt noch mal, es geht gerade überhaupt nicht um dieses beschissene Kleid oder um meine Figur, Jay!« Jetzt schreie ich. »Es geht um die Tatsache, dass du mich bis zur wortwörtlich allerletzten Minute in dem Glauben gelassen hast, dass du mich heiraten willst!«
Voller Wucht pfeffere ich den Ring zwischen die Fischernetze. Trevor zuckt zusammen und starrt hinter dem teuren Schmuckstück her, doch Jay hört nicht auf, mich anzusehen.
»Und das wollte ich auch!«, beteuert er aufgelöst. »Ich wollte dich heiraten, Flo! Und ich habe mir nie eingestehen können, dass ich … dass ich für Trevor längst mehr empfunden habe als Freundschaft.«
»Tja. Und was empfindest du dann für mich?«, frage ich und versuche vergeblich, das Beben in meiner Stimme unter Kontrolle zu bekommen. Das hier tut einfach zu weh.
»Ich liebe dich, Flo.« Jay sagt das so selbstverständlich und inbrünstig, dass ich wieder aufschluchze. Heiße Tränen schießen aus meinen Augen, laufen über meine Wangen, ruinieren vermutlich gerade das Rouge, das die Friseurin vorhin so sorgsam aufgepinselt hat. Aber nie war es unwichtiger, perfektes Rouge auf den Wangen zu haben als in diesem Moment, in diesem Bootshaus, vor diesem Mann, den ich für die Liebe meines Lebens gehalten habe.
»Du lügst«, erwidere ich heiser. »Wenn du mich lieben würdest, dann hättest du mir das hier nicht angetan.«
»Doch, ich liebe dich«, beteuert Jay nun fast trotzig. In seinen braunen Augen flackert Verzweiflung auf. »Aber … nicht so, wie man die Frau lieben sollte, die man heiraten will. Sondern … anders.« Hilflos zuckt er mit den Schultern. Voller Bitterkeit muss ich erneut auflachen, und in mein Lachen mischen sich weitere Schluchzer.
»Anders. Klar. Jetzt macht es auch Sinn, dass du keinen Sex vor unserer Hochzeit haben wolltest.« Ich spüre förmlich, wie Raven hinter mir ein wenig zusammenzuckt. Aber Ravens Anwesenheit ist mir ziemlich egal, als ich aufgewühlt hinterherschiebe: »Ja, jetzt habe sogar ich begriffen, dass du auch nach der Hochzeit nicht an Sex mit mir interessiert gewesen wärst. Ich war so unfassbar blöd!«
Mit diesen Worten drehe ich mich um und renne beinahe frontal in Raven hinein, der immer noch dicht hinter mir steht. Da ich mich erneut in meinem langen Kleid und noch dazu in meinem Schleier verheddere, muss ich gegen meinen Willen Halt an ihm suchen. Noch während er mich stützt und ich schluchzend versuche, meine Pumps aus den Massen an Stoff zu entwirren, sehe ich Raven in die Augen und fahre ihn aufgelöst an: »Und du … du hättest mich einfach zurück in die Pension gebracht und mir DASHIER verschwiegen?«
Raven zuckt ein wenig zurück, und die Furche zwischen seinen Augenbrauen vertieft sich. Ohne seine Antwort abzuwarten, reiße ich mich aus seinem Griff los, raffe mein Kleid undamenhaft weit in die Höhe, streife mir die nervigen Pumps von meinen Füßen und renne auf Seidenstrümpfen los.
»Flo!«, höre ich Jays verzweifelte Stimme hinter mir, aber ich ignoriere ihn. Wohin ich will, weiß ich nicht, aber ich renne nicht in die Richtung der Pension, denn da warten meine Familie und Freunde und mit Sicherheit noch mehr Touristen mit Kameras. Nein, ich haste tränenblind an den Bootshäusern vorbei und eile auf den Pier zu, der sich in das dunkle Wasser der Bucht zieht. Fischerboote sind an den Holzpfählen festgebunden, überall stapeln sich Hummerkörbe und bunte Bojen. Ein Mann in Ölzeug hebt erstaunt den Kopf und mustert mich ratlos, als ich an ihm vorbeihetze, meinen Schleier nach wie vor wie ein sich blähendes Segel aus Spitze hinter mir flatternd.
Da sehe ich es plötzlich. Wie angewurzelt bleibe ich stehen. Neben einem gewöhnlichen Fischkutter, auf dessen Deck sich Netze und Kisten stapeln, liegt ein weißer Kutter vor Anker, der sauber geschrubbt und frei von Arbeitsmaterial, dafür über und über mit rosa Herzluftballons geschmückt ist. »Just Married« ist in Gold auf einem Banner aus weißer Folie zu lesen, das am Heck gespannt ist.
Da heule ich richtig los. Verzweifelt presse ich mir eine Hand vor den Mund, während sich hysterische Schluchzer aus meiner Brust ringen.
»Ma’am, kann ich Ihnen helfen?«
Es ist der Fischer, der zögernd näherkommt, wie ich flüchtig erkenne, bevor ich mein nasses Gesicht in meinen Händen verberge. Ich kann nichts sagen, kann dem fremden Mann nicht erklären, dass meine Welt gerade aufgehört hat, sich zu drehen. Kann ihm nichts von Jay und Trevor erzählen, die gemeinsam diesen Kutter geschmückt haben, auf dem ich als frischgebackene Ehefrau hätte fahren sollen. Haben sie dabei endgültig gemerkt, dass sie ihre Gefühle füreinander nicht mehr unterdrücken können? Dass Jay kurz davor war, einen Fehler zu begehen? Während sie Herzluftballons aufgeblasen und das Just-Married-Banner aufgehängt haben?
Weitere Schritte nähern sich von hinten über den Pier. Hoffentlich nicht noch mehr besorgte Dorfbewohner. Doch bevor ich mich dazu durchringen kann, einen Blick zu riskieren und womöglich eine Erklärung abliefern zu müssen, höre ich Ravens Stimme. Er spricht leise mit dem Fischer, der sich mit mitleidigem Murmeln abzuwenden scheint. Dann sind wieder Schritte zu hören, bis ich spüre, dass Raven neben mir steht. Immer noch habe ich die Hände vor meinem Gesicht. Ich kann nicht aufhören zu heulen. Und ich kann diesen Mann jetzt nicht ansehen. Weil ich nicht will, dass er mich dermaßen aufgelöst erlebt. Er, der immer so beherrscht ist. Der seine Emotionen niemals derart zur Schau stellen würde, wie ich es gerade tue.