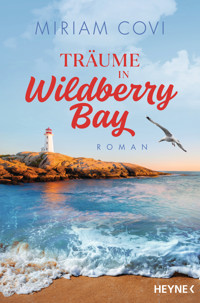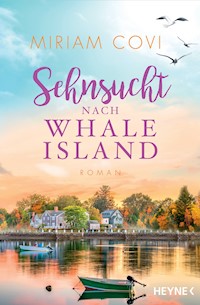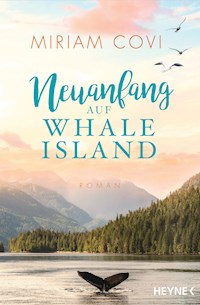9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Wenn dir eine Brise Meeresluft ins Gesicht weht, ist es Zeit, dem Glück eine Chance zu geben
Amelie Ludwig freut sich sehr auf den Familienurlaub im malerischen Nova Scotia. Was gibt es Schöneres, als mehrere Wochen in der wilden Natur zu verbringen, umgeben von kilometerlangen Stränden und kunterbunten Holzhäusern? Der perfekte Ort, um ihr gebrochenes Herz und die Erinnerung an einen schweren Schicksalsschlag für eine Weile zu vergessen. Doch kaum an der kanadischen Atlantikküste angekommen, begegnet Amelie dem attraktiven Callum, der zusammen mit seinem verrückten Hund alles daran setzt, ihr Herz zu erobern. Amelie zögert: Ist sie schon bereit, sich neu zu verlieben? Als sie ganz überraschend auf ein Geheimnis aus der Vergangenheit ihrer Familie stößt, ist ihr Gefühlschaos perfekt – und Amelie muss sich entscheiden, wo ihr Herz hingehört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Ähnliche
Das Buch
Amelie Ludwig freut sich sehr auf den Familienurlaub im malerischen Nova Scotia. Was gibt es Schöneres, als mehrere Wochen in der wilden Natur zu verbringen, umgeben von kilometerlangen Stränden und kunterbunten Holzhäusern? Der perfekte Ort, um ihr gebrochenes Herz und die Erinnerung an einen schweren Schicksalsschlag für eine Weile zu vergessen. Doch kaum an der kanadischen Atlantikküste angekommen, begegnet Amelie dem attraktiven Callum, der zusammen mit seinem verrückten Hund alles daran setzt, ihr Herz zu erobern. Amelie zögert: Ist sie schon bereit, sich neu zu verlieben? Als sie ganz überraschend auf ein Geheimnis aus der Vergangenheit ihrer Familie stößt, ist ihr Gefühlschaos perfekt – und Amelie muss sich entscheiden, wo ihr Herz hingehört.
Die Autorin
Miriam Covi wurde 1979 in Gütersloh geboren und entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für zwei Dinge: Schreiben und Reisen. Ihre Tätigkeit als Fremdsprachenassistentin führte sie 2005 nach New York. Von den USA aus ging es für die Autorin und ihren Mann zunächst nach Berlin und Rom, wo ihre beiden Töchter geboren wurden. Seit 2017 lebt die Familie in Bangkok. Zur zweiten Heimat wurde für Miriam Covi allerdings die kanadische Ostküstenprovinz Nova Scotia, in der sie viele Sommer ihrer Kindheit und Jugend verbringen durfte und wo sie auch heutzutage regelmäßig versucht, dem Großstadttrubel zu entkommen – und zu schreiben.
Lieferbare Titel
Sommer in Atlantikblau
Sommer unter Sternen
MIRIAMCOVI
Roman
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Originalausgabe 06 / 2020Copyright © 2020 by Miriam CoviCopyright © 2020 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarker Str. 28, 81673 MünchenRedaktion: Diana MantelUmschlaggestaltung: Martina Eisele Design unter Verwendung von Alamy Stock Photo (Vetre Antanaviciute-Meskauskiene)Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN978-3-641-24942-7V001www.heyne.de
Für meine Töchter,Emilia und Matilda.Bitte hört niemals auf,als Schwestern füreinander da zu sein – und euren Träumen zu folgen.
We were born before the windAlso younger than the sun’Ere the bonnie boat was wonAs we sailed into the mystic.
(aus »Into the Mystic« von Van Morrison)
Kapitel 1
Es war ein Fehler, in diesen Urlaub einzuwilligen, denke ich zum wiederholten Male, während unser Mietwagen in der Abenddämmerung einer gewundenen Landstraße folgt. Wir fahren an einer malerischen Farm vorbei, bevor unser Auto eine Kreuzung überquert, wo ein großes, geschnitztes Schild mit einem aufgemalten Segelschiff und der Aufschrift »Lunenburg« verkündet, dass wir unser Ziel erreicht haben.
Ich wünschte wirklich, ich könnte meine drei Mitreisenden aussteigen lassen, mich selbst ans Steuer setzen und wieder zurückfahren, zum Flughafen von Halifax, der Hauptstadt der kanadischen Atlantikprovinz Nova Scotia, wo wir heute am späten Nachmittag gelandet sind. Allerdings möchte ich nicht deshalb schon wieder abreisen, weil ich das, was ich bisher von Kanada gesehen habe, so schrecklich fände – ganz im Gegenteil. Die Landschaft, die an unserem Mietwagen vorbeizieht, hat mich mit jedem zurückgelegten Kilometer mehr verzaubert: Dichte Wälder, hier und da ein See, der in der Abendsonne glänzte, und dann dieses idyllische Farmland rings um das Städtchen Lunenburg. Aber auch die schönste Landschaft könnte mich nicht vergessen lassen, wie unangenehm die Begleitumstände dieser Reise sind.
Bis mich Papa vor ein paar Wochen gefragt hat, ob ich mit ihm Urlaub machen wolle, hatte ich noch nie von diesem Fleckchen Erde gehört. Nova Scotia, das sei der lateinische Name für »Neu-Schottland«, hat mir Papa auf meinen ratlosen Blick hin erklärt und gleich hinzugefügt, dass ich doch immer schon nach Kanada habe reisen wollen. Was natürlich stimmt, auch wenn ich keine Ahnung von der Existenz dieser Ostküstenprovinz mit dem komplizierten Namen gehabt hatte. Aber Kanada, das klang nach endlosen Wäldern und unberührten Seen, nach viel Natur und wenigen Menschen. Ganz nach meinem Geschmack. Dass es darüber hinaus auch noch an den Atlantik gehen sollte, war mir mehr als recht, denn ich liebe das Meer, und als Bielefelderin habe ich leider selten das Vergnügen, salzige Seeluft einzuatmen. Deshalb sagte ich also Ja, als Papa mich fragte, ob ich Lust hätte, ihn nach Nova Scotia zu begleiten. Ich selbst könnte mir so einen Urlaub niemals leisten, dafür verdiene ich in meinem Job nicht genug. Mein Gehalt reicht ja nicht einmal für die Miete einer eigenen Wohnung – zumindest rede ich mir so die Tatsache schön, dass ich nach wie vor in der kleinen, ausgebauten Wohnung im Dachgeschoss meines Elternhauses lebe. Dass Papa, der endlich seinen wohlverdienten Ruhestand begonnen hat, mich nach Kanada einladen wollte, freute mich also wirklich sehr.
Aber natürlich hätte ich wissen müssen, dass es einen Haken gab. Den gibt es doch immer im Leben. Und besonders in meinem.
»So, fast geschafft«, höre ich Lars sagen, während ich nach wie vor aus dem hinteren Seitenfenster sehe und die farbenfrohen Holzhäuser betrachte, die im sanften Abendlicht an unserem Auto vorbeiziehen. Lars hat sich am Flughafen wie selbstverständlich ans Steuer unseres Mietwagens gesetzt, während ich mich rasch auf die Rückbank geschoben habe. Nachdem ich sieben Stunden lang im Flugzeug Schenkel an Schenkel und Ellbogen an Ellbogen in einer viel zu engen Dreierreihe neben ihm sitzen musste, bin ich wirklich dankbar für diesen Abstand zu ihm.
»Am Ende dieser Straße links abbiegen«, sagt mein Vater. Er ist der Beifahrer und hält eine Straßenkarte in der Hand, denn er traut unserem Navi nicht. »Das müsste die Falkland Street sein.«
»Ja, das ist sie«, antwortet Lars und setzt den Blinker. Nun wende ich meinen Blick doch vom Fenster ab, auch wenn mich die Häuser am Straßenrand wirklich faszinieren: Sie sind alle aus Holz gebaut und in den unterschiedlichsten Farben angestrichen, von schlichtem Weiß über helles Grau, dunkles Blau bis hin zu fröhlichem Gelb. Viele von ihnen haben verspielte Erker und Dachgauben, kunstvolle Schnitzereien über schönen Sprossenfenstern, und alle stehen auf gepflegten Rasenflächen, umgeben von blühenden Büschen und alten Bäumen.
Doch kein noch so malerisches Haus kann mich von meinem eigentlichen Problem ablenken.
Verstohlen mustere ich Lars. Von meinem Platz aus sehe ich ihn natürlich nur von schräg hinten, aber das reicht, um mein Herz schneller schlagen zu lassen. Sein dunkles Haar ist akkurat kurz geschnitten, und ich starre auf seinen sauber rasierten Nacken, bevor mein Blick über seine Wangenknochen wandert, über seine rechte Schulter und den Arm, bis hinab zu seiner Hand, seine schmalen, langen Finger, die das Lenkrad umfassen. Als er an einem Stoppschild hält, sehe ich kurz zum Rückspiegel hoch und begegne seinem Blick. Seine braunen Augen hinter den Gläsern seiner modischen Hornbrille blicken mich warm an, wie immer, und Lars lächelt mir flüchtig zu, bevor er wieder auf die Straße schaut und abbiegt.
Ich atme tief ein und aus. Warum nur muss ich immer noch so auf Lars reagieren? Nach all diesen Jahren, die ich ihn nun schon kenne? Zehn Jahre und drei Monate, um genau zu sein. Ja, zehn Jahre und drei Monate ist es her, seit Lars Berger seinen ersten Arbeitstag bei Peters & Hagemüller hatte. Er war Student, ein Jahr jünger als ich mit meinen vierundzwanzig Jahren, und begann dort, genau wie ich, Kundendaten in einen PC einzugeben. In den PC, der neben meinem stand. Ich war zu dem Zeitpunkt bereits seit fast drei Jahren bei der Firma, die als Dienstleistungsunternehmen für diverse Kaufhäuser und Einzelhandelsketten die Daten von Kundenkartenanträgen in Datenbanken einpflegt. Eigentlich hatte es auch bei mir nur eine Aushilfstätigkeit sein sollen, ein vorübergehender Job. Zwar war ich keine Studentin, aber ich hatte mal vorgehabt, einen völlig anderen Beruf auszuüben.
Bevor der schlimmste Tag meines Lebens dazwischengekommen war und alles zunichtegemacht hatte.
Lars blieb fast drei Jahre lang bei Peters & Hagemüller, jobbte dort mal vor, mal nach seinen Vorlesungen an der Universität Bielefeld, wo er Ingenieurswissenschaften studierte. Und natürlich jobbte er in den Semesterferien – eine wunderbare Zeit, auf die ich mich ganz besonders freute, weil er dann nicht nur stundenweise neben mir saß, sondern den ganzen Tag.
Morgen für Morgen fieberte ich dem Moment entgegen, in dem er durch die Tür kommen, seine Messenger Bag über die Stuhllehne hängen und mich fragen würde: »Und, fabelhafte Amelie, wie geht’s dir?« Fabelhafte Amelie, so nannte er mich immer, in Anspielung auf den berühmten Film »Die fabelhafte Welt der Amélie«. Morgen für Morgen wurde ich rot, bekam Hitzewallungen und antwortete meist etwas nicht sehr Intelligentes, weil ich in Lars’ Gegenwart immer schrecklich gehemmt war.
Nun ja, streng genommen nicht nur in seiner Gegenwart, immerhin bin ich chronisch schüchtern und bekomme fremden Menschen gegenüber meist keinen Ton heraus, aber bei Lars war alles immer noch ein wenig schlimmer, auch wenn er mir bald überhaupt nicht mehr fremd war. Dafür war er wunderbar, ganz und gar fantastisch, nicht nur sehr attraktiv, sondern noch dazu witzig und intelligent, sensibel und … aus all diesen Gründen auch fast immer vergeben. Ja, Lars befand sich eigentlich während der ganzen drei Jahre, die wir zusammengearbeitet haben, in Beziehungen: Zuerst war da die untreue Sabine, der Lars nach ihrer Trennung keine zwei Wochen hinterhertrauerte, bevor Anne, die Klammernde, sein Leben durcheinanderbrachte – und schließlich für Katharina Platz machen musste.
Trotz seiner Freundinnen freute ich mich jedes Mal wie eine Schneekönigin, wenn sich Lars morgens neben mich auf seinen Schreibtischstuhl fallen ließ, sein Passwort eintippte und mir entspannt zulächelte, während sein PC zum Leben erwachte. Sobald er da war, vergingen die Stunden bei »Peters & Hagemüller« wie im Fluge. Und als er nach fast drei Jahren zu meinem großen Kummer aufhörte, dort zu jobben, begannen die Arbeitstage, sich endlos in die Länge zu ziehen.
Und dennoch bin ich immer noch bei »Peters & Hagemüller« und gebe Kundendaten in den PC ein – sage und schreibe sieben Jahre, nachdem Lars die Firma verlassen hat, weil er, im Gegensatz zu mir, nun einem richtigen Beruf nachgeht.
Ich unterdrücke einen Seufzer, als ich die kleine Narbe betrachte, die Lars rechts an der Schläfe hat, weil er als Kind gegen eine Tischkante gelaufen ist. Warum nur muss Lars der Mann meiner Träume sein? Ausgerechnet er?
»Mensch, ich dachte, wir wären endlich da«, mault meine Schwester Nele neben mir und streckt sich mit einem Stöhnen. »Ich kann nicht mehr sitzen.«
»Wir sind auch sofort da, Kleines. Hier links abbiegen, Lars«, sagt mein Vater und versucht, die Karte so zu halten, dass er sie beim schwächer werdenden Licht noch lesen kann. »Da, das ist die Kaulback Street. Kaulback, lustig, oder? Wie das deutsche ›Kaulbach‹. Man merkt, dass die ersten Siedler hier unter anderem Deutsche waren.«
»Echt?«, fragt Nele und gähnt ausgiebig, während sie ihre Arme über ihren Kopf streckt und dann beginnt, ihr langes, dunkles Haar zu einem Pferdeschwanz zu binden. Das Haar meiner jüngeren Schwester ist glatt und seidig, so, wie ich mir meines immer gewünscht habe. Mit einem unterdrückten Seufzer fahre ich mir durch meine Locken, die nicht so schön dunkel sind, sondern rötlich-braun, und die sich wie immer wirr und widerspenstig zwischen meinen Fingern anfühlen. Eigentlich würde dieses Haar viel besser zu Neles Charakter passen und ihr glattes, pflegeleichtes zu meinem.
»Ja, Lunenburg wurde zwar 1753 von den Engländern gegründet, aber die ersten Siedler waren, neben Schweizern und Franzosen, viele deutsche Protestanten«, melde ich mich zu Wort.
»Lass mich raten«, sagt Nele. »Diese Protestanten kamen aus Lüneburg?«
Ich schüttele den Kopf. »Nein, die meisten kamen aus der Pfalz und Württemberg. Es ist nicht ganz sicher, woher der Name Lunenburg stammt – eine Theorie ist, dass die Stadt nach König Georg II. von England benannt wurde, der auch Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg war.«
»Aha«, macht Nele und wirft mir einen amüsierten Seitenblick zu. »Hast du einen Reiseführer verschluckt?«
»Haha«, murmele ich und starre wieder nach draußen, auf die Häuser, die nun dichter nebeneinanderstehen, an beiden Seiten der Straße die Bürgersteige säumen, ohne große Gärten. Die Straße führt einen steilen Hügel hinauf, so steil, dass sich unser Mietwagen hörbar quält, als mein Vater ruft: »Da, das ist sie, die York Street! Hier rechts abbiegen. So, als Nächstes müssten wir die Cornwallis Street kreuzen – gut, dass hier alle Straßen im Schachbrettmuster angelegt wurden, das macht die Orientierung wirklich leicht …«
Edward Cornwallis war der Gouverneur von Nova Scotia, der die Hauptstadt Halifax gegründet hat – auch das weiß ich, seit ich im Flugzeug tatsächlich den halben Reiseführer gelesen habe. Zum einen, weil mich Nova Scotia und seine Geschichte wirklich interessieren. Zum anderen, weil der Liebesroman, den ich auch dabeihatte, keine Option war, weil ich ja Schenkel an Schenkel mit Lars saß.
Allerdings hüte ich mich davor, laut etwas zu Edward Cornwallis zu sagen, weil ich keine Lust auf eine weitere spitze Bemerkung meiner Schwester habe. In Momenten wie diesem sollte man kaum meinen, dass Nele von Beruf Lehrerin ist – sie benimmt sich eher wie eine gelangweilte Schülerin. Manchmal habe ich tatsächlich den Eindruck, dass meine jüngere Schwester immer noch ein rebellischer Teenager ist. Nele unterstreicht meine Gedanken, als sie erneut demonstrativ gähnt, ohne sich die Mühe zu machen, eine Hand vor ihren Mund zu halten. Irritiert mustere ich sie, bevor ich wieder stumm aus dem Fenster starre.
»So, jetzt langsam, Lars, hier muss es irgendwo sein, zwischen Prince und Hopson Street …«, höre ich Papa murmeln. »Blaugrün sah es im Internet aus, das Haus. Es muss irgendwo auf der linken Seite … Ach, da ist es ja!«
Ich recke meinen Kopf und versuche, im schwachen letzten Tageslicht etwas zu erkennen. Als Lars in die Einfahrt des besagten Hauses einbiegt, streifen die Lichtkegel der Scheinwerfer eine dunkelblaue Eingangstür, zu der drei Steinstufen hinaufführen. Im Erdgeschoss brennt hinter Sprossenfenstern mit weißen Spitzengardinen Licht. Richtig, die Verwalterin dieses Ferienhauses wollte uns ja hier treffen, um uns alles zu zeigen und uns den Schlüssel auszuhändigen. Neugierig schnalle ich mich ab und öffne die Wagentür, während Nele erleichtert »Na endlich!« seufzt und ebenfalls aussteigt.
Ich umrunde unseren Mietwagen und bleibe vor den Eingangsstufen stehen, lasse meinen Blick über die Schnitzereien am Dachvorsprung oberhalb der Haustür wandern, lege dann meinen Kopf in den Nacken und betrachte den verspielten Erker, der über den Fenstern des ersten Stocks seinen Kopf aus der Dachschräge zu schieben und mit seinen Sprossenfenstern zu drei Seiten die Lage auf der Straße im Blick zu behalten scheint. Schließlich betrachte ich die Holzschindeln der Außenwände, die in einem wunderschönen, sanften Blaugrün gestrichen sind, wie Papa angekündigt hatte.
Meeresgrün.
Mein Herz schlägt ein wenig schneller, und automatisch wandert meine Hand zu meinem Dekolleté, um nach einem kühlen, glatten Anhänger zu tasten, der dort längst nicht mehr hängt. Ich schlucke mühsam und lasse meine Hand sinken.
Die Haustür öffnet sich, und eine Frau tritt heraus, die etwa in Neles Alter sein dürfte, also Anfang dreißig. Sie trägt eine große, runde Brille, die mich an Harry Potter erinnert, ihr kinnlanges Haar ist fliederfarben gefärbt und steht ein wenig wirr in alle Richtungen, als habe sie keine Zeit gefunden, es zu kämmen. Ihre kurzen Shorts passen exakt zum Farbton der Haare, und auf ihrem mintfarbenen T-Shirt prangt der Spruch »Stay calm and keep knitting«. Bevor ich mich über diese Liebeserklärung ans Stricken wundern kann, fällt mein Blick auf die sonnengelbe Wolle und den offensichtlich fast fertig gestrickten Pullover, den die Frau in einer Hand hält. Die leuchtende Farbe strahlt mit der fröhlich lächelnden Fremden um die Wette. Wie immer sucht mein Blick sofort nach Schmuck, das kann ich einfach nicht abstellen: Die Frau mit dem fliederfarbenen Haar trägt gelbe Emaille-Ohrstecker in Sonnenblumenform und einen auffälligen Silberring, der das Gehäuse einer Meeresschnecke darstellt.
»Hallo!«, ruft sie jetzt und kommt die Eingangsstufen herab. »Willkommen! Ich bin Bonnie! Und ihr müsst Familie Ludwig sein!«
Aha, Bonnie scheint einer dieser Menschen zu sein, die nur mit Ausrufezeichen sprechen. Obwohl mir derart überschwängliche Zeitgenossen meist sehr suspekt sind – vermutlich weil ich das genaue Gegenteil davon bin –, finde ich Bonnie auf Anhieb sympathisch.
»Angenehm, Otto Ludwig«, stellt sich Papa höflich vor, während er Bonnie die Hand schüttelt und sie anlächelt. Als Bonnie stutzt und ihn so überrascht mustert, dass es auffällt, fürchte ich sofort, dass Papas schiefes Lächeln sie irritiert: Wie immer bewegt sich nur sein rechter Mundwinkel in die Höhe, während der linke seinen Dienst verweigert. Auch Papas linkes Augenlid hängt ein wenig und verpasst ihm so einen einseitigen Schlafzimmerblick, obwohl das helle Blau seiner Augen nach wie vor lebhaft und wach funkelt. Aber bevor ich dazu komme, mich darüber zu ärgern, dass diese fröhliche Frau, die ich gerade spontan in mein Herz schließen wollte, meinen Vater so anstarrt, fragt Bonnie verwirrt: »Ähm – kennen wir uns? Waren Sie schon einmal in Lunenburg, Otto?«
»Ich?«, hakt Papa nach und kratzt sich verlegen am Kopf, als sich Nele einschaltet und wie immer eine Spur zu laut sagt: »Quatsch, unser alter Herr hat seit Menschengedenken keinen Urlaub gemacht, Bonnie. Nein, er war ganz sicher noch nie hier. Hi, ich bin Nele.«
Ich bin wirklich erleichtert darüber, dass Bonnie gar nicht wegen Papas leicht verrutschten Gesichtszügen gestarrt hat, denn wenn ich mit etwas überhaupt nicht klarkomme, sind es unsensible Menschen – vermutlich weil ich selbst so extrem sensibel bin.
Während Bonnie auch Lars begrüßt, mustere ich meinen Vater verstohlen und frage mich besorgt, ob er die lange Reise gut verkraftet hat. Seit seinem Schlaganfall mache ich mir permanent Sorgen um ihn, obwohl er stets stur behauptet, wieder fit wie ein Turnschuh zu sein. Das hängende Augenlid und sein schiefes Lächeln sind glücklicherweise tatsächlich die einzigen Erinnerungen daran, dass er vor einem Jahr vorübergehend weder sprechen noch seinen linken Arm bewegen konnte und ein paar Tage im Krankenhaus verbringen musste. Ein Gutes hatte der Schreck damals zumindest: Papa hat sich nach seinem Schlaganfall einen Ruck gegeben und eingesehen, dass er nicht mehr länger so hart arbeiten konnte, wie er es sein Leben lang getan hatte. Vor einem halben Jahr hat er die Geschäftsleitung der Schreinerei an seinen langjährigen Kompagnon übergeben und sich mehr und mehr aus dem Betrieb zurückgezogen. Und darum sind wir nun hier, denn, wie Nele schon gesagt hat: Unser Vater macht zum ersten Mal, seit wir denken können, Urlaub.
»Ähm, hallo, ich bin Amelie«, sage ich hastig, als ich merke, dass Bonnie nun mir erwartungsvoll die Hand entgegenhält.
»Freut mich, Amelie! So, dann kommt doch herein, ich zeige euch das Haus!« Bonnie hält die Haustür weit auf und winkt uns mit dem sonnengelben Knäuel heran. Wir lassen unser Gepäck zunächst im Auto und folgen der Verwalterin über die Schwelle. Ich bilde den Schluss unseres Grüppchens und versuche, möglichst viel Abstand zu Lars zu halten, indem ich langsam laufe und mich alle paar Schritte interessiert umsehe: In der Diele begrüßt uns ein Teppich in maritimen Blautönen auf glänzenden dunkelbraunen Holzdielen, und an den Wänden erinnert das Tapeten-Muster aus kleinen blauen Segelbooten und Möwen an den Atlantik, der ganz nah sein muss, denn in der Luft hängt eindeutig der Duft von Meer, selbst im Haus. Vermutlich liegt das daran, dass die Fenster hochgeschoben sind, sodass sich die Spitzenvorhänge in der sanften Abendbrise bewegen, überlege ich, als ich den anderen ins Wohnzimmer folge. Die Holzmöbel in diesem Raum haben einen ähnlich dunklen Farbton wie der Fußboden, aber das Zimmer wirkt trotzdem überhaupt nicht düster, weil die großen Sprossenfenster mit ihren weißen Rahmen und hellen Vorhängen sowie die ebenfalls weiß getünchten Steine des Kamins einen schönen Kontrast bilden. Das Sofa, das vor dem Kamin steht, hat einen hellen Cremeton, und die darauf verteilten Kissen sind kunterbunt, was mich verzückt näher treten lässt. Während mein Vater Bonnie in die Küche folgt und sich von ihr dies und das erklären lässt, gleiten meine Finger über die farbenfrohen Stickereien und aufgenähten Perlen, zupfen an den verspielten Quasten der Sofakissen.
Diese Quasten würden sich wunderbar als Anhänger an Ohrringen machen.
Hastig verdränge ich den Gedanken, erschrocken über das deutliche Bild der Schmuckstücke vor meinem inneren Auge. Das ist mir ewig nicht passiert! Entschlossen wende ich mich vom Sofa ab, trete näher an den Kamin heran und betrachte die Objekte, die auf dem Sims aufgereiht stehen: Es handelt sich um längliche Holzblöcke, manche etwa groß wie Ein-Liter-Flaschen, andere ein wenig kleiner, die nach oben spitz zulaufen. Alle sind mit breiten Querstreifen bemalt und ebenso kunterbunt wie die Sofakissen: Ein Holzblock ist dunkelblau mit Blockstreifen in leuchtendem Rot, ein anderer ist hellblau mit türkisfarbenen Streifen, ein weiterer sonnengelb wie Bonnies Wolle und hat weiße Kontraste.
»Ah, du hast die Bojen entdeckt!«, lässt mich Bonnies Stimme herumfahren.
»Ach, das sind Bojen?«, hake ich erstaunt nach und betrachte erneut die hölzernen Gegenstände auf dem Sims.
»Ja, mit diesen Holzbojen wurden früher die Hummerkörbe markiert! Sie schwammen an der Wasseroberfläche und zeigten den Fischern, wo sie ihre Körbe auf den Meeresgrund hinabgelassen hatten. Heutzutage nutzen die Jungs leider so runde orangefarbene Plastikbojen, total unsexy, aber diese Holzstücke sind immer noch gern gekaufte Antiquitäten!«
Sie grinst mich breit an und legt ihr Strickzeug auf das Sofa. »So, kommt mal mit, ich zeige euch die Zimmer im ersten Stock!«
Während sich Nele bei Papa unterhakt und mit ihm Bonnie folgt, bleibe ich noch am Kamin stehen, denn ich habe eine kleine Figur entdeckt, die ganz außen auf dem Sims steht: Ein aus Holz geschnitzter Fischermann in knallgelbem Ölzeug, der eine Miniaturversion der bunten Bojen an einem Seil baumelnd hält. Man merkt, dass Nova Scotia von der Fischerei lebt – beziehungsweise davon gelebt hat, denke ich, als mir wieder der Reiseführer in den Sinn kommt: Wie ich gelesen habe, ist aufgrund der Überfischung der Meere und gesetzlicher Fangquoten das goldene Zeitalter für die Fischer auch hier in Ostkanada vorbei.
»Na, gefällt es dir hier?«, fragt Lars plötzlich hinter mir, und ich sehe mich beinahe erschrocken nach ihm um.
Kapitel 2
Ich dachte, er wäre Nele und Papa längst nach oben gefolgt, aber er lehnt am Esstisch, der nahe dem Durchgang zur Küche steht. Mit verschränkten Armen und leicht schief gelegtem Kopf lächelt er mich an, und meine Knie werden in seiner Gegenwart weich, wie sie es seit zehn qualvollen Jahren tun, diese nichtsnutzigen Knie. Egal, wie oft ich sie darum bitte, damit aufzuhören: Sie ignorieren mich, ganz genau wie der Schwarm Schmetterlinge in meinem Magen, der auch jetzt mal wieder anfängt, aufgeregt mit den Flügeln zu flattern. Und obwohl ich mich nach Kräften bemühe, es zu verhindern, merke ich, wie die vertraute, verhasste Hitze beginnt, unbarmherzig von meinem Hals nach oben zu wandern, von meinen Wangen Besitz zu ergreifen, mein ganzes Gesicht rot zu färben, ein fleckiges Rot, das jedem zuzuschreien scheint: »Seht her, Amelie ist mal wieder etwas peinlich! Ja, sie schämt sich! Sie ist schon wieder verlegen!« Oder, noch schlimmer: »Sie ist in Lars verknallt! Seit zehn Jahren und drei Monaten!«
Ich würde jetzt wirklich gern in die glänzenden Dielenbretter versinken.
»Ähm, ja«, murmele ich. »Ein wunderschönes Haus.«
»Stimmt«, sagt Lars und löst sich vom Esstisch, als ich beginne, das Zimmer zu durchqueren und auf die Treppe zuzugehen, die in den ersten Stock hinaufführt. »Hat dein Vater gut ausgesucht.«
»Ja, finde ich auch.« Und das, obwohl Papa noch nie zuvor im Internet ein Ferienhaus gebucht hat. Ich hatte tatsächlich Sorge, dass wir in der letzten Absteige landen könnten. Zu Unrecht, muss ich erkennen.
Am liebsten würde ich Lars vorgehen lassen, aber da das zu albern wirken würde, haste ich die Treppe hinauf, darum bemüht, möglichst schnell wieder in der Gesellschaft von Nele und meinem Vater zu sein. Denn mit Lars allein bin ich seit Jahren nicht mehr gewesen.
Seit sieben Jahren, um genau zu sein. Seit meine Schwester und er ein Paar geworden sind.
Und genau deshalb habe ich noch versucht, unserem gemeinsamen Kanadaurlaub zu entgehen, nachdem ich erfahren hatte, dass Lars mit von der Partie sein würde. Denn mir war klar, dass meine Taktik, ihn zu meiden, zum Scheitern verurteilt sein würde, wenn wir erst einmal gemeinsam in einem Ferienhaus wohnten. Panisch überlegte ich, wie ich aus dieser Situation wieder herauskäme, aber mir fehlten plausible Argumente, warum ich doch nicht mit in den Urlaub fliegen konnte – denn das eine wahre Argument konnte ich meiner Familie gegenüber natürlich nicht anbringen. So rang ich eine ganze Weile im Stillen mit mir. Irgendwann merkte ich Papa gegenüber vorsichtig an, dass ich vielleicht doch nicht nach Nova Scotia würde mitkommen können, weil ich vermutlich gar keinen Urlaub bekäme. Aber dann sah ich die tiefe Enttäuschung in seinen Augen und erinnerte mich daran, dass ich ihn an den Schlaganfall hätte verlieren können, dass ich meine Zeit mit ihm voll auskosten musste, weil alles von Heute auf Morgen vorbei sein konnte – und verwarf meine Pläne, zu Hause zu bleiben, sofort wieder.
Die Stimme meiner Schwester reißt mich aus meinen Gedanken und erinnert mich einmal mehr daran, dass dieser Urlaub überhaupt keine gute Idee war: »Also, Lars und ich nehmen dieses Zimmer!« Nele streckt ihren Kopf aus einer Tür nahe dem Treppenabsatz, als ich den ersten Stock erreiche. Sie bläst in ihre Ponyfransen, die wie immer ein wenig zu lang sind und fast in ihre Augen hängen. »Das ist das größte, und es hat ein eigenes Bad. Sorry, Amelie, aber du brauchst wirklich kein Kingsize-Bed.«
Nein, denke ich und schlucke gegen die Frustration in meinem Hals an. Das brauche ich nicht.
»Natürlich, nehmt ihr das große Zimmer«, murmele ich und werfe einen flüchtigen Blick durch die geöffnete Tür auf ein breites Bett, auf dem eine wunderschöne Patchworkdecke in Blautönen ausgebreitet liegt. An der Wand erkenne ich eine Kommode und einen Einbauschrank, daneben eine weitere Tür, vermutlich zum Badezimmer.
»Amelie, komm mal her und sag mir, welches Zimmer dir lieber ist«, reißt mich Papas Stimme aus meinem verstohlenen Starren. Ich werfe einen letzten Blick auf das Bett, in dem Lars bald mit meiner Schwester liegen wird, und wende mich dann rasch meinem Vater zu. Er steht in der geöffneten Tür zum Nachbarzimmer, und ohne auch nur einen Blick hineingeworfen zu haben, sage ich hastig: »Nimm du dieses Zimmer, Paps. Ich schlafe da hinten.«
Ich deute auf die Tür zu einem dritten Zimmer, aus dem Bonnie gerade herauskommt.
Denn, egal, wie schön das Zimmer neben dem meiner Schwester sein mag: Auf gar keinen Fall schlafe ich Wand an Wand mit Lars. Auf gar keinen Fall will ich mitbekommen, wie die beiden nachts womöglich das tun, was ich so gern mit Lars tun würde.
Ich werde noch röter und eile den Flur entlang, auf Bonnie zu, die mich überrascht mustert.
»Ähm, Schatz, das da ist das Badezimmer«, bemerkt mein Vater hinter mir. Als ich ratlos stehen bleibe und ihn ansehe, erwidert er meinen Blick mit einem amüsierten Lächeln und meint: »Falls du nicht in diesem Zimmer hier schlafen willst …«
»Nein, schon gut, nimm du das. Wo … wo ist denn das dritte Schlafzimmer?« Ich wechsele vom Deutschen ins Englische, damit auch Bonnie mich versteht.
»Unter dem Dach«, erklärt diese sofort, und ich atme erleichtert auf. Unter dem Dach, das ist gut. Das bedeutet genügend Sicherheitsabstand zu Lars und Nele. Bonnie greift nach meiner Hand. »Komm mit, ich zeige es dir!«
»Das Haus ist wirklich schön«, bemerke ich, als ich ihr zu einer schmalen Holztreppe folge.
»Ja, nicht wahr?«, fragt Bonnie, während sie mir voran die knarzenden Stufen hinaufgeht und eine Tür öffnet, die von einem winzigen, dunklen Flur aus in ein Zimmer unter dem Dach führt.
»Gehört das Haus dir?«
»Nein«, erwidert Bonnie, und ich merke, dass ein leichter Schatten über ihr Gesicht huscht. »Es gehört einer befreundeten Familie. Ich verwalte es nur und sorge dafür, dass sich die Gäste wohlfühlen.« Ihr gut gelauntes Lächeln ist schnell zurück, und sie macht ein paar Schritte in das Zimmer hinein, das klein ist und an einer Seite Dachschrägen hat, sodass man nicht überall aufrecht stehen kann. Trotzdem bin ich sofort verzaubert – von den gerahmten Fotos eines schmucken Segelboots an der Wand, die keine Schräge hat, und von dem weißen Holzbett mit einer weiteren Patchworkdecke, diese mit einem wunderschönen Muster in Weiß und Meeresgrün, ausgerechnet. Aber vor allem verschlägt es mir den Atem, als ich den Erker entdecke, in dem ein kleiner Sekretär mit Schreibtischstuhl und herrlich altmodischer Tiffany-Lampe steht.
»Wow! Dieses Zimmer hat den Erker? Wie wunderschön!«, hauche ich, als ich ein paar Schritte auf den Sekretär zumache. Meine Hände fahren über das glatte Holz der Schreibtischoberfläche, und mein Herz setzt einen Schlag aus, als ich erkenne, dass in dem Schirm der Tiffany-Lampe nicht nur die üblichen glatten Scherben verarbeitet wurden, sondern auch ein paar dunkelblaue Glasstücke mit charakteristisch matter Oberfläche.
Meerglas.
Rasch löse ich meinen Blick von der Lampe und sehe aus den Sprossenfenstern, die links und rechts und hinter dem Sekretär zu drei Seiten den Blick aus dem Erker nach draußen zulassen. Ich erkenne unser in der Einfahrt geparktes Auto, die Straße – und wenn ich meinen Kopf recke – ich kann mein Glück kaum fassen! –, dann schimmert mir im letzten Tageslicht, durch eine Lücke zwischen den Häusern und Bäumen der Nachbargrundstücke hindurch, tatsächlich ein Fetzen tiefblauen Meeres entgegen. Zwar ein ganzes Stück weit weg, den steilen Hügel dieser Stadt hinab, aber dennoch so fabelhaft nah, wie mir das Meer ewig nicht mehr war.
Bonnie hat gerade eine Falte in der Patchworkdecke glatt gestrichen und tritt nun neben mich. Mit einem breiten Lächeln sagt sie: »Schön, dass es dir gefällt! Diese Art Erker an der Frontfassade über dem Hauseingang nennt man ›Lunenburg Bump‹, ein Vorsprung, der typisch ist für die hiesige Architektur. Diese Häuser in der Altstadt waren früher zum großen Teil Kapitänsvillen, und man sagt, dass die Alkoven gebaut wurden, damit die Frauen der Seefahrer hier oben sitzen und nach ihren Ehemännern Ausschau halten konnten. Manche behaupten allerdings, dass diese Ausgucke nur deshalb so wichtig waren, damit die Strohwitwen ihre Liebhaber hinausschmeißen konnten, bevor der Gatte von See zurückkam.« Bonnie grinst mich mit dramatisch aufgerissenen Augen hinter ihren runden Brillengläsern an, und ich muss kichern. »Die meisten dieser Kapitänsvillen wurden seit jeher traditionell in den kräftigsten Farben angestrichen – darum gilt Lunenburg auch heute noch als die farbenfroheste Stadt von Nordamerika. Unsere Häuser leuchten in Rot, Blau, ja sogar in Pink und Grasgrün, und so weiter und so fort – weil die Kapitäne, sparsam, wie sie waren, die Farbreste aufbrauchten, die sie für das Streichen ihrer Schiffe benutzt hatten. Ja, die Schiffe waren damals auch sehr farbenfroh, denn so konnten sie sofort einem bestimmten Kapitän zugeordnet werden, wenn sie in den Hafen einliefen. Ein positiver Nebeneffekt war, dass man sowohl die Schiffe als auch die Häuser der Stadt dank ihrer kräftigen Farben leicht erkennen konnte, wir haben hier nämlich oft ziemlich dichten Nebel.«
Interessiert habe ich Bonnie zugehört, und als nun Nele und Lars, gefolgt von Papa, das Zimmer betreten und sich ebenfalls neugierig umgucken, sehe ich wieder hinaus, betrachte das Stückchen Meer in der Ferne und beschließe, sofort morgen früh loszuziehen, um mir den Atlantik aus der Nähe anzusehen.
In einem beruhigend gleichmäßigen Rhythmus fliegen meine Füße über den Asphalt, der noch feucht ist von dem Regenschauer der letzten Nacht. Die Wolkendecke, die mich begrüßt hat, als ich – der Zeitverschiebung sei Dank – bereits um fünf Uhr aufgewacht bin, ist inzwischen aufgerissen und erlaubt einem strahlend blauen Morgenhimmel, sich über Lunenburg zu erstrecken. Ich drehe mein Gesicht Richtung Sonne, die meine Wangen angenehm wärmt, während meine geliebten türkisfarbenen Laufschuhe der steilen Prince Street hügelabwärts folgen. Bruce Springsteen singt aus meinen Kopfhörern und begleitet mich, wie immer, wenn ich laufe.
»Baby, we were born to run«, singt er, beruhigend vertraut, auch in dieser fremden Umgebung. Es ist noch früh am Freitagmorgen, kurz vor sieben Uhr, aber es sind schon einige Leute unterwegs: Ein Teenager auf einem Mountainbike, der Zeitungsrollen in Plastikhüllen aus einer Umhängetasche fischt und in die Einfahrten oder auf die Verandastufen von Häusern entlang der Straße wirft. Ein anderer Jogger, der mir schnaufend hügelaufwärts entgegenkommt und mich mit einem freundlichen Nicken grüßt, als würde ich in dieser fremden kleinen Stadt tatsächlich schon jemanden kennen. Eine Frau mittleren Alters, die mit ihrem Hund spazieren geht, die Leine in der einen Hand, einen Thermobecher in der anderen, vermutlich mit Kaffee gefüllt. Oh, ich beneide sie um diesen Kaffee! Wir haben nämlich gestern, als wir kurz nach dem Flughafen einen Stopp in einem Supermarkt gemacht und die nötigsten Lebensmittel für einen abendlichen Imbiss und unser erstes Frühstück gekauft haben, Kaffeepulver vergessen. Und in der Küche des Ferienhauses war leider nur eine Packung mit Pfefferminztee zu finden. Die Vormieter scheinen keine Kaffeetrinker gewesen zu sein, sehr zu meinem Leid. Daher hoffe ich, dass ich gleich, nach meiner Joggingrunde, irgendwo einen Coffee Shop entdecken werde.
Als Bruce Springsteen gerade beginnt, Dancing in the dark in meine Ohren zu singen, erreiche ich das Ende der Prince Street und biege nach rechts in die Cumberland Street ein. Papa hatte recht, dank des Schachbrettmusters der Straßen verirre selbst ich Orientierungs-Niete mich nicht. Ich konzentriere mich auf meine gleichmäßige Atmung und auf die Schritte meiner Laufschuhe, die im Rhythmus zu Springsteens Song über den Bürgersteig traben. Wie immer beruhigt mich das Laufen ungemein. Mein Gehirn schaltet auf Autopilot, lässt den Rest meines Körpers machen, meine Muskeln, meine Lunge, mein angestrengt pumpendes Herz. Alle Sorgen schwirren davon, lassen nur Raum für die Worte von Bruce, die in meinem Kopf widerhallen, mich stumm mitsingen lassen. Endlich muss ich nicht länger daran denken, dass ich einen großen Teil der Nacht wach gelegen und an die Dachschräge meines mir noch fremden Zimmers gestarrt habe, in Gedanken einen Stock tiefer, bei Lars. Und endlich muss ich nicht länger an die Träume denken, die mich dann, als der Schlaf endlich kam, heimsuchten. Ausnahmsweise keine Albträume, die von Autowracks handelten, aber dafür mindestens genauso verstörend waren, denn wer träumt schon gern von Sex mit dem Freund der Schwester?
Einfach ein- und ausatmen, nicht mehr denken, einen Fuß vor den anderen setzen, immer weiterlaufen, laufen, laufen.
So war es auch, als ich zum ersten Mal losgerannt bin, vor dreizehn Jahren. Taub vor Schmerz und Verzweiflung habe ich damals das Krankenhauszimmer verlassen, in dem meine Mutter kurz zuvor gestorben war, bin aus der Klinik gegangen – und losgelaufen. Ohne zu wissen, wohin ich wollte, habe ich angefangen zu rennen, in meinen Sandalen, meine Umhängetasche schräg über meine Schultern geschlungen, schwer und störend gegen meine Seite schlagend. Erst nach einer halben Ewigkeit bin ich bei uns zu Hause angekommen, schweißnass, mit blutenden Stellen an meinen Füßen, wo meine Sandalen die Haut aufgescheuert hatten. Am nächsten Tag bin ich mit schmerzenden Muskeln in ein Sportgeschäft gehumpelt und habe mir die ersten Laufschuhe meines bis dahin sehr unsportlichen Lebens gekauft. Meine Familie dachte, das sei der Schock, der mich merkwürdige Dinge tun ließ. Aber ich lief nicht nur in den ersten Tagen und Wochen nach Mamas Tod. Nein, ich lief auch dann noch, als ich meinen Job bei Peters & Hagemüller bekam. Als ich Lars kennenlernte. Als Lars und meine Schwester ein Paar wurden. Zwar nehme ich nicht an Marathons teil, stoppe weder meine Zeiten, noch habe ich Pulsmesser oder Schrittzähler. Nein, ich laufe ganz einfach. Ich laufe, um zu vergessen.
Auch jetzt noch, dreizehn Jahre später.
Nun, an diesem sonnigen Morgen in Lunenburg, sprinte ich an einem grasbewachsenen Hügel vorbei, wo ein hübscher Holz-Pavillon zu einer Pause einlädt – eine Pause, die ich nicht einlege. Jetzt noch nicht. Tap, tap, tap, machen meine Füße gleichmäßig auf dem Bürgersteig, als ich nach links in die King Street einbiege. Weiter geht es hügelabwärts, vorbei an dem Backsteingebäude einer Bank, vorbei an einem weiteren entzückenden viktorianischen Haus mit vielen Schnitzereien. Vor mir, am Ende dieser Straße, erkenne ich nun deutlich ein Stückchen blauen Meeres zwischen den Häusern. Erwartungsvoll beschleunige ich meinen Schritt, sorge dafür, dass die Entfernung zum Wasser rasch kleiner wird. Im Vorbeilaufen werfe ich einen Blick in die hübsch dekorierten Schaufenster eines Souvenirladens, wo ich neben Tassen mit Blaubeermuster und knallroten Stoff-Hummern weitere hölzerne Bojen entdecke, wie auf dem Kaminsims unseres Ferienhauses. Dann renne ich mit federnden Schritten auf den Bluenose Drive zu, auf die Straße, die parallel zum Hafen von Lunenburg entlangführt, wie ich aus meinem Reiseführer weiß. Mein Herz macht einen Hüpfer, als ich den tiefblauen Atlantik vor mir sehe – und im nächsten Augenblick setzt es vor Schreck einen Schlag aus. Wie aus dem Nichts taucht ein Ungeheuer auf, ein zotteliges schwarzes Monster, das mich von der Seite anfällt.
Kapitel 3
Ein Bär! Ja, das muss ein Schwarzbär sein, denn Schwarzbären gibt es in Nova Scotia, das weiß ich aus dem Reiseführer. Manchmal verirren sie sich auch in die Städte, durchforsten Mülltonnen auf der Suche nach Fressbarem. O Gott, und schon an meinem allerersten Morgen in dieser Stadt werde ich von einem Bären angefallen! Mit einem lauten Kreischen taumele ich rückwärts, fuchtele in Panik mit meinen Armen, während ich zu spüren glaube, dass gigantische Tatzen nach mir ausholen. »Hilfe!«, schreie ich entsetzt und versuche, mich vor dem Biest in Sicherheit zu bringen.
Im nächsten Augenblick taucht ein Mann neben mir auf, und der Bär lässt von mir ab. Mit wild hämmerndem Herzen mache ich ein paar Schritte rückwärts, reiße mir meine Kopfhörer aus den Ohren, höre statt Springsteen nun deutlich, wie der Mann energisch ruft: »Skipper, aus! Was ist denn in dich gefahren? Aus!«
Und dann merke ich, dass der Bär bellt. Und mit dem Schwanz wedelt. Mit einem langen, zotteligen Schwanz. Ich bin mir fast sicher, dass Bären kurze Schwänze haben. Und sie bellen eher selten.
»Sorry!«, höre ich den Mann sagen und blinzele verstört, als ich ihn ansehe. Er ist dabei, dem schwarzen, zotteligen Ungeheuer eine Leine anzulegen, was mir endgültig klarmacht, dass ich mich vor einem Hund zu Tode erschrocken habe. Ich mag keine Hunde. Nein, ich habe sogar Angst vor ihnen, wie gerade mal wieder mehr als deutlich geworden ist.
Wenn man dieses gigantische Biest von dem Ausmaß eines kleinen Ponys überhaupt als Hund bezeichnen kann. Der Mann richtet sich auf und geht zwei Schritte in meine Richtung, wobei sein immer noch aufgeregt mit dem Schwanz wedelnder Hund bellend um ihn herumtänzelt und ihn fast stürzen lässt.
»Skipper, jetzt reicht es aber! Sitz!«
Zu meinem Erstaunen sinkt das schwarze Monster tatsächlich auf seinen Allerwertesten, wobei sein Schwanz weiterhin rhythmisch und schnell auf den Bürgersteig schlägt, ungefähr im gleichen Tempo wie mein panischer Herzschlag.
»Sorry«, höre ich den Mann wiederholen. »Skipper ist manchmal etwas überschwänglich, wenn er Joggern begegnet. Er rennt nämlich selbst für sein Leben gern.«
Nur zögernd löse ich meinen Blick von dem Hund, der mich mit schief gelegtem Kopf und weit heraushängender Zunge hechelnd mustert, denn ich befürchte, dass er mich wieder anfallen könnte, sobald ich mich wegdrehe. Dann jedoch ringe ich mich doch dazu durch, sein Herrchen anzusehen, während ich noch hektisch nach Luft schnappe. Der Fremde lächelt mich entschuldigend an.
»Wir wollten dich wirklich nicht erschrecken«, sagt er und streckt mir die Hand entgegen. Er trägt ein zerschlissenes braunes Lederarmband mit einer einzelnen blauen Glasperle. »Hi, ich bin Callum MacKay.«
Nach Atem ringend starre ich den Fremden an. Er dürfte in meinem Alter sein, also ungefähr Mitte dreißig, und ist ein ganzes Stück größer als ich – was allerdings nicht viel heißt, schließlich bin ich mit meinen 1,62 Metern ein wahrer Zwerg. Sein Haar sieht ungefähr so zerzaust aus wie das Fell seines Hundes, allerdings ist es nicht schwarz, sondern dunkelblond. Als würde auch ihm gerade bewusst werden, dass er sich heute Morgen noch nicht gekämmt hat, fährt sich Callum hastig mit der linken Hand durch seine Strähnen, die länger sind, als ich es bei Männern mag – so lang, dass er sich vermutlich fast einen kurzen Pferdeschwanz binden könnte. Nein, es geht doch nichts über eine gepflegte Kurzhaarfrisur, wie bei Lars, denke ich. Dann wird mir bewusst, dass mir dieser Callum immer noch seine rechte Hand hinhält, und ich gebe mir einen Ruck und schüttele sie zögernd. Allerdings muss ich weiterhin so sehr nach Atem ringen, dass ich kein Wort herausbekomme.
Callums Blick wird besorgter. Er mustert mich eingehend, und mir fällt auf, dass seine Augen tiefblau sind. Sie haben die gleiche Farbe wie der Atlantik, der hinter ihm in der Morgensonne glänzt.
»Geht es dir gut? Du … du bist ziemlich rot im Gesicht«, meint er vorsichtig, während Skipper leise winselt und fast so klingt, als würde er seinem Herrchen recht geben und sich ebenfalls um mich sorgen. Hätte mich dieses Monstrum von einem Hund nicht gerade zu Tode erschreckt, könnte ich ihn fast niedlich finden. Wenn man einen Hund, der eher an einen Schwarzbären erinnert, überhaupt als niedlich bezeichnen kann.
Verlegen wische ich mir mit einer Hand über das Gesicht. Ich ahne, wie ich aussehe: Wie immer, wenn ich jogge, bin ich sicherlich krebsrot im Gesicht, und da ich obendrein Hunderte Sommersprossen auf Stirn, Wangen, Nase und Kinn habe, wirke ich vermutlich wie ein rot-braun gesprenkelter, nach Luft ringender Zwerg mit äußerst wirren Locken.
»Mir geht es gut, ja«, stoße ich endlich hervor. »Ich … ich habe mich nur sehr erschrocken vor … Skipper.«
»Tut mir ehrlich leid«, wiederholt der Mann und wirft seinem Hund einen tadelnden Blick zu. »Skipper ist leider ziemlich überschwänglich.«
Das Schwanzklopfen auf dem Asphalt wird stärker, und ich merke, dass Skipper nur zu gern wieder auf mich zuspringen würde, aber Callums strenger Blick scheint das gerade noch zu verhindern.
»Ich dachte, er wäre ein Bär«, gebe ich zu, bevor ich die Worte verhindern kann. Callums blaue Augen weiten sich, halb überrascht, halb amüsiert, merke ich. Nur mit Mühe scheint er ein Lachen unterdrücken zu können, als er wiederholt: »Ein Bär?«
»Es ist mein erster Morgen in Kanada!«, verteidige ich mich rasch und spüre noch mehr heiße Röte in meinen Kopf schießen. Diese verfluchte Schüchternheit, die ich einfach nicht abschütteln kann! Ich bin versucht, mir wieder meine Kopfhörer in die Ohren zu schieben, mich umzudrehen und weiterzujoggen – wäre da nicht die Sorge, dass Skipper mich verfolgen könnte.
»Du machst hier Urlaub?«, hakt Callum nach und mustert mich neugierig.
»Ja«, erwidere ich einsilbig.
»Woher kommst du?«
»Aus Deutschland.«
»Wow, ganz schön weit weg. Und verrätst du mir, wie du heißt?«
»Ich muss weiter.«
Callum lacht auf. »Merkwürdiger Name.«
»Haha«, murmele ich verlegen und nestele an meinen Kopfhörern herum, schiebe mir einen ins Ohr.
»Hey, hör mal, es tut mir echt leid, dass dir Skipper so einen Schrecken eingejagt hat«, beteuert Callum rasch. »Ich weiß, er kann furchterregend wirken, wenn man ihn nicht kennt – aber er ist einfach ein riesiger, gutmütiger, leider nicht besonders intelligenter, aber dafür extrem verspielter Kerl. Und er hat übrigens auch ein wenig deutsches Blut: Außer Neufundländern hat sich nämlich eine deutsche Dogge in seinen Genpool geschummelt, soweit ich seinen Stammbaum nachvollziehen konnte. Außerdem ganz sicher ein Stinktier. Und, wenn ich es mir recht überlege, vielleicht lagst du gar nicht falsch und es ist sogar etwas Schwarzbär in ihm.«
Als wolle er bestätigen, dass Callum recht hat, jault Skipper einmal laut auf und sieht mich erwartungsvoll hechelnd an. Gegen meinen Willen muss ich lächeln.
»Aha«, murmele ich. »Das erklärt einiges.«
»Ja, oder? Allerdings weiß ich immer noch nicht, wie du heißt«, grinst mich Callum an. Er wirkt völlig gelassen und selbstbewusst, und ich beneide ihn darum.
»Amelie«, erwidere ich knapp.
»Schöner Name.«
Ich ignoriere Callums Bemerkung und beginne, meinen zweiten Kopfhörerstöpsel in mein Ohr zu schieben.
»Hey, warte«, bittet mich der fremde Kanadier mit dem Ungetüm von einem Hund, und ich sehe ihn zögernd an. Ich möchte wirklich dringend weiterrennen und keinen Small Talk halten, schließlich hasse ich Small Talk schon unter normaleren Umständen als diesem: am frühen Morgen, verschwitzt und mit knallrotem Gesicht, noch dazu vor meinem ersten Kaffee.
»Was für Musik hörst du beim Laufen?«
Wie bitte? Ich brauche zwei Sekunden, bis ich seine Frage begreife, dann antworte ich überrascht: »Am liebsten Springsteen.«
Callum pfeift anerkennend. »Guter Geschmack«, bemerkt er, während ich an meinem i-Pod herumnestele. »Bleibst du länger hier in Lunenburg?«
»Vielleicht«, weiche ich aus und wende mich zum Gehen.
»Solltest du heute Abend noch nichts vorhaben …«, beginnt Callum, und mir ist klar, dass in meinem Blick geradezu Panik aufflackern muss, als ich ihn ungläubig anstarre. Callum scheint das auch zu registrieren, denn er macht einen halben Schritt rückwärts und meint beinahe beschwichtigend: »Also – ähm, es gibt da dieses Pub, The Singing Sailor, und da spielt heute Abend eine Band. Ich dachte, wenn du Springsteen magst, dann könnte die Musik dort was für dich sein.«
»Aha«, mache ich. Dann vergewissere ich mich mit einem raschen Blick, dass Callum die Hundeleine fest in der Hand hält, sehe Skipper ein letztes Mal an und wende mich ab. Ich glaube, dass Callum noch etwas sagt, aber ich höre ihn nicht mehr, denn ich habe mir entschlossen den zweiten Stöpsel ins Ohr geschoben, drehe Bruce laut auf und renne weiter, auf den tiefblauen Atlantik zu, ohne mich noch einmal zu dem Mann umzudrehen, dessen Augen die gleiche Farbe haben.
Ich merke erst, dass ich über eine Stunde am Hafen von Lunenburg gesessen habe, als sich mein Magen laut knurrend in Erinnerung bringt. Aber dieser Hafen ist auch einfach so schön, dass man leicht Zeit und Hunger, ja sogar Kaffeedurst vergessen kann: Das leuchtende Feuerrot eines hölzernen Gebäudekomplexes nahe dem Ufer, auf dessen Front in großen Lettern »Adams & Knickle Ltd.« zu lesen ist, bildet einen dramatischen Kontrast zum tiefblauen Wasser der Hafenbucht. Eine Weile habe ich neben diesem Gebäude auf einer Bank gesessen, die am Rande eines Kreises aus aufrecht stehenden schwarzen Granitplatten ein Plätzchen zum Verweilen bietet. Die Anordnung der Platten soll an eine Kompassrose erinnern, habe ich in meinem Reiseführer gelesen, und in den Granit sind in langen Spalten die Namen all der Seeleute aus Lunenburg eingraviert worden, die für immer auf dem Atlantik geblieben sind. Die ersten hier Verewigten sind im Jahr 1890 umgekommen, die letzten erst im vergangenen Jahr. Nachdenklich ist mein Blick eben über die zahlreichen Namen gewandert, von denen tatsächlich viele deutsch klangen und an die ersten Siedler erinnerten: Zwicker und Kraus waren dabei, viele Himmelmans und Knickles. Bevor mich die Traurigkeit dieser Granittafeln zu sehr in Beschlag nehmen und schmerzlich an meinen eigenen Verlust erinnern konnte, habe ich mich abgewandt und bin schnellen Schrittes auf die breite hölzerne Pier gelaufen, die in das dunkelblaue Hafenwasser hinausragt.
Und hier sitze ich nun, an einen Poller gelehnt, mein Gesicht der Morgensonne zugewandt, das Kreischen der Möwen in den Ohren, salzige Luft in den Lungen. Dieser Ort macht mich auf unerklärliche Weise glücklich, stelle ich zu meinem eigenen Erstaunen fest. In der Luft hängt das leise bimmelnde Geräusch der metallenen Ösen mehrerer Segel, die gegen Masten schlagen. Es liegen einige Segelboote und zig hölzerne Ruderboote angeleint an der Pier, auf der ich sitze, und auch draußen, in der Hafenbucht, schwimmen diverse Jachten, anscheinend mit Ankern festgemacht. An einer weiteren Pier zu meiner Linken liegen außerdem zwei größere Fischtrawler, die mir bewusst machen, dass es in Lunenburg nach wie vor Fischerei-Industrie gibt.
Eine Weile beobachte ich ein kleines Segelboot, das von der Pier ablegt und zunächst mithilfe eines Motors hinaus in die Bucht fährt, bis die Segel gehisst werden und sich geradezu begeistert im Wind blähen, sodass das Boot ohne maschinelle Hilfe still und elegant auf den Atlantik hinausgleiten kann. Ich war noch nie auf einem Segelboot, aber als ich dem weißen Segel hinterhersehe, bekomme ich eine unbestimmte Sehnsucht nach der Weite, die einen dort draußen, außerhalb der Bucht, erwarten muss.
Mit einem zufriedenen Seufzer lasse ich meinen Blick von dem Segelboot aus über das dunkelblaue Wasser gleiten, betrachte einen Vogel, der auf den Wellen schwimmt – ist das ein Kormoran? –, und beobachte gegenüber, auf der anderen Seite der Bucht, einen kleinen weißen Wagen, der über eine weitläufige, gepflegt wirkende Rasenfläche fährt. Aha, dort drüben scheint ein Golfplatz zu sein. Ich bin absolut kein Golf-Fan, aber von dort aus muss man einen wirklich fantastischen Blick auf Lunenburg haben. Ich drehe mich halb um, betrachte die Reihe aus kunterbunten Holzhäusern, die hinter dem Bluenose Drive auf den Hafen und das Meer hinabsehen. Die Fassaden leuchten in Lila und Rosa, Gelb, Grün und Blau in der Morgensonne und lassen mich verzückt an bunte Perlen an einer Halskette denken. Und da entdecke ich es, neben dem Restaurant mit der zweistöckigen Veranda, von wo aus man beim Essen sicherlich wunderbar auf den Hafen hinabsehen kann: Ein kleines, grau geschindeltes Haus, über dessen Sprossenfenstern ein großes Schild hängt: »Seaview Coffee Shop«. Okay, höchste Zeit für Kaffee!
In dem heimeligen Coffee Shop herrscht schon um kurz vor halb neun an diesem Morgen reger Betrieb. Neugierig sehe ich mich um, betrachte die große Schiefertafel hinter der Theke, an der mit Kreide in geschwungener Handschrift die Speisen und Getränke festgehalten sind, gekrönt von den Worten: »Smell the sea, and feel the sky, let your soul and spirit fly, into the mystic …«
Ahh, ich liebe das Lied von Van Morrison, aus dem die Zeilen stammen! Und nicht nur dieses Zitat erinnert daran, dass der Ozean lediglich ein paar Schritte entfernt ist, denn ich bemerke, dass der Tisch, der sich an der Fensterfront zur Straße entlangzieht und an dem einige Coffee-Shop-Besucher auf Barhockern nebeneinandersitzen, aus einem Surfbrett gefertigt wurde. Von der Decke hängen mehrere der bunten, hölzernen Bojen herab, die ich inzwischen gut kenne, die Wände werden von großen gerahmten Fotos diverser Segelschiffe verziert, und als Treppengeländer entlang der drei Stufen, die in den hinteren Teil des Coffee Shops hinabführen, dient ein hölzernes Paddel. In diesem tiefergelegenen Bereich des Cafés kann man wunderbar an kleinen Tischen entlang einer weiteren Fensterfront sitzen und auf den Atlantik hinabsehen.
Während ein junges Mädchen (bunte Hängeohrringe aus Holz im Ethno-Stil und mehrere geflochtene Freundschaftsarmbänder an beiden Handgelenken) hinter dem Tresen Milch aufschäumt, plaudert der bärtige Mann mit dem langen, geflochtenen Zopf in Silbergrau, der offensichtlich der Besitzer des Coffee Shops ist, gut gelaunt mit diversen Stammkunden. Er scheint jedem sein übliches Getränk zuordnen zu können, ohne dass die Gäste überhaupt etwas sagen müssen: Der rothaarige Mann mit dem ölbefleckten Overall bekommt einen großen Mocha Latte ohne Sahne, die zwei älteren Damen trinken jeweils einen mittelgroßen Karamell Macchiato, die eine (Perlenkette und goldene Ohrstecker) mit einem Extra-Schuss Sirup, die andere (Perlmuttarmreif und auffällige Ohrringe, die aus antiken Silbergabeln geformt worden sein müssen, faszinierend!) mit Sojamilch, beide am Ecktisch mit der tollen Aussicht über den Hafen. Und die junge Mutter (nur ein Ehering, sonst kein Schmuck) mit den Augenringen und dem Baby im Tragetuch, die vor mir dran ist, bekommt den entkoffeinierten Milchkaffee, obwohl sie ganz sicher ein wenig Koffein gebrauchen könnte – aber ihr Baby wohl eher nicht.
»Hallo!«, begrüßt mich der Besitzer des Ladens mit sonorer Stimme und lacht mich freundlich an. »Was du trinkst, weiß ich noch nicht. Also, was dürfen wir dir zaubern?«
»Einen kleinen Latte Macchiato to go, bitte«, sage ich und fühle überdeutlich die heiße Röte in meine Wangen steigen, wie immer, wenn ich mich mit Fremden unterhalten muss. Verlegen nestele ich ein paar Dollarscheine aus der seitlichen Eingrifftasche meiner Jogginghose und beobachte, wie der Mann fröhlich pfeifend eine blau geblümte Porzellantasse unter den Kaffeevollautomaten schiebt. Ich will schon etwas sagen, will wiederholen, dass ich meinen Kaffee zum Mitnehmen haben wollte, aber wie immer in solchen Momenten kommt mir kein Ton über die Lippen. Wie oft ich schon beim Bäcker das falsche belegte Brötchen entgegengenommen habe, wie oft ich im Restaurant das falsche Gericht klaglos akzeptiert habe, ich kann es nicht sagen. Ich bringe es einfach nicht über mich klarzustellen, dass ich etwas anderes wollte. Ja, das zu sagen, was ich will, fiel mir schon immer schwer.
Aber dieses Mal bekomme ich gar nicht das Verkehrte, merke ich plötzlich, als ich meinen Blick über die Holztheke wandern lasse und das Schild erblicke, das neben einem ganzen Tablett voll von solch blau geblümten Porzellantassen steht: »Take away your coffee, return the mug« lese ich, also: Nimm deinen Kaffee mit, bring die Tasse zurück. Da erkenne ich auch den gerahmten Zeitungsartikel an der Wand hinter der Theke, und ich trete einen Schritt näher an den Rahmen heran und überfliege den Text, in dem es um den Beschluss des Stadtrats von Lunenburg geht, Wegwerf-Plastik-Artikel zu verbieten: Plastiktüten im Supermarkt, Plastikteller in den Imbissstuben – und eben Pappbecher mit Plastikdeckeln in den Coffee Shops. Erstaunt lese ich, dass alle Ladenbesitzer des Ortes dafür waren, obwohl es für manche mehr Aufwand bedeutet, wie eben die Porzellantassen wieder zu spülen. Außerdem müssen sie darauf hoffen, dass alle Tassen zurückgebracht werden, aber darüber scheint sich in Lunenburg laut dem Artikel bisher niemand Sorgen zu machen.
»Die Leute spielen wunderbar mit, bisher sind kaum Tassen abhandengekommen!«, wird der Besitzer des Seaview Coffee Shops zitiert. Der heißt laut Zeitungsartikel Jimmy und lacht von einem Schwarz-Weiß-Foto neben dem Text fröhlich in die Kamera, in jeder Hand eine der geblümten Tassen, sein grauer Zopf über einer Schulter hängend.
»Guten Morgen!«, höre ich in dem Augenblick eine Stimme hinter mir, begleitet vom Bimmeln der Glocke über der Ladentür. Merkwürdig, überlege ich ratlos. Diese Stimme erinnert mich stark an …
Ich drehe mich um und starre den Herrn an, der den Coffee Shop betreten hat und sich hinter mir anstellt. Fassungslos schnappe ich nach Luft.
Kapitel 4
Papa?«, frage ich ratlos. Der ältere Herr, der gerade gut gelaunt den beiden Damen am Ecktisch zugewinkt hat, starrt mich verblüfft an. Ich starre zurück – in die hellblauen Augen meines Vaters. Allerdings hängt das linke Lid nicht, und als er den zwei Frauen zugelächelt hat, gingen beide Mundwinkel in die Höhe. Und, was noch frappierender ist – der Mann vor mir trägt einen dichten grauen Vollbart, den mein Vater gestern Abend noch nicht hatte. Aber wer zum Teufel …?
»Ähm, ich denke, Sie verwechseln mich«, lacht der Mann nun auf, wirkt aber nicht wirklich amüsiert, sondern auf einmal fast verstört. Er spricht sehr gutes Englisch, fällt mir auf. Papa eher nicht.
»Ähm, Entschuldigung«, stammele ich, obwohl das gar nicht sein kann. Das ist keine Verwechslung. So viel Ähnlichkeit gibt es doch gar nicht!
»Ah, guten Morgen!«, höre ich Jimmy erfreut rufen, während er meinen Latte Macchiato über die Theke schiebt. »Dein Kaffee kommt gleich, altes Haus. Schwarz wie deine Seele, wie immer.«
Der Mann, der aussieht wie mein Vater, nickt mit einem gemurmelten »Danke dir, Jimmy«, dann sieht er wieder mich an, so ernst und gleichzeitig verwirrt, wie auch ich mich fühle.
Das ist heute wirklich alles zu viel für mich. Erst träume ich die halbe Nacht vom Freund meiner Schwester, dann werde ich von einem bärenähnlichen Hund angefallen und blamiere mich vor seinem Besitzer mit den meerblauen Augen, und schließlich laufe ich zu allem Überfluss einem Mann über den Weg, der aussieht wie mein Vater. Himmel noch mal, warum bin ich denn bloß nach Lunenburg gekommen? So zauberhaft schön dieses Städtchen auch sein mag, es tut meiner Seele, die sich einfach nur nach Ruhe sehnt, wirklich überhaupt nicht gut.
Hastig wende ich mich ab, spüre, wie mein Körper von Kopf bis Fuß vor Hitze brennt. Verlegen schiebe ich mein Geld über die Theke, stottere ein Dankeschön und flüchte auch schon aus dem Laden, meine Porzellantasse fest in einer Hand, dem fragenden Blick des Doppelgängers meines Vaters hartnäckig ausweichend.
Als ich das meergrüne Haus erreiche, bin ich völlig außer Atem. Von meinem Kaffee habe ich nur gerade so viel abgetrunken, dass beim Gehen nichts über den Rand schwappen konnte, so eilig hatte ich es, zurückzukommen und meinen Vater zu sprechen.
»Papa?«, frage ich atemlos, als ich das Wohnzimmer betrete. Doch hier ist niemand. »Papa?«, rufe ich, lauter diesmal. Da höre ich aus dem Garten Neles Stimme, wie immer eine Spur zu laut.
Ich durchquere die Küche, von der eine Hintertür in den Garten hinausführt. Unter den weit ausladenden Ästen eines großen Ahornbaums, der den halben Rasen in Schatten taucht, sitzen Papa, Lars und Nele an einem dieser amerikanischen Holz-Picknick-Tische, bei denen die Sitzbänke fest mit dem Tischteil verbunden sind.
»Ach, da ist sie ja!«, höre ich Nele sagen. Erwartungsvoll sehen mir die drei entgegen. »Wohin bist du denn schon so früh verschwunden?«
»Ich war joggen«, erkläre ich und stelle meine Tasse auf den Holztisch, während ich mich neben Papa auf die Bank sinken lasse.
»Du bist aber nicht über zwei Stunden lang gelaufen, oder?«, hakt mein Vater ein wenig besorgt nach und mustert mich eingehend. Vermutlich leuchtet mein Gesicht noch immer krebsrot, aber das ist gerade egal.
»Nein, ich … ich saß noch eine Weile am Hafen. Ist wunderschön da.«
»Ja, wir wollen auch gleich mal eine Erkundungstour machen«, sagt Lars. Er sieht verdammt gut aus, stelle ich fest, in dunkelblauem Poloshirt und beigen Shorts, ganz auf Urlaub eingestellt. Mein Herz stolpert kurz, bevor ich meinen Blick hastig von ihm abwende und versuche, nicht schon wieder die Bilder der letzten Nacht in mir hochsteigen zu lassen.
»Ist das etwa Kaffee?« Nele reckt ihren Hals und schielt geradezu gierig in meine Tasse. »Hast du Kaffeepulver besorgt?«
»Nein«, erwidere ich, ein wenig schuldbewusst. »Das ist ein Coffee to go aus einem ganz süßen Coffee Shop am Hafen.«
»Das ist ein Coffee to go?« Ratlos mustert Lars die blau geblümte Porzellan-Tasse.
»Ja, in Lunenburg sind Wegwerf-Plastik-Artikel verboten, darum gibt es diese Tassen, die man nach Gebrauch zurückbringen soll. Eine geniale Idee, finde ich.«
»Eine noch genialere Idee wäre es gewesen, mir auch einen Kaffee mitzubringen, Schwesterherz«, meldet sich Nele mit schneidender Stimme zu Wort.
Betroffen lasse ich die Tasse sinken, reiche sie dann meiner Schwester über den Picknicktisch hinweg. »Hier, trink ruhig.«
»Ist da Zucker drin?« Misstrauisch beäugt Nele mein Getränk. Ich schüttele den Kopf.
»Nee, danke«, sagt sie da und verschränkt die Arme vor der Brust, starrt auf ihre Fingernägel hinab, die in einem hübschen Himbeerrosa lackiert sind. Überhaupt sieht sie mal wieder zum Anbeißen aus: Der üppige Volant am Carmen-Ausschnitt ihres weißen Oberteils betont ihre grazilen Schultern, und obwohl ich nichts für den meistens ziemlich kitschigen und viel zu üppigen Modeschmuck übrig habe, den Nele gern trägt, ist ihre heutige Kette mit den pastellfarbenen Plastikblüten ganz niedlich und beinahe dezent. Neles Haar ist zu einem französischen Zopf geflochten – eine Frisur, die ich liebend gern mal tragen würde, die aber dank meiner wilden Locken ein Ding der Unmöglichkeit ist.
»Zucker ist bestimmt in der Küche zu finden«, bemerke ich. »Soll ich welchen holen?«
»Nein, schon gut«, erwidert meine Schwester mit einem ungeduldigen Augenrollen, und ich stelle meine Tasse mit einem Seufzer vor mir ab. Es hat keinen Sinn, mit Nele zu diskutieren. Sie war noch nie ein Morgenmensch, aber heute scheint sie ganz besonders schlecht drauf zu sein.
Ich frage mich wirklich, wie Lars es mit ihr aushält.
»Hast du schon gegessen?«, fragt Papa und hält mir einen Brotkorb entgegen, in dem noch zwei verlorene Toastbrotscheiben liegen. »Wir haben Marmelade und Frischkäse. Später müssen wir noch einmal einkaufen gehen, gründlicher als gestern. Irgendwie haben wir die Hälfte vergessen. Nicht nur Kaffeepulver, sondern auch Butter und Eier. Ich hätte sonst Rührei gemacht.«
»Danke«, murmele ich und angele eine Brotscheibe heraus, lasse sie dann aber einfach nur achtlos auf meinen Teller fallen. Ich kann jetzt wirklich nicht an Essen denken.
»Ist alles okay, Amelie? Du siehst ein wenig … aufgewühlt aus«, meint Papa nachdenklich und tätschelt liebevoll meine Wange.
»Papa, ich … ich bin eben, im Coffee Shop, jemandem begegnet, der aussah wie du.«
Mein Vater starrt mich groß an, und ich höre Nele losprusten. Dann hustet sie, weil sie sich anscheinend an einem Toastkrümel verschluckt hat, und Lars klopft ihr pflichtschuldig auf den Rücken, während er mich ratlos über den Tisch hinweg ansieht.
»Du meinst, Papa hat einen Doppelgänger in Lunenburg?«, fragt Nele und holt keuchend Luft. Dann kichert sie albern los. »Das ist ja ein Ding! Hast du ein Foto gemacht?«
Ihr ausgelassenes Lachen versetzt mir ohne jede Vorwarnung einen wehmütigen Stich. Plötzlich scheint Nele überhaupt nicht mehr morgenmuffelig zu sein, und sie zickt auch nicht länger herum, weil ich ihr keinen Kaffee mitgebracht habe. In diesem Moment ist sie auch nicht die altkluge Lehrerin, die mich mit dieser gewissen Arroganz in der Stimme fragt, wie lange ich denn noch bei Peters & Hagemüller »jobben« wolle, wie sie es auf dem Hinflug mal wieder getan hat. Und sie ist für einen Augenblick nicht die Unsensible, die nicht zu realisieren scheint, dass ihre Bemerkung, ich brauche ja kein Kingsize-Bett, mich, den notorischen Single, verletzt.