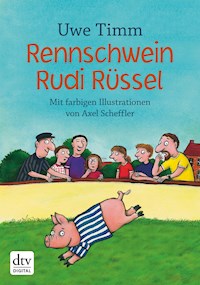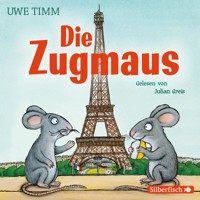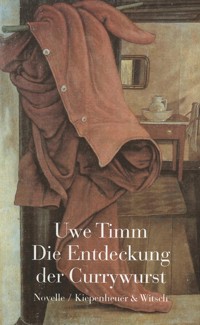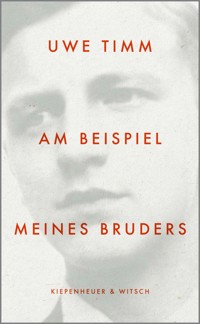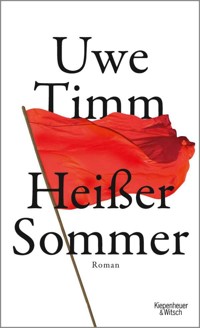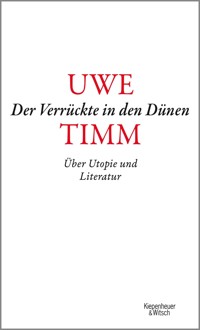9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den Geschichten dieses Buches folgt Uwe Timm der Spur des Wunderbaren, das in scheinbar gewöhnlichen Alltagssituationen nistet. Mit seinem absoluten Gehör für die gesprochene Sprache, voller Sinn für Ironie und Situationskomik, erzählt Timm von überraschenden Wendungen im Leben seiner Figuren. Wie kann ein einziges Abendessen eine recht ungewöhnliche Ehe beenden, und was wird aus der blutjungen Frau, die mit verdorbenem Magen aus der Wohnung flieht? Wie wird sie, die ewig Ungeschickte, ihr Leben meistern? Was mag der Fahrer eines Lastwagens, von zwei jungen Frauen engagiert, wohl von der Tour nach Polen in den Westen transportieren und warum lässt er den Wagen dann einfach stehen? Und welch tückische Rolle kann ein Schließfach im Leben eines Querkopfes spielen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Uwe Timm
Nicht morgen, nicht gestern
Erzählungen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Uwe Timm
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Uwe Timm
Uwe Timm, geboren 1940, freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt Vogelweide, 2013, Freitisch, 2011, Am Beispiel eines Lebens, 2010, Am Beispiel meines Bruders, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, Der Freund und der Fremde, 2005, und Halbschatten, Roman, 2008. Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet, erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis und 2012 die Carl-Zuckmayer-Medaille.
Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch
Der Mann auf dem Hochrad, Legende, 1984 Morenga, Roman, 1984. Der Schlangenbaum, Roman, 1986. Vogel, friss die Feige nicht.Römische Aufzeichnungen, 1989. Kopfjäger, Roman, 1991. Erzählen und kein Ende, 1993. Die Entdeckung der Currywurst, Novelle, 1993. Johannisnacht, Roman, 1996. Nicht morgen, nicht gestern, Erzählungen, 1999. Eine Hand voll Gras, Drehbuch, KiWi 580, 2000. Rot, Roman, 2001, Sonderausgabe 2005. Am Beispiel meines Bruders, 2003. Der schöne Überfluss. Texte zu Leben und Werk von Uwe Timm, hrsg. von Helge Malchow, 2005.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
In den Geschichten dieses Buches folgt Uwe Timm der Spur des Wunderbaren, das in scheinbar gewöhnlichen Alltagssituationen nistet. Mit seinem absoluten Gehör für die gesprochene Sprache, voller Sinn für Ironie und Situationskomik, erzählt Timm von überraschenden Wendungen im Leben seiner Figuren. Wie kann ein einziges Abendessen eine recht ungewöhnliche Ehe beenden, und was wird aus der blutjungen Frau, die mit verdorbenem Magen aus der Wohnung flieht? Wie wird sie, die ewig Ungeschickte, ihr Leben meistern? Was mag der Fahrer eines Lastwagens, von zwei jungen Frauen engagiert, wohl von der Tour nach Polen in den Westen transportieren und warum lässt er den Wagen dann einfach stehen? Und welch tückische Rolle kann ein Schließfach im Leben eines Querkopfes spielen?
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1999, 2003, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Klaus Oberer, München
Covermotiv: © Klaus Oberer, München
ISBN978-3-462-30879-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Das Abendessen
Nicht morgen, nicht gestern
Screen
Der Mantel
Das Schließfach
Eine Wendegeschichte
Für Hanne Lore Timm
Das Abendessen
Ich habe sie gleich wiedererkannt. Ich war etwas früher zu den Gates im Kennedy-Airport gegangen, in die Rauchersektion, wo ich sie sitzen sah, diese noch immer zierliche Frau, älter geworden war sie, natürlich, hatte sich sonst aber kaum verändert, auch das Haar hatte noch diesen leuchtend kastanienbraunen Ton. Dabei musste sie, wenn ich richtig rechnete, 46 sein. Sie trug Jeans, ein weißes langärmeliges Hemd, darüber ein ausgewaschenes, blaues kurzärmeliges T-Shirt. Neben dem Sessel stand eine große Fototasche. Sie las in sich versunken ein amerikanisches Taschenbuch, dessen Titel ich nicht erkennen konnte, und hin und wieder führte sie ohne aufzublicken die Zigarette zum Mund, rauchte langsam, ohne jede Gier, eher beiläufig, und doch lag eben darin etwas betont Lustvolles. Getroffen hatte ich sie nur einmal, bei einem Abendessen, vor knapp zwanzig Jahren, allerdings das merkwürdigste Abendessen, das ich erlebt habe. Sie und ihr Mann hatten uns eingeladen, Gisela und mich. Das mit Gisela war eine dieser kurzen Freundschaften, die – es waren die freizügigen Siebzigerjahre – schnell geschlossen wurden und sich ebenso schnell und meist problemlos wieder auflösten. Gisela war mit Renate befreundet. Von Renate, genannt Princy oder auch Princess, hatte ich schon vorher viel gehört. Ein damaliger Freund, Lionel, der wie Renate Kunstgeschichte studierte, beschrieb sie mir als wunderschön, aber schwer erträglich. Sie hat immer eine kleine Stofftasche bei sich, darin ein Kissen, das sie sich auf die Bänke in der Uni, aber auch auf Stühle und Sessel legt, nicht etwa wegen eines Bandscheibenschadens, sondern um etwas höher zu sitzen. Und dann gibt sie, wenn man mit ihr unterwegs ist, irgendjemandem diese Stofftasche kurz zum Halten und vergisst sie regelmäßig in der Hand des anderen, sodass ihr immer jemand diese Tasche nachträgt. Eine Prinzessin auf der Erbse. Perfekt, sagte Lionel, äußerlich perfekt, ja wunderschön, sehr zart, aber eben auch mit diesem Selbstverständnis ausgestattet, zerbrechlich zu sein. Wie diese Stofftasche trägt sie auch einen Anspruch mit sich herum: Ihr andern seid erschienen, mich fürstlich zu bedienen. Princess. Und nun hat sie auch noch ihren Frosch gefunden. Ramm heißt der Typ, sagte er, hat Geld und eine Glatze, ist sonst aber behaart wie ein Orang-Utan.
Wart ihr mal schwimmen?
Nein, aber seine Hemden sind für seinen Bauch immer zu knapp geschnitten, also drängt sich zwischen den Knöpfen das Bauchfell durch, rötlich braun, das Fell eines Yetis. Lionel hatte, als er mir das erzählte, schon einiges getrunken, und seine Erregung über Ramm und Renate bestätigte den Verdacht, dass er sich ziemlich in sie verliebt hatte.
Nein, sagte Gisela, die Renate am besten kannte, sie ist ganz anders, sehr konsequent, aber eben zugleich wirklich hilflos, wie von einem anderen Stern.
Ich war neugierig auf die beiden, auf Renate wie auf Ramm. Sie hatten erst vor drei Monaten geheiratet und gerade eine Altbauwohnung mit sechs Zimmern in Eppendorf bezogen. Eine übergroße Wohnung für zwei Personen. Die Wohnung war grundrenoviert, die Stukkatur säuberlich ausgekratzt, es roch nach Farbe. Zimmer von einer ruhigen weißen Leere, ein Tisch, schwarz, die Stühle ebenfalls schwarz, die Sessel schwarze Lederwürfel von Le Corbusier, mit Chromspangen versteift, an der Wand etwas Abstraktes, Rot und Blau waren über eine Leinwand heruntergesuppt.
Renate war, wenn ich mich recht entsinne, gerade 26 geworden, sah aber aus wie siebzehn. Alles an ihr war zierlich, die Beine, die Finger, die Hände, die Ohren, die Ohrläppchen, der Hals, Nase, und alles stimmig, tatsächlich makellos, man suchte regelrecht nach einem störenden Detail, hätte sie wenigstens einen schiefen Schneidezahn gehabt, aber sogar die Zähne waren ebenmäßig. Lediglich die Stimme irritierte, so tief, wie sie war. Sie passte einfach nicht in diesen zierlichen Körper. Auch das Lachen nicht, ein dunkles, eigentümlich raues Lachen. Ich mochte dieses Lachen, denn es ließ mich jedes Mal wieder aufhorchen. Wenn wir alle lachten, hörte ich immer nur ihr Lachen. Und wenn ich sie ansah, war es, als lachte, warm und lebendig, eine dieser Schaufensterpuppen, die damals als perfekt plastifizierte Mädchenfrauen die Kaufhausschaufenster bevölkerten. Ich gab mir denn auch an dem Abend die größte Mühe, Renate zum Lachen zu bringen.
Ramm war viel älter als sie, fünfundvierzig, also für uns damals, die wir Mitte Zwanzig waren, uralt. Das Seidenhemd spannte sich über seinen Bauch, und tatsächlich war ein Knopf aufgesprungen, und ein paar dunkelbraune Haare lugten hervor. Ramm hatte etwas schütteres Haar, aber keineswegs eine Glatze, wie Lionel behauptet hatte. Warum ausgerechnet den, hatte Lionel immer wieder gefragt, diesen Yetifrosch.
Der Grund ist doch ganz einfach, hatte Gisela gesagt.
Da bin ich aber gespannt!
Sie langweilt sich nicht mit ihm. Ramm ist witzig und für jede Überraschung gut. Außerdem kocht er hervorragend. Und er legt ihr alles, sich selbst sogar, zu Füßen.
Ramm war freundlich, souverän, mit einem guten Sinn für Komik und Selbstironie. Er kam viel in der Welt herum, arbeitete in einem Büro für Unternehmensberatung, das auch international agierte. Wir erzählten von Professoren, Seminararbeiten und Hörsälen, während er gerade aus New York zurückgekommen war. Schon eine Taxifahrt durch Manhattan brachte mehr Stoff als ein Monat an der Uni in Hamburg. Damals, Mitte der Siebzigerjahre, war es an den Hochschulen wieder ruhig geworden, keine Streiks mehr, keine Institutsbesetzungen, keine Wasserwerfer vor dem Philosophenturm. In dem grauen Betonklotz gingen die Leute wieder ihren Studiengängen nach, wenn sie nicht an Selbstmord dachten.
Er habe, erzählte Gisela, auf einem der sonst so faden Sonntagsspaziergänge Renate gefragt, ob sie ihn heiraten wolle, und als sie antwortete, bist du verrückt, habe er Ja gesagt und sich ausgezogen – es war Winter, einer der seltenen schneereichen Winter in dieser Stadt – und sich auf dem Alsteruferwanderweg vor ihren Augen nackt im Schnee gewälzt. Willst du mich heiraten?, hatte er gerufen, immer wieder: Willst du mich heiraten? Erst hatte sie nur gelacht und dann schnell Ja gesagt, denn Spaziergänger näherten sich, eine Familie mit drei Kindern und Hund.
Außerdem – die treibende Kraft kleiner, doch sehr konkreter Wünsche ist nicht zu unterschätzen – hatte sie sich schon immer eine große Altbauwohnung gewünscht. Als Kind sei sie in so einem langen Wohnungskorridor Rollschuh gelaufen, ihr Vater war früh gestorben, und ihre Mutter musste mit Renate in eine kleine Neubauwohnung ziehen.
Mach du doch bitte den Wein auf, sagt Ramm zu mir und reicht mir vorsichtig eine Flasche aus dem Holzregal. Diamond Creek 1973, aus Kalifornien, ein Cabernet Sauvignon. Und du, Renatekind, sagt Ramm, wenn du schon mal bitte die Rotweingläser hinstellst.
Und Renatekind reckt sich, stellt sich auf die Zehenspitzen, die spitzen Absätze der Pumps heben sich, der Minirock zieht sich noch weiter über die zierlichen Oberschenkel hoch, sie streckt den braun gebrannten Oberarm aus, und der tief ausgeschnittene Blusenärmel gibt den Blick auf die kleine, zartweiße Brust frei, ihre Hand streckt sich, die Finger kommen dennoch nicht an die Gläser. Sie hätte jetzt einen Stuhl heranziehen und hinaufsteigen können, aber sie blickt sich Hilfe suchend um, da sagt Gisela, die gute einsachtzig misst und im studentischen Ruderclub als Schlagfrau im Vierer ohne Steuermann schon mehrere Preise auf der Alster geholt hat: Komm, lass mich mal ran, und Gisela greift in den Schrank und holt die Gläser heraus. Ramm hatte uns nach einem extratrockenen Oporto in die Küche dirigiert, eine dieser Küchen, in denen man zu zehnt sitzen kann und die nach dem letzten technischen Stand eingerichtet war, alles glänzte, strahlte. Nur manchmal, sagt Renate, wenn Ramm kocht – sie nannte Ramm nur beim Nachnamen –, riecht es so nach Horn.
Nein, sagt Ramm, das ist nicht Horn, das ist Lack, aber ein Naturlack. Hab ich extra drauf bestanden. Wenn wir erst ein paarmal gekocht haben, verliert sich der Geruch.
Vielleicht liegt es doch an der Platte. Vielleicht hättest du doch eine Mikrowelle einbauen lassen sollen, sagt Renate.
Nein, sagt er, die lehne er ab, prinzipiell. Alles wird beschleunigt, auf der Straße, in der Luft, im Büro, in den Beziehungen, da muss man sich wenigstens beim Kochen Zeit nehmen. Leider gibt es kein Gas hier. Nur auf einer Flamme kann man präzise kochen. Dafür zeigt er uns eine technische Neuheit, brandneu, wir bestaunen einen Elektroherd mit einer durchgehenden Keramikplatte, darunter leuchten glührot die Heizringe. Ein Material, sagt Ramm, das bei den milliardenschweren Anstrengungen, einen Fuß auf den Mond zu kriegen, abgefallen ist. Ramm hat etwas von Eric Clapton aufgelegt und klopft den Takt mit einem Holzkochlöffel auf die schwarzgranitene Anrichte. Erst muss die Platte heiß werden, und zwar richtig, erklärt er uns, dann die Pfanne draufstellen, ebenfalls richtig heiß werden lassen. Er holt das Kartoffelgratin aus dem Ofen, zwei Mickey-Mouse-Topflappen, heiß! heiß!, stellt die Schüssel auf den Tisch. Da, sagt Renate, die nie kocht, gar nicht kochen kann, aber wie sie von sich behauptet, eine gute Nase hat: Sag mal, das riecht doch schon wieder nach verbranntem Horn. Etwas zischt auf der Herdplatte und verdampft.
Ramm geht, schaut nach, nein, nichts, vielleicht ein Stück Käse vom Gratin.
Sonderbar, sagt Renate, schon gestern und vorgestern, immer wenn wir kochen, zischt es. Und dann jedes Mal dieser widerliche Geruch nach verbranntem Horn.
Wir sitzen, trinken Diamond Creek, und ich erzähle, während Renate vom Gratin nascht, von einem Onkel, der die Kartoffelsorten herausschmecken konnte, von dem ich jedes Mal erzähle, wenn es ein Kartoffelgericht gibt. Alle schmecken dann und versuchen den Geschmack der Kartoffel zu beschreiben. Wie schmeckt die Clarissa? Die Sprache reicht da einfach nicht aus. Ramm sitzt nachdenklich, schmeckt und schmeckt, sagt, allerdings haben wir Knoblauch dran, das überdeckt natürlich den Geschmack, und er trommelt wieder mit den Zeigefingern den Takt auf den Küchentisch, und vom Herd ist ein kleines Ploff zu hören, und wieder riecht es nach verbranntem Horn. Sonderbar, sagt Renate, nascht von dem Kartoffelgratin, das riecht schon wieder nach Horn. Sie kaut. Ekelhaft. Und wieder macht es ploff und wieder.
Da, schau mal, sagt Gisela, was da kriecht. Alle springen auf, da kommt schon die nächste durch den edelstahlverkleideten Rauchabzug direkt über dem Herd, fällt auf die Herdplatte, eine dicke, fette Kakerlake, marschiert zielstrebig auf die Kochplatte los, auf diesen leuchtenden Kreis zu, zögert, rennt los, wie von der rot glühenden Platte angezogen, wird aber immer langsamer, so als müsse sie durch einen Sumpf waten, in den sie auch tatsächlich einzusinken scheint, dann, einen winzigen Augenblick nur, wölbt sich der Chitinpanzer auf, es macht dieses kleine Ploff, und ein Rauchwölkchen steigt auf, der Gestank nach verbranntem Horn. Renate sieht uns an, mit ihren tief entsetzten blauen Kinderaugen, ja, Hilfe suchend blickt sie kurz mich, dann Ramm an und reißt die Hand vor den Mund, springt auf, stürzt los, durch den Gang, wir laufen hinterher, rufen Renate! warte! Sie kotzt, sie kotzt einen verwackelten Strahl rechts und links an die schneeweiße Wand, den ganzen langen Korridor entlang, den sie so liebt, weil er sie an das Rollschuhlaufen erinnert, sie stürzt in die Toilette, schließt sich ein.
Ramm klopft vorsichtig an die Tür: Renatekind! komm raus, ruft Ramm. Hörst du. Ist doch nicht so schlimm. In Afrika essen einige Stämme dauernd Kakerlaken. Eine gute Proteinquelle.
Von innen wird das mit überlauten Kotzgeräuschen beantwortet, dann folgt ein mitleiderregendes Röcheln.
Ramm klopft zart mit dem Fingerknöchel an die Toilettentür: Komm, Renatekind, mach auf. Ich wisch dich ab. Einen Moment ist es still, und in diese Stille hinein sagt Ramm, ein Indianerstamm in Kalifornien treibt Heuschrecken auf einen Kreis glühender Kohlen, die rösten die Heuschrecken, um sie sodann genussvoll zu verspeisen.
Abermals Würgegeräusche.
Kommt, sagt Ramm zu uns, sie ist da etwas empfindlich. Wir setzen uns wieder in die Küche. Ramm sagt, ich habe Kakerlaken gesehen, so groß wie Mäuse, in New York, in einem Luxushotel, dagegen sind dies hier kleine possierliche Tierchen.
Mögt ihr, er hielt ein Steak mit der Gabel hoch. Ich nicke tapfer, Gisela sagt mit der Bestimmtheit der Viererschlagfrau: Nein.
Verstehe. Er legt zwei Steaks in die Pfanne. Es zischt. Nie das Fleisch vorher salzen, das zieht den Saft raus. Erst muss die Oberfläche sich schließen. Darum muss die Pfanne sehr heiß sein. Ich starre auf den Rauchfang. Sonderbarerweise kommt keine Kakerlake mehr aus dem Rauchfang, obwohl jetzt noch der Geruch nach gebratenem Fleisch hochsteigt.
Kakerlaken sind äußerst vielseitige Tiere, können fliegen, laufen, tauchen. Ich glaube, sagt Ramm, die kommen nur, wenn man klopft. Warten regelrecht darauf, dass sie gerufen werden.
Die sind abgerichtet. Wisst ihr, warum?
Keine Ahnung, sage ich, während Gisela immer noch gebannt auf den Rauchfang starrt. Sie hätte jetzt einfach aufstehen und auf den Balkon gehen können. Sie hätte sagen können: Ich schöpf mal frische Luft.
Die Tierchen haben in den achtzig Jahren, seit das Haus steht, einen eigenen hausspezifischen Gencode entwickelt, der eben auf dieses Klopfen zähen deutschen Rindfleisches reagiert. Die wussten, es klopft, also gibt es etwas zu fressen. Da wurden erst von den Köchinnen, dann von Hausfrauen die Schnitzel weich geklopft, all die Jahre, da gab es was zu essen, und dann kamen sie kritze kratze anmarschiert, ließen sich runterplumpsen, dort unten standen früher nämlich die Abfalleimer. Ramm nimmt die Steaks vom Herd, legt eines auf meinen Teller, schneidet es an, rot das Fleisch, noch blutig. Gut so?
Ja, sage ich heroisch.
Er stellt die Pfanne in den Abwasch, geht zur Anrichte, klopft mit dem Löffel kurz den Clapton-Rhythmus mit, und tatsächlich kommt sogleich eine Kakerlake, wie herbeigerufen, purzelt auf den Herd, rennt los und verwandelt sich in Rauch.
Gisela steht auf, nicht so hektisch wie Renate, aber doch zielstrebig, geht, nein, läuft aus der Küche.
Ramm isst mit Genuss sein Steak, nickt beim Kauen bestätigend mit dem Kopf. Ich zwinge mich, nicht zum Herd zu blicken, sanft schneidet das Messer ins Fleisch, in das dunkle Braun, dann Grau, schließlich Rot, aus dem noch etwas Blut sickert. Die sitzen natürlich im Luftschacht, da kannst du streichen, wie du willst, kannst alles mit Stahl und Chrom bepflastern, die sitzen im Hausgedärm und freuen sich. Womit sie nicht rechnen, das ist diese tückische Platte, lassen sich wie eh und je fallen, in all die schönen Abfälle, stattdessen landen sie auf dieser warmen Fläche, laufen los auf ihren Füßchen, gleiten wie auf Glatteis, nur dass es plötzlich heißer wird und heißer, und schon kleben die Füßchen fest, rennen weiter, die Füßchen schmelzen, sie wollen mit ihren Stummelflügeln auffliegen, aber da ist es schon zu spät, die Flügel von der Hitze verklebt – und dann machts nur noch ploff.
Willst du nichts vom Gratin?
Nein danke.
Gisela ruft von der Wohnungstür: Ich muss an die frische Luft. Sie schlägt die Tür hinter sich zu. Ihr müsst, sagt Ramm, mal mitkommen, nach Lagos, und zeigt mit gespreizten Fingern die Kakerlakengröße, die wachsen, je nachdem, wie viel sie fressen. Aber da ist Gisela schon draußen.
Schade.
Auch ich sage, schade, höre von fern das Weinen, nein, das Wimmern aus der Toilette.
Ich rufe: Tschüss, Renate, aber als Antwort ist nur erneutes Würgen zu hören.
Ich laufe die Treppe hinunter und atme tief durch. Gisela steht da und wartet. Die Straße ist erfüllt vom Duft der blühenden Linden.
Eine Woche später erzählte mir Gisela, Renate sei aus der Wohnung von Ramm ausgezogen. Kurz darauf ging ich nach München und Gisela nach Berlin. Seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen.
Das Signallicht zum Einsteigen leuchtete auf, kurz danach sagte eine Lautsprecherstimme, die Maschine nach Frankfurt sei zum Einsteigen bereit. Ich sah, wie Renate das Buch wegsteckte, aufstand, ihre schwere Fototasche nahm und ganz selbstverständlich schulterte. Ich ging zu ihr, genau genommen nur, um ihre Stimme zu hören, diese eigentümlich tiefe Stimme. Renate?
Ja, sagte sie mit dieser tiefen Stimme, und sie sah mich an, suchte in meinem Gesicht ratlos nach jemand Bekanntem.
Wir haben uns einmal bei einem Abendessen gesehen, damals in der neuen Wohnung, die Sie gerade mit Ihrem Mann bezogen hatten. Das war so eine merkwürdige Geschichte mit den Kakerlaken.
Ach herrje, sagte sie, mit dieser tiefen Stimme, und lachte ihr eigentümliches raues Lachen. Dann haben Sie ja gerade das Ende meiner kurzen Ehe erlebt. Vielleicht können wir uns zusammensetzen, sagte sie. Aber ich saß mit meinem Billigflugticket in der Economyclass, und sie flog Businessclass. Zwei verschiedene Eingänge trennten uns beim Einsteigen.
Nach dem Essen und nachdem der Film IQ