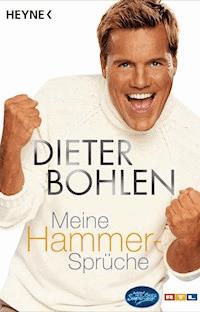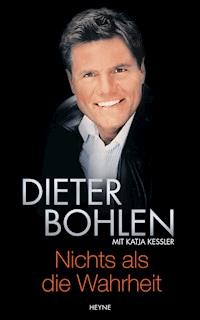
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieter Bohlen kennt nicht nur die ganze Wahrheit, sondern auch keine Tabus: In seinem Buch erzählt er das Abenteuer seines Lebens und enthüllt die bestgehüteten Geheimnisse der Promi-Szene. Herrlich ehrlich, äußerst aufschlussreich und ausgesprochen amüsant!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Dieter Bohlen mit Katja Kessler
Nichts als die Wahrheit
Inhaltsverzeichnis
Bild 1
Liebe Bohlen-Buch-Leser!
Immer wieder werde ich gefragt:
Lieber Dieter, wie kriegt man so viel Kohle?Lieber Dieter, wie kriegt man so viele Frauen?Lieber Dieter, wie kriegt man so viele Autos?Lieber Dieter, wie macht man das, immer in den Medien zu sein?Die Zeit scheint reif für ein paar Antworten. Frage eins bis drei wären schnell geklärt: Talent + arbeiten + arbeiten + arbeiten + arbeiten – dann kommt irgendwann auch die Kohle. Und: Haste Kohle, haste Frauen, haste Autos.
Doch nun zu Punkt vier: In die Medien zu kommen ist nicht so, wie Klein Erna sich das immer vorstellt. Man sitzt nicht den ganzen Tag zu Haus, überlegt sich irgendwelche komischen Geschichtchen und ruft dann die Zeitung an. Geschichten erzählt nur das Leben. Wer keine Personality hat, kommt auch nicht in die Medien (es sei denn, er schläft mit einem Promi). Profil wie ein Bridgestone-Reifen – das gibt einem nur der liebe Gott, das hat man oder hat man nicht. Ich mein: Wer sagt schon, was er denkt? Haben doch alle die Büx bis oben hin voll. Das ist die Message dieses Buchs: Free your mind! Think different! Be different!
Und noch etwas war für mich Anlass zum Schreiben meiner Autobiografie: der Schotter (womit wir wieder bei Punkt 1 wären). Ich habe den Spieß einfach mal umgedreht – früher haben die Leute für die Lügen über mich sehr viel Geld gekriegt, jetzt kassiere ich für die Wahrheit.
Hier bin ich, leckt mich alle! Euer Dieter
Bild 2
Also ich sag mal so: Wenn andere mit dem goldenen Löffel im Mund geboren werden, dann sind’s bei meinen Ahnen Mistgabel und Sahnespritztüte. Oma und Opa Bohlen waren Schweine- und Kuh-Bauern in der dunkelsten Ecke von Ostfriesland, irgendwo an einem Kanal. Außer Schweinen und Kühen hatten sie noch elf Kinder. Ich kann von Glück sagen, dass mein Vater ein echter Sturkopp ist und unbedingt Abi machen wollte. Sonst würde ich jetzt vielleicht auch mit Gummistiefeln hinterm Deich rumhopsen und an Kuheutern rummachen. Oder ich wäre Otto Waalkes geworden, auch ein Absturz.
Der wichtigste Mensch, die allergrößte Liebe meines Lebens ist Mamas Mama: meine Oma Marie. Alles was ich bin, bin ich durch sie. Sie war etwas absolut Einmaliges. Dass ich ihr Enkel war, gab mir schon früh das Gefühl, auch etwas Besonderes zu sein. Sie ist die Person, die in mir den Keim gepflanzt hat, meinen Träumen zu folgen. Dazu muss man wissen: Oma Marie war Hausfrau in Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, und flüchtete nach dem Krieg mit Opa Wilhelm, einem Konditormeister, fünf Kindern und einem megamäßig leckeren Rezept für Erdbeertorte in die Nähe von Oldenburg. Opi starb früh an Leberkrebs, Oma Marie war Oma Courage, strickte, häkelte, machte morgens, mittags, abends Essen. Sie konnte das beste Kaninchen auf diesem Planeten, das spickte sie mit Knoblauchzehen, bis es aussah wie ein Igel. Immer wenn der kleine Dieter ein Jahr älter wurde, steckten seine Kerzen quasi nicht im Kuchen, sondern im Karnickel, ihr Geburtstagsgeschenk für mich. Für mich war sie die schönste Frau der Welt, sie schnitt sich nie die Haare und hinten am Kopf, weiß ich noch, hatte sie so eine Schnecke aus geflochtenem Haar kleben. Von ihr kriegte ich dieses Antennenmäßige, was ein Mensch haben muss, um Komponist zu sein. »Vor den Erfolg hat der Heiland den Schweiß gesetzt«, »Du sollst immer ehrlich sein« – ihre Schnacks waren meine Werte, ich sag immer: Mein Neues Testament stammt nicht von Gott, sondern von Omi.
Wenn sie mal was geschenkt bekam, was in unserer Familie zweimal in fünf Jahren passierte, bunkerte sie es gleich in der Kommode, »für schlechtere Tage«, wie sie meinte. Ich halte es seit Kindheit genauso: Anzüge erst mal in den Schrank, alles Teure schnell ab in den Safe. Und später, wenn ich alles wieder vorholen will, merke ich manchmal: »Ist ja schon total out, das Teil.« So liegt zum Beispiel seit Jahren eine 18-Karat-Cartier-Uhr – so mit dickem Gold drum rum – in meinem Tresor. Die kann man eigentlich nur noch anziehen, wenn man Dealer in Herne-Süd werden will und Sätze sagt wie: »Ey, du voll fett der krasse Macker!«
Omi hatte eine russische Seele: erdig, schwermütig, melancholisch, dieses ganze Moll-Feeling in meiner Musik habe ich von ihr. »Herrr, gäh vorrann auf derrr Lebbensbahn!«, sang sie immer mit zittriger Stimme in ihrem Memel-Ecke-Ostpreußen-Akzent, der so angenehm rollt und so ein Wohlfühlen und eine Gemütlichkeit im Bauch macht. Und den ich noch heute im Ohr habe. Oder sie schimpfte: »du Lorrrrbass«, »du fetterrrr Borrrrcher«, was so viel heißt wie »du Lümmel«, »du Wutz«. Damit meinte sie mich, ihren Enkel. Vor einem Konzert in Danzig drückte ich mal einer bettelnden alten Mutti einen Tausender in die Hand, nur weil sie mich so an Omi erinnerte. Als sie vor ein paar Jahren starb, meine Omi, war das Am-Grab-Stehen für mich, wie fünfzig Prozent von mir mit einzubuddeln. Könnte ich jetzt wie E. T. in den Himmel telefonieren, wo sie sicherlich dem lieben Gott auch grade Karnickel brät, würde ich sagen: Omi, ich liebe dich und es vergeht kein Tag, wo ich nicht an dich denke. Eigentlich plante ich auch, an dieser Stelle ein Tempo-Taschentuch ins Buch zu kleben, dies wurde mir aber vom Verlag untersagt.
Nach meiner Oma ist meine Mama Edith die zweitsüßeste Frau von der ganzen Welt, weich wie Yes-Torty, die sich schämt, wenn ich im Fernsehen das Wort »geil« in den Mund nehme, und die sich dann beim Friseur hinter ihrer »Frau im Spiegel« versteckt, um nicht drauf angesprochen zu werden. »Junge, dafür haben wir dich nicht studieren lassen«, sind ihre Worte. Sie sieht aus wie Dagmar Berghoff, nur noch hübscher, wie ich finde. Eine ganz zierliche Person, der man fast einen Keks zustecken möchte, weil sie so wenig wiegt und Beschützerinstinkte in Männern weckt. Ein Journalist schrieb mal unter ein Bild von uns beiden: »Der mit den Falten, das ist der Sohn.« Ach ja, die Falten! Zum einen lege ich mich, seit ich achtzehn bin, rigoros in die Sonne, das hinterlässt natürlich seine Spuren. Zum anderen habe ich die Hans-Bohlen-Krater-Gene geerbt. Ich habe die Befürchtung, in seine Familie sind mal Hush-Puppies eingekreuzt worden. Egal! Mein Vater sieht vielleicht nicht aus wie ein Model, dafür hat er einen enormen Charme. Früher fielen die Frauen reihenweise auf ihn rein, auch Klein Edith.
Ich war ein Volltreffer. Meine Eltern – Hans fünfundzwanzig, Edith grade mal achtzehn – verabredeten sich nur einmal zum Eisschlecken, schon wurde Mama Mutti. Sie heirateten, denn das war natürlich damals unmöglich, Kinderkriegen ohne Trauschein. Bei meiner Geburt schrie sie die ganze Zeit: »Ich platze, ich platze!«, für sie muss sich das angefühlt haben, als ob sie da ein ganzes Haus inklusive Garage und Vorgarten zur Welt bringt, dabei kriegte sie blutunterlaufene Augen. Ich hatte nämlich schon damals das, was mich heute auszeichnet: eine halbe Wassermelone auf den Schultern.
Kaum war zwei Jahre später mein Bruder Uwe geboren, warf mein Vater seinen Job als Beamter im Straßenbauamt Aurich hin und machte sich mit seiner Straßenbau-Firma »Hans Bohlen Tiefbau GmbH Oldenburg« selbstständig. Das Geld für die allerersten Maschinen und Geräte bettelte er sich bei allen möglichen Bekannten zusammen. Abends am Abendbrottisch ging es nur um Preise, Schubkarren, Zementmischer, Walzen, Raupen und Bagger. Gleichzeitig schaufelte sich mein Vater Bratkartoffeln mit extra viel Eiern und Flinsen rein, die Oma Marie für ihn gebrutzelt hatte. Bevor wir anderen uns hingesetzt hatten, war er schon fertig mit seinem Teller. Die Auftragslage war schwierig, meine Mutter hielt im Büro die Stellung und bekam fast jedes Mal einen Kreislaufkollaps, wenn die Lieferanten den Zement anlieferten und die Preise wieder um einskommafünf Pfennig gestiegen waren. Sie feilschte, als ob es um ihr Leben ginge, und versuchte die Moneten zusammenzuhalten, während mein Vater zu ihrem Leidwesen oft zu wenig wie ein Geschäftsmann dachte. Wenn sie mahnte: »Hans, diesen Arbeiter musst du jetzt wirklich entlassen, der war acht Wochen krank, außerdem säuft er wie ein Loch«, dann brauchte sich der Typ nur hinzustellen und sich ein paar Tränen abzuweinen und schon zerfloss mein Vater vor Mitgefühl. Überhaupt: Das hab ich von ihm, da bin ich wie er: Dieses Weichwerden bei Menschen, die schluchzen. Auch mein Papa wäre, glaube ich, auf marodierende Feld-, Wald-, Wühl- und Tränenmäuse reingefallen.
Bei all der Arbeit und Anspannung wollte ich meiner Mutter immer zeigen, wie lieb ich sie hatte. Bei uns vor dem Haus hatte meine Oma Rabatten voll mit blauen und gelben Stiefmütterchen gepflanzt. Als ich zwei Jahre alt war, rupfte ich die alle raus, weil mir meine Oma das Märchen von Schneewittchen erzählt hatte und ich keine böse Stiefmutti wollte. Zum Muttertag 1959, ich war gerade fünf, hatte ich endlich die Idee für den ultimativen Liebesbeweis: Ich beschloss, meiner Mutter ein bisschen von ihrer vielen Arbeit abzunehmen und unser Haus – Esszimmer, Küche, Bad – einmal komplett feucht aufzuwischen. Als ich nach getaner Arbeit feststellte, dass mein Werk nicht zufrieden stellend glänzte, ging ich zum Kühlschrank, holte die gesammelten Margarine-Vorräte raus und versuchte damit, alles zum Spiegeln zu bringen. Meine Mutter schlug die Hände überm Kopf zusammen und kriegte einen Schreianfall, woraufhin ich schon in diesem zarten Alter beschloss, meine Aktivitäten in der Küche in Zukunft auf ein Minimum zu reduzieren.
Trotz Arbeiten und megamäßig Ranklotzen: Die Kohle war knapp bei uns zu Hause und wenn sie nicht knapp war, war sie ganz aus. Eines Abends wollten meine Eltern ins Kino und hatten noch nicht mal das Geld für zwei Karten übrig. In meinem Zimmer im Regal stand ein hellblaues Sparschwein, in das mein Onkel Günther und meine Tante Marianne bei ihren Besuchen immer was für mich reinsteckten. Um sich überhaupt mal einen netten Abend leisten zu können, schlich mein Vater in mein Zimmer und erschlug mein Sparschwein, während ich schlief.
Ein anderes Mal wünschte ich mir einen tollen Doppeldecker-Tuschkasten mit ganz vielen Zwischenfarben und Extrafach für meine Pinsel. Alle in meiner Klasse, so hatte ich das Gefühl, hatten die Luxus-Ausführung von Pelikan, aber für den kleinen Dieter reichte es dann doch nur wieder für die Sparversion aus Taiwan. Theateraufführungen in der Schule waren der größte Horror. Ich wollte so gern als Held gehen, alle sollten mich beneiden. »Hier ist ein Badehandtuch, leg dir das um die Schultern, du bist jetzt Prinz!«, sagte meine Mutter. Damit war der Fall für sie erledigt.
Und ich erinnere es auch noch wie heute: Mein erster und einziger Besuch mit meinem Vater im Hallenbad. Ich hatte zwei Albträume: meine grün-schwarz karierte Badehose, die ich hasste, weil sie so hässlich war. Und mich mit allen anderen zusammen umziehen zu müssen. »Kann ich da rein?«, fragte ich meinen Vater und deutete auf die Einzelkabine für zwei Groschen. Aber er sagte nur: »Komm mit!« und zog mich in die kostenlose große Gemeinschaftskabine für Männer. Da stand ich dann mit meinem kleinen nackten Pingelmann zwischen lauter Hängebäuchen, fummelte schnell meine Badehose aus der Tasche und schämte mich tot, weil ich dachte, alle würden mir was abgucken.
So war mein Aufwachsen: voll sparsam, immer aufpassen, immer kalkulieren. Und wenn mein Vater einmal überraschend dreihundert Ytong-Steine für den Werken-Unterricht in meiner Schule spendierte, damit wir daraus Fische und Herzen sägen konnten – »Hier, Kinder, bastelt mal schön!« –, lag der Verdacht nahe, dass er nur deshalb so großzügig war, weil er wollte, dass sein Sohnemann von einem Fünfer auf eine Drei kam.
Aber es war nicht nur der Mangel an Geld, der meine Kindheit prägte, es waren auch die Erzählungen meines Vaters. Wenn er seine trübe Jugend beschrieb, was häufig vorkam, dann hatte man förmlich den Geschmack von durchgeachselten Hemden und Schweißfüßen auf der Zunge: »Jeden Morgen musste ich fünfzehn Kilometer zu Fuß zum Gymnasium laufen, Dieter«, mahnte er, »ob Hitze, ob Kälte, ich musste ran!« So ging es endlos weiter: Wie alle gegen ihn gewesen seien. Wie er sich hätte durchbeißen müssen. Und seine Ausführungen endeten stets mit denselben Worten: »Du weißt ja gar nicht, wie gut du’s hast, Dieter!« Denen die ewig gleichen Horror-Szenarien folgten: »Wenn du in der Schule nicht Gas gibst, dann kriegst du nur noch einen Job bei der Müllabfuhr und verhungerst in der Gosse.« Ich bekam mächtig Grusel, ich war ja auch noch ganz klein damals.
Dieser Grusel wurde zu meinem ständigen Begleiter, der Stress und die Existenzangst meiner Eltern waren auch meine. Immer an Weihnachten spitzte sich die Situation in unserer Familie dramatisch zu, dann herrschte emotionaler Ausnahmezustand bei uns in Oldenburg. Mein Vater schloss sich mit seinen Jahres-Bilanzen in sein Büro im Anbau hinterm Wohnzimmer ein, und wenn er feststellte, dass auch dieses Jahr nix an Geld übrig geblieben war, kam er wieder zum Vorschein und wollte sich erschießen. (Wobei er für eine Pistole wahrscheinlich gar kein Geld gehabt und es nur für ein Bahnticket bis zur nächsten Brücke gereicht hätte.) »Ich kann euch alle sowieso nicht mehr ernähren! Besser, ich bring mich um«, schimpfte er. Dann erschrak meine Mutter: »Aber Hans, so was kannst du doch nicht sagen!«, und stellte wie jedes Jahr schnell die Gans auf den Tisch. Aber auf mich verfehlten diese Worte natürlich nicht ihre Wirkung. Ich sag mal: Wie andere Kinder unterm Baum ihre Geschenke fanden, so stand da für mich mein psychologisches Päckchen mit der Aufschrift »keine Kohle«. Ich weiß nur: Ob jetzt Multi-Multi-Multi-Millionär oder nicht, ich werde zeit meines Lebens von dem Druck vorwärts getrieben werden, dass ich nicht genug auf die hohe Kante geschafft habe.
Nach innen kein Frieden, nach außen auch nicht. Mit den anderen Kindern in meiner Straße befand ich mich im Dauerkriegszustand. Denn obwohl es vorne und hinten nicht reichte und meine Mutter manchmal nicht wusste, wovon sie die Rechnungen für Kies und Sand zahlen sollte, hatte sich mein Vater, der alte Hasardeur, einen Mercedes 180 D gegönnt. Der sorgte dafür, dass meine Mutter einen halben Anfall kriegte und nicht mehr mit meinem Vater sprach. Und bei meinen Spielkameraden hatte ich von Stund an verschissen, hier brach der allgemeine Neid aus: »Ey Bohlen, komm her, willst Dresche?« Auf einen Schlag war ich voll unbeliebt. Ihre liebste Tätigkeit war es, mir auf dem Rückweg von der Schule im Straßengraben aufzulauern. Und immer wenn sie mich zu fassen kriegten, musste ich mir neue Schliche und Methoden ausdenken, wie ich sie mir vom Hals halten konnte: »Passt mal auf«, lockte ich, »lasst mich nach Hause gehen, ich hol euch ’ne riiiiesige Tafel Schokolade!« So wurde schon früh meine Kreativität gefördert. Zu Hause angekommen, holte ich natürlich keine Süßigkeiten aus dem Schrank, sondern schickte meine Omi mit dem Besen vor. Ich stand triumphierend und feixend hinter der sicheren Hecke und sah zu, wie sie meinen Peinigern eine Tracht Prügel androhte. Und gleichzeitig war mir angst und bange vor dem nächsten Mal, wo sie mich kriegen würden.
Der Umzug nach Eversten, einem Vorort von Oldenburg, war es, der mich schließlich rettete, da war ich zehn. Mittlerweile hatte mein Vater so viele Landstraßen betoniert, Gruben ausgebaggert und Kanalisationsrohre verlegt, dass wir uns ein schickes Eigenheim in bevorzugter Wohnlage leisten konnten. »Nicht kleckern, sondern unterkellern« – was mein Papa machte, machte er richtig: Da wartete nicht nur irgend so eine Villa auf die Familie Bohlen, da wartete ein riesiger hingeklotzter zweigeschossiger Kasten aus gelbem Klinker mit hässlichem Flachdach auf uns. Wobei: Kästen mit Flachdach waren damals schwer angesagt.
Mein Vater hatte mittlerweile eine Armee von zweihundert Arbeitern, die er zwischen mehreren Großbaustellen hin und her bewegte. Und ich war immer mächtig stolz, wenn wir in seinem Mercedes über die Baustellen kurvten, er das Fenster runterkurbelte und laut rief: »Haut mal ’nen Schlag rein, Jungs!« Das gefiel mir mächtig gut – mein Vater, mein Denkmal. Ich wollte, wenn ich erwachsen war, auch Scheiben runterkurbeln und Anweisungen geben.
In der Schule fand ich es eine gute Idee, meinen Vater zu imitieren. Brachte mir auch nicht wirklich viele Freunde. Ich weiß noch: Ich nahm immer wieder Anlauf, Klassensprecher zu werden. Aber wenn dann am Ende der geheimen Abstimmung die Zettelchen ausgezählt wurden, erschien auf der Tafel hinter meinem Namen stets nur ein einsamer Kreidestrich, sodass ich wusste: »Hey, der Einzige, der dich hier wählt, bist du selbst.« Der Blick auf diesen Strich erschütterte mich. Im Geiste sah ich mich als Anführer, als eine Art Bandenchef, und ich kam einfach nicht auf den Trichter, woran es lag, dass die anderen nicht alle auf mich abfuhren.
Dann begegnete mir das Schicksal – in Form eines hässlichen verpickelten Typen, da war Klein Bohlenski gerade in der zweiten Klasse vom Gymnasium. Dieser Typ war zwar hochgradig unappetitlich, aber was er konnte, war Gitarre spielen. Und auf einmal saßen alle Mädels, alle Jungs aus meiner Klasse fasziniert um ihn rum, wenn er »I Wanna Hold Your Hand« von den Beatles spielte. Alle machten uh und ah, plötzlich war er cool, war er angesagt. Alle wollten ihn kennen. Und bei mir fiel der Groschen: »Moment, so funktioniert das also mit dem Beliebtsein!«
Ich lief sofort zu meinem Vater. Tagelang lag ich ihm in den Ohren mit nur einem Satz: »Duuu, Paaaapa, du, ich möchte auch so ’ne Gitarre!« Aber natürlich sagte mein alter Herr: »Nee, nix da Gitarre! Hausaufgaben machen!« Das konnte mich von meiner Idee nicht abbringen. Ich wollte, dass die anderen auch so um mich rumsaßen, mich bewunderten und fragten: »Sag, Dieter, wie machst du das?«
Die Lösung war ein Bauer aus Eversten, fünfhundert Meter weiter die Straße hoch. Für fünf Mark am Tag konnte ich hier mit einem Drahtkorb unter dem Bauch hinter einem Trecker in der Ackerfurche rumkriechen und Kartoffeln einsammeln, die der Pflug aus der Erde gewühlt hatte. Mit siebzig Mark und zwei Kilo Mutterboden unter den Fingernägeln rannte ich los und kaufte mir bei Merkur neben der Kirche meinen Traum: eine kleine Wandergitarre.
Gitarre gut und schön, aber jetzt musste ich auch was spielen können. Ich hatte noch zehn Mark über, von denen leistete ich mir eine Gitarrenstunde. Eine einschneidende Erfahrung: Ich bin Linkshänder, der Gitarrenlehrer zupfte beharrlich mit rechts. Das brachte mich total durcheinander, ich kapierte nur Bahnhof. So war meine erste Stunde gleichzeitig auch meine letzte.
Also wenn die Bienen ihren Rüssel in die Blüte …
An dieser Stelle möchte ich mal was zu dem Thema sagen, was mich schon früh beschäftigte: Sex und Aufklärung. Wenn ich meine Oma löcherte: »Du, Omi, wo komm ich eigentlich her?«, dann war ihre Standardausflucht: »Dich hat der Esel im Galopp verloren!« Keine wirklich befriedigende Antwort. Ich wusste mir zu helfen: Besuche beim Bauern im Stall vermittelten mir erste grobe Eindrücke.
Jetzt wollte ich es genau wissen: Wie funktioniert das eigentlich bei den Menschen? Zum Glück wusste ich, dass die Mädels aus meiner Nachbarschaft genauso neugierig waren wie ich auf die Antwort. »Kommt!«, sagte ich zu meinen Kumpels. »Ich hab da was organisiert.« Alle zusammen schlichen wir hinter die schützenden Erdwälle eines Schießstandes, der sich hinter einer Kneipe befand. Vorne feierten die Erwachsenen, hinten spielten wir Kinder Doktorspiele. »So, der Arzt kommt, ihr müsst euch jetzt ausziehen!«, meinte ich zu den Mädels.
Natürlich wurden wir irgendwann von ein paar Erwachsenen dabei erwischt. Ich sag mal: Heute wäre das natürlich ganz anders, da würde man Tiefen-Gespräche führen nach dem Motto: »Können wir euch helfen?«, aber damals hieß es nur: »Ey, ihr Schweine! Wartet, bis wir euch erwischen, Drecksäue!« Ich hatte unglaubliche Angst, dass jemand zu meinen Eltern gehen und mich verpetzen könnte. Ich wusste, mein Vater wäre ausgeflippt. Die ganze Nacht zitterte ich oben in meinem Zimmer unterm Dach, wartete auf das Klingeln an der Haustür, lauschte auf Gebrüll, auf wütende Schritte, die die Treppe hochpolterten. Aber nichts passierte. Und kaum, dass ich feststellte, dass nichts passierte, kam mein Selbstbewusstsein zurück. Eigentlich, fand ich, war das doch ganz normal, dass man als kleiner Junge sehen wollte, wie das beim kleinen Mädchen unten aussah – oder nicht?
Nächster Schritt: Küssen lernen. Bei uns in der Straße wohnte eine, die hieß Nele und sah voll gruselig aus: Sie hatte eine Pony-Frisur, die ihr bis über die Nase hing, um zu kaschieren, dass sie sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken konnte. Aber das war egal. Für zwei Mark konnte man sie küssen. Das Geld »borgte« ich mir bei meiner Mutter aus dem Portemonnaie. Hektisch und verschwitzt lief ich zu dieser Nele, aber die wollte mich nicht küssen, selbst nicht gegen Bares. Und schon gar nicht auf Zunge, wie mir vorschwebte. Ihr Laden brummte wohl, die Nachfrage an diesem Tag war einfach zu groß. Schließlich durfte ich doch ran, genau fünf Minuten. Und ich weiß noch: Sie schmeckte nach Kaugummi.
Lülle
Ich war bereit! 1967, mit dreizehn, trat Lülle in mein Leben. Lülle hieß eigentlich Liesel, wohnte bei mir in der Straße, trug Zöpfe und wurde meine allererste Freundin. Wir schmusten immer bei ihr zu Hause, im Gegensatz zu mir hatte sie voll tolerante Eltern. Außerdem war es Lülles hochherrschaftliche Aufgabe, mit mir Hitparade zu spielen: Sie musste die Titel anhören, die ich komponiert hatte. Das Boykottieren des Gitarrelehrers hatte nämlich tief greifende Folgen. Weil ich nicht mehr hinging, konnte ich auch keine Noten lesen. Und weil ich keine Noten lesen konnte, konnte ich auch keine Stücke nachspielen. Also mussten eigene Kompositionen her. Mein liedtechnischer Tages-Ausstoß lag bei zwei Stücken. Von denen musste Lülle sagen, wie sie sie fand, und Platzierungen vergeben. Meine Konkurrenten waren: »Dear Mrs. Applebee« von David Garrick, »I’m a Believer« von den Monkees, »All You Need Is Love« von den Beatles und »Goodnight My Love« von Roy Black.
Ein trüber Tag brach an, als Lülle fünfzehn wurde, mich verstieß und sich, zackizacki, von einem fremden Musiker namens Detlef schwängern ließ. Ich sah sie nie mehr wieder. Mit Lülles Abschied schickten meine Eltern zehn Stoßgebete zum Himmel. Oder besser gesagt: Meine Oma betete, denn meine Eltern waren viel zu beschäftigt.
Herr Engelmann
Dank der Gitarre lief es mit den anderen Kindern jetzt supi, nur die Erwachsenen widersetzten sich meinem Charme, allen voran mein Klassenlehrer, Herr Engelmann. Typ männliches Fräulein Rottenmeier, superstreng und verkniffen, mit Glatze und Schmissen auf der Backe. Unser Verhältnis ging endgültig den Bach runter an dem Tag, als ich für meine Mitschüler mal wieder den Vorturner machte: »Schmeiß doch mal die Türleiste übers Geländer, Dieter! Traust dich nicht!«, stichelten sie. So was muss man mir nicht zweimal sagen. Just in dem Moment, wo ich das Ding übers Geländer semmelte, kam meine Bio-Lehrerin die Treppe hoch, die Leiste verfehlte sie um Haaresbreite und klatschte einen halben Meter vor ihr auf die Stufen. Was ich völlig übersehen hatte: Das Ding war gespickt mit tausend kleinen Teppichnägeln. Beinahe wäre aus ihr ein Fakir geworden.
Sie dachte natürlich, dass es sich um einen absichtlichen Anschlag auf ihre Person gehandelt hätte. Fünf Minuten später kam der alte Engelmann und fragte: »Wer war das?« Ich dachte mir nichts dabei, ich hatte ja auch kein schlechtes Gewissen und hob die Hand: »Ich war das.« Engelmann kam auf mich zu, holte aus und schlug mir mit voller Wucht, links, rechts, bamm, bamm, bamm, an den Kopf! Meine Nase platzte auf, das Ohrläppchen riss ein, ich fiel auf den Boden, er trat noch mal nach und schrie: »Raus hier, Bohlen, raus, raus, raus!«
Ich rannte auf die Toilette, drehte Klopapier zu Popeln und stopfte sie mir in beide Nasenlöcher, weil ich blutete wie verrückt. Ich war völlig perplex, ich wusste, ich hatte wieder was ausgefressen. Als ich zu Hause ankam, ging’s erst richtig rund. Engelmann hatte keine Mühen gescheut, meinen Vater anzurufen und darüber aufzuklären, was für einen missratenen Sohn er hätte. »Hierher, Freundchen!«, sagte mein Vater, den Schuhlöffel schon in der Hand, und deutete in Richtung Badezimmer.
Mein Vater bat gern zum Vier-Augen-Gespräch ins Badezimmer. Aber das alles passierte nicht einfach nur so, nein, es war eher eine gerechte monatliche Zuteilung, die ich brauchte, denn ich war ein kompliziertes Kind. Und aus diesem komplizierten Kind sollte ein guter Mensch werden, wenn nicht durch einen Appell an die Rezeptoren im Hirn, dann durch die am Hintern. Meine Mutter sah das ähnlich: Wenn es ihr zu viel wurde, griff sie in ihrer Not für die Klärung pädagogischer Detailfragen auch mal zum Kochlöffel. Da wurde dann nicht mehr viel gelabert von wegen: »Aber Mama, ich wollt doch nur …!«, zack, hatte ich eins an der Backe.
Auf der anderen Seite: Wenn’s drauf ankam, konnte ich auf meine Eltern zählen. Da waren sie wie Löwen, die ihr Junges verteidigten. Es passierte beim Ringe-Turnen in der Schule. Ich kriegte einen Schlag auf den Kopf und stürzte auf die Matte. Völlig benommen rappelte ich mich hoch. Blut lief mir aus der Nase und den Ohren. Ich sah alles nur noch milchig und verschwommen. Verwirrt und planlos torkelte ich Richtung Umkleidekabinen, griff mir meine Klamotten und verließ das Schulgelände, ohne dass mich jemand aufgehalten hätte oder ein Lehrer auf mich aufmerksam geworden wäre. Unsicher und orientierungslos wankte ich durch Oldenburg, die Klamotten verkehrt rum, die Etiketten nach draußen, die Reißverschlüsse offen. Und kein Passant, der mich angesprochen und sich gewundert hätte: »Hallo, Junge, sag mal, was ist denn los mit dir? Können wir dir helfen?« So war auch damals ein bisschen die Zeit: Da interessierte es die Leute auf der Straße einfach nicht, ob so ein Typ wie ich Nasenbluten hatte und die Lage nicht peilte.
Ich wankte bestimmt sechs, sieben Kilometer zu Fuß nach Hause, brach dort in den Armen meines Vaters an der Haustür zusammen. Bewusstlos wurde ich ins Oldenburger Kreiskrankenhaus eingeliefert. Hier kam die Diagnose »Schädelbasisbruch mit Haarriss der Schädeldecke«. Dazu Sprüche wie »Herr und Frau Bohlen, richten Sie sich mal besser drauf ein, das war’s wohl mit Ihrem Sohn.« Hier verdanke ich meinem Vater mein Leben: Er machte auf dem Absatz kehrt und schaffte mich in eine Privatklinik. Da war ihm nix zu teuer. Acht Wochen musste ich im Bett liegen, die ersten Wochen davon bei vollkommener Dunkelheit. Ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen, alles ging drunter und drüber in meinem Gehirn und es klöterte beim Sprechen. Man wies mich darauf hin, dass das vielleicht ein Leben lang bleiben würde, aber das interessierte mich nicht. Viel besser war, dass alle meine Freunde aus der Schule auf ein Stündchen vorbeischauten. Und meine Eltern mich täglich mit Marmorkuchen und Geschenken eindeckten. Da war Kauen, Rumgekrümel und Partystimmung bei mir am Bett, aber die eigentliche Ursache für den Schlag auf den Kopf, der Grund, warum ich überhaupt im Krankenhaus war, ließ sich im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren. Obwohl alle meine Klassenkameraden drum rum gestanden hatten, wollte keiner was gesehen haben. Und ich selbst konnte mich an nichts erinnern.
Hendrike
Mit fünfzehn hatte ich eine eddelige Haarmatte bis auf die Schultern, trank gern ein paar Bierchen nach der Schule, mit Vorliebe Jever Export, frisch gezapft, und hing bevorzugt im »Gretna Green« rum, einem dunklen Schülertreff, wo sie die aktuellen Songs aus den Charts spielten: »Obla Di, Obla Da« von den Beatles und »Eloise« von Barry Ryan. Hier lernte ich meine große Liebe kennen: Hendrike. Vater angesehener Augenarzt, sie etepetete erzogen mit Ballett, weißem Flügel im Wohnzimmer, Hausmädchen und Latein-Unterricht.
Hendrike hatte kohlschwarze Haare, braune Augen, eine rabenrattenscharfe Figur – eine Estefania von Oldenburg und voll mein Typ. Meine Family war für Hendrikes Family nur die Abteilung »neureiche Coming-Ups aus der Vorstadt«. Hendrike ließ mich merken, wie gruselig sie mich fand. Sie mochte mich nicht einfach nur nicht, nein, sie fand mich zum Kotzen. Nach außen hin gab sie sich auf mein Gebalze zwar höflich, von wegen, sie sei »unsicher« und »wüsste nicht«. Aber sie wollte sich partout nicht mit mir treffen. So blieb mir nichts anderes übrig, als ihr im »Gretna Green« aufzulauern. Auf der Tanzfläche rotierte ich vor ihren Augen mit dem Becken, machte auf Elvis. Das war sonst meine Garantie-Methode, Mädels weich zu klopfen. Hendrike ignorierte mich, quatschte mit ihren Freundinnen, flirtete mit anderen Jungs.
Aber meine Oma sagte immer: »Steter Tropfen höhlt den Stein«, und so war das auch bei Hendrike. Jeden Abend, pünktlich wie ein Wecker, sagte ich ihr, wie toll sie aussähe. Dass ich den ganzen Tag nur an sie gedacht hätte. Dass sie die Frau meines Lebens sei. Irgendwie stimmte das alles auch. Ich glaube, Hendrike spürte das. Nach drei Monaten Graben erhörte sie mich.
Sie war meine Prinzessin. Es war dieser Gegensatz, der mich anzog: Sie, die jede Woche in die Oper und ins Theater ging, die so rein war und mit dreizehn Jahren natürlich noch Jungfrau. Die dasaß mit kerzengradem Rücken, anmutig wie eine Elfe. Bei der es zu Hause immer nach Duftkerzen roch, während ich Kerzen nur von Weihnachten kannte. Wozu gab’s auch Elektrizität? Hendrike war die Frau, die ich haben wollte, meine Göttin, zu der ich aufblickte. Nur in einem Punkt fühlte ich mich ihr überlegen: Zog ich ihr die Klavier-Noten weg, konnte sie noch nicht mal mehr »Hänschen klein« spielen. »Mann!«, meinte ich zu ihr. »Du hast jetzt fünf Jahre Klavierunterricht und kannst überhaupt nix spielen ohne Noten, wo bist du denn bitte kreativ?« Dann saß sie da, schaute mich beleidigt an und fing an zu weinen.
Nach einem halben Jahr lernte ich ihre Eltern kennen: Wir saßen alle um den Tisch rum, Hendrike, ihr Vater, ihre Mutter, ihre vier Geschwister, da beugte sich ihr Vater zu mir und flüsterte: »Dieter, ich muss dich mal zur Seite nehmen.« Und ich fragte: »Ja, was ist denn?« Und er: »Nur damit wir uns da richtig verstehen, meine Tochter ist erst vierzehn …« Er redete so ein bisschen gespreizt und nebulös, woraufhin ich zu ihm sagte: »Ja, wenn Sie damit meinen, dass ich nicht mit Ihrer Tochter schlafen soll – das hab ich schon längst erledigt!« Woraufhin ihr Papi ganz locker ausholte und mir eine schallerte, dass ich neben dem Tisch lag. Bis an mein Lebensende hatte ich Hausverbot bei Hendrike.
Aber so war ich früher: Erwachsene hassten mich chronisch. Und ich merkte, wie heikel es manchmal ist, die Wahrheit zu sagen. Anscheinend gibt es verschiedene Wahrheiten: welche, die man sagen darf, und welche, die man für sich behält. Ich habe bis heute nicht begriffen, welche welche ist.
Hendrike und ich trafen uns fortan heimlich. Ich liebte sie rasend, war chronisch eifersüchtig. Eine Zeit lang hockte ich tagsüber im Baum vor ihrem Haus und beobachtete mit dem Feldstecher, wer bei ihr ein und aus ging. Sie hatte mir erzählt, dass sie mit irgendwelchen Mädels und Typen Hausaufgaben machen würde, und ich wollte sichergehen, dass sie mich nicht betrog. Unendliche Nachmittage verbrachte ich in diesem Scheiß-Baum.
Nachts kletterte Hendrike dann bei sich aus dem Fenster, lief – taptitap – sieben Kilometer zu Fuß zu mir und warf Steinchen gegen mein Fenster. Ich ließ sie rein, wir schnackselten eine Runde (oder auch zwei). In der Früh um drei – dumdidum – lief sie die sieben Kilometer wieder zurück. Meine Eltern kamen hinter das Treiben, als ich trotz Steinchen-Werfens einen dieser nächtlichen Hendrike-Besuche verpennte. Wer allerdings wach wurde von dem Lärm, war mein Vater: Er lud Hendrike in seinen Mercedes und karrte sie stillschweigend zurück nach Hause, ohne mich zu wecken. Was Weibergeschichten anbelangte, konnte ich auf sein vollstes Verständnis zählen: »Wir Männer, wir müssen doch zusammenhalten.«
Irgendwann kam der Herbst, der doofe Baum verlor seine Blätter und ich beschloss, die Observation von Hendrike aufs nächste Frühjahr zu verschieben. Außerdem wartete meine Musik auf mich. Seitdem ich die Gitarre in die Hand genommen und bei Lülle Hitparaden-Erster geworden war, war ich besessen von dem Gedanken, Musiker zu werden. Ich kam aus der Schule, warf den Ranzen aufs Bett und komponierte und traktierte meine Gitarre, bis meine Kumpels kamen: eine weitere Gitarre, ein Bass, ein Schlagzeug. Dann ging’s ab in den dunklen, miefigen Heizungskeller, noch nicht das Optimum, aber immerhin ein Anfang. Hier in unserer Verbannung träumten wir von hell erleuchteten Stadien voller Menschen. Hausaufgaben Fehlanzeige, ich hatte Wichtigeres zu tun.
Eines Tages riss meinem Vater der Geduldsfaden: Tierisch genervt von dem ständigen Lärm in unserem Haus stürmte er in mein Zimmer und sagte: »Deine schulischen Leistungen sind schlecht! Jetzt ist Schluss!«, und – kawumm – trat er die Gitarre in die Grütze. Ich höre noch heute das Holz splittern. Ich heulte. So ist das, wenn du wochenlang im Kartoffeldreck wühlst für eine Gitarre. Wenn du dich schon Paul McCartney die Hand schütteln siehst. Und dann kommt dein Vater und haut von einer Sekunde zur anderen alles kurz und klein. Doch mein Papa, die alte Raufaser-Haut mit der Seele eines Sauriers, stand da und hätte beinahe mitgeflennt – noch am selben Tag hatte ich eine neue Klampfe und konnte weiterzupfen. Ich machte auf Bob Dylan und komponierte fortan Protestsongs:
»Viele Bomben fallen,doch keiner ändert was,es nützt kein Krawallen,geschehen muss etwas.«
Das Ganze im Stil von »Blowing In The Wind«, also Lagerfeuer-Gitarren-Schrabbel-Sound.
Orgelitis Akutis
Nicht kleckern, sondern unterkellern, wenn schon, denn schon, was eine Saurier-Seele macht, macht sie ganz. Als meine großen Vorbilder aus dem Radio – Deep Purple, Uriah Heep, also die ganzen wichtigen ausländischen Bands – plötzlich alle Keyboards in ihren Songs hatten, holte mein alter Herr zum großen Wurf aus. Ich hatte natürlich nicht versäumt, ihn davon in Kenntnis zu setzen, dass so eine Orgel eine gute Geschenkidee sei und meine Band unbedingt technisch aufgepeppt werden müsste. So kam es, dass ich für sage und schreibe 1950 Mark eine kleine »Philicorda« zu Weihnachten geschenkt bekam. Drei Tage vorher konnte ich nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war. Es sprengte meine Vorstellungskraft, so was Tolles unterm Baum zu finden. Nie wieder in meinem Leben freute ich mich so über ein Geschenk.
Stolz stellte ich die kleine, süße, schnuckelige Philicorda in mein Zimmer und hämmerte Tag und Nacht ohne zu essen und zu trinken auf ihr herum. »Ich will Komponist werden!«, verkündete ich jedem. Meine Eltern lächelten gequält, wenn sie durch das lautstarke Geklimper nicht grade einen Nervenzusammenbruch hatten. »Das reicht vielleicht für den Hausgebrauch«, meinte mein Vater, »damit kannst du auf Hochzeiten und Beerdigungen auftreten. Aber eine Familie kannst du damit nie und nimmer ernähren.«
Natürlich konnte sich mein Papa auch nicht verkneifen, mal wieder eines seiner geliebten Weltuntergangsszenarien ins Rennen zu schicken: »Irgendwann komme ich mit meinen Freunden zum Bahnhof und da stehst du als Penner mit dem Hut.« Aber eigentlich muss ich ihm dankbar sein, dass er so eine Motivationsbremse war. Gerade weil er sich nicht mitreißen ließ, konnte ich mir sicher sein, dass ich wirklich wollte, was ich da wollte.
Mit fünfzehn gründete ich mit meinem Kumpel Charly meine erste richtige Band: Mayfair. Und eine Band brauchte natürlich auch einen Gig. Ich ging zu Pfarrer Schulze und sagte: »Du, ich brauche dein Gemeindehaus!« Wir verkauften dreihundert Eintrittskarten für eine Mark das Stück. Vor dem Auftritt hatten Charly und ich aber so viel Lampenfieber und waren so aufgeregt, dass wir in einer Kneipe eineinhalb Liter Bier in uns reinschütteten. Das eigentliche Konzert dauerte dann nur noch fünf Minuten. Ich musste mich an meiner Orgel festhalten, weil ich so schwankte. Charly übergab sich hinter der Bühne. Der Mega-Reinfall.
Dieses Alles-für-die-Musik-Geben hatte natürlich seinen Preis. In der Schule gab es niemanden, der so grottenschlecht war wie ich, dafür fiel ich beim Stören positiv auf: An dreihundertfünfundsechzig Tagen im Jahr wollten mich die Lehrer von der Schule schmeißen. Wenn andere zwei Einträge im Klassenbuch hatten, dann hatte ich fünfundsiebzig: »Dieter schmeißt mit Schuhbürste nach Mitschüler.«, »Dieter bohrt mit Finger in Bauchnabel.« Dieter dies, Dieter das. Jeden Tag, jede Woche. Ich war mehr draußen vor der Tür als im Unterricht. Alle Lehrer hassten mich, denn wenn die redeten, redete ich auch. Und ich trieb es nur zu gern auf die Spitze: »Du, Dieter, wenn du fertig bist, sag Bescheid«, meinte mal einer zu mir. Und ich einige Minuten später zurück: »Ja, danke! Ich bin jetzt fertig!« Am meisten strapazierte ich meinen Musiklehrer, den fand ich am aller-ober-verachtenswertesten: der konnte nicht Klavier spielen, nicht Gitarre, der konnte gar nichts. Den ließ ich überhaupt nicht mehr zu Wort kommen. Am Ende jedes Halbjahres strotzte mein Zeugnis vor schlechten Zensuren.
So hätte ich es vielleicht noch eine ganze Weile weitergetrieben, wenn nicht plötzlich ein Erwachsener bei uns zu Hause auf der Couch gesessen und Omis Erdbeertorte gegessen hätte, den ich nach diesen ganzen Nieten und Nullen um mich herum endlich ernst nehmen konnte: studiert, superschlau, Professor Doktor für Ingenieurwesen – mein Onkel Heinz. Wenn Sie jetzt erstaunt fragen: Wie kommt so einer in die Familie Bohlen? Antwort: Ich weiß es nicht. Er nahm mich ins Gebet: »Hör mal, Dieter«, sagte er, »entweder du strengst dich jetzt an und machst ein Super-Abi oder du arbeitest wie einer der Kuddels auf der Baustelle deines Vaters – Schippe in die Hand und buddeln, bis der Arzt kommt.« Das machte mir wirklich Angst. De facto hatte ich diverse Male bei meinem Vater ausgeholfen und wusste ganz genau: Alles, nur nicht Bau. Jedes Mal, wenn ich Steine geschleppt hatte, musste ich mich danach übergeben. Körperliche Arbeit war wirklich nix für mich und Abschmecker in der Kläranlage in Eversten wollte ich auch nicht werden.
Das war mein Schlüsselerlebnis, der berühmte Bolzenschuss, da wachte ich auf. Ich begann zu schleimen bei meinen Sozi-Lehrern, dass es krachte. Ich schrieb Sätze wie »Ich bin gegen Kapitalisten« oder »Kampf dem STAMOKAP!« in meine Aufsätze, ging abends mit ihnen ein Bier trinken und hatte auf einmal nur noch gute Noten im Zeugnis. Ich muss zugeben: Die Glibberspur, die ich hinter mir herzog, war breit wie die A 7. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, einem Lehrer zu Hause beim Gardinenaufhängen geholfen zu haben. Igittigitt, aber in Deutsch ’ne Zwei.
Meine Oma hatte mir immer eingebläut: »Alles, was man macht, soll man hundert Prozent machen oder gar nicht.« Ein Satz mit unheimlich viel Wahrheit. Also her mit dem Schleimtopf! Das volle Pfund! Mittendrin in der Soße mein Ziel: mein Lehrer Dr. Knake, Willy Wichtig bei den Sozis, dem wollte ich ganz besonders gefallen. Mit ihm begann ich zu den Versammlungen der SPD zu gehen. Diese Treffen fand ich toll, wo man über Weltpolitik sprach und über Brüderlichkeit und nach dem achtzehnten Bier waren alle gleich – nämlich alle gleich besoffen.
Und wenn dir deine Lehrer permanent vermitteln, Kapitalismus ist Scheiße und Ausbeuterei, dann kommst du natürlich nach Hause und hast deinen Vater im Fadenkreuz, den dekadenten Baulöwen. Plötzlich war er in meinen Augen der Oberkapitalist und Hass-Kandidat, der davon lebte, andere Leute auszusaugen und für sich arbeiten zu lassen. Ich wurde Mitglied bei den Jusos, fing an »Mercedes ist Scheiße!« und »Guck mal, unsere Bonzen-Villa!« zu rufen. Das ging so weit, dass ich auf unser hässliches Flachdach kletterte und dort an der Antenne eine rote Fahne mit Hammer und Sichel hisste. Abends kam mein Vater von der Baustelle, sah die rote Fahne wehen und zitierte mich zur »Rücksprache« in unser Badezimmer. Die Tür wurde abgeschlossen, ich hörte meine Mutter noch von draußen rufen: »Nein, Hans! Nein!«
Aber das sollte das letzte große Gipfeltreffen zwischen mir und meinem Vater sein: Nach der schulischen Wende folgte die Sohn-technische Perestroika, das Ende der Ära »Kotzbrocken«, der Beginn von »Ich, der liebe Dieter«. Ich war siebzehn und das kam so: Eines Abends hockten wir – mein Schlagzeugerkumpel, dessen Maus, Hendrike und ich – oben bei mir auf der Bude. Es war schon später, Mitternacht vielleicht, mein Vater wollte schlafen und wir waren ihm dabei zu laut. »Seid leiser!«, raunzte er vom Fuß der Treppe. Nichts passierte. Er rief ein zweites, ein drittes Mal – wir lärmten unverdrossen. Das vierte Mal schenkte er sich das Rufen und kam gleich die Treppe hoch. Da war er nicht mehr nur auf hundertachtzig, sondern schon auf dreihundertfünfzig. Eigentlich ist mein Vater jemand, der ist unheimlich lieb zu Tieren und Frauen. Aber wir hatten ihn bis aufs Blut gereizt. Er holte aus und der erstbesten Person, die er zu fassen kriegte, schallerte er eine: Das war die Freundin meines Freundes – doof auch. Dieser Freund wiederum war ein ziemlicher Hänfling, total spargelig, mit dem Aussehen wie Jesus nach dem ersten Schlaganfall. Aber das mit seiner Freundin konnte er ja nun nicht so auf sich sitzen lassen. Heldengleich wuchs er über sich hinaus. Vielleicht war er aber auch einfach nur zu bekifft, um irgendwas zu raffen. Er stand auf: »Hey, was soll das?«, und verpasste meinem Vater einen Leberhaken, worauf der umfiel und schrie: »Man hat mich erstochen! Man hat mich erstochen!« Hatte das wohl nicht richtig gesehen – war ja auch alles ein bisschen duster bei mir da oben im Zimmer. Und ich meinerseits dachte nur: »Au, Mensch, Mensch! Jetzt gibt’s aber richtig Ärger!«, und türmte. Die ganze Nacht traute ich mich nicht nach Hause, aus Angst, meinem Vater in die Hände zu fallen, und es tat mir auch alles wirklich Leid, was da passiert war. »Mensch, Dieter, alte Socke!«, sagte ich mir, »wenn du so weitermachst, bringst du deine Alten noch unter die Erde!« Als ich wiederkam, war mein Vater schon ins Bett gegangen, wir verloren nie wieder ein Wort über den Vorfall. Von da an hatten wir ein Gentlemen’s Agreement: Ich riss mich am Riemen, er langte nie mehr zu. Im Badezimmer wurde fortan nur noch gebadet.
Nach dem Reinfall des erstes Gigs im Gemeindehaus hatte ich ein bisschen Zeit verstreichen lassen, damit Gras über die Blamage wachsen konnte. Beim nächsten Anlauf sollte alles perfekt sein. Ich klebte Plakate, die wir in einer Druckerei hatten drucken lassen und für die mein Vater die Rechnung kriegte (nicht fürs Drucken, sondern fürs wilde Plakatieren). Hendrike saß an der Kasse, wir spielten eine Mixtur aus Eigenkompositionen und meinen Helden Deep Purple und Uriah Heep. Ein triumphaler Erfolg. Meine damaligen Musikkumpel waren eine Ansammlung von netten Pennern: der eine Anstreicher, der andere Tankwart, der nächste arbeitslos. Alle zusammen, wenn man sie so dasitzen sah: ein Haufen von hoffnungslosen Losern. Jedes Wochenende tourten wir mit unserem abgewrackten VW-Bus durch die Gegend und absolvierten Auftritte, die wir uns selbst verschafft hatten. Hinten im Bus hockte Hendrike mit ein paar Mädels auf Matratzen, häkelte Vorhänge und batikte Blusen, vorne saßen wir Typen und machten auf Easy Rider. Während alle anderen kifften, hatten Hendrike und ich ein Spezial-Hobby: die Auskundschaftung des Erotischen. Ich kaufte mir eine 8-mm-Kamera und drehte wilde Filme mit Hendrike in der Hauptrolle, Theresa Orlowski hätte Bauklötze gestaunt. Wir schworen uns ewige Liebe und wollten heiraten.
Vielleicht wäre es auch so gekommen, wenn mir auf Dauer Scheunenfeste und Dorftaufen genug gewesen wären. Aber ich wollte mehr. Ich wollte mit meiner Band unbedingt da auftreten, wo schon Randy Newman und Al Jarreau gesungen hatten: Im »Onkel Pö« in Hamburg. »Hallo«, rief ich an, »ich möchte bei euch spielen.« – »Okay«, war die Antwort, »schick uns mal eine Demokassette.« Drei Wochen später hatten wir unseren ersten ernst zu nehmenden Gig. Man jubelte uns zu, ich fühlte mich toll, ich fühlte mich stark. Doch plötzlich hatte ich ein Problem an der Backe, mit dem ich nicht gerechnet hatte: die vielen scharfen Hühner am Ausgang vom »Onkel Pö«. Voll gierig standen sie nach unseren Auftritten da und verlangten regelrecht danach, weggeputzt zu werden. So waren die Zeiten und mein Motto war: Man darf nicht Nein sagen zu den Mädels. Es lief immer gleich ab: Wir fuhren mit der Band und mehreren unserer Bewunderinnen zu einem der Groupies nach Hause. Während die Damen unter unseren allgemeinen Anfeuerungsrufen auf den Tisch stiegen, um uns etwas vorzustrippen, saßen wir Herren auf dem Teppich und tranken Bier.
Ich kam so auf sieben, acht nette Flirts nebenher, kopfmäßig blieb ich aber immer meiner Hendrike treu. Sie war meine Frau, meine Super-Sonne, die anderen waren nur kleine Satelliten drum rum. Hendrike durfte von den Groupies natürlich nichts wissen. Sie hätte mich erst in den Hintern getreten und dann zum Mond geschossen.
Wie ich ein Akademiker wurde
Mit dem Abi in der Tasche hieß das Ziel: ab nach Göttingen zum Studieren. Die Vision meiner Eltern: studierter Betriebswirt, was Ordentliches sollte ich werden, die väterliche Firma übernehmen. Mit stolzgeschwellter Brust winkten sie ihrem Prachtstück (mir) an der Haustür hinterher, doch was sich so easy anhört, war leichter gesagt als getan. Zur Uni hin, sich immatrikulieren müssen – kein Mensch hatte mir gesagt, wie schwer das ist. Dass man sich fühlt wie Falschgeld, keiner einen Plan hat und man von Pontius zu Pilatus läuft. In Oldenburg war ich Dieter Dampf in allen Gassen gewesen. Dieter, der Hero, der in zwanzig Bands spielte und mit fast jeder Tante ein Verhältnis hatte. Alle kannten mich und ich kannte jede. Und zweihundertachtzig Kilometer entfernt in Göttingen war ich ein Nichts, dem die Düse ging vor Angst, dass er es nicht packen könnte. Kein Risiko eingehen, die Kosten schön übersichtlich halten – für neunzig Mark im Monat mietete ich einen Karnickelstall, der sich Wohnung nannte, mit Gemeinschaftsklo auf dem Flur. »Mach uns keine Schande, hörst du?«, hatten mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben, dazu monatlich fünfhundert Mark. Ich besaß nur einen Teller, ein Glas, ein Besteck. Was das Abwaschen ausgesprochen unkompliziert machte: einfach untern Wasserhahn vom Gemeinschaftsklo halten – fertig.
Plötzlich stand Hendrike bei mir vor der Tür. Großes Latinum, weißer Flügel, Häkelnadeln: Alles hatte sie hingeschmissen. Sie stellte mein Leben vor ihr Leben, nur um mit mir zusammen zu sein, wollte jetzt eine Lehre als Krankenschwester beginnen. Für sie waren wir eine Einheit, uns durfte nichts trennen. Damit hätte ich nie gerechnet, ihre Familie auch nicht, der Schock saß tief. Und während ihr Vater daheim in Oldenburg vor Wut und Verzweiflung darüber, dass die Tochter ihre Karriere ruinierte, in den Perser-Teppich biss, siegte mein Sinn fürs Praktische. Sie gab mir die Sicherheit, meine Neunzig-Mark-Klitsche zu kündigen. Gemeinsam mieteten wir eine größere Wohnung. Wo wir nun richtig als Mann und Frau zusammenlebten, funktionierte das Handling mit der Sonne und den Satelliten nicht mehr so recht. Plötzlich war ich tierisch eifersüchtig, argwöhnte, sie könnte genauso sein wie ich und mich betrügen. Leute erzählten mir frohlockend, Hendrike würde unterm Kittel nie was anziehen, alle seien ganz wild auf meine Freundin und mindestens das halbe Krankenhaus hätte einen Ständer. Na, da hatten sie in mir ja den richtigen Adressaten! Ich fing an, Streit vom Zaun zu brechen: »Wo kommst du her?«, »Warum kommst du so spät?« Ich machte mich wirklich zum Elch, das war der Anfang vom Ende, von da an ging unsere Liebe den Bach runter.
An den Wochenenden trat ich wie gehabt mit meinen fünfundzwanzig verschiedenen Bands auf: Mayfair, Urvogel, Dacapo, Aorta. Bis in die Morgenstunden spielten wir die Top 100: »Mississippi« von Pussy Cat, Tony Christie mit »Is this the Way to Amarillo?«, dazu Smokie und Hot Chocolate. Schwer angesagt war ich auch als Marianne Rosenberg: Ich sah zwar nicht aus wie sie, aber wegen meiner hohen Stimme hieß es immer: »Das kann nur einer singen, da musst du jetzt ran, Dieter!« Als kleine Motivationsstütze bekam ich fünf Apfelkorn auf die Orgel geknallt, dann kam die Forderung: »Los jetzt! Wir wollen ›Ich bin wie du‹ hören. Pro Auftritt gab’s zweihundert Mark, an manchen Wochenenden schaffte ich drei Auftritte. Ich kaufte mir einen Golf in Senfei-Farbe, die damalige Trendfarbe. Dazu leistete ich mir die teuerste und geilste Orgel, eine A 100 von Hammond.
Montags um acht saß ich wieder in der Statistik-Vorlesung, schwerste Mathematik, die kein Mensch kapierte, Semester-Durchfallquote siebzig Prozent. Aber mich trieb die Angst, dass meine alten Herrschaften über Nacht beim lieben Gott zum Harfespielen antreten müssten, weil sie immer ohne Rücksicht auf die Gesundheit wie die Bekloppten schufteten. Mein Vater hatte bereits einen Herzinfarkt hinter sich, meine Mutter lag permanent im Clinch mit ihrem Kreislauf. Kein Tag, an dem ihr nicht schwindelig wurde. Sie sah total spiddelig aus, wog nur noch achtundvierzig Kilo.
Ich sah mich von jetzt auf gleich vor dem Nichts stehen, keine monatliche Sicherheit mehr aus Oldenburg. Deshalb ackerte ich meinerseits wie ein Blöder, lernte jede freie Minute. Das verschlechterte natürlich noch zusätzlich die angespannte Situation zwischen mir und Hendrike. Aber ich sah nicht, dass meine Beziehung auf dem Spiel stand.
Nach nur drei Semestern beendete ich schon mein Vorstudium und begann mit Hauptstudium und Diplom-Arbeit: »Die Equity-Methode und ihre Anwendung auf die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung«. Daneben verfolgte ich meinen wahren Lebenstraum: Musiker werden. Wie ein Besessener komponierte ich Titel und produzierte Demobänder. Das ging so: Ich nahm ein Telefonbuch und schlug es im Takt auf den Küchentisch. Dabei ließ ich ein vierspuriges Aufnahmegerät laufen – so hatte ich die »Base«, die Grundspur. Darauf schichtete ich noch meinen Gesang, ein bisschen Orgel und Gitarrenspiel. Das Ganze ging als Kassette und im Couvert in die Hamburger Hallerstraße 40. »Da gibt’s so ’nen Musikverlag«, hatte mir ein Kommilitone gesteckt, der in dem Laden mal Praktikant gewesen war, »dort kann man Titel hinschicken.« Der hatte da voll den Durchblick. Nach vier Tagen kamen die Umschläge mit tödlicher Sicherheit und dem Vermerk zurück:
»Vielen Dank für Ihre Zusendung. Leider ist in unserem momentanenProduktrahmen eine Veröffentlichung dieses Titels nicht möglich.«
Mir war natürlich klar, was die meinten: »Diesen Müll hier können wir nicht gebrauchen.« So blieb ich weiterhin der Einzige, der wusste, dass meine Songs mindestens genauso gut waren wie die Superhits »Mammy Blue« von den Pop Tops und »Es fährt ein Zug nach Nirgendwo« von Christian Anders. Die führten zu dem Zeitpunkt gerade die Charts an.
Das Ende meiner großen Liebe
Ich lebte in meinem privaten Universum, war nur auf meine eigenen Ziele fixiert. Plötzlich der Donnerschlag: Hendrike erwartete ein Baby. Ich Idiot hatte nicht aufgepasst und meine eigene goldene Königsregel verletzt: immer hübsch vorsichtig sein, im richtigen Moment die Luft anhalten und eine Rechenaufgabe anfangen. Ich wollte das Kind. Hendrike nicht. »Hilf mir, Dieter«, verlangte sie. Ich sagte: »Nein.« Eines Morgens lag ein Zettel bei uns auf dem Küchentisch, an dem ich sonst mit meinem Aufnahmegerät saß und an meiner Karriere bastelte. Jetzt stand da: »Bin nach Holland gefahren.«
Ich hatte eine unendliche Wut in mir, war tief verletzt, dachte nur: »Mensch, sie kann dich nicht lieben, sie will ja noch nicht mal dein Kind!« Statt an sie zu denken, mich um sie zu sorgen, mich zu kümmern, dachte ich nur: »Mensch, du Armer, du wirst zurückgestoßen«. Und so reagierte ich auch. Ich hatte nix begriffen, war weiterhin nur mit mir selbst beschäftigt. Ich drehte total durch und war richtig ekelig zu ihr, dass sie irgendwann die Reißleine ziehen musste: »Tschüss, Dieter, such dir eine neue Wohnung!«, hieß ihre Konsequenz. Heute weiß ich: Hendrike hatte die richtige Entscheidung getroffen. Ich war selbst noch ein Kind, ein weiteres Baby hätten wir nicht gewuppt gekriegt. Das hatte sie im Gegensatz zu mir ganz klar erkannt. Ich möchte ihr an dieser Stelle, dreißig Jahre später, gerne sagen: Sorry, Hendrike, dass ich so blind war.
Es war der vollkommene Absturz für mich, ich fiel ins Bodenlose. Am liebsten wäre ich vom Göttinger Kirchturm gesprungen. Immer wieder rief ich sie an, bettelte: »Lass mich zurückkommen!« Ich verlor meine Traumfrau.
Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Ich brauchte Jahre, bis ich über Hendrike hinweg war. Und selbst danach war da nur eine dünne Kruste Schorf.