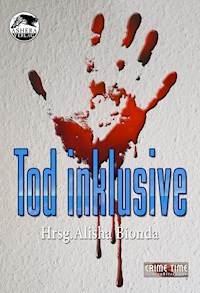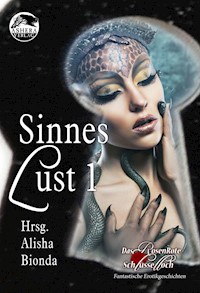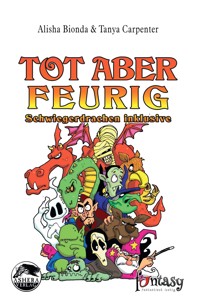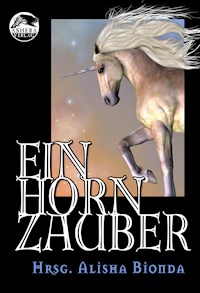6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ashera Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Hommage an Edgar Allan Poe Kunst ist die Wiedergabe dessen, was die Sinne in der Natur durch den Schleier der Seele erkennen. Edgar Allan Poe Barbara Büchner, Tanya Capenter, Nicolaus Equidamus, Andreas Flögel, Erik Hauser, Florian Hilleberg, Desirée Hoese, Sören Prescher und Arthur Gordon Wolf verfassten ihre ureigene Hommage an Edgar Allan Poe, indem sie den Meister des Grauens in ihren Geschichten agieren lassen. Mit einem Essay von Florian Hilleberg Das Besondere an diesem Band ist, dass jede der Geschichten wahre Stationen und Begebenheiten aus dem Leben von EAP beinhaltet, sprich er selbst Prota- oder Antagonist in den Texten ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hrsg. Alisha Bionda
Odem des
Todes
Anthologie
In der Reihe „Edition Media Noctis“ bereits erschienen:
Odem des Todes, Hrsg. Alisha Bionda, Anthologie
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wären rein zufällig.
Copyright © 2021 dieser Ausgabe by Ashera Verlag
Ashera Verlag GbR
Alisha Bionda & Annika Dick
Hauptstr. 9
55592 Desloch
www.ashera-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder andere Verwertungen – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Verlags.
Covergrafik: iStock
Innengrafiken: iStock
Coverlayout: Atelier Bonzai
Redaktion: Alisha Bionda
Lektorat & Satz: TTT
Vermittelt über die Agentur Ashera
(www.agentur-ashera.net)
Man kann ebenso gut zu tief als zu oberflächlich sein
und vergessen,
dass die Wahrheit nicht immer in einem tiefen Brunnen,
sondern oft dicht
vor unseren Augen liegt,
und dass man
durch ein allzu eifriges
sich Verbohren
in einen Gegenstand
seinen Gedanken die Kraft nimmt.
Edgar Allan Poe
Inhalt
Vorwort
Die Geister der Vergangenheit
Süße Liebe Wahnsinn
Das Verhängnis der Griswolds
Die Rosenbrosche
Metzenger
Odem des Todes
Die fehlenden Köpfe
Dunkel sind die Kammern deiner Träume
Geisterstunde
Edgar Allan Poe - Ein Essay von Florian Hilleberg
Die Herausgeberin
Vorwort
Alisha Bionda
Die am Tag träumen kennen viele Dinge, die den Menschen entgehen, die nur nachts träumen.
Edgar Allan Poe
Über Edgar Allan Poe eine weitere Hymne zu singen, wäre nur eine Wiederholung vielfacher Ehrungen und würde Sie sicher langweilen.
Auch den ein oder anderen Kurzgeschichtenband hat es natürlich als Hommage an ihn und sein Schaffen bereits gegeben.
Als solche sieht sich auch ODEM DES TODES.
Mit zwei Besonderheiten: Edgar Allan Poe agiert selbst in den Erzählungen, er wurde in die Stationen und Begebenheiten seines Lebens fiktiv eingebunden.
Und das wird Sie hoffentlich nicht langweilen.
Am Ende des Bandes finden Sie darüber hinaus einen Essay von Florian Hilleberg über den „Meister der Schauergeschichte“. Er rundet den düsteren Reigen ab.
Ich wünsche Ihnen daher phantastisches und anschauliches Lesevergnügen.
Alisha Bionda, September 2020
Die Geister der Vergangenheit
Arthur Gordon Wolf
Die zahllosen Pressemitteilungen über den Fund eines bislang unbekannten Briefes von Edgar Allan Poe (wobei viele höchst reißerisch und inhaltlich fehlerhaft sind) haben in der Literaturszene für einen nicht unbeträchtlichen Wirbel gesorgt. Nun, da vier Schriftsachverständige innerhalb des vergangenen letzten halben Jahres unabhängig voneinander die Echtheit des Schriftstücks bestätigt haben, ist die Sensation perfekt. Eine Sensation deshalb, da der Inhalt zweifellos da-zu führen wird, die Person und das Werk des Dichters in einem neuen Licht zu sehen. Erstmals werden Details aus Poes frühen aber auch späten Jahren enthüllt, die viele Fragen seiner Biografen, Kritiker und Leser beantworten. Gleichzeitig wirft der Brief allerdings auch neue Fragen auf. Aber lesen Sie selbst; damit die Gerüchte über den Inhalt des Dokuments nicht noch phantastischere Dimensionen annehmen, wird der Brief hier in ungekürzter Form (lediglich mit einigen wenigen Anmerkungen meinerseits versehen) abgedruckt. [Rachel C. Brooksdale, Baltimore, März 2009]
Hochgeehrter Herr!
(Da der Adressat namentlich nicht erwähnt wird, streiten sich die Sachverständigen noch. Während ein Teil glaubt, der Brief sei an Dr. James E. Snodgrass gerichtet, vertritt der andere Teil die These, Poe habe sich an seinen späteren Nachlassverwalter Rufus Wilmot Griswold gewandt.)
Mein Geist wandert in den letzten Tagen ständig zwischen Träumen und Wachen. Ich habe fast jedes Empfinden für die Zeit als solche verloren. Da ich nicht weiß, wann mein Bewusstsein erneut in dunkelste Gefilde blasphemischster Phantasmagorien oder noch schlimmer, in absolutes Nichts (und das bei ‚bewusstem‘ Miterleben des Träumers) hinabstürzen wird, muss ich mich eilen, diese Zeilen zu Papier zu bringen. Ich bitte daher meine flüchtige Handschrift zu entschuldigen.
(Ein weiterer Grund für die Probleme bei der Authentifizierung des Briefes lag in der sehr krakeligen und oft kaum lesbaren Schrift begründet.)
Wie man mir sagte, befinde ich mich augenblicklich im Washington College Hospital in Baltimore. Wie ich hierher gelangte, wer mich meiner Kleider beraubte und mir stattdessen Lumpen und einen Strohhut gab, ist mir ein Rätsel. Kein Rätsel ist mir allerdings mein gesundheitlicher Zustand, habe ich doch höchstselbst dafür Sorge getragen, meinen Geist zu betäuben. Offenbar habe ich die Wirkung jener Südsee-Mixtur aber falsch berechnet.
(Von dieser Mixtur wird noch später die Rede sein. Was genau sich hinter dieser Bezeichnung – zum Beispiel die genauen Inhaltsstoffe – verbirgt, ist bis zum heutigen Tag ungeklärt.)
Meine Ohnmacht sollte vollständig und länger anhaltend sein. Ich hatte geplant …(Rest unleserlich.)
Aber ich schweife ab. Bevor ich auf die Tat, das Experiment, genauer eingehe, sollte ich wohl die Gründe offenlegen, die mich zu diesem dramatischen Schritt bewogen haben.
Es hatte Jahre, sehr viele Jahre gedauert, bis ich mir selbst endlich die Ursache für meine tief verwurzelten Ängste, meine abscheulichen Phobien, eingestanden habe. Mögen sie durchaus der Quell vieler meiner Schauergeschichten, Grotesken und Arabesken gewesen sein, so haben sie dennoch unablässig an meiner Lebensenergie genagt. Wie nimmersatte Succubi höhlten sie mich innerlich aus, ließen mich mehr und mehr zu einem blassen Schatten meiner selbst werden.
Das Ur-Trauma meines Lebens nahm seinen Anfang in der Alten Welt. Alles begann an einem kalten Dezembertag des Jahres 1815 im fernen Schottland. Ich war zuvor mit meinen Pflegeeltern von Richmond nach London gereist, weil Mr Allan vor Ort eine Zweigniederlassung seiner Firma gründen wollte. Leider aber war es mir nicht vergönnt, in London die Schule zu besuchen, und so schickte man mich zu Mr Allans Schwester in den Norden nach Irvine. Zusammen mit James (gemeint ist James Galt, der Cousin Poes) trat ich Ende November die mehr als unerfreuliche Fahrt an. Ich fühlte mich ohnehin unwohl in England. War mein Name in Richmond noch Edgar Poe gewesen, so wurde ich auf der Insel nur noch Edgar Allan genannt. Es bedeutete aber keineswegs, dass ich von nun an ein anerkanntes Familienmitglied der Allans gewesen wäre. Mein Ziehvater sollte der Frage nach meiner Adoption nämlich bis zu seinem Tode aus dem Wege gehen. Dieses seltsame Zwitterdasein verwirrte meinen jugendlichen Geist so sehr, dass ich zuweilen tatsächlich die irrige Vorstellung hatte, es müssten zwei verschiedene und doch identische Ausgaben meiner Selbst existieren.
Mit Schottland verbinde ich nur Kälte, Stille und … pures Grauen. War London noch eine unfreiwillige aber angenehme Abwechslung vom täglichen Einerlei gewesen, so präsentierte sich mir Irvine als provinziell, karg und verknöchert. Die Schule bildete da keine Ausnahme. Die Old Grammar School und seine Lehrkräfte, allen voran Rektor Dr. J. L. Brown, (den alle Schüler wegen seiner Vorliebe für Schnupftabak hinter vorgehaltener Hand nur ‚Old Snort‘ nannten) waren ein Paradebeispiel für militärischen Drill und sinnfreies Auswendiglernen. Kreativität wurde hier geradezu als auszumerzender Makel betrachtet. So lässt sich wohl unschwer begreifen, warum ich nach jeder Möglichkeit suchte, um dieser täglichen Pflicht zu entgehen. Tante Mary, die meinen Unwillen mehr als deutlich bemerkte, wies endlich James an, zu mir ins Zimmer zu ziehen. Er sollte verhindern, dass ich mich bei Nacht und Nebel aus dem Bridgegatehaus davonschlich.
Jeden Morgen machte ich mich also gehorsam auf den recht kurzen Schulweg, doch wann immer es mir in den Sinn kam (und James mich nicht bis zur Pforte begleitete), strebte ich einem interessanteren Ziel entgegen. Nun war Irvine nicht gerade ein Ort, an dem es für einen 14-jährigen Jungen viele aufregende Dinge zu entdecken gab, und daher führte mich mein Weg fast immer hinunter zum Fluss.
(Wie in nahezu all seinen Briefen macht sich Poe auch hier jünger, als er war – tatsächlich wurde er aber am 19. Januar 1809 geboren. Er war zu diesem Zeitpunkt also fast schon 17 Jahre alt.)
Ich hockte mich dann an das gefrorene Ufer und starrte wie gebannt auf die milchig trübe Strömung des ‚Irvine‘. Während die Kälte langsam in meine Glieder kroch, träumte ich davon, auf einem Boot den Fluss hinabzusegeln. Und von dort hinaus aufs stürmische Meer, weit nach Norden in die Gefilde ewigen Eises. Ich malte mir dramatische Abenteuer aus, die ich als verwegener Entdecker zu bewältigen hatte. Ich träumte von gewaltigen Eisbergen, die mein Boot zu zerschmettern drohten und von blutgierigen weißen Kreaturen, die nur jenseits des Polarkreises existierten.
An jenem besagten Dezembertag hatte ich erneut der ‚Old Grammar‘ den Rücken gekehrt und saß wie gewohnt am Fluss, als mich eine Bewegung aus meinen Träumen riss. Eine schwarze Katze suchte zwischen angeschwemmtem Unrat nach Nahrung. Das Tier war recht mager und hatte stumpfes, struppiges Fell.
„Na, du Streuner! Wohin des Weges?“, rief ich ihr zu.
Die Katze hielt in ihrem Treiben inne und starrte mich an. Als ich ihr Gesicht sah, zuckte ich unwillkürlich zusammen. Offenbar bei einem Kampf mit einem Rivalen oder durch einen Unfall hatte das Tier sein rechtes Auge verloren. Dort, wo eigentlich die glitzernde Pupille sein sollte, gähnte nun ein garstiges ausgefranstes Loch.
„Eine Schönheit bist du ja nicht gerade“, sagte ich, nachdem ich den ersten Schreck überwunden hatte. So, als hätte mich das Tier verstanden, machte es plötzlich einen Buckel und stieß ein kehliges Fauchen aus. Sein einzelnes noch verbliebenes Auge funkelte mich dabei böse an.
„Aber, aber“, entgegnete ich in möglichst freundlichem Ton, „kein Grund, gleich so gereizt zu reagieren. Wie es scheint, sind wir uns doch gar nicht so unähnlich. Das schottische Klima bekommt offenbar keinem von uns sonderlich gut.“ Ich klopfte sanft auf den Boden neben mir. „Komm, und setz dich her zu mir! Dann können wir gemeinsam von freundlicheren oder aufregenderen Orten träumen.“
Ein Hund wäre meiner Einladung wohl gefolgt, die Katze jedoch, blieb wo sie war. Vielleicht hatte sie schon zu viele unliebsame Erfahrungen mit Vertretern meiner Spezies gemacht. Eine Weile musterte sie mich noch argwöhnisch, bevor sie dann dem Flusslauf in südlicher Richtung folgte. Da mein Beobachtungsposten höchst unbequem geworden war, beschloss ich kurzerhand, dem Tier zu folgen.
„Heh, Einauge!“, rief ich. „Warte auf mich! Zu zweit lässt sich die Welt weitaus besser erkunden.“ Mit keinerlei Geste verriet die Katze, was sie von meinem Vorschlag hielt. So, als existiere ich nicht, ging sie weiterhin ihrem Tagesgeschäft nach. Offenbar hatte sie meine Person in die Rubrik „gefahrlos und uninteressant‘ eingestuft. So sehr ich mich aber auch sputete, nie wollte es mir gelingen, ihr näher als etwa zehn Yards zu kommen.
Auf diese Weise durchstreiften wir beide das Ufer bis jenseits des Pulverhauses, als mein Führer mit einem Mal wie von Furien gehetzt die steile Böschung hinaufeilte. Ich musste mir mühsam einen Pfad durch das knorrige Buschwerk bahnen und befürchtete schon, die Katze aus den Augen verloren zu haben. Oben angelangt suchte ich angestrengt die Umgebung ab. Da sich zu meinen Füßen nun allerdings nur flache, karge Felder erstreckten, dauerte es nicht lange, bis ich eine mir wohlvertraute Gestalt entdeckte. Mein struppiger Freund hielt genau auf einige Häuser im südöstlichen Außenbezirk des Ortes zu. Hatte das Tier etwa einen Ruf vernommen, der jenseits der Grenzen des menschlichen Hörvermögens lag? Auch wenn der dunkle Schemen inmitten der teilweise mit Schnee überzuckerten Felder gut erkennbar war, hastete ich voran, um den Abstand wieder zu verringern.
Ich war etwa wieder auf fünfundzwanzig Yards herangekommen, als ich endlich auch das genaue Ziel der Katze ausmachen konnte. Geradewegs trippelte sie auf ein altes Backsteingebäude mit einem schlanken Schornstein zu. Wie ich von früheren Exkursionen durch die Stadt wusste, handelte es sich bei dem Bauwerk um die alte Ziegelei, die ihre Produktion allerdings schon vor vielen Jahren eingestellt hatte.
(Hier scheint die Erinnerung Mr Poe einen Streich zu spielen, denn nachweislich befand sich in dieser Gegend nie eine derartige Fabrik.)
Der hässliche rußgeschwärzte Quader und der Turm des Schornsteins ragten wie Teile einer heidnischen Begräbnisstätte vor mir auf. Ich malte mir aus, wie Äonen zuvor grausige Titanen hier ihre letzte Ruhe gefunden hatten.
Mein schweigsamer Stadtführer gewährte mir jedoch nicht die Muße, die Atmosphäre des Ortes hinlänglich in mich aufnehmen zu können. Unbeirrt lief er an der mit schweren Holzbohlen verbarrikadierten Pforte vorbei und verschwand dann im Innenhof. Als ich den Platz schließlich erreichte, war von dem Tier nichts mehr zu sehen. Das Rätsel ließ sich jedoch schnell lösen. Der hintere Teil der Ziegelei bildete ein längliches Rechteck, dessen eine Längsseite aus der Rückwand des Gebäudes selbst und die Schmalseite aus einer etwa vier Yards hohen Mauer bestand. An der zweiten Längsseite erhob sich ein steiler, vielleicht zehn Yards hoher Erdwall, dessen Kamm von einem Bretterzaun gekrönt wurde. Wenn die Katze also nicht den beschwerlichen Weg dort hinauf genommen und ein Loch im Zaun gefunden hatte, musste sie sich irgendwo in der Fabrik verbergen. Ich benötigte nur wenige Minuten, bis ich den vermeintlichen Zu-gang fand. In der hinteren rechten Ecke des Hofes, teilweise von staubigem Unkraut verdeckt, stand ein Kellerfenster einen Spalt weit auf. Vorsichtig hob ich den länglichen Flügel weiter an und spähte hinab ins dämmrige Innere des Kellers. Alles, was ich erkennen konnte, waren hohe Stapel von Holzscheiten und dunkle Schemen von Gerümpel.
„Heh, Einauge, bist du da drin?“, rief ich. Aus dem Inneren kam jedoch keinerlei Antwort. Die einzige Bewegung wurde durch die winzigen Staubteilchen erzeugt, die munter im Lichtstrahl des Fensters tanzten. Ich zögerte nur kurz, dann siegte mein Entdeckergeist. Wie ein tatendurstiger Odysseus betrat ich die Höhle jenes unbekannten Polyphems. Zudem bereitete es mir schon jetzt eine nicht unbeträchtliche Freude, meine Kleidung zu beschmutzen. In der Schule und im Hause meiner Tante wurde nämlich in schon abstruser Manier auf Sauberkeit geachtet. Schmutzige Fingernägel waren bereits ein erster Schritt in die Abgründe der ewigen Verdammnis.
Ich konnte daher ein Kichern nicht unterdrücken, als ich mich eng auf die Erde pressen musste, um meinen Körper bäuchlings mit den Füßen voran durch die schmale Öffnung zu schieben. Selbst jetzt passte ich kaum durch den Rahmen. Mit aller Kraft und strampelnden Beinbewegungen wollte das Unterfangen schließlich aber glücken. Als ich endlich auf dem Boden des Kellers angelangt war, obsiegte die Freude über die gelungene Tat über die Schrammen, die mein Rücken hatte hinnehmen müssen. Auch machte ich mir zu diesem Zeitpunkt keinerlei Gedanken darüber, wie ich auf selbigem Wege wieder aus dem dunklen Verlies entkommen wollte.
Vorerst war ich mit wichtigeren Dingen beschäftigt. Ich suchte nach einem geeigneten Holzscheit und klemmte ihn derart gegen die Fensterklappe, dass ein möglichst breites Lichtband zu mir hinunterfiel. Erst jetzt war es mir möglich, meine Umgebung genauer in Augenschein zu nehmen. Ich stand inmitten eines wilden Durcheinanders aus Brennmaterialien, Abfall, Fässern und Maschinenteilen unbekannter Herkunft. Die Ziegelei hatte ihren Ofen vornehmlich mit Holz und Kohle betrieben und so waren neben Holzstapeln auch die Reste zweier Bogheadberge übrig geblieben. Wie zwei finstere Pyramiden ragten sie bis hinauf zur Decke. Der Rest des Bodens, der nicht von Fässern und Werkzeugen eingenommen wurde, war mit einer hohen Schicht aus zerbrochenen Ziegeln bedeckt. Offenbar war hier auch der bei jedem Brennvorgang anfallende Ausschuss zwischengelagert worden. Jeder Schritt erzeugte ein malmendes, knirschendes Geräusch.
In meiner Fantasie durchlief der Keller eine wundersame Metamorphose und erschien mir mit einem Mal wie eine von Piraten angelegte Schatzhöhle. Schmutz und Unrat wandelten sich zu Bergen aus Gold und Edelsteinen; meine Sohlen zertraten keinen gebrannten Lehm, sondern schritten über portugiesische Dublonen und spanische Dukaten. Ich wagte mich weiter vor in die Dämmerzone zwischen Licht und Finsternis. Zuweilen musste ich mir meinen Weg über Fässer hinweg oder unter Bretterstapeln hindurch bahnen. Dicke, klebrige Spinnweben legten sich wie unsichtbare Schleier über Gesicht und Haar. Erst als nur noch ein gräulicher Schimmer die Dinge um mich herum von der vollkommenen Schwärze der Schatten abgrenzte, hielt ich inne. Ich wandte mich um und war erstaunt, wie weit ich bereits ins Innere des Kellers vorgedrungen war. Die Wand mit dem Einstiegsfenster war nur noch ein kleiner heller Fleck, der zwischen all dem Unrat kaum mehr auszumachen war. Erstmals überkam mich für einen kurzen Augenblick ein Gefühl der Beklommenheit. Als tapferer Forscher, der ich aber war, ließ ich Empfindungen dieser Art nicht zu. Möglicherweise stand ich kurz davor, eine große Entdeckung zu machen. Ich atmete mehrmals tief durch und konzentrierte mich dann auf die genauere Erkundung meiner unmittelbaren Umgebung. Durch diese innere Zwiesprache gestärkt, kroch ich zumeist auf allen vieren so weit voran, bis meine Augen noch Umrisse erspähen konnten. Ich fühlte mehr, als dass ich sah, doch alles, was meine Finger ertasteten, war von hölzerner oder rostig metallischer Beschaffenheit. Von Gold oder Edelsteinen fehlte jede Spur.
Ich hatte mich soeben schweren Herzens dazu durchgerungen, den Rückweg anzutreten, als ein dumpfes Grollen den Keller erbeben ließ. Donner wie von einem fernen Unwetter erklang über mir. Und dann wurde daraus ein ohrenbetäubendes Dröhnen und Poltern. Noch ehe ich wusste, wie mir geschah, stürzten die Wände über mir zusammen und begruben mich in einer Wolke aus undurchdringlichem Staub.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich für einen kurzen Moment die Besinnung verlor; lange kann meine Ohnmacht jedenfalls nicht gedauert haben. Als ich nämlich die Augen wieder aufriss (um absolut nichts zu sehen), hatte sich der Staub noch nicht gelegt. Das erste Gefühl, was sich meiner bemächtigte, war das des Erstickens. Verursacht durch die fast greifbare Qualität der Luft aber auch durch den Druck, den ein unbekanntes Gewicht auf meine Brust ausübte, wollte es mir einfach nicht gelingen, auch nur einen richtigen Atemzug zu machen. Ich keuchte und hustete, aber durch das Husten drang nur noch mehr des teuflischen Staubes in meine Lungen. Ich fühlte mich wie ein Ertrinkender, der wider besseres Wissen das falsche Element einatmete. Diesmal verlor ich für längere Zeit das Bewusstsein, und wahrscheinlich rettete mir dieser Umstand sogar das Leben. Hätte ich weiterhin gegen das Ersticken angekämpft, hätte mir die Panik zweifellos genau dieses schreckliche Ende bereitet. Im schlafenden Zustand beruhigte sich dagegen meine verkrampfte Kehle, während mein Geist von wohligem Nichts umhüllt wurde.
Als ich schließlich wieder erwachte, keuchte ich zwar wie ein Taucher, der aus großer Tiefe nach oben gestiegen war, nach kurzer Zeit beruhigte ich mich aber. Der Staub war verschwunden und die Luft wieder normal atembar. Dieser Umstand sollte jedoch nicht bedeuten, dass mein Schicksal nun eine glückliche Wendung genommen hätte. Im Gegenteil. Kaum war ich dem Erstickungstod entronnen, befiel mich eine neue Angst. Erst jetzt sah ich mich in die Lage versetzt, meine augenblickliche Situation genau zu überprüfen. Ich lag rücklings auf dem Boden, konnte aber nur meinen linken Arm und das linke Bein bewegen. Ein Großteil meines Körpers wurde von einem schweren Gewicht gegen die Erde gepresst. Ich ertastete mit meiner freien Hand den Oberkörper und fand dort steinartige Brocken, die mich in einer dicken Schicht bedeckten. Auch wenn ich die Objekte nicht sehen konnte, wusste ich sogleich, worum es sich handelte: Kohle. Allem Anschein nach hatte meine Erkundungsreise dazu geführt, einen der Kohleberge zum Einsturz zu bringen und mich unter fetter Boghead zu begraben.
Warum aber war ich dann nicht vollständig verschüttet worden? Mit der Hand ertastete ich einen nicht unbeträchtlichen Freiraum zu meiner linken Seite. Über mir stieß ich jedoch schon nach kaum einer Elle auf Widerstand. Es war eindeutig Holz. Befand ich mich etwa in einem Sarg? Eilig verwarf ich diesen irrigen Gedanken. Wo sollte in einer Ziegelei ein Sarg herkommen und wer hätte mich in diesen legen sollen? Vielleicht hat man mich aber gefunden und für tot erklärt, schoss es mir durch den Kopf. Um mich dann zusammen mit Kohlen zu beerdigen? Nein, es musste eine andere Erklärung geben. Wenn ich nicht den Verstand verlieren wollte, galt es, jener Spirale morbider Gedanken schnell zu entrinnen. Konzentrier‘ dich!, schrie ich mich innerlich an. Tu, was du tun kannst!
Mühsam begann ich also, die Kohle von meinem Körper in jenen unbekannten Hohlraum zu befördern. Nach einiger Zeit hatte ich so auch meinen rechten Arm befreit, der die weitere Arbeit deutlich schneller bewältigen half. Leider aber konnte ich mich aufgrund der begrenzten Ausmaße meiner Höhle nicht aufrichten, weswegen ich meinen Körper nur bis zur Höhe der Knie von seiner Last zu befreien vermochte. Zudem spürte ich, dass mein rechter Fuß noch von etwas anderem als Kohle eingeklemmt worden war. Ein Balken oder Maschinenteil hielt ihn fest in seinem Griff. Immerhin gelang es mir, ohne Schmerzen die Zehen zu bewegen. Wie es schien, hatte mir mein Abenteuer zumindest keinen Knochenbruch oder eine andere schwerwiegende Verletzung beschert. Unter Tränen dankte ich dem Schöpfer für diesen glücklichen Umstand, eingedenk der Tatsache, dass jedes Schicksal auch weitaus grausigere Aspekte bereithalten konnte.
Jene Zuversicht half mir allerdings nicht lange, lag ich doch noch immer eingekeilt und verschüttet in einem finsteren Keller, irgendwo im eisigsten Winkel Schottlands. Niemand wusste, wo ich mich befand, und so konnte ich nicht auf Rettung von außen hoffen. Dessen ungeachtet schrie ich unzählige Male um Hilfe, so lange, bis mir meine Stimme versagte, natürlich regte sich nichts. Ich bezweifelte sogar, dass selbst ein Spaziergänger, der durch Zufall in den Hinterhof der Ziegelei geraten war, auch nur einen Laut vernommen hätte.
Mag man es als Segen oder Fluch bezeichnen, jedenfalls gewöhnten sich meine Augen langsam an die spärlichen Lichtverhältnisse meines Kerkers. Ich erkannte nun, dass eine breite Tür oder Bretterwand schräg über meinem Kopf zu liegen gekommen war und so eine schmale Nische geschaffen hatte. Ohne jenes hölzerne Dach wäre mein Körper vollständig und unrettbar von den Kohlen begraben worden. Ein weiterer Glücksfall inmitten aller Unbill. Ich vermied es allerdings, mir vorzustellen, was geschehen würde, wenn die Bretter dem Druck von oben nachgaben. Schon meinte ich ein verräterisches Knarren und Knarzen zu hören. Eine unnatürliche Ruhe nahm von mir Besitz. Immerhin hatte ich nun die Gewissheit, in dieser Falle nicht elendig an Durst und Hunger zu Grunde gehen zu müssen. Sollte mich nicht das Dach mit all seiner Last erschlagen, so würde ich unweigerlich das Opfer der eisigen Temperaturen werden. Hier im Keller wehte zwar kein Wind, ich vermutete aber, dass das Quecksilber auch im Inneren des Gebäudes kaum über den Gefrierpunkt stieg.
Ich weiß nicht, wie lange ich dort meinen düsteren Gedanken nachhing; Minuten dehnten sich zu Stunden und Stunden zu Tagen. Der menschliche Verstand nimmt Zeit auf höchst unterschiedliche Weise wahr, zerfließen doch in meiner momentanen Lage Tage, ja selbst Wochen, zu flüchtigen Momenten, zu Bewusstseinssplittern während eines Augen-aufschlags. Damals in der Ziegelei war das Rad der Zeit in tiefer Melasse versunken; es begann sich erst wieder schneller zu drehen, als ich das Rufen hörte. Es war dies kein menschlicher Laut. Es war ein Miauen. Anfangs glaubte ich an eine Verwirrung meiner Sinne, als sich der Laut jedoch wiederholte, durchfuhr mich die Erkenntnis, nicht allein in diesem Verlies eingeschlossen zu sein, mit neuer Energie und ungeahntem Lebensmut. Augenblicklich schossen mir die verrücktesten Ideen durch den Kopf. Die Katze konnte mich zwar nicht direkt befreien, aber wenn ich ihr gut zuredete, würde sie sicher Hilfe holen. Wie ein treuer Hund würde sie zum nächsten Haus laufen und so lange schreien, bis man ihr zu meinem Versteck folgen würde.
Die ersten Versuche, nach dem Tier zu rufen, scheiterten kläglich. Noch immer waren meine Stimmbänder so angegriffen, dass kaum mehr als ein leises Krächzen meine Lippen verlassen wollte. Ich musste erst mühsam ein wenig Speichel sammeln, um meine brennende Kehle zu befeuchten. Erst dann gelangen mir artikulierte Worte.
„Einauge?“, krächzte ich. „Wo bist du? Komm her, mein alter Freund. Ich könnte hier ein wenig Hilfe brauchen.“
Das Miauen kam zwar etwas näher, sonst geschah aber nichts. Offenbar hatte sich das Misstrauen der Katze mir gegenüber nur unmerklich abgeschwächt.
„Nun komm schon her“, bettelte ich. „Ich tu dir doch nichts. Hörst du? Ich brauche kräftige Hände, die mir hier heraushelfen.“ Nur mit Mühe gelang es mir, meine Stimme ruhig und leise klingen zu lassen. Schreien und Fluchen würde das Tier ohnehin nur noch weiter verschrecken.
Mit Erleichterung bemerkte ich, wie das Maunzen des Tiers wieder näher drang. Doch dann ertönte plötzlich ein tiefes lang anhaltendes Fauchen. Hatte mir der Laut nur wenige Stunden zuvor lediglich ein Lächeln entlockt, so erfüllte er mich nun mit tiefstem Grauen. Unter den Kohlen eingeklemmt war ich meiner Größe und meiner Kraft beraubt, die kleine Katze nun plötzlich nicht nur zu einem ebenbürtigen Kontrahenten, sondern zu einer tödlichen Bedrohung geworden. Meine Arme waren nur eingeschränkt einsetzbar und einem Angriff – von welcher Seite auch immer – würde ich nicht ausweichen können. Alles deutete zudem darauf hin, dass mein Gegner schon manchen blutigen Kampf ausgefochten hatte. Mein Atem wurde so hechelnd, dass ich fast erneut die Besinnung verlor. Das Schicksal hatte mich vor Ersticken, Erfrieren und Verdursten nur deswegen bewahrt, um mich nun von den Zähnen und Krallen einer mordgierigen Hauskatze zerfetzen zu lassen. Mein Blut pochte wie wild in meinen Schläfen. „Hau ab, du Mistvieh!“, schrie ich, so laut ich es noch vermochte. Dabei schlug ich mit beiden Händen so fest wie möglich gegen das Holzdach über mir. Es kümmerte mich nicht, dass ich es dabei möglicherweise zum Einsturz brachte. „Scher dich fort, du Höllenbrut! Du einäugiges Monster! Wage es nur, mich anzugreifen, und ich werde dir dein verbliebenes Auge mit Freuden auch noch herausreißen!“
Schlimmer als das Fauchen war die Stille, die mich danach umfing. Unruhig warf ich meinen Kopf von einer Seite zur anderen, doch außer grauen Schemen konnte ich nichts erkennen. Schlich sich das verderbte Tier bereits an mich heran, um mir im geeigneten Moment die Kehle aufzureißen? Trotz der Kälte brach mir der Schweiß aus allen Poren. Und dann hörte ich etwas. Ein widerlich dumpfes Pochen. Immer und immer wieder. Ich hielt den Atem an, um den Ort jenes Trommelns, das sich mehr und mehr zu einem Dröhnen auswuchs, besser bestimmen zu können. Als ich endlich die Quelle des beständigen Geräusches ausgemacht hatte, entrang sich meiner Kehle ein krächzendes Lachen. In meinen Ohren hallte der Laut jedoch mehr wie der Schrei einer verlorenen Seele nach. Das Pochen und Dröhnen war nichts anderes als der Schlag meines eigenen Herzens. Wahrscheinlich befand ich mich zu diesem Zeitpunkt an der Schwelle zum Wahnsinn, denn nur zu gerne hätte ich in meine Brust gegriffen, um dieses schreckliche Organ für immer zum Schweigen zu bringen. Wie sollte ich die Bewegungen des Feindes erkennen, wenn mein eigener Körper mir die Ohren verschloss?
Für unbestimmte Zeit fiel ich in einen traumlosen Schlaf. Als ich wieder erwachte, war das Dröhnen aus meinem Kopf verschwunden. Die absolute Stille lastete jedoch schwerer auf mir, als all die Kohlen es je vermocht hätten. Wo war die blutrünstige Katze abgeblieben? War sie schon längst wieder dem Labyrinth des Kellers entwichen oder hockte sie direkt neben mir und ergötzte sich an meiner Hilflosigkeit? Erstaunt stellte ich fest, dass mir dieser Gedanke keinen Schrecken mehr bereitete. Die Erkenntnis der Ausweglosigkeit meiner Lage war nun endlich in die tiefsten Winkel meines Bewusstseins gedrungen und hatte so jede Form von Hoffnung, jede Art von Gefühl in mir ersterben lassen. Die einzige Emotion, die mich noch durchströmte, war die des Fatalismus.
So dachte ich.
Doch es gibt Dinge, die selbst die Vorstellung des Lebendig-begraben-Seins an Grauen noch übertreffen.
Ewigkeiten trieb ich auf dem Ozean der Stille dahin, einem Boot ohne Segel oder Ruder gleich, nur darauf hoffend, eine gewaltige Woge möge mich endlich hinab in die erlösende Finsternis reißen. Aber nichts geschah. Kein gnädiger Poseidon, keine hilfreiche Nereide nahm sich meiner an.
Stattdessen drang ein Geräusch an mein Ohr. Ein dreimaliges Klicken. Nur ein Stück Kohle, das nach unten rollte. Ich zuckte zusammen. War nicht dort, wo Bewegung war, auch Leben?
„Einauge, bist du das?“ Meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Gebannt lauschte ich nach jedem noch so leisen Ton, aber mein Gefängnis verharrte in Schweigen. Wieder mochten Ewigkeiten des Dahintreibens vergangen sein, als ein neuerlicher Laut meine Sinne reizte. Nein, um präzise zu sein, waren es gleich mehrere Laute. Ein hohes Pfeifen erfüllte plötzlich die Luft, doch zusammen damit hörte ich auch ein durchdringendes Röcheln und Gurgeln. Etwas oder jemand holte offenbar tief Luft, ich konnte mir jedoch keine menschliche Kehle vorstellen, die in der Lage gewesen wäre, solch absonderliche Töne auszustoßen. Mir wollte aber auch kein Tier in den Sinn kommen, das dies vermocht hätte. Und dem Volumen des Röchelns nach musste es ein großes Exemplar sein, ein sehr großes. Der Gedanke, ein riesiger Grizzly hause in den Tiefen des Kellers, war geradezu absurd. Zudem gab es keinerlei Bären hier in Schottland. Mit was hatte ich es dann zu tun?
Denn eine Tatsache war unbestreitbar: Etwas war hier in diesem Keller. Und es kam unaufhaltsam näher.
Wieder klickerten Kohlestücke verräterisch zu Boden. Und dann ertrank ich förmlich in Pfeifen und Röcheln. Das grässliche Atmen erklang so laut, dass ich glaubte, die Ausdünstungen von Verwesung und Pestilenz riechen zu können. Eine Angst jenseits aller je begreifbaren Ängste hielt mich in ihren eisigen Klauen. Ich wollte schreien, strampeln, um mich schlagen, doch kein Laut entrang sich meiner Kehle. Keine Fiber meines Körpers gehorchte mir. Im Zustand der vollkommenen Starre erwartete ich das grausige Zeremoniell meiner Opferung.
Das unbekannte Wesen musste nun genau über mir sein. Ein neugieriges Kratzen wie von scharfen Sicheln brachte die Decke zum Erzittern. Feiner Kohlestaub rieselte auf mich hinab. Ich empfand eine perverse Form der Erleichterung. Endlich hatte das Warten ein Ende. In wenigen Augen-blicken würde mich das vollkommene Nichts empfangen, ein paradiesischer Ort, an dem es keine Schmerzen und Ängste gab.
Mein vorzeitiges Armageddon kam mit tosendem Donner über mich. Alles bebte und zitterte. Und alles floss. Wie auf einem kalten Lavastrom trieb ich zusammen mit meinem steinernen Kerker einem gierigen Höllenschlund entgegen, nur um erneut vom Schicksal verhöhnt zu werden. Denn nichts anderes konnte es sein. Gab es etwas Schrecklicheres, etwas Unmenschlicheres, als den Funken der Hoffnung zu schüren, wenn jegliche Rettung unmöglich war? Und dennoch erstarrten die Elemente in ihrem zerstörerischen Treiben, bevor ich die Schwelle zum Reich der Schatten übertreten hatte.
Die Wände meiner Krypta waren nun so nahe an mich herangerückt, dass sie Brustkorb und Arme wie Schraubzwingen zusammenpressten. Dafür spürte ich unter meinem Kopf einen Hohlraum, der vorher dort nicht existiert hatte. Wie eine Raupe schob ich mich mühsam mit beiden Beinen in diese Richtung. Erst jetzt bemerkte ich auch, dass das neuerliche Beben meinen eingeklemmten Fuß befreit hatte. Ich schob und wand mich so lange, bis mein Körper schließlich rücklings in die Vertiefung fiel. Endlich konnte ich wieder meine Arme bewegen. Ich drehte mich um und erspähte sogleich einen hellen Fleck über mir. Ein weiterer Teil einer hölzernen Abtrennung hatte sich zwischen mich und die mörderischen Kohlen geschoben und so das rettende Dach gebildet. Und dort, wo ich helles Grau erkannte, war eine Öffnung. Auf allen vieren kroch ich sofort hinauf und durch das Gerümpel zurück zur rettenden Wand mit dem Fenster. Wie lange ich für den Weg durch den Irrgarten benötigte, und wie es mir schließlich gelang, mich von innen durch den schmalen Rahmen nach draußen zu zwängen, ist mir bis zum heutigen Tage ein Rätsel.
Als ich keuchend im Hof zu liegen kam, war es bereits Nacht.
Über und über mit Ruß bedeckt torkelte ich über die Felder zurück zum Fluss. Ich wollte es unter allen Umständen vermeiden, meiner Tante etwas von der Ziegelei und meiner Torheit berichten zu müssen, und so sprang ich ungeachtet der Temperaturen in die eisigen Fluten, um zumindest einen Großteil der verräterischen Spuren zu verwischen. Sonderbarerweise empfand ich das Wasser als angenehm erfrischend. Mein Abenteuer hatte mich offenbar derart erhitzt, dass mir selbst arktische Bedingungen nichts anhaben konnten. Durchnässt und vollkommen entkräftet traf ich schließlich im Bridgegatehaus ein.
Die Aufregung war natürlich groß. Nachdem man in der Schule von meinem neuerlichen Fehlen erfahren hatte, war man im ganzen Ort auf die Suche nach mir gegangen. Tante Mary hatte kurz davor gestanden, meinem Vater eine Nachricht zukommen zu lassen. Ich erzählte nur etwas Wirres von einem Unfall am Fluss und verkroch mich dann erschöpft auf mein Zimmer. Noch bevor mein Kopf das Kissen berührte, war ich eingeschlafen.
Bis zum heutigen Tage habe ich versucht, dieses Erlebnis aus meiner Erinnerung zu streichen. Doch der menschliche Verstand lässt sich nur schwerlich täuschen. Ja, es scheint sogar, dass gerade jene Erlebnisse, die man verdrängen will, eine besondere Macht über uns entwickeln. Eine Macht, die umso größer wird, je länger wir davor fliehen. Meine eigene Flucht dauerte über dreißig Jahre, bis ich endlich den Mut dazu fand, mich meinen Alpträumen zu stellen.
Und so beschaffte ich mir jene Südsee-Mixtur, die bei richtiger Dosierung einen todesähnlichen Schlaf herbeiführt.
(Vieles spricht dafür, dass es sich hierbei um eine Droge handelt, die im Voodoo-Kult – vornehmlich auf Haiti – eingesetzt wird.)
Denn nur wenn ich mich willentlich meiner größten Angst stellte, würde ich sie auch überwinden können.
Ich nahm mir ein Zimmer im Bradshaw’s, verfasste einen Brief mit allen wichtigen Angaben für meine Retter und schritt beherzt zur Tat.
(Wer genau der oder die Retter sein sollten, wird leider nicht erwähnt.)
Aber die Wirkung ließ auf sich warten. Mehr als Kopfschmerzen und ein Schwindel wollten sich einfach nicht einstellen. Hatte ich eine zu geringe Dosis gewählt? Zudem wuchs in mir wieder die alte Angst. Was war, wenn das Zimmermädchen den Brief achtlos wegwarf und niemand meinen Scheintod bemerkte? Voller Unruhe und Panik verließ ich das Hotel und irrte durch die Stadt. Nur zu gerne hätten mich wohl Schurken wie dieser Burton (William Burton, Gründer des Gentleman’s Magazine, begründete Poes Ruf als Alkoholiker) in jenem Zustand gesehen, doch war nicht etwa Alkohol, sondern die Droge an meiner Verwirrung schuld. Irgendwann muss ich wohl Strauchdieben in die Hände gefallen sein, aber mir fehlen hier jegliche Erinnerungen. Das Nächste, was ich bewusst erlebte, war Dr. Moran, der mich gründlich untersuchte. Und dann die Schwestern, allen voran Morella Reynolds.
(Ein weiteres Geheimnis – lt. Aktenlage des Krankenhauses hat dort nie eine Morella Reynolds gearbeitet)
Sie war auch so freundlich, mich mit ausreichend Tinte und Papier zu versorgen, um diese Zeilen niederzuschreiben. Auch verfasste ich zuvor einen weiteren Brief mit Anweisungen, den ich in die treusorgenden Hände von Schwester Morella übergab.
(Poe erwähnt leider nicht, an wen dieser Rettungs-Brief gerichtet war.)
Ich spüre, wie die Droge langsam, sehr langsam, doch noch die Überhand über mich bekommt. Schon bald werde ich mich meiner Nemesis stellen. Und werde strahlend wie der Phoenix aus der Asche daraus hervorgehen, um mutig neuen Ufern entgegenzueilen.
(Spielt Poe hier etwa auf das Literatur-Magazin an, das er im Oktober neu gründen wollte?)
[Nachtrag: Hier endet der Brief Poes. Das noch verschlossene (sic!) Manuskript wurde in dem Geheimfach eines Sekretärs gefunden, der nachweislich im Besitz von Dr. Moran gewesen ist. Warum Moran Poes Brief nie öffnete, wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Auch bleibt die Frage offen, wieso niemand im Washington College Hospital jemals etwas von einer Morella Reynolds gehört hat. Gerade die Person, die für Poes Rettung bei einer Schein-Beerdigung von entscheidender Bedeutung war, erweist sich als Spuk, als Schemen. Ist es denkbar, dass der Dichter zu diesem Zeitpunkt bereits delirierte und sich die Schwester nur einbildete? Aber wer gab dem Patienten dann Feder und Papier? Und an wen war der Brief gerichtet? Letztendlich bleibt zu hoffen, dass Poe die unbekannte Droge tatsächlich viel zu schwach dosiert hatte, sodass sie ihre Wirkung nicht entfalten konnte. Die Alternative wäre einfach zu grauenvoll. R.C. Brooksdale]
Der Autor
Arthur Gordon Wolf
©des Fotos:Uwe Schinkel
www.