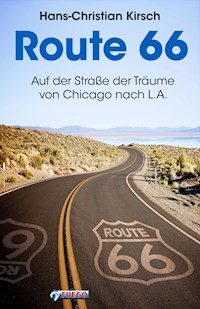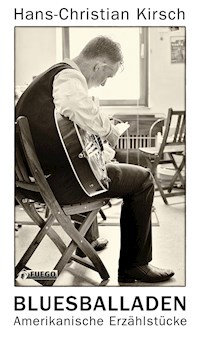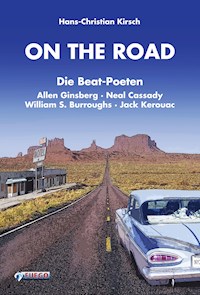
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fuego
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das wilde Leben und die impulsive, rebellische Literatur der Beat-Generation glichen nicht selten einer Höllenfahrt. Hans-Christian Kirsch porträtiert die Leitfiguren der literarischen Untergrundbewegung der 50er und 60er Jahre in den USA und setzt der Beat-Literatur mit liebevoller, aber keineswegs unkritischer und bisweilen ironischer Reverenz ein sehr persönliches Denkmal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Hans-Christian Kirsch
On the Road
Die Beat-Poeten
Allen Ginsberg · Neal Cassady
William S. Burroughs · Jack Kerouac
FUEGO
- Über dieses Buch -
Das wilde Leben und die impulsive, rebellische Literatur der Beat-Generation glichen nicht selten einer Höllenfahrt. Hans-Christian Kirsch porträtiert die Leitfiguren der literarischen Untergrundbewegung der 50er und 60er Jahre in den USA und setzt der Beat-Literatur mit liebevoller, aber keineswegs unkritischer und bisweilen ironischer Reverenz ein sehr persönliches Denkmal.
›Hans-Christian Kirsch hat in seinem spannenden Buch die Biographien der vier Hauptrepräsentanten der Bewegung - Cassady, Kerouac, Ginsberg, Burroughs - so atmosphärisch lebendig nacherzählt, dass man einen präzisen Einblick in Entstehung und Entwicklung einer Kulturrevolte erhält, deren seismische Wellen noch heute unsere Lebensweise beeinflussen.‹
(Die Weltwoche)
›Hans-Christian Kirsch ist den ›beat poets‹ auf ihren langen Reisen durch Amerika gefolgt. Kunstvoll hat er die Lebenswege der vier Schriftsteller zu einer Biographie verschlungen, die nicht nur Literatur-, sondern auch Sozial- und Sittengeschichte eines großen Landes ist, das sich seines Anspruchs von (God’s own country) nur noch so lange sicher sein könnte, bis es mit dem Eingreifen in den Vietnam-Krieg endgültig seine Unschuld verlor.‹
(Die Welt)
›Eine Monographie, die ebenso material- wie kenntnisreich und noch dazu spannend zu lesen ist.‹
(Hans Christoph Buch in der FAZ)
Constantly risking absurdity
and death
whenever he performs
above the heads of his audience
the poet like an acrobat
climbs on rime
to a high wire of his own making
and balancing on eyebeams
above a sea of faces
paces his way
to the other side of day
performing entrechats
and sleight-of-foot tricks
and other high theatrics...
Lawrence Ferlinghetti*
I. BUCH
Die Kinder der großen amerikanischen Wüste
1
Ein Kind der Straße
(1926-1946) Neal Cassady
... and I am waiting
for a rebirth of wonder
and I am waiting for someone
to really discover America
and wail
and I am waiting
for the discovery
of a new symbolic western frontier
and I am waiting
for the American Eagle
to really spread its wings
and straighten up and fly right...
Lawrence Ferlinghetti1
... geboren am 8. Februar 1926 in Salt Lake City auf der Durchreise.
Die Eltern, Neal Cassady sr. und dessen Ehefrau Maude, sind auf der Fahrt nach Kalifornien.
Für Maude ist es die zweite Ehe. Sie stammt von einer Farm in der Nähe von Duluth, Minnesota. Sie war mit dreizehn als Dienstmädchen zu einer wohlhabenden Familie in Sioux City in Iowa geschickt worden. Damals war sie drall und hübsch wie eine gutgeratene Süßkartoffel, aufgeweckt und charmant. Sie hat es verstanden, ihre Arbeitgeber für sich einzunehmen. Sie haben sie behandelt wie ihre eigene Tochter. Maude hat James Kenneth Daly geheiratet, einen wohlhabenden Mann irischer Abstammung, der als Lokalpolitiker Karriere gemacht hatte und 1919 unter dem Motto ›Mit eisernem Besen gegen Bürokraten mit Ärmelschonern und die Stadträte mit den weiten Taschen‹ Bürgermeister wird. James Daly liebte dicksämiges Bier, Hammelbraten und die Entenjagd.
1922, er muss sich demnächst wieder zur Wahl stellen, stirbt er nach einem Schlaganfall, noch nicht ganz vierzig...
In den fünfzehn Jahren Ehe hat er mit Maude acht Kinder gezeugt. Das letzte der Kinder wird geboren, als sein Erzeuger schon unter der Erde ist. Die junge Witwe verträgt sich nicht mit ihrer Schwiegermutter, deswegen zieht sie schließlich um nach Des Moines. Hier lernt sie Neal Cassady kennen, einen Mann Anfang dreißig, Vagabund und Trunkenbold, der des Lebens Höhen und Tiefen gesehen hat. Als sie ihn trifft, ist er kurzfristig wieder einmal obenauf und führt gerade den größten Friseursalon am Ort. Zehn Stühle. Die örtliche Prominenz seift er selbst ein, verpasst ihr eigenhändig einen Fassonschnitt. Zu seinen Kunden gehört ein Golflehrer. Der verschafft ihm Zutritt zum örtlichen Country Club. Dort begegnet Neal Maude. Maude hört gern Musik. Neal sr. führt sie zu den sonntäglichen Platzkonzerten aus. Er macht Maude den Hof, schläft ein paarmal mit ihr.
›Du könntest mich eigentlich heiraten‹, hat sie an einem Sonntagnachmittag lachend gesagt. ›Ich bin nämlich schwanger.‹
›Wird gemacht, Darling.‹
Neal gibt sich als Gentleman.
›Aber ich will auch ein Dach über dem Kopf. Das bin ich meinen Kindern schuldig.‹
Neal kauft einen Ford-Lastwagen und errichtet auf der Ladefläche eine Art Haus.
In diesem Gefährt bricht das Paar, begleitet von den zwei jüngsten Kindern, der fünfjährigen Betty und dem dreijährigen Jimmy, mitten im Winter nach Hollywood auf. Die älteren Kinder bleiben zurück, sich selbst überlassen.
In Salt Lake City bringt Maude das Baby zur Welt. Man hält sich nur so lange in der Stadt auf, bis die Wöchnerin wieder reisefähig ist.
In Hollywood angekommen, kauft das Paar einen Friseursalon. Es dauert nicht lange, und Neal verfällt wieder in seine, alten Gewohnheiten. Er öffnet und schließt den Laden, wann es ihm passt, stromert herum, spielt, schwadroniert, trinkt.
1928 verkauft er das Geschäft für weit weniger, als er seinerzeit dafür bezahlt hat. Er geht nach Denver. Dort lebt ein Bruder von Maude. Der Schwager arbeitet bei der Railway Express Company und findet, Denver sei für seine Schwester und Neal gerade der rechte Ort, um sich niederzulassen.
Ein alter Schuster vermietet für ein Jahr sein kleines Haus an Neal, der in der Schuhmacherwerkstatt zwei Friseurstühle aufstellt.
Die beiden winzigen Hinterzimmer füllen sich. Die Kleinen, Jimmy, Betty und Neal jr., sind von Anfang an dabei. Dann rückt die Brut der Älteren aus Des Moines an: Bill, Ralph, Jack und Mae. Die dreizehnjährige Evelyn hat sich schon selbständig gemacht.
Für neun Personen sind die zwei Räume hinter dem geteilten Ladengeschäft zu klein. Es gibt nicht genügend Betten. Überall liegen Kleider herum. In der Küche muss in zwei Schichten gegessen werden.
Die älteren Jungen sind sich bald darüber im klaren, dass der Stiefvater ein Versager ist. Sie machen sich selbständig.
Bill, der Älteste, zu diesem Zeitpunkt einundzwanzig, heiratet die Witwe eines reichen Mannes. Sie bringt ein Speise- und Tanzlokal außerhalb von Denver mit in die Ehe. Er bildet sich selbst zum Barkeeper aus.
Ralph, der Zweitälteste, ist ein hübscher, aber zu Gewalttätigkeiten neigender Junge. Er ist achtzehn und ist bald für einen Mann tätig, der nur Sam genannt wird und in der Larimer Street in downtown Denver schwarz Schnaps brennt.
Zu Ralphs Aufgaben gehört es unter anderem, die Getränke auszufahren. Einer der besten Kunden der illegalen Destille ist ein gewisser Black Barlow, der im Gebirge eine hübsche Ranch besitzt. Dort wird der sechzehnjährige Jack, eines der Kinder aus Maudes erster Ehe, Wachmann.
Kaum hat sein großer Bruder ihm diesen Job verschafft, kommt es auf der Ranch zu einer Razzia der Bundespolizei. Die Schnapsfahnder nehmen Jack fest und stecken ihn für einige Zeit ins Gefängnis. Kaum ist er wieder in Freiheit, nimmt er seinen Job beim Alkoholschmuggel wieder auf. Jack und Ralph bringen es zu einem neuen Ford und versorgen Bill mit dem schwarzgebrannten Whiskey.
In der Ehe von Maude und Neal sr. kriselt es. Die älteren Söhne verdienen mehr Geld als der Stiefvater. Sie stecken hin und wieder der Mutter etwas zu, aber Neal sr. verachten sie.
Im Sommer 1929 sieht es noch einmal ganz gut aus. Jack und Ralph haben ein neues, ordentliches Haus gekauft. Neal sr. hat Arbeit in einem Friseursalon mit wohlhabender Kundschaft. Er übernimmt nun sogar die Zahlung der monatlich fälligen Hypothekenzinsen. Ralph und Jack verdienen weiter nicht schlecht beim bootlegging. Die beiden Mädchen Mae und Betty gehen in eine ordentliche Schule. Neal jr. ist nun drei Jahre alt.
Dann, im Oktober 1929 wird alles anders. Nach dem großen Börsenkrach hat niemand mehr Geld in Denver. Neal sr. wird arbeitslos. Das Geschäft mit dem Schwarzgebrannten bricht zusammen. In Bills Speise- und Tanzlokal bleiben die Kunden aus. Der Barkeeper und seine Frau ziehen auf einen Autohof.
Neal, Maude und die Kleinen wohnen jetzt in einer Zweizimmerwohnung über einer lärmenden Molkerei. Mae und Betty werden in ein katholisches Waisenhaus gesteckt. Maude ist wieder schwanger. Im Mai 1930 bringt sie ihr zehntes Kind zur Welt, ein Mädchen, Shirley Jean.
Neal sr. findet oft nur am Samstag Arbeit. Auch jetzt noch stecken Jack und Ralph der Mutter hin und wieder ein paar Dollar zu, aber es gibt Tage, an denen nur eine Mahlzeit auf den Tisch kommt. Einen Block weiter liegt eine Kuchenfabrik. Am Sonntag schneidet Neal dort hinter heruntergelassenen Vorhängen den mittleren Angestellten die Haare und wird dafür mit Kuchen bezahlt.
Anfang 1932 ist Neal sr. eigentlich ständig ohne Arbeit; wann immer er einen Cent in die Hände bekommt, gibt er ihn für Alkohol aus. Ein paarmal stiehlt er das Geld, das die großen Jungen der Mutter gegeben haben. Als es herauskommt, verprügeln sie ihn. Maude ist das Zusammenleben mit ihm endgültig leid. Die Eheleute trennen sich.
Die Mutter zieht mit dem neunjährigen Jimmy und dem Baby Shirley ins Snowden, einen Block mit Sozialwohnungen in der Innenstadt. Der große Neal haut ab in die Slums und nimmt den kleinen Neal mit. Bald residieren sie in einem Nachtasyl an der Ecke 16th und Market Street, dem Metropolitan.
Das Gebäude ist vom Einsturz bedroht. Seine Bewohner sind Säufer, Landstreicher, Schwachsinnige und Invaliden, die sich mit Betteln in der Innenstadt durchs Leben schlagen.
Es gibt keine Zimmer, sondern nur Gelasse: zwischen dreißig und vierzig Schlafzellen, die man pro Nacht für zehn oder fünfundzwanzig Cent mietet.
Vater und Sohn hausen in einem der größeren Räume, für die man pro Woche einen Dollar zahlt.
Untervermietet haben sie einen Schlafplatz auf einer Plattform über dem Knie einer Rohrleitung.
Dort haust der Krüppel Shorty, der keine Beine mehr hat, ein erschreckend hässlicher, aber sanftmütiger Mensch. Die Haut ist überkrustet von Schmutz. Das Gesicht hat keine Stirn. Sein Mund zeigt beim Grinsen die Stümpfe schwarz gewordener Zähne. Er hat einen schmalen Körper und überschlanke Arme.
Mit einem Brett auf Rädern, auf dem er sich mit Stöcken abstößt, fährt er jeden Morgen zu seinem Platz vor einem Restaurant in der Larimer Street. Seine täglichen Einnahmen als Bettler reichen gerade hin, um sich etwas zu essen und billigen Fusel zu kaufen. Heimgekehrt in sein Gelass, trinkt er sich in den Schlaf. Sind seine Einnahmen schlecht, masturbiert er. Sein verspritzter Same erinnert den kleinen Neal an auf dem Flur verschüttetes Eiweiß.
Geweckt wird Neal jr. jeden Morgen von dem Schlag der Turmuhr des Kaufhauses Daniels and Fisher.
Während der Vater in dem Bett ohne Laken weiterpennt, taumelt der Junge in den Waschraum, wo sich ein Dutzend Männer duschen und sich über die Plätze vor dem Spiegel streiten.
Kaffee, Brot und Haferflocken, sein Frühstück, erhält der Junge im Haus der Bürgermission, wo man an die zweihundert Obdachlose speist, die dafür zweimal in der Woche am Gottesdienst teilnehmen müssen.
Von der Armenspeisung läuft Neal zur Schule, die etwa eine Meile entfernt liegt. Während die Schulstunden meist ohne besondere Zwischenfälle verlaufen - er besitzt eine rasche Auffassungsgabe, ist an Wissen interessiert und keiner von denen, die die Lehrer auf dem Kieker haben -, ist der Weg in die Schule und wieder heim jedesmal ein Abenteuer. Da gibt es Abkürzungen über die Feuerleitern der Slumgebäude, Spaziergänge über Dächer, durch Zwischenräume, an Spukhäusem vorbei. Gewandtheit, Ausdauer und Willensanstrengung sind dabei erforderlich. Balancieren auf den Randkanten der Bürgersteige. Wassertrinken an einem hohen Brunnen, ohne dass dabei die Schuhe nass werden. Einen alten schmutzigen Tennisball immer in Bewegung halten, und bei all dem sich die Zeit unterwegs so einteilen, dass man auf dem Hinweg auf die Sekunde beim Läuten der Glocke zur Stelle ist.
Er gewöhnt sich daran, draußen ständig zu rennen und nur noch normal zu laufen, wenn er mit einem Erwachsenen unterwegs ist.
Aber am liebsten ist er doch im Metropolitan. Die Insassen des Asyls sind alle nett zu dem Jungen. Sein Auftauchen bedeutet eine Ablenkung, einen Lichtblick in ihrem desillusionierten, trübseligen Leben.
Im Innenhof wird es am Abend lebendig. Die Runde der Glücksspieler versammelt sich. Der kleine Neal kiebitzt mal hier, mal dort, oder er zielt mit seinen aus Stricknadeln selbstgemachten Wurfpfeilen auf die Sprünge im Steinfußboden oder die Sitzflächen leerer Stühle.
Am Samstag arbeitet der Vater am dritten Stuhl in Zazas Friseursalon in der Larimer Street. Es ist dem jungen Neal erlaubt, dort herumzusitzen, den Duft von Talkum und Pomade einzuatmen und in den Illustrierten zu blättern, die für die Kunden ausliegen. Gleich nebenan liegt das schmutzige Zaza-Filmtheater, in dem es ranzig riecht und dessen verbilligte Vorstellungen Neal besucht. Er sieht Western, Tanzfilme mit Fred Astaire und Ginger Rogers, er sieht King Kong und lernt von den älteren Jungen den Reim ›King Kong plays Ping Pong with his Ding Dong‹. Samstag, das bedeutet eine üppige Mahlzeit in einem Schnellimbiss, der für sein schmutziges Besteck berüchtigt ist. Samstag, das bedeutet, dass der Vater sich Fusel kauft und schon angetrunken mit dem Jungen in die Nachtvorstellung des Kinos geht.
Und am Sonntag im Winter gibt es in der Halle des Metropolitan genug zu erleben, aber lass es Frühling werden, dann ziehen Vater und Sohn jeden Feiertag hinunter in das halbverfallene Industrieviertel von Denver. Ihr Weg führt vorbei am Singer-Nähmaschinenwerk, an einem Möbelspeicher, an der Union Train Station und dem ausgedehnten Gleisgelände zwischen der 1st und der 14th Street. Und dann kommen sie an den South Platte River, der sich unter der Brücke aus Eisen und Holz dahinschlängelt. Stundenlang kann Neal jr. dort stehen und flache Steine über die Wasserfläche hinflitzen lassen.
Am Fluss, unter den Brücken, findet der Junge auch allerlei Abfall: Flaschen, für die man ein paar Cent bekommt, Speichen von alten Fahrrädern, rostige Metallteile von aufgegebenen Maschinen, die man beim Altwarenhändler los wird. Einmal findet er dort einen ganzen Stapel alter Tageszeitungen, zweihundert Nummern von einem bestimmten Tag, noch mit Schnur darum.
Mehr noch beschäftigen die Phantasie des Jungen die Szenerien der riesigen, allmählich verfallenden Industriebauten. Beispielsweise das Gebäude der Pride-of-The-Rocky-Getreidemühle mit seinen gewaltigen Kellern und den drei Stockwerken voller Maschinenungetüme, die so eng zusammengerückt stehen, dass die Durchgänge wie Löcher für die Gespenster von Maulwürfen wirken. Noch viele Jahre später wird er sich an die unheimliche Atmosphäre in diesen Industriebauten mit magischer Eindringlichkeit erinnern können:
›...Über den in Unordnung geratenen, teilweise zerbrochenen Maschinenteilen... und über dem gesamten, wie schlafend daliegenden Gebäude lag eine Staubschicht, die sich über ein Dutzend Jahre hin angesammelt hatte. Erschreckenderweise war es toter Staub, und obwohl er knöcheltief war, wirbelte ich weder ein Körnchen davon auf, noch drang etwas davon in meine Schuhe, während ich in meiner bestürzten Traumverlorenheit da herumschlich. Alles war tot, still, keine Bewegung, kein Laut, außer einem einzigen, dem von Hunderten durch die Sonne ihre Energie beziehenden Fliegen, die um mich summten. Ich kam mir vor wie in einem Grab, so isoliert war ich durch die dicken Mauern des von Zügen überratterten Viadukts in der 20. Street, der nur ein paar Yards entfernt lag. Am bedrückendsten aber war vielleicht der Gedanke, dass die Hitze hier bis in den Sommer immer mehr zunehmen würde, bis ihre Schwere so übermächtig wäre, dass es kein Entkommen mehr gab.‹2
In den nächsten Jahren seines Lebens wandert Neal zwischen Vater- und Mutterwelt hin und her. Auch das Snowden ist alles andere als ein ordentliches Haus. Im Metropolitan hausen Vagabunden, im Snowden kleine Gauner. Typen, die mal gesessen haben, Perverse, Prostituierte, Süchtige. Und im Keller haben Ralph und Jack ihr Lager, Freizeit-Mafiosi, die sich der Horde Kinder im Haus für Diebstähle bedienen und die Leute aus der Nachbarschaft nach ihrer Pfeife tanzen lassen.
Noch schlimmere Erfahrungen macht Neal jr. mit Jim. Der Bruder stachelt den Kleinen an, sich zu prügeln, wobei Neal meist den kürzeren zieht. Jim tötet einen Wurf junger Katzen, indem er sie in der Kloschüssel hinunterspült. Oder er heißt Neal auf ein unbebautes Grundstuck mitkommen. Unterwegs fangen sie Katzen ein, die dort der Kleine am Schwanz packen und in die Luft werfen muss, als Zielscheibe für Jims Schüsse.
Und dann ist da das Geheimnis des Wandbettes. Ein Bett, das aus einem Holzgestell besteht, das man im Mittelteil eines Schrankes verschwinden lassen kann. Jim empfindet eine teuflische Freude daran, den Kleinen darauf festzubinden und ihn gegen die Wand zu kippen. Dreißig Zentimeter Zwischenraum bleiben. Ein Grab. Der Geruch von Kalk; verschwitztem Bettzeug. Die Dunkelheit. Bis zu einer Stunde lässt Jim ihn in diesem Gefängnis, und wehe, Neal würde versuchen, sich zu befreien oder mit einem Klagelaut die Mutter auf sich aufmerksam zu machen. Das würde ihm hinterher nur eine Tracht Prügel von Jim eintragen. Also sitzt er seine Zeit in dem Wandgefängnis eingeschüchtert und geduldig ab. Manchmal wird ihm schwindlig, alles dreht sich, bis er einem schönen Nichts entgegentreibt. Er lernt, diesen Zustand bewusst herbeizuführen, indem er über längere Zeit den Atem anhält. Einen Augenblick zu lange, und er wäre hinüber. Aber das ist gerade der Spaß dabei. Hilflos zu sein und dabei doch Macht zu haben über Leben und Tod. Da ist Neal sieben, acht Jahre alt. Die Eltern haben sich darauf verständigt: Während der Schulzeit soll der Junge bei der Mutter bleiben und nur die neunzig Tage im Sommer beim Vater sein.
In den Sommerferien nimmt ihn Neal sr. zu einer seiner Tausend-Meilen-Sausen durch den Westen mit, nach Nebraska, bis nach Kalifornien. Immer wieder erlebt der Junge Augenblicke panischer Angst. So, als Vater und Sohn wieder einmal auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit auf dem Gleisfeld- eines Rangierbahnhofes herumlaufen. Eine Lokomotive taucht vor ihnen auf, und der Alte hat den einen Fuß in einer Weiche eingeklemmt; Um nicht überrollt zu werden, bleibt ihm schließlich nichts anderes übrig, als den Schuh zu opfern, und an einem Fuß nur noch den Strumpf, davonzuhumpeln.
Der Vater will sich in San Jose, Kalifornien, als Gelegenheitsarbeiter für die Pflaumen- und Aprikosenemte anwerben lassen. Er wird abgewiesen, weil er ein Kind bei sich hat.
›Ein hässlicher Italiener um die fünfzig, in schmierigen Hosen, schmutzigem Unterhemd und abgetretenen, fettbespritzten Schuhen (in der Hitze war das alles, was er trug, denn er besorgte das Braten in seiner Grillbar selbst), tippte Vater leicht an und teilte ihm mit, dass er von unserer Notlage gehört habe. Er erbot sich, so lange für mich zu sorgen, wie Papa brauchte, um ein Sümmchen zusammenzubringen. Vater war von einer solchen günstigen Lösung sehr entzückt und ganz dafür, aber ich sträubte mich auf das heftigste, trotz wortreicher Bitten und Beruhigungen mit begleitendem Klaps auf Kopf und Schultern, während der verzweifelte Vater stärker zu einer Entscheidung drängte, weil er sah, dass die Arbeitsabteilung schon zum Abmarsch bereit war - der angehende Samariter meinte, er würde uns zu seiner Taverne auf der anderen Straßenseite begleiten, und dort begann ich, als ich unter den Blicken fremder Leute zu einer Brauselimonade genötigt wurde, zu schwanken. Danach war es für sie leicht, also aßen Papa und ich ein paar eilige Bissen einer tränenverschwommenen Mahlzeit miteinander, gratis, wobei der Gastgeber, mein neuer Papa, mit Lächeln und Segenssprüchen um uns herumschwebte, dann bestieg Papa den Lastwagen mit der Männerfracht, und mit einem schwachen Winken seiner Hand hatte ich ihn für einen Monat verloren.‹3
Zwar hat der Junge Sehnsucht nach seinem Vater, aber Sehnsucht und Freude über das Leben wie auf einem Schloss aus einem Film schließen einander nicht aus. Der Adoptivvater fährt zudem einen funkelnagelneuen Cadillac V-16, und als Neal zum ersten Mal neben ihm Platz nehmen darf, entzündet sich seine lebenslange Begeisterung für Automobile.
Im Haus des Italieners gibt es eine den Jungen verhätschelnde Haushälterin, die schmackhafte, Neal nach dem Hobo-Leben geradezu üppig erscheinende Mahlzeiten auf den Tisch bringt.
Sein Bett kommt ihm enorm groß und ›zu weich und sauber, um wahr zu sein‹, vor.
Er wird einer bettlägrigen Frau mittleren Alters vorgeführt.
Offenbar hat ihn der Grillbarbesitzer tatsächlich aus keinem anderen Grund als dem mitgenommen, dass er kinderlieb ist. Aber Neal jr. verlässt nie die Angst, der Wohltäter plane seinen Tod. Als der Vater endlich wieder auftaucht, eröffnet der Italiener ihnen, er wolle Neal jr. adoptieren, ihn aufs College schicken und ihn zu seinem Erben einsetzen.
Als erwachsener Mann wird sich Neal nicht mehr daran erinnern können, was seinen Vater veranlasste, dieses Angebot auszuschlagen: Vielleicht wollte er einfach der Gesellschaft seines Sohnes nicht verlustig gehen. Der Italiener schenkt dem Jungen zum Abschied einen echten Degen mit juwelenbesetztem Griff. ›Der wunderliche Gegenstand wird ihm im folgenden Jahr von einem Vagabunden gestohlen, der ihn versetzt, um sich Alkohol zu kaufen.
Auf die Wochen bei dem wohlhabenden Italiener folgt eine Zeit mit einer verwitweten Wanderarbeiterin aus Oklahoma, die der Vater beim Obstpflücken kennengelernt und in die er sich verliebt hat; Das Paar nimmt eine Mietwohnung in Los Angeles. Die Frau hat einen Sohn in Neals Alter. In Erinnerung bleibt Neal, wie er mit dem gleichaltrigen Jungen auf einem Hügel sitzt, von dem aus sie auf die kilometerlangen Lichterreihen der Stadt unter sich hinschauen. Sie unterhalten sich über die ›jeweiligen tödlichen Vorzüge meines schönen neuen Messers und seines rostigen, aber echten 32er Revolvers (einziges Andenken, das ihm von einem unbekannten Vater hinterlassen worden war), und wie hitzig unsere Streitigkeiten auch wurden; als jeder von uns die springenden Punkte unserer Waffen anführte - meine Stärke war die Lautlosigkeit des Messers...‹4
Der Aufenthalt 1933 in Kalifornien dehnt sich dann noch bis kurz vor Weihnachten hin aus. Neal sr. hat sich entschlossen, diesmal nicht als Hobo zu reisen. Er gibt eine Armutserklärung ab und beantragt Reisehilfe. Neal geht unterdessen in Los Angeles auch zur Schule, in eine Schule, in der jeder Tag mit einem Treueid auf die Fahne beginnt und sich im Flirt mit einer bewunderten Mitschülerin herausstellt, dass er farbenblind ist.
Seine ersten sexuellen Erfahrungen sammelt Neal, als er neun oder zehn Jahre alt ist. Doktorspiele mit einem um ein paar Jahre älteren Mädchen im Snowden. Von der Feuerleiter aus beobachtet er, wie eine Amateurprostituierte ihren Kunden empfängt und ihn abfertigt. Dann ist er wieder beim Vater. Eines Abends nimmt Neal sr. den Jungen zu einem seiner Saufkumpane mit, einem schwachsinnigen Deutschen, der mit einem Stall voller Kinder in einer Scheune auf dem Land haust. Spät in der Nacht entwickelt sich ein munteres Treiben. Während der Familienvater sich bewusstlos betrunken hat und wie tot daliegt, klettert Neal sr. mit der Hausfrau ins Heu. Die älteren Jungen fallen über ihre kleinen Schwestern her. Zuerst fürchtet Neal jr., sie würden die Mädchen umbringen, aber dann kommt es ihm so vor, als ob die sogar Spaß an dem hätten, was sich bei diesem Ringkampf nackter Leiber unter Gekicher und Gestöhn abspielt. Gegen Morgen wird es dann ernst. Der Ehemann ist wieder bei Sinnen und überrascht Neal sr. mit seiner Frau beim Beischlaf. Die beiden Männer prügeln sich. Vater und Sohn machen sich hastig davon. ›Spielverderber, murmelt Neal sr.‹
Sein erstes Auto stiehlt Neal jr. - da ist er vierzehn. Im Lauf der nächsten vier Jahre wird er an die fünfhundert Wagen entwenden, mit ihnen eine Spritztour machen und Mädchen oder Jungen, die er mitgenommen hat, auf dem Rücksitz vögeln. Manche Wagen fährt er zu Schrott und lässt sie am Straßenrand stehen, andere bringt er wieder dorthin zurück, wo er sie gestohlen hat. Immer wieder wird er von der Polizei geschnappt und vorübergehend ins Arbeitslager oder Jugendgefängnis eingewiesen. Das kann ihn nicht zähmen. Sex ist für ihn längst zu einem im Kampf ums Überleben verwendbaren Tauschobjekt geworden. Er vögelt das schwachsinnig-gutmütige Dienstmädchen reicher Leute, die in die Ferien gefahren sind, und handelt sich dafür jeden Tag zwei warme Mahlzeiten ein.
Neal ist ein Gauner, aber seine Gaunereien zeugen von kreativer Phantasie, sind so ungewöhnlich in einem Land, in dem auch noch die Halb- und Unterwelt eisern bemüht ist, gewissen Normen zu entsprechen, dass er immer wieder Erfolg damit haben wird, weil die Menschen von ihm beeindruckt sind.
Mit fünfzehn betritt er in Baumwollhosen, Turnschuhen ohne Strümpfe und in einem khakifarbenen Armeehemd einen Billardsalon im Stadtzentrum von Denver, um den ersten einer langen Reihe eindrucksvoller Bauernfängertricks zu landen.
Über mehr als zwei Wochen hat er in den Salon immer wieder hereingeschaut. Er hat sich dort umgesehen und den besten Spieler seines Alters ausgespäht. Der junge Bursche heißt Jim Holmes. In einer Ansprache, die einem Flibustier im Senat in Washington zur Ehre gereichen würde, macht er dem Billard-Virtuosen einen Vorschlag: Holmes soll ihn all seine Tricks lehren, er wird ihn dafür in Literatur und Philosophie unterrichten. ›Ich kann dir die Handlung aller Shakespeare-Komödien erzählen... oder möchtest du die Sonette hören... Nietzsche? Ich könnte dir erklären, was der verrückte Deutsche gedacht hat. Soll ich? Jetzt sag nur nicht: Das interessiert mich nicht. Es ist scharf, Mann. Irre scharf.‹ Am nächsten Tag spielt tausend Meilen von Denver entfernt ein berühmtes Football-Team. Neal verspricht, als Dreingabe Holmes und seine Freunde die gesamte Strecke hin und zurück zu chauffieren, wenn Holmes für das Benzin aufkommt.
Heller Wahnsinn. Lodernde Lebendigkeit. Die schöne Gewalttätigkeit und Intensität eines Wildfeuers. Später wird Holmes sagen: ›Es ist schwierig, jemandem eine Vorstellung von Neal zu vermitteln! Man trifft nicht häufig solche Leute. Wann begegnet man schon jemandem, der sich so völlig aussetzt.‹ Jim Holmes erzählt später auch:
›Er steckte voller Energie, ein gutaussehender Mann mit einem starken Körper, ehe er ihn zerstörte. Er konnte nächtelang ohne Schlaf auskommen... was ihm gefiel, war, ständig etwas zu tun, in Bewegung zu sein. Er lebte immer voll und ganz in der Gegenwart, in diesem bestimmten Augenblick.‹5
Holmes kommt ihm hinter seine Tricks: ›Gleichgültig, was der Betreffende tat, oder wer er war, Neal ging jeden auf die gleiche Art an. Zum Beispiel, wenn du ein junges Mädchen warst, das aufs College wollte, sagte er sofort: Nun, das ist ja großartig. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Es war eine Technik. Er war nicht eigentlich ein Betrüger. Er respektierte das Individuum. Und es begann immer mit ganz trivialen Dingen. Wenn du einen Plattenspieler daheim hattest, sagte er: Würde es dir was ausmachen, mich mit zu dir heim zu nehmen. Ich besitze keinen Plattenspieler. Ich hatte mal einen vor einem Jahr. Ich würde so gern mal wieder Coleman Hawkins hören: Neal hatte eine Art zu reden, mit der er Menschen einfach um den Finger wickeln konnte. Es besaß eine natürliche Begabung, andere auf sich zu fixieren. Ziemlich einzigartig.‹6
Auch Jim Holmes erliegt dieser Faszination. Er nimmt Neal mit heim, gibt ihm etwas zu essen, schenkt ihm einen braunen Tweedanzug und bringt ihm bei, wie man beim Kartenspiel betrügt. Außerdem findet Neal bei Holmes für die nächsten Jahre eine Bleibe.
Aber es gibt nun schon mindestens zwei Neals, den selbstsicheren, dreisten, wild-lebendigen und den verstörten, von Alpträumen heimgesuchten.
Zwischen seinen Auszeiten im Loch wieder einmal auf freiem Fuß, hat Neal einen fürchterlichen Traum. Er sieht sich darin nicht länger jung, sondern als ein Mann um die vierzig, in einem zerrissenen T-Shirt und Bierbauch, spärlichem Haar, aufgedunsenem Gesicht. Es fehlen ihm schon ein paar Zähne. Er betritt ein Pfandhaus, um dort eine Matratze für Schnapsgeld zu versetzen. Plötzlich wird er von seinem Vater verfolgt. Der trägt die übliche alte schwarze Baseballmütze und hat, ganz untypisch, eine eindrucksvolle Erektion. Neal sr. verlangt seinen Anteil aus dem Matratzengeschäft und verfolgt seinen Sohn, bis dieser mit Magenschmerzen aus seinem Traum erwacht.
Neal nimmt sich vor, sein Leben zu ändern. Das Reformprogramm, das er aufstellt, sieht vor: Morgens um sieben aufstehen. Danach Putzmann im Zaza-Friseursalon. Ausfegen. Den verstopften Abfluss von Haaren reinigen. Um acht eine Tour Zeitung austragen. Um neun irgendwo ein Frühstück schnorren. ›Süße, dein Honig ist immer noch der beste weit und breit.‹ Mit einer Zuckerschnute: ›Welchen Honig meinst du, den auf dem Tisch oder den aus meinem Spalt?‹ Er leckt genüsslich die beiden Finger ab, mit denen er eben noch in ihr herum gegraben hat.
›Klar doch, der aus deinem Spalt... der beste Honig östlich der Rockies.‹
Um zehn in der Public Library Schopenhauer lesen. Um elf Wagen waschen in der Rocky-Mountain-Garage. Zu Mittag mit dem Fahrrad zum Lunch zu Freunden. Dafür muss er den Abwasch erledigen. Dann wieder in die Bücherei. Ab vier in den Billardsalon (zwecks Entspannung), um elf noch einen Zeitungsstand nach ein paar Münzen filzen und an einem Straßenstand zwei Tacos mit Chilisauce erstehen. Geschlafen wird bei der mitleidigen Schwachsinnigen.
Am Morgen klingelt es, draußen hat sich ein Mann aufgebaut ... in einem Anzug, wie ihn Manager aus den höheren Etagen tragen. Neal steht da - nackt. Er fragte mürrisch-skeptisch: ›Was wollen Sie denn hier?‹ Der Mann hebt einen Schlüsselbund: ›Tut mir leid. Die Wohnung gehört leider mir.‹
Auch eine Art, sich kennenzulernen. Der Mann in dem dunklen Anzug ist ein Hochschullehrer, zur Aufbesserung seiner Bezüge auch als Wohnungsmakler tätig.
Für diesen Justin B. Mannerly ist Neal Cassady ein exotischer Schmetterling, den er sich gern mal unter dem Vergrößerungsglas betrachten möchte, denn diese Spezies steht in keinem Bestimmungsbuch. Was ihn neugierig werden lässt ist eine merkwürdige Eigenart dieser Spezies: der Junge hat einen Bildungseifer, wie ihn Mannerly sich für manchen seiner Studenten wünschen würde. Und Neal merkt sich den Namen eines ehemaligen Schülers Mannerlys, der in New York an der Columbia University studiert. Der Name lautet Hal Chase. Bald ist der seltene Schmetterling wieder davon geflattert. In eine Reformschule, auf eine Straffarm. Das übliche Delikt: Autodiebstahl. Anfang 1945 kommt Neal wieder auf freien Fuß. Er betritt mit dem Mädchen, das ihn zu dieser Zeit aushält, Walgreen’s Drugstore in Denver. Er sieht eine süße, etwas töricht dreinblickende Blondine. Das Honigtopflächeln. Er sagt zu seiner Begleiterin: ›Dieses Mädchen werde ich heiraten.‹ Das Mädchen heißt LuAnne und ist fünfzehn, er ist jetzt neunzehn. Fünf Monate später sind sie tatsächlich verheiratet. LuAnne entzieht sich durch die Eheschließung den Nachstellungen ihres Stiefvaters. LuAnne und Neal laufen aus Denver davon. Sie trampen nach Nebraska, wo LuAnne eine Anstellung als Dienstmädchen bei einem blinden Rechtsanwalt findet und Neal einen Job als Tellerwäscher annimmt. Sie leben in einem winzigen Zimmer, für das sie im Monat zwölf Dollar Miete zahlen. In der Nacht findet Neal häufig keinen Schlaf. Dann zitiert er Shakespeare oder liest seiner jungen Frau Proust vor.
›Und nun, Schatz, möchte ich, dass du mir so genau wie möglich die Wirkung dieser Sätze auf deinen Gefühlszustand beschreibst...!‹
Schließlich siedelt das Paar nach Sidney in Nebraska über, wo LuAnne für eine Tante arbeitet, aber sich bald von der alten Frau ausgenützt fühlt.
Mitte 1946 beschließt Neal, er habe nun vom Mittelwesten entschieden genug gesehen. LuAnne stiehlt ihrer Tante hundert Dollar. Neal schließt den Wagen des Onkels kurz.
Sie nehmen sich vor, auf der Ranch eines Freundes in Sterling, Colorado, Station zu machen. Aber dann erfasst Neal der Reiserausch. Sie fahren durch ein Unwetter. Er bindet sich ein Taschentuch über die Augen, um sich so gegen die sichtbehindernden Hagelschauer zu schützen, lehnt sich aus dem Seitenfenster. Nach einer Weile wendet er sich kurz um und schreit LuAnne zu: ›Ich seh jetzt klar. Wir fahren durch bis nach New York, Schatz! Hab die Adressen von Hal Chase und Ed White. Und, verstehst du: Sie werden uns mit so herrlich poetischen Menschen wie diesem Allen Ginsberg und Jack Kerouac bekannt machen. Yiiippee!‹
2
Die langen Schatten des Wahnsinns
(1926-1944) Allen Ginsberg
... City of horrors,
New York much like hell.
Allen Ginsberg1
... geboren am 3. Juni 1926 im Beth Israel Hospital in Newark im Staate New Jersey. Der Vater, Louis Ginsberg, ist Sohn jüdischer Einwanderer aus Lwow (Lemberg) in Galizien, die 1880 nach Newark kamen, wo sie Verwandte hatten. In Amerika angekommen, kauft sich Aliens Großvater Pferd und Wagen und beginnt eine Wäscherei zu betreiben; Er heiratet Rebecca Schechtman, deren Eltern 1870 aus der Ukraine in die Vereinigten Staaten eingewandert sind.
Während Louis von klein auf Sozialist ist - als Kind hat ihn sein Vater zu den Vorträgen von Eugene Victor Debs, dem Gründer der IWW (Industrial Workers of the World) mitgenommen -, ist seine Frau Naomi Kommunistin. Naomi stammt ebenfalls aus einer jüdischen Familie. Ihr Vater Mendel Livergang - sein Name wird bei seiner Einreise in die USA in Morris Levy abgeändert - hat sich in Russland der Einberufung zum Militär dadurch entzogen, dass er aus seinem Heimatdorf in die Großstadt Witebsk übersiedelt ist, in der damals die Juden ein Drittel der gesamten Bevölkerung ausmachten. Während die Juden im Süden eher einem sozialistisch getönten Zionismus zuneigten, wurde die Judenschaft von Witebsk durch Einflüsse aus dem Deutschen Kaiserreich marxistisch. 1905 war es in der Stadt, in der als junger Mann auch der Maler Marc Chagall gelebt hat, zu einem Pogrom gekommen. Mendel hatte sich daraufhin entschlossen, mit seiner Familie nach Amerika auszuwandern. Dort ließ, er sich in der Orchard Street, in einem alten jüdischen Viertel von Manhattan, nieder und eröffnete einen Laden, in dem man Eiscreme und süßes Gebäck kaufen konnte. Später zog die Familie Naomis aus den Slums der Lower Eastside nach Newark. Noch auf der High-School mit siebzehn begegnete Naomi ihrem späteren Mann, der wie sie selbst auch Lehrer werden wollte.
Von Anfang an gibt es zwischen Louis’ Familie und Naomi Konflikte, bei denen die unterschiedlichen politischen Ansichten zumindest das auslösende Moment sind. Naomi ist inzwischen in die Kommunistische Partei eingetreten. Die Sozialisten befürworten einen Kriegseintritt der USA, die Kommunisten sind dagegen.
1918 stirbt Naomis Mutter Judith, als Opfer der Grippeepidemie, die damals von Europa nach Amerika übergreift. Naomi erleidet einen Nervenzusammenbruch. Sie ist überempfindlich gegen Licht und muss drei Wochen in einem abgedunkelten Raum liegen, ehe sie ihre Tätigkeit an einer Schule für geistig behinderte Kinder wieder aufnehmen kann.
Louis und Naomi beschließen, trotz Widerstands der Eltern des Bräutigams zu heiraten. 1919, nach ihrer Eheschließung, ziehen sie nach Newark. Das junge Paar gibt sich betont fortschrittlich. Louis schreibt Gedichte, und es gelingt ihm, seine ersten Verse zu veröffentlichen. Zusammen mit seiner Frau tritt er der Poetry Society of America bei.
1921 wird ein Sohn geboren, der den Namen Eugene erhält, 1926 ein zweiter, Allen. Der Vorname ist von dem seines Urgroßvaters abgeleitet, der S’rul Avrum hieß.
1929 muss sich Naomi einer Operation an der Bauchspeicheldrüse unterziehen. Abermals hat sie einen Nervenzusammenbruch und kommt vorübergehend in ein Sanatorium. Louis übersiedelt zunächst ohne seine Frau nach Paterson in New Jersey, wo er eine Stellung als Englischlehrer annimmt. Die Ginsbergs wohnen in einem heruntergekommenen jüdischen Viertel. Vor dem Haus kreuzt eine Eisenbahnlinie die Straße, auf der anderen Seite des Schienenstrangs steht das Backsteingebäude einer Seidenfabrik.
Allen, der auf der Straße im Sand Murmeln spielt, fürchtet sich vor Geistern. Als er in die Schule kommt, ist die Mutter immer noch im Sanatorium. Am ersten Schultag macht das Kind ein solches Geschrei, dass man den Vater rufen muss, der es mit heimnimmt. Es ist nicht leicht für Louis, neben seiner Tätigkeit als Lehrer auch noch für die beiden kleinen Jungen zu sorgen.
Den Sommer verbringen Eugene und Allen mit Naomi in einem Ferienlager der Kommunistischen Partei bei Monroe Lake im Staat New York, einem paradiesischen Ort für Stadtkinder, die hier draußen nackt in den Wiesen herumtollen und in den Bächen Fische fangen.
Louis, der seine Frau und die Kinder jeweils am Wochenende besuchen kommt, ist unangenehm berührt von den Propagandamalereien im Speisesaal, auf denen die Kapitalisten mit bluttropfenden Händen dargestellt werden. Weil es aber Naomi und den Kindern in der ländlichen Umgebung so gut gefällt, erhebt Louis keine Einwände, als seine Frau auch im zweiten Jahr mit ihren beiden Söhnen in dieses Lager fährt.
Nach Ende der Ferien stürzt sich Naomi mit einem Eifer, der nichts Gutes vermuten lässt, in die Parteiarbeit und wird vorübergehend sogar Sekretärin des Ortsvereins. Louis muss deswegen um seine Anstellung als Lehrer fürchten; Zu Parteiversammlungen nimmt Naomi häufig ihre beiden Söhne mit.
Das erste Lied, das Allen lernt, ist das Kampflied der amerikanischen Kommunisten The Red Flag. Er selbst hat die Atmosphäre dieser Zeit in einem Gedicht mit dem Titel ›Amerika‹ so beschrieben: ›... als ich sieben war nahm mich meine Mama mit zu den Versammlungen der Kommunistischen Zelle sie verkauften uns Garbanzos, für jedes Ticket bekam man eine Handvoll, der Eintritt kostete fünf Cents und die Reden gabs umsonst. Alle waren engelhaft und hatten ein Herz für die Arbeiter. Es war alles war so aufrichtig. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für eine gute Sache die Partei 1935 war. Scott Nearing war ein großer alter Mann ein richtiger Mensch. Mother Bloor rührte mich zu Tränen einmal sah ich den Israel Amter ganz aus der Nähe. Das müssen wohl alles Spione gewesen sein.‹2
1934 ziehen die Ginsbergs wieder einmal um. In der Haledon Avenue mieten sie nun ein ganzes Haus. Die beiden Brüder schlafen in einem Bett. Wenn Allen sich bei Gene ankuscheln will, gefällt das dem Bruder nicht.
In der Nacht wacht Allen manchmal plötzlich von Straßengeräuschen auf und versucht, sich die riesigen Entfernungen von der Erde zu den Sternen vorzustellen.
Er hat Tagträume, ist in Earl, den blondhaarigen Anführer einer Jungenbande, verliebt, steht manchmal vor dessen Haus. Er denkt sich aus, wie herrlich es wäre, eine Zauberformel zu kennen. Er wünscht sich Dollars, ein weißes Pferd, ein Schloss mit einem Kerker: ›Ich inspiziere meine nackten Opfer/gefesselt und verkehrt herum aufgehängt/meine Fingerspitzen fordern Zustimmung an ihren Hüften/während ich ihre unbehaarten Wangen küssen kann, soviel ich will... ich gehe mit meinen starken Wächtern vorbei, gebeugt/den Hintern herausgestreckt, damit sie mir zustimmend draufklatschen.‹3 Häufig hat er solche Unterwerfungsphantasien.
In der Familie gibt es jetzt immer öfter Streit. Die Schwiegereltern machen Naomi dafür verantwortlich, dass ihr Sohn Schulden hat. Naomis Misstrauen gegen ihre Schwiegermutter wächst.
Naomi läuft daheim nackt durch die Wohnung. Louis ist nicht prüde, aber dieses Bedürfnis bei ihr wird immer mehr zu einem neurotischen Exhibitionismus, der auch die Kinder verschreckt.
Immer deutlicher zeichnen sich bei ihr Symptome einer paranoiden Schizophrenie ab. Sie hört Stimmen, macht überspannte Bemerkungen, reagiert übertrieben misstrauisch.
Bald muss sie wieder in eine Anstalt. Louis’ Geldmittel sind erschöpft, deswegen kommt diesmal ein Privatsanatorium nicht in Frage. Louis lässt sie in das Staatliche Krankenhaus Greystone in New Jersey einweisen.
Greystone ist ein riesiger Bau, eine Kaserne, anonym, unheimlich. Die dort bei Geisteskrankheiten angewandte Therapie besteht in der Verabreichung von Insulin und in Elektroschocks. Vierzigmal wird Naomi Stromstößen ausgesetzt, die ihre Phantasien dämpfen, aber sie gleichzeitig zutiefst verängstigen.
Im Vertrauen auf die Sachkenntnis der Ärzte lässt Louis die Behandlung seiner Frau mit Elektroschocks weiter zu. Erst 1936 kehrt Naomi wieder zu der Familie heim.
Allen trägt jetzt eine Brille mit dicken Gläsern und eine Zahnspange. Ein hässlicher Junge - weich, schwammig, unbeholfen. Sein Lieblingsschriftsteller ist Edgar Allan Poe, sein Lieblingsbuch Dr. Doolittle. Als sein Motto gibt das Jahrgangsbuch der Schule an: ›Tu, was du willst, wenn du es willst.‹4 Sein Freund Morton vertraut ihm an, wenn er in der Schule Mädchen sähe, würde er sich am liebsten auf sie stürzen. Ob auch Allen solche Wünsche überkämen? Nein, solche Empfindungen sind Allen fremd.
Im Haus von Mortons Eltern gehen vier Jungen ins Badezimmer. Allen ist auch mit dabei. Morton setzt sich auf die Toilette, einer der Jungen kniet sich vor ihn hin und küsst Mortons Penis.
1937, Allen ist jetzt elf, verdüstert sich die Atmosphäre daheim immer mehr. Naomi hat erneut einen Schub. Sie beschuldigt ihre Schwiegermutter, ihr ständig nachzuspionieren; das Geld für ihren Aufenthalt in der Anstalt habe Louis in Wahrheit seiner Mutter gegeben.
Wenn Louis auf solche Anschuldigungen nicht reagiert, macht Naomi dunkle Anspielungen auf eine Liebesaffäre mit einem anderen Mann in den ersten Jahren ihrer Ehe. Häufig schwänzt Allen die Schule, um daheim auf seine Mutter aufzupassen.
Eines Nachts schließt Naomi sich im Badezimmer ein und weigert sich herauszukommen. Louis Ginsberg muss die Tür aufbrechen. Drinnen steht seine Frau, starr und mit entgeistertem Blick. Das Blut rinnt ihr von beiden Handgelenken. Die Kinder warten im Nachthemd zitternd im Flur. Schließlich ruft der Jüngere: ›Mama verliert ihr Blut. Mama muss sterben.‹ Louis schließt die Tür. Seine Geduld mit der Kranken ist bewunderungswürdig.
Die erstaunliche Toleranz gegenüber Wahnsinn und Abweichungen von der Norm, die Allen Ginsberg zeit seines Lebens an den Tag legen wird - hier dürfte sie ihre Wurzeln haben.
Im Herbst 1939: Die Deutschen fallen in Polen ein. Naomi ist über drei Jahre in Greystone interniert gewesen. Noch einmal holt Louis sie heim. Sie ist desorientiert, verkriecht sich ins Schlafzimmer. Allen geht zu ihr. Ein Augenblick, der die ganze Misere verrät: ›Sie ging ins Schlafzimmer, um sich aufs Bett zu legen, zu grübeln, zu schlafen, sich zu verstecken - Ich leg mich zu ihr, um sie nicht allein zu lassen - leg mich auf das Bett neben sie - die Jalousien sind heruntergelassen, dämmrig, später Nachmittag - Louis im Vorderzimmer am Schreibtisch, wartet - vielleicht drauf, dass das Hühnchen zum Abendessen kocht.
»Hab keine Angst vor mir, weil ich aus der Irrenanstalt zurückkomme - ich bin deine Mutter -«
Arme Liebe, verloren - eine Furcht - ich liege da. Hab gesagt: »Ich lieb dich, Naomi« - steif, neben ihrem Arm. Ich hätte weinen können.‹5
Die politischen Streitigkeiten zwischen den Eltern leben wieder auf.
Naomi verteidigt den Überfall der Sowjetunion auf Finnland. Louis kann auch nicht immer den Mund halten.
Allen geht inzwischen auf die High-School, bekommt gute Noten in Englisch, arbeitet an der Schülerzeitung mit. Er debattiert über Hitler, denkt auf dem Heimweg von einer Theatervorstellung, von den merkwürdigen Mustern der Hecken und geheimnisvollen Schatten befremdet, über die Ausdehnung des Universums nach... vielleicht, dass das Ende Mauern aus Gummi sind. Aber wie kann das das Ende sein? Jenseits der Gummiwand ist doch wohl auch noch etwas?
Sich selbst sieht er so: ›Starke Brille und ein dünnes Gesicht mit vorstehenden Zähnen, geht zum Zahnarzt, um sie richten zu lassen. Eine Art mentaler Ghoul, völlig losgelöst vom Kontakt mit der Wirklichkeit, existierte er in einer Welt der Zeitungen und der Ästhetik: Beethoven, Leadbelly, Ma Rainey und Bessie Smith.‹6 Er schreibt Gedichte, getraut sich sogar, sie in der Klasse vorzulesen. Seine Englischlehrerin macht ihn mit der Lyrik Walt Whitmans bekannt. Der langschwingende Rhythmus in den Zeilen dieser Verse, die Aufforderung zum Ungehorsam, die Rebellion gegen von den Mächtigen geforderte Anpassung, die hymnische Begeisterung über die Magie der Wirklichkeit rühren ihn an. So denkt, so atmet auch er. Whitman definiert seine politischen Ideale.
Im Winter 1941 wird Naomis Zustand wieder bedenklich. Gibt es Suppe zu den Mahlzeiten, behauptet sie, ihre Schwiegermutter habe Gift hineingeschüttet. Es überkommen sie rätselhafte Anfälle, ein Versagen verschiedenster Körperfunktionen... Bilder, die sich Allen unvergesslich einprägen.
›Eines Nachts, plötzlicher Anfall - ihre Geräusche im Badezimmer - wie ein Krächzen ihrer Seele - Auswurf und rote Kotze kommt ihr aus dem Mund - wässriger Durchfall explodiert aus ihrem Hintern - auf allen vieren vor der Toilette - Urin läuft zwischen ihren Beinen davon...‹7
Wenn Allen von der Schule wegbleibt, um bei ihr zu wachen, erzählt sie ihm ihre Angstphantasien: Allein Buba, der Schwiegermutter, ist es zuzuschreiben, dass man ihr in Greystone vierzig Elektroschocks verabreicht hat.
In der Zimmerdecke sind Drähte eingebaut. Jedes Wort, das sie ausspricht, wird von Präsident Roosevelt persönlich abgehört. Allen holt einen Besenstiel und klopft damit die Zimmerdecke ab, um seiner Mutter zu beweisen, dass da nichts ist. Doch, beharrte sie. Sie hört sie doch reden. Sie geben ihr Namen, heißen sie eine Hure, befehlen dem Agenten, sie zu töten.
Dann springt sie auf und rennt zum Fenster. Die Stimmen haben ihr gesagt, dass der Agent unten auf der Straße steht.
Allen tritt hinter ihr ans Fenster. Es ist ihr zuzutrauen, dass sie sich hinabstürzt.. An einer Bushaltestelle warten ein paar Leute. Der eine Mann sieht aus wie ein Bankangestellter, er trägt einen eleganten Hut. Das ist er, ruft Naomi. Sie öffnet das Fenster, schreit: Fort mit dir, du Mistkerl.
Dann plötzlich erklärt sie, sie sei so müde, brauche Ruhe, müsse sich erholen.
Allen muss den Hausarzt anrufen, den sie anfleht, sie in eine Klinik in Lakewood einzuliefem. Erstaunlicherweise stimmt der Arzt ihrem Ansinnen zu.
Naomi packt einen Koffer, weigert sich, den Lift zu benutzen, weil sie fürchtet, der Fahrstuhlführer könne ihr Weggehen den Spitzeln melden.
Auf der Straße hält sie sich den hochgestellten Kragen ihres Mantels vor den Mund, um sich so gegen die von ihrer Schwiegermutter ausgestreuten Bazillen zu schützen.
Naomi und der fünfzehnjährige Allen sprechen in mehreren Sanatorien vor. Sie werden aber überall abgewiesen.
Endlich gelingt es Allen, die Aufnahme der Mutter durchzusetzen. Man führt sie in ein Zimmer unter dem Dach. Allen raunt der Mutter zu, sie solle sich still verhalten. Hier sei sie in Sicherheit. Er werde jetzt heimfahren, um Louis zu verständigen.
Nein, ruft sie, Louis dürfe nichts erfahren. Er werde sonst sofort Spione ausschicken, um sie überwachen zu lassen. Er werde sie vergiften. Der einzige Grund, warum er sie überhaupt am Leben gelassen habe, sei der, dass er sie früher geliebt habe. Ginge es nach seiner Mutter, sei sie schon längst tot.
Als Allen sie einigermaßen beruhigt hat, tritt er die lange Rückfahrt nach Paterson an.
Daheim wartete der Vater schon verängstigt. Um zwei Uhr nachts kommt ein Telefonanruf. Naomi ist barfuß hinunter in die Empfangshalle gekommen, hat an Türen geklopft und alte Frauen in ihren Zimmern erschreckt. Dann hat sie sich verbarrikadiert. Sie hat Mussolini, Hitler und ihre Schwiegermutter verwünscht.
Die bestürzten Pfleger verlangen von Louis, dass er seine Frau sofort abholen kommt.
Um halb sieben Uhr morgens macht er sich von Paterson mit dem Bus über Newark auf den Weg.
Auf dem Weg von der Anstalt zur Busstation hat er alle Mühe, ihrer Herr zu werden. Sie stürzt in eine Apotheke und verlangt dort eine Bluttransfusion. Louis kann sie endlich beruhigen und zur Bushaltestelle führen. Aber als der Bus ankommt, weigert sich der Fahrer, die offensichtlich gemeingefährliche Frau einsteigen zu lassen. Louis telefoniert mit Greystone und setzt durch, dass man seine Frau dort aufnimmt. In der Staatlichen Nervenheilanstalt bleibt sie während der nächsten zwei Jahre.
Allen wird sechzehn. Er beobachtet Sterne. Er polemisiert gegen die Anhänger der Isolationspolitik. Er hört Musik: Gershwin und Aaron Copland. Sein Bruder Eugene, der von der Lehrerausbildung zum Jurastudium gewechselt hat, wird zur Armee einberufen. Allen betätigt sich bei der Zivilverteidigung. Er arbeitet als Laufbursche in der Öffentlichen Bibliothek und verdient dreizehn Cent in der Stunde. Einmal schleicht er sich heimlich in das Büro der Bibliothekarin, entnimmt aus dem Giftschrank den Krafft-Ebing und schlägt darin das Stichwort ›Homosexualität‹ nach.
Er will herausfinden, ob er schwul ist. Wenn er sich verliebt, sind es immer Jungen. Einer, für den er besonders schwärmt, heißt Paul Roth. Er ist ein halbes Jahr älter als Allen und geht mit einem Stipendium an die Columbia University in New York.
Allen will seinem Idol dorthin folgen und bewirbt sich ebenfalls an dieser Universität. Er bekommt ein Stipendium.
An dem Tag, an dem er mit der Fähre von Hoboken nach Manhattan übersetzt, legt er vor sich selbst den Schwur ab, sein Leben dem Dienst an der Arbeiterklasse zu widmen.
Er besteht die Aufnahmeprüfung. Aber dem Jungen, in den er verliebt ist, begegnet er an der Universität selten. Er hört Jura. Er ist entschlossen, Anwalt für Arbeitsrecht zu werden.
In Columbia sind die Kriegsmarinekadetten eingezogen. Die zivilen Studenten hat man ausgelagert.
Allen wird in einem großen Apartmenthaus des Union-Theological-Seminars, einen halben Block vom Campus entfernt, untergebracht.
Einige Tage vor Weihnachten 1943 hört er aus einer der Studentenbuden auf seinem Flur ein Musikstück, das ihn interessiert. Er klopft. Es öffnet ihm ein engelsgesichtiger junger Mann mit blondem Haar und hohlen Wangen. Man könnte meinen, er trinke nichts anderes als Wind und statt Fleisch esse er einen Haufen Schatten, geht es Allen durch den Kopf.
›Was spielst du denn da?‹ fragt er.
›Gefällt es dir?‹
›Ich würde sagen, es ist das Klarinettenquintett von Brahms.‹
›Richtig. dass es jemanden gibt, der so etwas zu schätzen weiß‹, wundert sich der andere und bittet ihn zu sich herein. Der Kommilitone stellt sich vor. Luden Carr. In den Bücherregalen sieht Allen französische Bücher. Flaubert, Rimbaud. Carr stellt zwei Gläser auf den Tisch und schenkt Rotwein ein. Die beiden werden Freunde. Sie treffen sich immer öfter zu langen Gesprächen. Carr stammt aus einer wohlhabenden Familie aus St. Louis, wo sein Großvater mütterlicherseits mit Jute und Hanffasern handelte. Als Lucien noch ein Kind war, hatte der Vater die Familie verlassen.
Lucien ist zwei Jahre älter als Allen. Er hat eine Schule für verhaltensgestörte Kinder besucht, hat später an der renommierten Universität von Chicago sein Studium begonnen und ist im Herbst nach Columbia gekommen.
Für Allen wird Rimbaud, mit dessen Gedichten ihn Carr bekannt macht, zur großen Entdeckung, zum Tor in die europäische Moderne. Bei ihm stößt er auf Sätze, auf die sich später die Literaten der Beat Generation berufen werden. Sein Tagebuch verzeichnet, was ihm nun als Aufgabe und Eigenart des Dichters erscheint:
›Der Dichter wird ein Seher durch ein langes dérangement aller Sinne. Alle Formen der Liebe, des Leidens, des Wahnsinns hat er durchlaufen. Er sucht sich selbst, gibt sich allen Giften in sich hin, behält aber nur die Quintessenz. Unbeschreibliche Qual, zu der er all seinen Glauben braucht, all seine übermenschliche Kraft, da er unter den Menschen zum großen Patienten wird, zum großen Kriminellen, zum großen Verfluchten - und zum überragenden Gelehrten. Denn wonach es ihn verlangt, ist das Unbekannte.‹8
Es wird zugleich sein Lebensprogramm für die nächsten Jahre. Noch zögert Allen, ob er sich auf ein solches Boheme-Leben, wie es Lucien predigt, einlassen soll. Hat er sich nicht vorgenommen, ein Anwalt und Verteidiger des Proletariats zu werden?
Langsam verflüchtigen sich Allens idealistische Träume. Er sieht, dass sich die Literatur der europäischen Moderne mit Themen beschäftigt, die auch ihn persönlich beunruhigen: Wahnsinn, Außenseitertum, das, was der Spießer abartig zu nennen pflegt.
Ja doch, auch er ist ein Abartiger, ein Außenseiter. Er will es nur immer noch nicht wahrhaben.
Daheim hat sich auch einiges geändert. Nachdem beide Söhne aus dem Haus sind, nachdem Louis zweiundzwanzig Jahre an der Seite von Naomi vor allem aus Verantwortungsbewusstsein und Pflichtgefühl ausgehalten hat, sie seine Liebe längst nicht mehr erwidert, ihn ständig mit Anschuldigungen und Verdächtigungen überhäuft, ist er am Ende seiner psychischen Kraft. Mehrmals hat Naomi nach solchen Anfällen von Misstrauen die gemeinsame Wohnung verlassen. Jetzt zieht sie endgültig aus, kriecht bei ihrer Schwester Eleanor in der Bronx unter. Ihren Lebensunterhalt verdient sie mit Adressenschreiben. Auf Außenstehende wirkt sie normal, voller Selbstvertrauen, geradezu fröhlich. Aber immer wieder hat sie Anfälle, bei denen sie dann Stimmen hört und die alten Ängste sie wieder überwältigen. Sie wird schließlich die Geliebte eines Vertrauensarztes der Marinegewerkschaft, bei dem sie als Sprechstundenhilfe arbeitet.
Dass es irgendwann zwischen den Eltern zum Bruch kommen würde, war vorauszusehen gewesen. Insofern geht Allen die Trennung der Eltern jetzt auch nicht übermäßig nahe. Er besucht hin und wieder sowohl den Vater in Paterson als auch die Mutter bei ihrem neuen Freund. Mehr und mehr nehmen ihn die Gespräche und die Lebensart seiner neuen Bekannten an der Universität gefangen.
Mit Lucien Carr besucht er zum ersten Mal das New Yorker Künstlerviertel Greenwich Village, dem damals noch ein Hauch Verworfenheit anhaftete.
Durch Lucien lernt Allen einen hochaufgeschossenen, rotbärtigen Mann kennen, der David Kammerer heißt: eine tragische Gestalt.
Kammerer hatte sich in Lucien Carr verliebt, als er diesen als Kind auf einem Spielplatz sah. Seither ist er ihm überallhin gefolgt. Hier in New York schlägt er sich mit Gelegenheitsarbeiten durch. Er ist zu jedem Opfer bereit, wenn er nur in Luciens Nähe sein kann. Das Verhältnis der beiden ist spannungsreich, weil es kaum ein Mädchen gibt, auf das der schöne Lucien mit seinen grünen Katzenaugen keinen Eindruck machen würde.
Bei Allen löst das Verhältnis der beiden Männer zwiespältige Empfindungen aus. Einerseits kommt es ihm geradezu wie eine Offenbarung vor, dass sich jemand ganz offen zu seiner von der Gesellschaft tabuisierten Neigung bekennt. Andererseits hat die Besessenheit Kammerers und die Distanzierung, mit der Carr darauf reagiert, für ihn etwas Erschreckendes. Angesichts dieses Verhältnisses wird ihm klar, in welche Enttäuschungen und Leiden seine Veranlagung auch ihn stürzen wird.
Als sie Kammerer aufsuchen, hat der einen Freund aus St. Louis zu Besuch: einen großen, dünnen Mann mit aschgrauer Haut, sandfarbenem Haar und zusammengekniffenen Lippen, die ab und zu nervös zucken. Allen, der zu diesem Zeitpunkt siebzehn ist, kommt der Besucher uralt vor. In Wirklichkeit ist der Gast, der gleich um die Ecke wohnt, damals dreißig Jahre.
Die Rede kommt auf eine Schlägerei zwischen Kammerer und einem betrunkenen Maler, bei der dessen Atelier völlig verwüstet worden ist. Lucien hat dabei dem Maler ein Stück vom Ohrläppchen abgebissen und darauf seine Zähne auch noch in Kammerers Schulter gegraben.
›Mit den Worten des unsterblichen Barden‹, zitiert der Gast, der sich als William Seward Burroughs vorgestellt hat, ›ein Gegenstand, zu ausgehungert für mein Schwert.‹9
Dass jemand offenbar für alle Gelegenheiten ein passendes Shakespearezitat aus dem Ärmel schütteln kann, beeindruckt Allen ungemein. So beginnt seine Freundschaft mit William Burroughs.
3
Ein Sohn aus gutem Hause
(1914-1944) William Burroughs
Once started out
to walk around the world
but ended in Brooklyn.
That Bridge was too much for me
I have engaged in silence
exile and cunning.
Lawrence Ferlinghetti1
... geboren am 5. Februar 1914 in St. Louis. In der Reihe seiner Vorfahren treten uns zwei bekannte Typen der amerikanischen Bevölkerung des 19. Jahrhunderts entgegen: der Yankee-Erfinder und der Prediger aus dem Süden.
Der Großvater väterlicherseits war Mechaniker gewesen. Er hatte Patente auf Eisenbahnweichen und auf ein Papiermesser angemeldet, ohne Geld damit zu verdienen. Häufig war er arbeitslos. Sein Sohn William wurde mit achtzehn nach der High-School Bankangestellter. Als solcher war er Tag für Tag acht Stunden damit beschäftigt, Zahlenkolonnen abzuschreiben und zu addieren. Tausender, die zu Millionen kommen, von denen Hunderter abgezogen und erneut Tausender dazugezählt werden.
Eine langweilige, monotone Arbeit. Sieben Jahre blieb William bei der Bank. Dann war seine Gesundheit ruiniert. Tuberkulose. So schwer, dass er seinen Beruf aufgeben musste.
Er erinnerte sich an die Erfindertradition in der Familie.
Es war die Zeit, in der man mit einem neuen Produkt, das sich in Massenproduktion herstellen ließ, von heute auf morgen reich werden konnte.
Die erste Schreibmaschine 1868.
Das erste Telefon 1876.
Die Registrierkasse 1879.
Der Füllfederhalter 1884.
William Seward Burroughs erfand eine Rechenmaschine, die mit der Drehbewegung einer Kurbel eine Reihe von Zahlen addieren konnte und die Rechenoperation sofort ausdruckte. Später kam ein breiter Wagen dazu, der das Buchhaltungsjournal beförderte.
Von dem bis heute üblichen Papierstreifen ließen sich alle Geschäftsvorgänge eines Tages ablesen.
Zusammen mit einem anderen Erfinder,. dem Kanadier Joseph Boyer, gründete er mit einem Startkapital von 100.000 Dollar die American Arithmeter Company. Später würde das Kapital nach dem Willen der Aktienbesitzer auf 200.000 Dollar erhöht.
William Seward Burroughs I. hatte inzwischen geheiratet. Die Krankheit hatte ihn nicht daran gehindert, Kinder in die Welt zu setzen, vier an der Zahl, die Söhne Mortimer und Horace und zwei Töchter.
Die Wundermaschine hatte einen Konstruktionsfehler. Je nachdem, wie heftig man die Kurbel bewegte, wurden verschiedenartige Summen ausgedruckt.
Eines Tages betrat Burroughs leicht alkoholisiert das Lager der Firma und warf alle noch nicht verkauften und zurückgesandten Maschinen aus dem Fenster hinunter auf den Hof.
Er fing noch einmal an zu probieren und zu zeichnen.
Elin Metallzylinder mit einem Kolben wurde eingefügt, in dem zwei kleine Löcher den Ölfluss regulieren. Damit war sichergestellt, dass der Schaftmechanismus sich immer gleichmäßig bewegte, gleichgültig welche Kraft auf die Kurbel einwirkte.
Die verbesserte Maschine, die 1891 für 425 Dollar angeboten wurde, war nun wirklich der Traum eines jeden Buchhalters.
Während Burroughs’ Vermögen wuchs, ging es mit seiner Gesundheit immer mehr bergab. Er zog mit der Familie nach Citronelle in Alabama, ein Ort, von großen Pinienwäldern umgeben. Frische Luft war immer noch das einzige Heilmittel gegen Tuberkulose, das man zu jener Zeit kannte. Aber Ruhe und gute Luft konnten seine zerstörten Lungen auch nicht mehr retten. William Burroughs I. starb mit einundvierzig Jahren im September 1898.
Inzwischen hatte sich die Firma unter Boyers Leitung gut entwickelt. Sie war nach Detroit umgezogen, beschäftigte 1904 465 Angestellte und verkaufte in diesem Jahr 7800 Additionsmaschinen. Das Vermögen der Gesellschaft, die sich inzwischen Burroughs Adding Machine Company nannte, wuchs bis zum Jahr 1920 auf 430 Millionen Dollar an. Aber davon profitierten Burroughs’ Nachkommen kaum noch. William Seward I. hatte beim Umzug in den Süden einen guten Teil seiner Kapitalanteile abgestoßen und den verbleibenden Rest in eine Treuhandgesellschaft eingebracht.
Die Manager der weiter aufstrebenden Gesellschaft überredeten die Kinder der Erfinder, ihre Anteile zu verkaufen. Sie bekamen dabei für die Wertpapiere, die bald eine Million und noch später ein vielfaches dieser Summe gebracht hätten, ganze 100.000 Dollar.
William Burroughs II. hat später einmal ausgerechnet, dass das Aktienpaket seines Vaters in den dreißiger und vierziger Jahren um die 20 Millionen Dollar wert gewesen wäre. Dass er in seinen Geschichten das kapitalistische Zeitalter als von Gangstern beherrscht darstellen wird, scheint angesichts solcher Erfahrungen in der eigenen Familie begreiflich.
Die Mutter Burroughs’ II., Laura, stammte aus einer Familie von Pachtbauern und Predigern aus dem amerikanischen Süden. Ihr Vater, James Wideman Lee, wurde methodistischer Pfarrer in St. Louis in einem Viertel der reichen Leute, seine Frau Eufala leitete die Women’s Temperance Union. Man sagte von ihr, sie hätte einen ihrer Söhne lieber tot als betrunken heimkommen sehen.
Ein Wahlspruch der Predigersippe Lee lautete: ›Wenn du das Spiel des Lebens gewinnen und den Gott ehren willst, der dich geschaffen hat, musst du hart und zielstrebig arbeiten.‹2
Wer solche Sonntagsschulweisheit im Sinn einer neuen Zeit zu interpretieren verstand, war Ivy Ledbetter Lee, der Bruder der Mutter. Von ihm erzählt man, er habe noch den skrupellosesten Kapitalisten in einen nur auf Wohltätigkeit sinnenden Philanthropen umzudichten vermocht. Seine dreist-schamlosen Lügen trugen ihm den Spitznamen ›Poison Ivy‹ ein.
Wenn William Burroughs’ Großvater der Erfinder der Addiermaschine ist, so ist Ivy der Schöpfer der modernen Public Relations.
Ein paar Jahre arbeitete er als Zeitungsschreiber in New York, tatsächlich aber als Presseagent des großen Geldes.
Im Oktober 1913 kam es in den USA bei einem Streik der Bergleute in Colorado zum sogenannten Ludlow-Massaker, bei dem durch Polizei und Staatsmiliz zwei Frauen und elf Kinder getötet wurden. Die Mehrheitseigentümer der Kohlegruben waren die Rockefellers. Im ganzen Land hatten sie eine schlechte Presse, worauf der bis dahin eher menschenscheue und in splendid isolation lebende John D. Rockefeller jr. plötzlich Volksnähe demonstrierte. Er besuchte die Bergarbeiter, tanzte mit deren Frauen, hielt Reden, die vor Verständnis für die soziale Not seiner Arbeiter und Angestellten nur so trieften.
1915 wurde Ivy Lee endgültig Rockefellers Public-Relations-Chef. Die Fähigkeit, Kapitalisten, die über Leichen gingen, in den Augen der Öffentlichkeit als Altruisten dastehen zu lassen, war die Ware, mit der Ivy Lee handelte.
Doch auch dem Erfinder der Public Relations unterliefen in seinen öffentlichen Beziehungen Fehler.
1933 kamen in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht.
Für ein Jahresgehalt von 33.000 Dollar ließ sich Lee von der IG Farben anwerben, um Adolf Hitler, den Führer eines neuen Deutschland, in den USA populär zu machen. Lee reiste nach Europa, wurde Hitler und Goebbels vorgestellt. Er riet den Nazigrößen im Grund zu nichts anderem, als was er auch schon Rockefeller geraten hatte: In der Öffentlichkeit darf nicht der Eindruck entstehen, dass man es mit Unmenschen zu tun hat.
Dem Außenminister Ribbentrop empfiehlt er, die deutschen Wiederaufrüstungspläne einfach abzustreiten. Und Hitler solle erklären, die SS sei nun einfach nötig, um die Kommunisten in Schach zu halten.
Gegen ein Deutschland, das berechenbar war, würde niemand in Europa oder Amerika etwas einzuwenden haben.
Allmählich aber entpuppten sich die Nazis keineswegs als jene netten Burschen, als die Lee sie der amerikanischen Öffentlichkeit hatte verkaufen wollen. Er wurde als Presseagent der IG Farben enttarnt. Sein Ruf war endgültig dahin, als er 1934 vor dem Ausschuss für Unamerikanische Aktivitäten zugeben musste, beträchtliche Summen aus Deutschland bekommen zu haben, um Hitler mit seinen Werbetricks in ein günstiges Licht zu. rücken. Um den süßen Geschmack des Erfolgs gebracht und nun gar als Staatsfeind gebrandmarkt, starb er verbittert im Oktober 1934 mit erst 57 Jahren an einer Gehirnblutung.
Laura Lee und Mortimer Burroughs heirateten 1910. Der junge Ehemann arbeitete noch für kurze Zeit als Vertreter für die Burroughs Company. Nach dem Verkauf seiner Firmenanteile eröffnete er ein Geschäft für Glasscheiben. Das Ehepaar hatte zwei Söhne, Mortimer jr., der 1911 geboren wurde, und William Seward II., der drei Jahre später zur Welt kam. Man lebte in einem Viertel der High-Society, ohne selbst recht dazuzugehören. Die Ehe der Eltern scheint glücklich gewesen zu sein, aber es ist eine Familie, in der man Gefühle nicht zeigt. Mort, der Ältere, schlägt nach dem Vater, ist von gedrungener Statur, wirkt gesund. Billy ist dünn, bleich, sieht eher der Mutter ähnlich und wird rasch zum schwarzen Schaf der Familie.
Billys Entwicklung verläuft von Anfang an kompliziert. Schon sehr früh scheint es Eindrücke und Einflüsse gegeben zu haben, die ihn in die Rolle des Außenseiters und Rebellen drängten.
Gefährlich wird sich in dieser Familie, in der zwischen den Eltern nie ein lautes Wort fällt, aber ein eher frostig-formelles Klima herrscht, der Einfluss von zwei Frauengestalten ausgewirkt haben, denen etwas Unheimliches anhaftet, die aber im Halbdunkel frühester Erinnerungen bleiben.
Da ist eine alte irische Köchin, die Burroughs retrospektiv mit einer der Hexen aus Macbeth