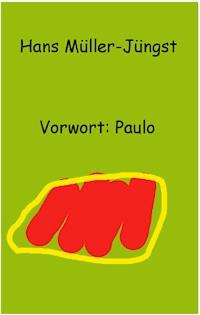5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Paulo bereist die Seidenstraße zwei Jahre lang und lernt viele verschiedene Menschen kennen, er stellt fest, dass es bei aller Fremdheit viel Verbindendes gibt und nimmt die fremdländische asiatische Welt mit besonders großem Interesse auf. Es entspricht seiner inneren Einstellung, dass er sich Fremdem gegenüber offen zeigt und es in sich aufnimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Ähnliche
HaMuJu
Paulo bereist die Seidenstraße (4)
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
ESSEN
Istanbul
Ich setzte mich in einem Waggon ans Fenster und wartete auf die Abfahrt. Der Zug setzte sich pünktlich in Bewegung und schlängelte sich nach Süden immer die Küste entlang. Nach etwa einer Stunde nahm ich einen letzten Blick auf das Marmara-Meer, dann verschwand der Zug im Landesinneren.
Konya
Malatya
Bingöl
Van
Teheran
Qom
Isfahan
Yazd
Semnan
Emamshar
Sabzevar
Soltanabad
Mashhad
Sarakh
Merv
Bayram Ali
Buchara
Sarmakand
Taschkent
Impressum neobooks
ESSEN
Ich liebte es über alles, mit Frau Aldenhoven unten in der Laube zu sitzen und ihr zuzuhören, wie sie aus ihrer ostpreußischen Heimat erzählte.
Frau Aldenhoven war eine alte ansehnliche Frau, sie war erfahren und hatte viel zu erzählen. Wie bei alten Frauen üblich hatte sie die langen grauen Haare nach hinten gekämmt und zusammengebunden. Die Haartracht wurde von einem Haarnetz gehalten. Ihre Kleidung war schlicht, hausfrauengemäß, ein Allerweltskittel in undefinierbarer Farbe, bei der ein Rot-Lila überwog. Sie trug Perlonstrümpfe, die sie über den Knien zusammenrollte und Schlappen., die eine Mischung aus Straßenschuh und Pantoffel waren. Frau Aldenhoven setzte zum Lesen eine Brille auf, sie war von stämmiger Figur, ihre Oberarme hatten einen beträchtlichen Umfang und ihre Beine waren durch die Perlonstrümpfe eingeschnürt. Sie hatte ein tief zerfurchtes Gesicht, auch Arme und Beine zeigten Falten. Es ging etwas Ehrwürdiges von ihr aus. Frau Aldenhoven war eine Person, zu der man aufschaute und die man achtete.
Sie wohnte unten im Haus. Immer, wenn ich zur Haustür hereinkam und Frau Aldenhoven unten im Flur war, grüßte ich sehr höflich und Frau Aldenhoven grüßte dann zurück, auf ihrem alten Gesicht war dann ein Lächeln zu sehen. Von Frau Aldenhoven ging ein Geruch aus, der schwer zu beschreiben war. Für mich war es ein Duft, wenngleich es ein Körpergeruch war. Sie roch aber nicht nach Schweiß und duftete nicht nach Parfum. Für mich verbarg der Duft ein ganzes Leben.
Der Duft gab etwas von Frau Aldenhovens Innerem frei, etwas, das sie nicht steuerte oder beeinflusste.
Der Duft war unverkennbar sie, sie war grundehrlich, arbeitsam und mitteilungsbedürftg. Ich liebte sie fast und sie spürte meine Zuneigung. Immer wenn Frau Aldenhoven in der Laube saß, sommertags, saß ich bei ihr. Es gab noch einige andere Erwachsene mit ostpreußischer Vergangenheit, niemand wusste aber seine Lebenserfahrungen so erfolgreich und berührend vorzubringen, wie Frau Aldenhoven. Immer wieder erzählte sie von Gumbinnen, wo sie als Magd auf einem Gutshof gearbeitet hatte, sie ließ nichts auf ihren ehemaligen Gutsherrn kommen, auch dann nicht, wenn er zu Pferde sitzend die Landarbeiter mit der Reitgerte züchtigte.
Frau Aldenhoven schwelgte so sehr in der alten Zeit, dass sie von den neuen Verhältnissen, die sie umgaben, gar nichts mitbekam. Den Hitler fand sie aber auch nicht gut, der war dumm und konnte dem Landadel nicht das Wasser reichen, schließlich waren die Gutsherren gebildete Menschen. Sie erzählte immer wieder, wie ein Trupp SS-Leute auf ihr Gut kam, um Land für die Reichswehr zu requirieren. Wie da ihr Gutsherr mit denen umgesprungen wäre, das hätte man sehen sollen!Gesenkten Hauptes wären die SS-Leute wieder von dannen gezogen! Frau Aldenhoven hatte ihren Mann nach dem Kriege verloren, er war in russischer Gefangenschaft umgekommen.
Wir könnten uns ja nicht vorstellen, was es bedeutet hätte, in einem russischen Gefangenenlager untergebracht gewesen zu sein. Bei -30°C hätten die Gefangenen in Steinbrüchen arbeiten müssen, kaum einer hätte die Strapazen überlebt. Wenn Frau Aldenhoven von der alten Zeit sprach, hegte sie keinen Groll, auch nicht gegen die sowjetischen Soldaten, denen sie kurz vor Kriegsende noch in die Hände gefallen wäre. Darüber schwieg sie sich dann aber aus. Sicher war sie, wie tausend andere Frauen auch, von den Soldaten vergewaltigt worden. Sie floh vor der vorrückenden Sowjetarmee nach Westen, bis sie im Ruhrgebiet ankam. Ihr „Ostpreußen“ war das Thema, mit dem sie sich bei jedem Gehör verschaffte. Andere Ostpreußenstämmige nickten immer nur stumm, wenn Frau Aldenhoven erzählte, sie hatten das Gleiche erlebt, ihnen fehlte aber die Fähigkeit, von diesen Dingen mit solcher Warmherzigkeit zu erzählen, wie es nur Frau Aldenhoven konnte. Unvergessen war die Geschichte, wie sie und drei weitere Mägde dreißig Pferde sicher in den Stall brachten, nachdem ein fürchterliches Gewitter aufgezogen war. Ein Hengst war auf sie zugestürzt und warf sie mit seiner Flanke gegen den Weidezaun. Sie nahm einen dicken Knüppel und schlug dem Hengst kräftig vor den Kopf. Daraufhin war er gefügig und trabte zum Stall, die anderen Tiere folgte ihm. Der Gutsherr, der zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Hof war, dankte es seinen vier Mägden am nächsten Tag, jede durfte einen Tag frei machen, wann es ihr gefiel.
Sie dankten dem Gutsherrn, den freien Tag hatte Frau Aldenhoven aber nie genommen. Die dreißig Pferde waren kostbare Trakehner, sie wären vor Angst ausgebrochen und hätten sich dabei möglicherweise verletzt. Einmal hatte Frau Aldenhoven Gelegenheit, von Gumbinnen aus mit dem Zug nach Königsberg zu fahren. Immer wieder erzählte sie die Geschichte, wie sie in Königsberg einen Hut gekauft hatte. Sie ging in ein Modegeschäft, trat sehr selbstbewusst auf und kaufte sich einen Hut von der Fensterauslage, die Verkäuferin half ihr beim Anprobieren. Der Hut stand ihr, sie behielt ihn während ihres Aufenthaltes in Königsberg auf. Sie sah sich mit ihren Freundinnen vom Gutshof das Schloss und den Dom an. Sie setzten sich auf die Terrasse eines Cafes, tranken Kaffee und aßen Kuchen. Frau Aldenhoven behielt die ganze Zeit ihren Hut auf und zog bewundernde Blicke auf sich. Am frühen Nachmittag fuhren sie wieder zurück nach Gumbinnen. Erst als sie wieder auf dem Gutshof waren, nahm Frau Aldenhoven den Hut ab und setzte ihn nie wieder auf, auf ihrer Flucht nach Westen war er verloren gegangen.
Sie zog alle in ihren Bann, besonders mich, ich wagte es nie, während ihres Erzählflusses dazwischen zu reden oder Rückfragen zu stellen. Alle Erwachsenen hatten in der Laube eine Flasche Bier vor sich stehen, nur Frau Aldenhoven nicht, sie trank ein Glas Wein. Wenn sie erzählte, nahm ihr Gesicht edle Züge an. Um ihren Erzählungen Inbrunst zu verleihen, schloss sie manchmal die Augen. Ihre Stimme hatte eine mittlere Lautstärke, sie sprach unverkennbar ostpreußisch, hinter jeden zweiten Satz setzte sie ein „näch“. Dann roch ich wieder den Duft, den sie verströmte. Das war Frau Aldenhoven, alles gehörte zusammen, ihre Geschichten, die zuhörenden Nachbarn, der Sommer und der Duft nach Frau Aldenhoven.
Ich würde das nie vergessen.
Sie war nie wieder in Ostpreußen. Es gab ja organisierte Fahrten, alle Reiseunternehmen boten solche Fahrten an. Von denen, die solche Fahrten unternommen hatten, hörte Frau Aldenhoven aber immer nur, dass drüben alles verfallen wäre, der Iwan nichts instand setzte. Sie war achtzig Jahre alt und wollte sich eine solche Fahrt nicht mehr zumuten, sie müsste sicher weinen, wenn sie den alten Gutshof verfallen da liegen sähe.
Ab und zu lud mich Frau Aldenhoven ein, bei ihr fernzusehen, was ich sehr gerne tat. Manchmal hatte sie vorher Königsberger Klopse bereitet.
„Nu iss mal schön!“, sagte sie dann zu mir und legte mir noch zwei Klopse auf den Teller. Ihre ganze Wohnung roch nach ihr, nach Wärme und Gemütlichkeit. Nach eineinhalb bis zwei Stunden ging ich dann wieder hoch zu uns. Ich hatte ihr dann immer alles über meine Freundinnen und Freunde erzählt. Oft war sie dabei auf ihrem Sofa eingenickt.
Ich weckte sie dann nicht und schlich mich aus ihrer Wohnung.
Eines Tages starb Frau Aldenhoven auf ihrem Sofa, sie war friedlich eingeschlafen. Mich beschlich eine tiefe Trauer. Ich hatte nie wieder einen Menschen mit so einer Wärme, Aufrichtigkeit und weiser Lebenserfahrung getroffen.
Ich beschloss, nach meiner Schule, die zwei Monate später beendet wäre, eine Auszeit von meinem Zuhause zu nehmen, ich war von der Bundeswehr freigestellt, hatte also Zeit in Mengen. Ich wollte ein halbes Jahr, völlig auf mich allein gestellt, durch die Welt ziehen. Fürs Erste hätte ich genügend Geld, meine Ersparnisse beliefen sich auf 3500 Euro, damit käme ich schon recht weit. Aber wohin sollte es gehen? Viele fuhren ach dem Abitur eine Zeit lang in die USA oder nach Australien. Da wäre mein Geld im Nu alle gewesen, die Lebenshaltungskosten waren in diesen Ländern mindestens so hoch wie bei uns. Ich musste mir auch darüber klar werden, was ich studieren wollte, denn das wusste ich noch nicht, da käme eine Auszeit gerade recht.
Ich besuchte Frau Aldenhoven auf dem Friedhof, vielleicht könnte sie mir einen Tipp geben! Ich setzte mich auf eine Friedhofsbank und dachte nach. Was hätte Frau Aldenhoven wohl zu Asien gesagt? Was hätte sie dazu gesagt, wenn ich die Seidenstraße entlang reisen wollte? Die sagenumwobene Seidenstraße ging mir schon lange durch den Sinn. Man konnte so etwas auch organisiert machen, nach Samarkand fliegen und dann komfortabel mit Bus oder Zug durch die Gegend fahren. Daran dachte ich natürlich nicht. Mir schwebte vor, die Seidenstraße entlang zu pilgern, schon mit einem Ziel, aber ohne fest organisiertes Vorwärtskommen. Pilgern würde Laufen bedeuten, endloses Laufen, aber ich würde auch mit LKWs und Bussen fahren. Ich begann, auf dem Friedhof direkt neben Frau Aldenhoven von meiner Fahrt die Seidenstraße entlang zu träumen, ich hatte den Eindruck, sie hätte nichts dagegen gehabt. Fast sah ich ihren edlen Gesichtsausdruck, fast nahm ich ihren warmen Ruhe verbreitenden Geruch wahr. Ich brachte die verbleibenden zwei Monate Schule hinter mich und verabschiedete mich von Freunden und Klassenkameraden. Wir wollten uns natürlich alle wiedersehen, ein Klassentreffen veranstalten, so in zwei, drei Jahren. Viele, denen ich von meinem Seidenstraßenplan erzählte, hielten mich für verrückt.
Einige gingen zur Bundeswehr, einige fingen ein Studium an, einige gingen auf Reisen.
Ich begann, mir die Sachen zusammen zu stellen, die ich während meines Unternehmens brauchen würde. Ich brauchte einen stabilen Rucksack, er musste nicht besonders groß sein, schließlich konnte ich nicht so viele Sachen über weite Strecken schleppen, sechzig Liter Packmaß würde er aber haben müssen. Das Material müsste fest und die Taschenverschlüsse müssten haltbar sein. Der Rucksack müsste sehr viele Stöße und unsanfte Würfe aushalten, er müsste auch eine komfortable Rückenstütze haben. Gut zugängliche Seitenfächer für Taschenmesser, Karten und kleine Kleidungsstücke mussten vorhanden sein. Natürlich musste der Rucksack wasserdicht sein, zumindest gegen Regen geschützt. Ich ließ mich beraten, fand aber kaum Leute, die Ahnung hatten und sich vorstellen konnten, welchen Anforderungen der Rucksack genügen musste. Ich machte keine Backpacker-Tour oder eine alpine Bergwanderung, mein Vorhaben war ganz anderer Natur und wahrscheinlich war es das, was die Berater überforderte, ich entschied mich schließlich für den „Bach Overland“ in schwarz. Auch auf die Farbe kam es an, ich wollte nicht durch Symbolfarben die Aufmerksamkeit meiner ganzen Umgebung auf mich ziehen. Mit 229,95 Euro lag der Rucksack im Preis ziemlich oben, ich hoffte, er würde halten, was er versprach. Der „Bach“ war mit 3,5 kg kein Leichtgewicht, das relativ große Gewicht hatte er seiner guten Verarbeitung zu verdanken. In den folgenden Tagen und Wochen setzte ich mir immer wieder den Rucksack auf den Rücken, packte ihn mit schwerem Material, zum Beispiel mit Ziegelsteinen und trainierte das Laufen mit Rucksack. Ich verstellte den Beckengurt und die Schultergurte, bis ich ein angenehmes Tragegefühl hatte.
In der Stadt kaufte ich mir dann eine Türkeikarte, denn meine Tour würde in Istanbul beginnen. Das war nicht ganz der Beginn der Seidenstraße, ich würde aber spätestens in Täbriz im Iran auf den klassischen Verlauf stoßen. Ich hatte schon seit langem das Schweizer Offiziersmesser, es war das klassische, das über so viele Funktionen verfügte, die ich gar nicht alle brauchte, aber man wusste ja nie! Als großes Problem stellte sich die Aufbewahrung meiner Wertsachen heraus. Es gab die verschiedensten Möglichkeiten: Brustbeutel, Innentaschen in der Hose, Gürtel mit Aufbewahrungsfächern auf der Innenseite usw. Alle Systeme hatten eine Macke, sie wurden am Körper getragen, wenn jemand wirklich scharf auf die Wertsachen gewesen wäre, hätte er einen niedergeschlagen und die Sachen geraubt, die er wollte. Aber man musste wenigstens die Ausweispapiere immer dabei haben, Geld konnte man sich bei Banken beschaffen. Am besten war die Einrichtung der Postbank, auf ausländischen Postfilialen kostenlos Geld abheben zu können. Das ersparte es einem, größere Geldbeträge bei sich tragen zu müssen. Zehn Abhebungen waren kostenfrei, danach musste man eine geringe Gebühr bezahlen, ungefähr 2,50 Euro wenn man 300 Euro abhob, das hielt sich sehr in Grenzen.
Ich musste mir auch noch einen Schlafsack besorgen, der einerseits wärmte, andererseits aber nicht so viel wog und klein in seinen Abmessungen war. Man hatte bei Schlafsäcken kaum Anhaltspunkte, wonach man sich beim Kauf richten sollte. Es gab den Temperaturbereich, der angab, bei wie viel Grad der Schlafsack noch ausreichend Wärme bot, das Material musste so stabil sein, dass es bei grobem Untergrund nicht sofort einriss. Ich entschied mich für einen „Ajungilak Kompakt 3-Seasons“, der für einen Temperaturbereich von +5°C bis zu -10°C vorgesehen war, er kostete 150 Euro. Ich musste mir zum Schluss noch ein paar solide Wanderschuhe kaufen. Wahrscheinlich wären die das größte Problem, dachte ich. Schließlich gab es gerade bei Wanderschuhen eine solche Fülle an Materialien, dass man kaum zurecht kam. Wollte man Ganzlederschuhe, worauf viele schworen, die aber ihr Gewicht hatten? Sie eigneten sich in steinigem Gebiet, wo sie den Fuß vor scharfkantigen Steinen schützen mussten. Oder genügte ein Leichtbauwanderschuh, der am Schaft nicht die hohe Materialfestigkeit zeigte, aber den großen Vorteil des geringen Gewichtes hatte? Die Sohle wäre genau so stabil wie die der Ganzlederschuhe und er war besser geeignet, den Fuß vor Wasser zu schützen. Letztlich kam es natürlich darauf an, wie der Schuh am Fuß saß. Man musste schon ein paar Tage mit dem Schuh laufen, um sagen zu können, ob Schuh und Fuß miteinander harmonierten. Es gab nur wenige Geschäfte, die sich darauf einließen.
Am Ende entschied ich mich für den „Raichle Explorer LS“. Der Schuh kostete 98 Euro und bot alles, was ich von einem guten Wanderschuh erwartete Er war überwiegend aus Nubukleder und wog nur 1,3 kg! Tagelang lief ich mit dem Schuh durch die Gegend. Ich verspürte nirgendwo Druckstellen oder sogar Blasen. Es kam auch darauf an, welche Strümpfe man in den Schuhen trug, ich nahm dünne Baumwollstrümpfe. Neben den Wanderschuhen würde ich noch ein Paar Turnschuhe und ein Paar Schlappen mitnehmen.
Damit hatte ich meine wichtigsten Ausrüstungsgegenstände zusammen gekauft. Ich beschloss, zunächst nach Istanbul zu fliegen und dort alles weitere abzuklären. Ich hatte noch zwei Wochen Zeit, dann würde es von Düsseldorf aus losgehen. Der Flug kostete 110 Euro, da überlegte ich nicht lange nach einer Busverbindung. In diesen zwei Wochen ließ ich mir eine Gammaglobulin-Impfung gegen Hepatitis C und eine gegen Hepatitis A geben, ich ließ meinen Tetanus-Status überprüfen und stellte mir eine Reiseapotheke zusammen. Sehr wichtig waren wirksame Mittel gegen Durchfall! Ich überprüfte meine Ausweispapiere und wurde Kunde der Postbank, Visa hatte ich schon längst, mein Flugticket hatte ich mir im Internet gekauft.
Ich legte alle Sachen zusammen, die mir wichtig für meine Reise erschienen, besonders warme Kleidung. Ich hatte von früher noch eine sehr gut gefertigte „Northface Outdoor“-Jacke, die mir sicher gute Dienste erweisen würde. Ich würde ein Reisetagebuch schreiben, ich packte also eine Kladde und einen guten Kugelschreiber in meinen Rucksack. Zum Glück fiel mir ein, dass ich mit meinem Schweizer Messer wohl nicht durch den Security-Check am Flughafen kommen würde, ich ließ es also zu Hause. Ich würde mir irgendwo unterwegs ein entsprechendes Messer besorgen.
Von allen wichtigen Dokumenten, die ich mitnehmen würde, machte ich Fotokopien, was die Wiederbeschaffung verloren gegangener Papiere erleichtern würde. Und dann ging es los! Vieles musste sich noch einspielen, zum Beispiel, wo ich mein Geld aufbewahren sollte, wie viel Geld ich immer griffbereit haben musste, wo meine Ausweispapiere waren, aber das würde sich alles schon finden. Ich verabschiedete mich von zu Hause und versprach, mich regelmäßig telefonisch zu melden. Das wäre ja alles kein Problem! Ich fuhr nach Düsseldorf.
Noch sah ich aus wie ein x-beliebiger Backpacker. Wie oft ich schon auf dem Düsseldorfer Flugplatz war! Ich war ganz in Gedanken, es würde nicht in einen vorbereiteten Urlaub gehen. Wenn ich von Istanbul aus in den Ostteil der Stadt übergesetzt hätte, nach Asien, dann würde mein großes Abenteuer beginnen. Die Busfahrt von Köln hätte sicher vierzig Stunden gedauert, mit dem Flugzeug wäre ich in drei Stunden am Atatürk-Airport. Gut, dass ich das Schweizer Messer zu Hause gelassen hatte, wir wurden alle sehr genau gecheckt!
Wie ließ sich meine Stimmung beschreiben?
Istanbul
In Istanbul angekommen war ich guter Dinge, das Wetter war herrlich, Sommerhitze! Aber ich war nicht entspannt, ich dachte voraus, an die Dinge, die auf mich zukommen würden, mit denen ich nicht rechnete, die mich vielleicht überraschten, auch negativ! Aber ich hatte keine Angst, im Gegenteil, dieses gespannte Gefühl hatte etwas Konstruktives, Vorwärtstreibendes. Ich fuhr mit Metro und Straßenbahn in die Stadt. Der Atatürk-Airport lag dreißig Kilometer außerhalb Richtung Griechenland.
Die U-Bahn war klimatisiert, in der Straßenbahn machten sich aber dann unangenehme Körpergerüche breit, die Leute stanken. Das schien aber niemanden sonderlich zu stören. Man hielt sich an den an der Deckenstange befestigten Haltegriffen fest und entblößte so die schwitzenden Achselhöhlen. Bestenfalls wandten die Leute scheinbar teilnahmslos ihr Gesicht ab und blickten nach draußen. Ich war froh, als ich endlich in Eminönü angekommen war. Jemandem, der es nicht gewohnt war, solch einen Gestank in der Öffentlichkeit um sich zu haben, war das doch unangenehm, sich mit den schwitzenden Zeitgenossen in der Straßenbahn herumdrücken zu müssen. Aber da sollten mir noch ganz andere Gerüche um die Nase wehen! In Eminönü suchte ich in der Hamidye Caddesi die Verwandten eines ehemaligen Klassenkameraden auf.
Aydin hatte es auf unserem Gymnasium tatsächlich bis zum Abitur geschafft. Er stammte aus Istanbul, sein Vater kam Anfang der 1970er Jahre nach Deutschland und bekam einen Job bei Krupp. In Istanbul wohnten seine Tante, sein Onkel, sein Cousin und sein Großvater. Die Familie wusste schon von Aydin, dass ich kommen würde und hieß mich willkommen, er selbst war nicht zu Hause. Es war ein quirliges Stadtviertel, in dem die Familie wohnte. Eine Unzahl von Menschen huschte über die Hamedi Caddesi hin und her und ging irgendwelchen Geschäften nach. Es gab zig kleine Läden in der Straße, in denen mit allem Möglichen gehandelt wurde. Sie waren uralt und wurden über Generationen geführt. Das war genau das, was den Charme dieser gigantischen Metropole ausmachte, ein Stück Beständigkeit in dem sich permanenten Veränderungen zuwendenden Trubel.
Aydins Onkel besaß ein altes zweistöckiges Haus, in dem er ein Geschäft besaß, er handelte mit Haushaltswaren, mit Töpfen, Gläsern und Küchenutensilien, besonders Besteck. Hinten im Laden gab es eine Messerschleiferei, die Leute kamen und brachten ihre stumpfen Haushaltsmesser, manche brachten auch Äxte. Ganz früher gab es auch eine Messerschmiede, davon konnte der Großvater erzählen. Aydins Cousin übersetzte, was der Großvater über seine Zeit als Messerschmied zu berichten wusste. Aus allen Stadtteilen Istanbuls wären die Menschen herbei geströmt und hätten seine Messer haben wollen, er hätte Bestellungen für Wochen gehabt. Man war immer zufrieden mit seiner Arbeit und die Leute kamen, um ihre Messer schleifen zu lassen. Mit einem Male war Schluss mit der Messerschmiede, billige Messer aus Fernost überschwemmten den Markt. Da konnte Aydins Großvater preislich nicht mithalten, er gab die Schmiede auf.
Hinten im Laden konnte man noch die erloschene Esse und den Amboss bestaunen, sie sahen aus, als könnte man sie jederzeit wieder benutzen, ein Feuer entfachen, die Glut mit dem Blasebalg anfachen und dann den Eisenrohling erhitzen, um ihn auf dem Amboss zu schmieden, tack, tack, tack, die Hammerschläge wären in der ganzen Nachbarschaft zu hören, sie waren immer der Pulsschlag des geschäftigen Lebens in der Hamedi Caddesi. Aber das war längst vorbei. Messer kamen aus industrieller Fertigung und waren bei weitem nicht so langlebig wie die, die Aydins Großvater geschmiedet hatte. Er trauerte der Zeit nach, saß in seinem Sessel und träumte in den Tag hinein.
Ursprünglich stammte er aus Konya, siebenhundert Kilometer südöstlich von Istanbul. Aydins Onkel ging seinen Geschäften nach, Aydins Tante war einkaufen, Aydins Cousin, der fünfzehn Jahre alt war und ich saßen beim Großvater und hörten, was er zu erzählen hatte. Er rauchte streng riechende Orientzigaretten, seine Finger waren ganz gelb von dem Zigarettenqualm. Pro Tag genehmigte er sich ein, zwei Raki, mehr trank er nicht. Das Alkoholtrinken hatte in der Türkei keine Tradition, nicht so wie bei uns, wo man bis zur körperlichen Erschöpfung soff. Der Großvater hieß Yussuf und schien froh zu sein, jemanden gefunden zu haben, der ihm zuhörte, Aydins Cousin, Mehmet, übersetze fleißig. Yussufs Augen glänzten, wenn er von früher erzählte. Seine Frau Hatice war vor vier Jahren an Krebs gestorben. Er hatte sie sehr geliebt und kam lange Zeit nicht über ihren Tod hinweg. Als Yussuf von meinem Vorhaben, die Seidenstraße entlang zu pilgern hörte, war er lange Zeit still. Dann schaute er mich an, als wollte er sagen:
„Du willst also die Welt entdecken!
Es sprudelte aus ihm heraus, ich musste ihm meine Ausrüstungsgegenstände zeigen, er nahm meinen Rucksack in die Hand und nickte anerkennend mit dem Kopf. Dann begutachtete er meine „Raichle“-Schuhe, sah sich genau deren Verarbeitung und die Sohle an und attestierte auch den Schuhen gute Qualität. Ob ich denn alles zu Fuß machen wollte. Ich verneinte und sage, dass ich alle sich mir bietenden Verkehrsgelegenheiten nutzen wollte. Ob ich denn kein Messer hätte, wollte Yussuf von mir wissen und ich sagte ihm, dass ich mit einem Messer nicht durch die Sicherheitsüberprüfung am Flughafen gekommen wäre.
Wenn ich zwei Tage Zeit hätte, könnte er mir ein Messer schmieden, sagte Yussuf dann. Ich antwortete, dass ich vier Tage in Istanbul bleiben und ihm beim Schmieden eines Messers gern zusehen wollte. Wieder hatte Yussuf den Glanz in den Augen, „gut“ sagte er dann, wir würden am nächsten Tag in den Großen Basar gehen und Messerstahl kaufen, er hätte einen alten Bekannten im Großen Basar, der sich auskannte und nicht betrügen würde. Ich müsste für ein geschmiedetes Messer aber schon dreißig bis vierzig Euro ausgeben!
Ich willigte ein und entgegnete, dass ich gerne bereit wäre, für ein gutes Messer so viel Geld auszugeben. Ich bekam ein eigenes Zimmer neben dem von Mehmet und ging früh schlafen. Aydins Onkel und Tante verließen am nächsten Morgen nach dem Frühstück zeitig das Haus. Wir liefen zum Großen Basar, den wir nach zehn Minuten erreichten, es wimmelte von Touristen. Die Händler waren alle auf die Touristen eingestellt und belagerten sie. Immer wenn sich eine Touristengruppe näherte, gingen sie auf sie zu und priesen ihre Ware an. Oft hatten sie den typischen Touristenramsch im Angebot, viele Touristen vielen darauf herein und kauften zu völlig überzogenen Preisen. Immer gaben die Händler den Touristen das Gefühl, gehandelt und ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Dabei machten sie selbst gut und gerne zweihundert bis dreihundert Prozent Gewinn. Der Große Basar war ein fünfhundert Jahre altes Geschäftsviertel in Istanbul, er bestand aus einem Gewirr von überwölbten Gassen und Gässchen. In der Mitte befanden sich die Gold- und Silberhändler. Eine Menge Cafes reihten sich aneinander. Yussuf ging zielstrebig auf seinen Händler zu.
Mustafa führte seinen Stand schon in der dritten Generation, er handelte mit Messern und Schmuck, man konnte über ihn aber auch Rohstahl beziehen, so wie er zum Schmieden gebraucht wurde. Er umarmte Yussuf herzlich und ging dann mit ihm in die hinterste Ecke seines Verkaufsraumes, dort kramte er ein Stück Rohstahl hervor. Yussuf nahm das Stück in Augenschein und befand es für gut, man wurde schnell handelseinig. Yussuf zahlte und ging mit Mehmet und mir wieder hinaus, er freute sich über das gute Geschäft, das er gemacht hatte. Wieder glänzten seine Augen, wahrscheinlich in Vorfreude auf seine Schmiedearbeit. Zu Hause angekommen schickte er Mehmet los, Holzkohle kaufen. Er entfachte auf seiner alten Feuerstelle ein kleines Holzfeuer und schichtete, als es richtig brannte, Holzkohle darauf. Die Esse zog immer noch gut. Den Blasebalg hatte man inzwischen elektrifiziert. Yussuf leitete den Luftstrom vorsichtig auf die Holzkohle, bis sie weiß glühte. Dann legte er den Stahlrohling in die Glut und wartete, bis er die Schmiedetemperatur erreicht hatte. Anschließend nahm er den Rohling mit der Schmiedezange und legte ihn auf den Amboss. Yussufs Bewegungen waren fast jugendlich und bestimmt, mit großer Eleganz schlug er mit dem Hammer auf den Stahlrohling und formte ihn nach seinem Willen. Tack, tack, tack, der alte Arbeitsrhythmus war wiedergekommen.
In der Nachbarschaft wunderte man sich, dass Yussuf seine Schmiedearbeit wieder aufgenommen hatte. Mehmet erklärte Neugierigen, was es damit auf sich hatte. Yussuf war lange Zeit nicht ansprechbar, er schien in seiner Arbeit versunken. Immer wieder legte er den Rohling ins Feuer, bis er rot glühte und schlug dann mit dem Schmiedehammer auf ihn ein.
Diese Tätigkeit dauerte Stunden. Mit einem Mal legte Yussuf den Hammer zur Seite und wischte sich den Schweiß von der Stirn, er schickte Mehmet los, für uns etwas zu essen zu kaufen. Eine keine Arbeitspause würde ihm gut tun. Immer wieder nahm er den Stahl in die Hand, er hatte ihn in einem Wassereimer abgekühlt, der Stahl hatte mittlerweile eine schöne Messerform. Nach der Pause nahm Yussuf seine Hammertätigkeit mit unverminderter Intensität wieder auf, am frühen Abend war er fertig. Er legte den Hammer zur Seite, wischte sich den Schweiß ab und setzte sich, etwas entfernt von der Feuerstelle, auf einen Stuhl. Das Messer war in seiner Rohform fertig, es fehlten noch der Griff und die Scheide und es musste noch ein Endschliff gemacht werden. Das würde Yussuf am nächsten Tag erledigen. Er wäre müde, sagte er und ließ sich, von Mehmet gestützt, nach oben bringen. Mehmets Eltern wunderten sich, warum Yussuf so umtriebig wäre. Mehmet erklärte, dass er für mich ein Messer geschmiedet und den ganzen Tag am Amboss gestanden hätte.
Sie sagten nichts dazu, Mehmets Mutter schüttete Yussuf einen Raki ein und setzte ihn in seinen Sessel, dann gab sie ihm seine Zigaretten. Yussuf war mit sich und seiner Arbeit zufrieden. Er würde am nächsten Tag drei Löcher in den Schaft bohren, um dann zwei Griffschalen an das Heft zu nieten. Er trank genüsslich seinen Raki und rauchte eine Zigarette. Ich lobte ihn für die Standhaftigkeit, mit der er seine Arbeit verrichtet hatte und ich lobte das Messer, das er gefertigt hatte. Nach vierzig Minuten war Yussuf eingeschlafen, sein ebenmäßiges Gesicht strahlte eine Zufriedenheit aus, wie sie nur ein guter Handwerker nach getaner Arbeit haben konnte. Mehmets Eltern führten Yussuf auf sein Zimmer und legten ihn ins Bett. Mehmet und ich gingen am Abend hinaus und liefen zur Galata-Brücke. Ich sah vom Fähranleger in Eminönü hinüber nach Üsküdar, auf dem Bosporus herrschte reger Schiffsverkehr, die Fähren zogen unablässig zwischen den großen Schiffen hindurch, die vom Mittelmeer ins Schwarze Meer zogen und umgekehrt. An der Galata-Brücke standen die Angler und warfen die gefangenen Fische in Plastiktüten, die sie vor sich hingestellt hatten. Sie unterhielten sich ununterbrochen, die meisten Angler rauchten, vom Halic zog ein unangenehmer Geruch herüber. Auf der anderen Seite der Galata-Brücke lag auf halber Höhe in Beyoglu der Galata-Turm. Dort am Bosporus lag Europas Ostgrenze, in zwei Tagen würde ich nach Asien übersetzen und für lange Zeit alles hinter mir lassen. Mehmet und ich liefen am Halic entlang, das kurze Stück bis zur Yeni-Moschee.
Dann gingen wir wieder stadteinwärts in die Hamidye Caddesi. Bis spät in den Abend hatten die Geschäfte geöffnet, der Trubel auf der Straße hatte kaum nachgelassen. Mehmet und ich gingen hoch und setzten uns eine Zeit in sein Zimmer. Er hatte einen PC und einen Fernseher. Mehmet zeigte mit die Spiele, die er auf seinen PC geladen hatte. Ich fragte ihn, was er später einmal werden wollte, Mehmet sagte, dass er das noch nicht genau wüsste, wahrscheinlich würde er aber irgendetwas in der Informatikbranche anstreben. Er wollte studieren, aber nicht in Istanbul, vielleicht in Konya, dort gäbe es 8500 Studenten in sechzehn Fakultäten. Aber zuerst müsste er seinen Schulabschluss machen, er schaltete den Fernseher an und stellte MTV ein. Wie zu Hause, dachte ich und schaute mir ein paar Clips an. Dann ging ich ins Bett. Der nächste Tag stand wieder im Zeichen der Messerfertigung. Yussuf war früh aufgestanden, was er aber immer tat. Er hatte in seiner Werkstatt aus früheren Zeiten noch einen Ebenholzblock liegen, daraus hatte er immer seine Griffschalen hergestellt. Er sägte und schliff mit der gleichen Behändigkeit, mit der er auch geschmiedet hatte.
Dann passte er die Griffschalen an, polierte hie und da noch ein bisschen und schlug drei Hohlnieten durch die Ebenholzgriffe und das Messerheft. Ich nahm das Messer, es lag ausgezeichnet in der Hand, Yussuf sah mir an, dass mir das Messer gefiel, er war stolz auf seine Arbeit. Er setzte sich noch eine halbe Stunde an den Schleifstein, dann war das Messer fertig. Yussuf nahm ein Stück Leder und schnitt zwei Scheidenhälften daraus, mit einer Ahle stach er Löcher für die Naht aus. Mit geübtem Griff nähte er aus den zwei Lederhälften eine Messerscheide zusammen, er heftete gleichzeitig eine Gürtelschlaufe daran.
Dann machte Yussuf ein feierliches Gesicht und händigte mir seine hervorragende Handwerksarbeit aus.
Ich zog meinen Hosengürtel durch die Lederschlaufe und steckte das Messer in die Scheide. Mit einem Mal befiel mich ein Gefühl der Zufriedenheit, ich hatte mein Messer! Natürlich könnte ich es nicht die ganze Zeit am Gürtel tragen, es würde mir gestohlen werden. Ich gab Yussuf vierzig Euro, er war zufrieden. Dann setzte er sich in seinen Sessel und begann, auf mich einzureden. Mehmet kam mit der Übersetzung kaum hinterher. Ich sollte auf meinem Weg nach Osten unbedingt in Konya Station machen. Ich könnte von Istanbul-Haydarpascha mit der Anatolischen Eisenbahn bis nach Konya fahren, dann wäre ich schon ein gutes Stück nach Osten vorwärts gekommen. Yussuf wünschte mir für meine Reise Allahs Segen und nannte mir die Adresse seines Bruders in Konya, da könnte ich übernachten. Es hätte ihn sehr gefreut, noch einmal schmieden zu können. Ich sollte ihm unbedingt schreiben, vielleicht sogar aus China!
Ein Lächeln überflog sein Gesicht, als er das sagte, wie auch immer das zu deuten war. Ich packte meine Sachen zusammen, am nächsten Tag würde ich von Haydarpascha aus weiterfahren.
Ich dankte Yussuf für die viele Mühe, die er sich gemacht hatte und dankte ihm für den Tipp mit Konya. Mehmets Eltern würde ich am nächsten Tag nicht mehr sehen, ich ging zu ihnen und dankte ihnen für ihre Gastfreundschaft. Ich hatte im Großen Basar für Mehmets Mutter ein Parfum und für seinen Vater ein Deo gekauft. Sie freuten sich darüber und wünschten mir alles Gute. Ich sah mir mit Mehmet noch ein paar Clips auf MTV an, dann legte ich mich ins Bett. Am nächsten Morgen war ich schon früh auf und trank mit Yussuf Cay. Mehmet kam gegen halb neun zu uns und frühstückte. Ich hatte nicht viel Hunger, ich musste immer an meine Fähre und meine Zugfahrt nach Konya denken. Der Abschied kam schnell. Um halb zehn sagte ich Yussuf endgültig Lebewohl, ich glaubte, in seinen Augen ein paar Tränen gesehen zu haben. Ich schlug ihm auf die Schulter und musste auch ein-, zweimal schluchzen. Dann umarmte ich Mehmet und schlug auch ihm auf die Schulter. Ich nahm meinen Rucksack und lief los zur Fähre Eminönü-Kardaköy, die in Haydarpascha Zwischenstation machte. Die Fähre verkehrte stündlich und war immer voll. Sie schaukelte ziemlich, als wir den Bosporus überquerten.
Nach fünfunddreißig Minuten legte wir in unmittelbarer Bahnhofsnähe an. Ich lief sofort in den Bahnhof und erkundigte mich nach dem Konya-Zug. Der würde in einer halben Stunde abfahren, sagte mir der Beamte am Schalter. Ich kaufte schnell ein Ticket und setzte mich auf den Bahnsteig. Bei einem mobilen Händler nahm ich eine Sesambrezel und ein Flasche Wasser. Der Zug stand schon bereit, Haydarpascha war ja ein Kopfbahnhof.
Ich setzte mich in einem Waggon ans Fenster und wartete auf die Abfahrt. Der Zug setzte sich pünktlich in Bewegung und schlängelte sich nach Süden immer die Küste entlang. Nach etwa einer Stunde nahm ich einen letzten Blick auf das Marmara-Meer, dann verschwand der Zug im Landesinneren.
Die Landschaft, die am Zugfenster vorbei rauschte, war sehr abwechslungsreich, schon bald hörte das Grün der Felder und Wälder auf und wich einem Grau-Rot von karger Steppe und wüstenartigen Landstrichen.
Konya
Sehr spät am Abend erreichten wir Konya, die Fahrt hatte doch zwölf Stunden gedauert. Ich nahm ein Taxi zu Yussufs Bruder, der extra aufgeblieben war und mich empfing, toll, die Gastfreundschaft! Er fragte, ob ich etwas trinken wollte, ich lehnte dankend ab und legte mich hundemüde in das Bett, das Ahmed mir zuwies. Ich wünschte ihm eine gute Nacht und schlief sofort ein. Ahmed sprach ein paar Brocken Deutsch, ich saß am nächsten Morgen mit ihm beim Frühstück und trank Cay. Seine Frau Menhire ließ sich nur kurz blicken, ich begrüßte sie, bevor sie wieder verschwand. Ahmed hatte Sesambrezeln geholt, die wir mit Marmelade aßen. Dann fragte er nach Yussuf und ich erzählte ihm von seinem Bruder, dass es ihm gut ginge in Istanbul und dass er mir ein Messer geschmiedet hätte. Ich zeigte Ahmed mein Messer und er sagte, dass er Yussufs Schmiedekunst schon immer bewundert hätte. Schon früher wäre er in Konya ein großer Schmied gewesen. Yussuf wäre in seiner Jugend bei einem der bedeutendsten Schmiede Konyas in die Lehre gegangen. Ahmed nahm mein Messer in die Hand und kam ins Schwärmen. Das wäre eine wirklich tolle Arbeit, fand Ahmed, ich sollte bloß auf mein Messer Acht geben! Dann gab er es mir zurück und ich steckte es in die Scheide, ich packte das Messer in die Rucksackseitentasche, am Gürtel wollte ich das Messer nicht tragen. Ahmed wollte mir Konya zeigen, er hätte mit Yussuf telefoniert und wüsste von meinen Plänen, die Seidenstraße zu bereisen. Ich müsste nach Tabriz in den Iran, von dort aus hätte ich direkten Anschluss an die Seidenstraße. Er würde jemanden in Malatya kennen, fünfhundert Kilometer weiter östlich, dorthin könnte meine nächste Etappe führen. Hassan hieß sein Bekannter und wäre ein Derwisch.
Konya war die Hochburg der Derwische. Aus der ganzen Türkei kamen Anhänger dieser Glaubensrichtung nach Konya. Die Derwische waren eine muslimische asketisch-religiöse Ordensgemeinschaft, sie trat für Liebe, Bescheidenheit und Disziplin ein. Der ekstatische Tanz, dessentwegen die Derwische vor allem bei uns waren, galt als Möglichkeit, über die Ekstase zu Allah zu finden. Der Trancetanz (sena) war ein Kreistanz, die Derwische drehten sich unablässig um die eigene Achse, um ihr Herz, wie sie sagten. Sie hatten dabei eine Hand zum Himmel geöffnet, um von Gott zu empfangen und eine Hand nach unten geöffnet, um den Menschen zu geben. Der Mevlevi-Orden war in Konya beheimatet, er ging auf den lange Zeit in Konya gelebt habenden persischen Mystiker Mevlana (1207-1273) zurück. Ahmed wollte mit mir zu einer Sena-Zeremonie gehen, die ausschließlich für Touristen veranstaltet wurde. Seit dem 2. September 1925 waren alle religiösen Aktivitäten verboten. Kemal Atatürk hatte somit auch das Wirken der Derwische untersagt.
Einzig die touristische Darbietung in Konya, die in der gesamten Türkei einen sehr hohen Stellenwert hatte, war erlaubt, sie kam in ihrer Bedeutung gleich nach Mekka. Konya war Hauptstadt des Ruma-Seldschukkenreiches, die Seldschukken galten als tolerant und weltoffen, sie duldeten alle Religionen nebeneinander. In unserer Zeit galt Konya eher als konservativ, am frühen Abend leerten sich die Straßen. Konya war eine sehr große Stadt mit fast einer Million Einwohnern. Ahmed ging mit mir zu den Derwischen, sie durften ihren Tanz in einer Turnhalle aufführen. Es war schon faszinierend zu sehen, mit welcher Hingabe die Derwische ihre Drehungen vollführten, ohne schwindelig zu werden. Ihr Gesichtsausdruck war dabei entrückt, sie blickten starr und teilnahmslos, wenn sie ihren Tanz beendet hatten.
Ahmed traf seinen Bekannten aus Malatya und umarmte ihn herzlich. Sie hatten sich ein ganzes Jahr lang nicht gesehen. Ahmed fragte Hassan, ob sein Reisebus mich mit nach Malatya nehmen könnte. Hassan überlege kurz und willigte dann ein. Ich sollte ihm ein bisschen Spritgeld geben, dann würde er mich mitnehmen. Die Fahrt würde aber zehn Stunden dauern, ich sollte mich am nächsten Morgen um acht Uhr an der Ecke Mevlana Caddesi/Aziziye Caddesi einfinden, dort würde man mich abholen. Ich dankte Hassan für sein Entgegenkommen und freute mich über die relativ unproblematische Weise, weiterzukommen.
Als Ahmed und ich wieder nach Hause gingen, war es 20.30 h, die Stadt war wie ausgestorben. Ahmed und ich saßen noch lange in seiner Küche und erzählten. Er war Lehrer für Türkisch und Mathematik an einer Art Mittelschule. Yussuf und er mochten sich sehr, auch Yussufs Frau wäre aus Konya gekommen. Seit sie tot war, wäre es um Yussuf ruhiger geworden.
Wie Yussuf auch rauchte Ahmed Orientzigaretten und trank ein, zwei Raki pro Tag. Ich nahm einen RaKi und fand ihn eigentlich sehr lecker, wie Ouzo, nur nicht so eiskalt. Er hatte Zimmertemperatur und konnte deshalb sein ganzes Aroma entfalten. Einmal im Jahr sahen sich die Brüder, abwechselnd fuhr Ahmed nach Istanbul oder kam Yussuf nach Konya. Sie waren beide schon über siebzig und deshalb nicht mehr ganz beweglich. Als Ahmed das letzte Mal in Istanbul war, waren sie beide mit der Straßenbahn über die Galata-Brück bis nach Kabatas gefahren. Anschließend waren sie mit der Seilbahn zum Taksim-Platz hoch und die Istiklal Caddesi entlang spaziert. In verschiedenen Lokalen hatten sie Pause gemacht und den einen oder anderen Raki getrunken. Beide tranken sie aber nie zu viel, keiner hatte den anderen jemals betrunken gesehen. Yussuf lebte schon seit fünfzig Jahren in Istanbul. Er war damals von Konya fortgegangen, weil es keine Arbeit mehr für Schmiede gab. Ahmed war seit mehr als zehn Jahren außer Dienst. Er lebte gern in Konya, seine Frau Menhire kümmerte sich um den Haushalt und bekochte ihn. Am nächsten Tag würde ich im Bus mit dem Schreiben beginnen, ich hatte ja schon einiges erlebt.
Um 23.30 h gingen Ahmed und ich zu Bett. Um 6.00 h stand ich schon wieder auf, ich musste ja um 8.00 h an der vereinbarten Stelle sein. Ahmed frühstückte wieder mit mir, er war ein anderer Typ als Yussuf, dennoch war zu erkennen, dass sie Brüder waren, da waren bestimmte Bewegungen, die auch Yussuf machte, die Art, wie Ahmed seine Zigarette hielt, wie er im Sessel saß, die hatte ich auch schon bei Yussuf gesehen. Um 7.00 h verabschiedete ich mich von Ahmed und dankte ihm, ich umarmte ihn und ging. Es war ein frischer Morgen, die Sonne schien aber. Ich war schon um 7.30 h an der Ecke Mevlana Caddesi/Aziziye Caddesi, es gab schon viel Autoverkehr, die Leute fuhren alle zur Arbeit. Ich trug an diesem Morgen meine „Raichle“, die waren schön warm, auch meine „Northface“-Jacke wärmte mich. Mein Rucksack trug sich wirklich gut, ich war aber auch, außer zu Hause, noch keine weiteren Strecken mit ihm gelaufen. Kurz nach acht erschien der Bus und nahm mich auf. Hassan begrüßte mich und stellte mich der Reisegesellschaft vor. Die Leute nickten alle sehr freundlich. Ich konnte mich mit dem einen oder anderen auf Englisch, mit einigen wenigen sogar auf Deutsch unterhalten. Alle kamen sie aus Malatye. Hassan konnte gebrochen Deutsch. Sein Schwager und er hatten zehn Jahre lang bei Ford in Köln gearbeitet.
Hassan sprach in hohen Tönen von Deutschland, er lobte die Sauberkeit und Ordnung, die Zuverlässigkeit der Bus- und Bahnverbindungen und den guten Lohn.
Malatya
Dennoch wäre er froh, wieder in seiner Heimatstadt Malatya sein zu können. Er betrieb ein kleines Hotel im Ort, „Gelbe Rose“ wäre sein Name. Dort würde ich ein Zimmer bekommen und wäre sein Gast. Das fand ich ausgesprochen nett von ihm. Ich hatte meinen Rucksack oben ins Gepäcknetz gelegt und zog aus der Seitentasche meine Kladde und den Kuli heraus. Dann fing ich mit meinem Reisetagebuch an. Der Anfang war immer schwer, als ich aber in Istanbul angekommen war, lief alles wie von selbst. Der Bus nahm die Strecke nach Adana. Weit vor Adana, circa hundertfünfzig Kilometer vorher, begann die Autobahn. Wir würden sie ungefähr zweihundertfünfzig Kilometer entlang fahren, bis wir den Abzweig nach Malatya nehmen würden, dann hätten wir noch einmal dreihundert Kilometer. Ich schrieb und schrieb, es machte Spaß, sich zurück zu erinnern, eigentlich war es doch schon eine Menge, die ich erlebt hatte. Ab und zu fragte Hassan, was ich gerade schrieb und ich erzählte dann ausführlich, wie ich in Istanbul ankam und bei den Eltern meines Klassenkameraden in Eminönü wohnen durfte. Hassan sagte, dass er Istanbul sehr europäisch fände. Das wäre okay, schließlich könnte man die Entwicklung der Stadt kaum steuern. Ihm wäre aber in Istanbul alles zu überlaufen, es herrschte zu viel Trubel.
Die Sonne schien in den Bus und wärmte die Luft im Businnern auf. Längst hatte ich die Jacke und meine Wanderschuhe ausgezogen, ich hatte meine Schlappen an. Gegen Mittag legten wir auf einem Rasthof bei Adana eine Pause ein. Es war richtig heiß geworden. Konya lag auf 1200 m Höhe, hier unten waren wir auf Meeresniveau. Alle gingen etwas essen, ich kaufte mir etwas Obst und ein paar Sesambrezeln. Dann füllte ich auf der Toilette meine Wasserflasche auf. Ich legte mich in Busnähe auf dem Rasen in den Schatten und döste vor mich hin. Hassan kam und setzte sich neben mich, er fragte, ob ich wirklich die Seidenstraße entlang reisen wollte. Ich bejahte seine Frage, er aber wollte wissen, warum ich eine solche Strapaze auf mich nehmen wollte. Ich antwortete, dass ich in mich gehen und über verschiedene Dinge, die für mein weiteres Leben wichtig wären, in Ruhe nachdenken wollte. Ich hätte einen bestimmten Lebensabschnitt beendet, das wäre meine durch mein Elternhaus behütete Schulzeit gewesen. Ich müsste von da an lernen, allein mit meinem Leben klar zu kommen. Dazu wollte ich mich auf die Probe stellen. Würde ich scheitern, bräche ich die Reise ab und flöge nach Hause. Wenn ich aber die Reise erfolgreich hinter mich brächte, wäre ich um viele Erfahrungen reicher, das wären Erfahrungen, die mir niemand nehmen könnte. Ich glaubte, diese Erfahrungen würden mich mein Leben lang begleiten. Im übrigen müsste ich darüber nachdenken, was ich nach meiner Rückkehr studieren wollte. Es wäre mit klar, fuhr ich fort, dass ich auf sehr privilegierte Weise reiste, ich hätte eine sehr gute Ausstattung und auch Geld, eigentlich könnte ich gar nicht scheitern. Im Extremfall würde ich einfach nach Hause fliegen. Dennoch gehörte einiges an Mut dazu, eine solche Reise zu unternehmen, meinte Hassan. Er wünschte mir auf jeden Fall viel Erfolg und Glück. Die Mittagspause war zu Ende, wir fuhren weiter. Am Nachmittag erreichten wir den Abzweig nach Malatya, ich packte meine Kladde und meinen Kuli wieder in den Rucksack und versuchte, ein kleines Nickerchen zu machen. Es wurde mit einem Male richtig gebirgig um uns herum, es waren wohl die Ostausläufer des Taurusgebirges, die uns die vielen Kurven bescherten. Am frühen Abend passierten wir Golbasi, wir hätten dann noch zwei Stunden bis Malatya. Um 22.00 h kamen wir an. Ich streckte meine Glieder, zog meine „Raichle“ und meine „Northface“ an und nahm meinen Rucksack auf. Dann stieg ich aus.
Hassan hatte einen kleinen Trolley-Koffer und kam zu mir. Wir müssten noch ungefähr zehn Minuten laufen, sagte er, die frische Luft würde uns bestimmt gut tun. Da hatte Hassan recht, die Busfahrerei hatte die Knochen ermüdet, es war gut, wieder ans Laufen zu kommen. Dann erreichten wir Hassans Hotel „Gelbe Rose“. Es war ein kleines Hotel mit zwölf Zimmern. Hassan hatte hauptsächlich Urlauber zu Gast. Die Umgebung Malatyas war sehr gebirgig und ein lohnendes Ziel für Wanderer. Es gab in erreichbarer Nähe sogar Schneegipfel und man konnte im Karakaya-Stausee baden. Hassan bot in seinem Hotel Vollpension an und nahm dafür 60 TL, was ungefähr 25 Euro entsprach.
Für unsere Verhältnisse war das ein extrem günstiger Preis, für Türken war das viel Geld, blieb aber bezahlbar. Hassans Frau stand in der Küche, sein Schwager, mit dem er in Köln gearbeitet hatte und seine Schwester arbeiteten auch in dem Hotel, sie wohnten unmittelbar nebenan. Ich saß mit Hassan noch einen Moment im Gastraum, wo er mir erzählte, warum er Derwisch war und was das für ihn bedeutete. Ganz so wie ich auch wäre er auf der Suche nach sich selbst und glaubte, als Derwisch fündig geworden zu sein. Er sähe seine Aufgabe darin, da, wo es möglich wäre, asketisch zu leben und den Mitmenschen zu helfen. Er wäre nicht so übertrieben orthodox, wie viele seiner Mitstreiter, glaubte aber fest an die Richtigkeit des Sufismus. Ein Sufi wäre die arabische Version des Derwisch, der persisch wäre. Ich fand es interessant, was Hassan erzählte, war aber mittlerweile sehr müde geworden.
Hassan zeigte mir mein Zimmer und sagte „gute Nacht“. Ich schlief wie ein Stein, Malatya lag 950 m hoch, es war wieder frisch geworden, ich zog mir die Decke über die Ohren. Am nächsten Morgen gab es ein ausgezeichnetes Frühstück. Es gab verschiedene Arten von Honig, Malatya leitete sich von dem hethitischen Wort „Melid“ für Honig ab. Die Stadt war uralt und in der bestehenden Form der dritte Wiederaufbau, sie war schon um 1710 v. Chr. Teil des Hethiterreiches. Die unterschiedlichsten Herrscher wechselten sich in Malatya ab, Hethiter, Römer, Byzantiner, Araber, Seldschukken und Osmanen.
Seit 1924 war Malatya türkische Provinz. Die Hauptstadt hatte 450000 Einwohner und eine mittelgroße Universität. Hassan hatte oft die Eltern von deren studierenden Kindern zu Gast. Er zeigte mir seine Heimatstadt und ging mit mir in eine Teestube. Dort grüßte er mehrere Bekannte und stellte mich ihnen vor. Einige kramten ein paar Brocken Deutsch hervor und begrüßten mich auf Deutsch. Sie hatten einige Jahre in Deutschland gearbeitet und das verdiente Geld gespart. In Malatya hatten sie dann für sich und ihre Familie ein Häuschen gekauft. Viele waren in Malatya mit dem Anbau von Aprikosen beschäftigt. Neunzig Prozent der weltweit produzierten Trockenaprikosen stammten aus Malatya. Auch Hassan hatte einige Aprikosenbäume in seinem Hotelgarten stehen. Die Früchte dienten aber ausschließlich dem Eigenbedarf. Hassan kannte jemanden, der am nächsten Tag einen LKW Aprikosen nach Bingöl bringen würde, er wollte ihn fragen, ob er mich nicht mitnehmen könnte. Alan hieß Hassans Freund, er war Vorarbeiter und LKW-Fahrer in der größten Aprikosenfabrik von Malatya. Alan war Kurde, seine Heimatstadt war Bingöl. Er war wegen seiner Arbeitsstätte nach Malatya gezogen.
Alan war um 16.00 h zu Hause, als wir bei ihm klopften. Er freute sich, Hassan zu sehen und begrüßte auch mich. Er lud uns ein, mit ihm Cay zu trinken, wir nahmen gerne an. Ich lief schnell auf die Straße, um Sesambrezeln zu kaufen. Hassan kam direkt zur Sache, ob Alan mich am nächsten Tag mit nach Bingöl nehmen könnte, ich müsste nach Täbriz und da läge Bingöl direkt an der Strecke. Das wäre kein Problem, sagte Alan, er würde allerdings schon um 7.00 h losfahren. Ich wäre dann bereit, sage ich, und dankte Alan im Voraus.
Um 17.00 h gingen Hassan und ich zum Hotel zurück, Hassan hatte mich zum Abendessen eingeladen. Ich freute mich riesig auf das Abendessen, denn ich hatte den ganzen Tag über nichts Richtiges gegessen. Ich lief schnell auf mein Zimmer und machte mich frisch, dann ging ich in den Gastraum, wo schon Hassans Familie und einige Gäste saßen. Es wurde aufgetischt: es gab Mercimek Corbasi – rote Linsensuppe, Iskender Kebap - Lammfleisch mit Tomatensauce, Brot, Joghurt und geschmolzener Butter, Sogan Salatasi - Zwiebelsalat und es gab zum Nachtisch Baklava - in Sirup getränkten Teig, der mit Pistazien und Nüssen versehen war. Es wurde nicht viel geredet, jeder aß mit Heißhunger. Auf dem Tisch stand sogar Wein aus Diyarbakir. Der Weinanbau war in der Türkei langsam im Kommen begriffen. Neben Diyarbakir gab es in Thrakien, Kappadokien und Izmir Weinanbau. Zum Raki, der auch auf dem Tisch stand, wurde eiskaltes Wasser gereicht. In dem Wasser fiel der Anis aus, sodass die „Löwenmilch“ entstand.
Ich hatte so viel gegessen, dass ich mich kaum noch rühren konnte. Von dem Wein und dem Raki wurde nur wenig getrunken. Fast alle tranken nach dem Essen Cay, ich auch. Ich hatte nie viel Alkohol getrunken, zu Hause mal ein, zwei Bier mit Freunden.
Einmal war ich betrunken, ich war sechzehn und auf eine Party eingeladen, der Martini hatte es mir angetan. Am nächsten Morgen hatte ich einen Brummschädel, den ich so schnell nicht vergaß.