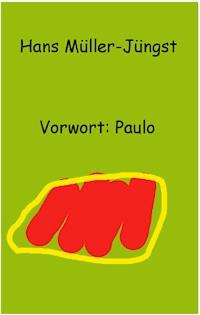Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paulo bereist die Seidenstraße zwei Jahre lang und lernt viele verschiedene Menschen kennen, er stellt fest, dass es bei aller Fremdheit viel Verbindendes gibt, vor allem aber lernt er Ebu, den glühenden Verfechter des zentralasiatischen Islam kennen und begleitet ihn bei seinen Vorträgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HaMuJu
Paulo im Ferganatal (5)
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Im Ferganatal
Ebus Tod
Puppenverkauf
Am Denkmal
Geschäftsvergrößerung
Streik
Impressum neobooks
Im Ferganatal
Der Übergang in das Ferganatal vollzog sich abrupt.
Von der gebirgigen Einöde und Trostlosigkeit gelangte man mit einem Ruck in das dicht besiedelte saftig grüne Ferganatal. Dieses Tal wurde im allgemeinen als das kulturelle Zentrum Zentralasiens betrachtet. Es lebten zehn Millionen Menschen in ihm, das waren zwanzig Prozent der Bevölkerung Zentralasiens. Das Tal war dreihundert Kilometer lang und hundertundzehn Kilometer breit. Es bildete eine Senke zwischen dem Tienshan und dem Alai-Gebirge und erstreckte sich auf die Staatsgebiete von Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan. Das Ferganatal hatte eine lange Geschichte.
Es gab Siedlungsspuren schon aus der Bronzezeit, auch Alexander d. Große hatte eine Rolle im Ferganatal gespielt. Ab dem 18. Jahrhundert war es Zentrum des Khanats von Kokand mit Herrschaftssitz in Kokand. Dieses Khanat war der mächtigste Konkurrent des Emirates von Buchara, es wurde im 19. Jahrhundert zu einem bedeutenden Flächenstaat. 1876 wurde das Khanat von Russland annektiert. Das Khanat wurde 1710 gegründet, als Shah-Rukh das durch Kasacheneinfälle und Sektenstreitigkeiten zerrissene Ferganatal unter seine Kontrolle brachte. Die Seidenspinnerei war im Khanat die ökonomische Basis. Es erlebte im 19. Jahrhundert eine wirtschaftliche Prosperität ungeahnten Ausmaßes. Es entstand ein florierender Handel mit Kashgar in China.
Die landwirtschaftlich Fläche wurde durch Anlegen von Bewässerungskanälen und Gräben erweitert. Die Khane von Kokand verstanden es, durch Intrigen und Unterstützung von Aufständischen in Nachbargebieten ihren Einfluss in Zentralasien so stark auszubauen, dass Kokand im 19. Jahrhundert zu einem der mächtigsten Staaten in ganz Asien wurde. Auf dem Höhepunkt seines Reichtums und seiner Macht hatte Kokand sechshundert Moscheen und fünfzehn Madrasas. Der immer schwelende Konflikt mit Buchara wurde Mitte des 19. Jahrhunderts zugunsten Bucharas entschieden, allerdings wurden die bucharischen Kaufleute aus der Stadt vertrieben, weil sie die Bevölkerung von Kokand vollkommen gegen sich aufgebracht hatten. Ab 1853 begann die russische Expansion, 1868 wurden das Khanat von Kokand genau so wie das Emirat von Buchara ein Vasallenstaat des Zarenreiches. 1896 wurde das Khanat endgültig annektiert und dem Generalgouvernement Turkestan angegliedert.
Die Stadt Kokand hatte früher eine Schlüsselposition am Eingang des Ferganatales, sie lag an der wichtigen Seidenstraße. In unserer Zeit hatte Kokand 190000 Einwohner und war eine relativ schmucklose Industriestadt, in der Dünger, Maschinen, Chemikalien, Textilien und Nahrungsmittel hergestellt wurden. Sie hatte einen Hauptbahnhof und einen Flugplatz. Ferner gab es in Kokand Institute, Hochschulen und Gymnasien. Als Sehenswürdigkeit galt in Kokand der Khanspalast, der zwischen 1863 und 1873 erbaut worden war. Die Fassade wurde von bunten Fliesen geziert, die nach traditioneller Brennweise hergestellt worden waren. Erwähnenswert waren auch die „Dschuma“-Moschee, die Madrasa „Amin Beg“ und das „Hamza“-Museum. Kokand bildete mit den Städten Namangan, Andizhan und Fergana ein Viereck, eigentlich eine Raute, die eine Seitenlänge von ungefähr hundert Kilometern hatte. Die wichtigsten Teile des Ferganatales wurden durch die Raute abgedeckt.
Es gab weiter im Westen von Kokand auf tadschikischem Gebiet die Stadt Khujand, eine sehr bedeutende Stadt, die von Alexander d. Gr. gegründet worden war. Sie lag am Syrdarja, einem Fluss, der das ganze Ferganatal mit Wasser speiste. Sie war wichtiger Handelsknotenpunkt an der Seidenstraße, tatsächlich war die Stadt wegen ihrer Seidenverarbeitung bekannt geworden. Die oben beschriebene „usbekische Raute“ war aber das Gebiet, das von Interesse war und in der sich bis in unsere Zeit hinein die wichtigsten Entwicklungen ereigneten. Der Syrdarja war ein über zweitausend Kilometer langer Fluss, der in Kirgistan entsprang, durch das Ferganatal floss und dann, nachdem er lange über kasachisches Gebiet geströmt war, in den Aral-See mündete. Ein extensiv angelegtes Kanalsystem im Ferganatal sorgte dafür, dass der Syrdarja an seinem Unterlauf nur sehr wenig Wasser führte, ja, dass er oftmals sogar austrocknete und dem Aral-See somit kein Wasser zuführte. Dieser Umweltfrevel wurde schon zu Sowjetzeiten begangen, als die Baumwollindustrie ausgeweitet wurde.
Der Syrdarja entstand durch den Zusammenfluss von Naryn und Karadarja südlich von Namangan. Von dort durchzog der Syrdarja das Ferganatal nach Westen, bis er eingangs des Kairakkum-Stausees die Grenze nach Tadschikistan passierte. Namangan war der nördliche Eckpunkt der „usbekischen Raute“. Die Stadt hatte 400000 Einwohner und war damit nach Taschkent die zweitgrößte Stadt Usbekistans. Sie bildete die usbekische Hochburg in dem von Kirgistan und Tadschikistan beanspruchten Ferganatal. Die Stadt war ein wichtiges Industriezentrum, es gab in der Nähe bedeutende Vorkommen an Erdöl, Gold, Kupfer und Quarz, sie war ein Erdölförderzentrum. In der Landwirtschaft dominierten Baumwolle, Früchte und Gemüse, das dazu notwendige Wasser wurde mit dem nördlichen Ferganakanal vom Syrdarja abgezweigt. Zur Zeit der russischen Besatzung war Namangan ein Zentrum des Islam mit zwanzig Madrasas und sechzig Moscheen. Seit der usbekischen Unabhängigkeit strebte Namangan eine Wiederauferstehung des Islam an, mit vielen Schulen und Moscheen, die von Wohltätigkeitsorganisationen aus dem mittleren Osten, einschließlich der konservativen Wahabi-Sekte aus Saudi Arabien gegründet wurden. Namangan war das Verwaltungszentrum der gleichnamigen Provinz, die das mildeste Klima in Usbekistan hatte. Sie hatte gemäßigte Sommer und kurze warme Winter, weshalb neben Baumwolle auch Aprikosen, Granatäpfel, Weintrauben, Äpfel, Pfirsiche und andere Früchte angebaut wurden. Es gab nicht viel Niederschlag, weshalb eine künstliche Bewässerung erfolgen musste. Haupttransportmittel war in der Provinz das Auto, erst danach kam die Eisenbahn.
Zwischen den Städten im Ferganatal gab es ein gut entwickeltes Flugnetz. Unweit von Namangan lag das historische Dorf „Churt“, in ihm wurden Kunstgegenstände aus Metall wie Messer, Schlüssel und landwirtschaftliche Werkzeuge hergestellt. Berühmt war die Provinz Namangan auch wegen ihrer Seidenraupenzucht.
Andizhan war als Stadt nur drei viertel so groß wie Namangan, sie war Hauptstadt und kultureller Mittelpunkt der gleichnamigen Provinz. Sie lag vierhundertfünfundsiebzig Kilometer südöstlich von Taschkent und war die Ostspitze der „usbekischen Raute“. Sie war seit ihrer Gründung im 9. Jahrhundert wichtiger Handelsknotenpunkt an der Seidenstraße. Im 18. und 19. Jahrhundert war die Stadt Teil des Khanates von Kokand. Andizhan war Geburtsstadt des Gründers des Mongolenreiches Babur Khan (1483-1530). Während der sowjetischen Besatzung wurden die bestehenden Grenzen geschaffen, die das Ferganatal unter die drei Sowjetrepubliken aufteilten. Andizhan selbst wurde Teil der Usbekischen Sowjetrepublik, die ganze Region wurde auf den Anbau von Baumwolle und Feldfrüchten sowie auf die Seidenraupenzucht ausgerichtet.
In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Region Andizhan instabil und unsicher. Armut und ein Aufschwung des islamischen Fundamentalismus schufen Spannungen in der Region und gipfelten in Aufständen in Andizhan im April 1990, während derer Häuser von Juden und Armeniern angegriffen wurden. Im Gefolge des Unterganges der Sowjetunion litten die Stadt und die Region als Ganzes unter einem schweren wirtschaftlichen Verfall. Mehrfache Grenzschließungen schädigten die heimische Wirtschaft stark, sie verschlimmerten die schon weit verbreitete Armut der Bevölkerung Andizhans. Islamische Fundamentalisten etablierten eine Organisation in der Stadt. Im Mai 2005 ereignete sich etwas in der Stadt, das als Andizhan-Massaker in das Bewusstsein der Bevölkerung gelangte.
Dieses Massaker geschah am 13. Mai 2005, als Truppen des Innenministeriums und des Geheimdienstes wahllos in die Menge Protestierender in Andizhan schossen. Die Schätzungen über die Zahl der Toten gingen sehr weit auseinander, sie reichten von 187, so die offizielle Version bis zu 5000, so die Schätzung außenstehender Beobachter. Die Körper vieler Getöteter wurden in Massengräbern verscharrt. Es wurde diskutiert, ob die Truppen unterschiedslos feuerten, um eine Gegenrevolution abzuwenden oder um einen Gefangenenausbruch zu verhindern Eine dritte Theorie sprach von einem Konflikt zwischen Clans um die Regierungsgewalt.
Massive Einsprüche der westlichen Staaten gegen die rigorose Vorgehensweise der usbekischen Truppen bewirkten einen Schwenk in der usbekischen Außenpolitik hin zu den asiatischen Nationen. Die usbekische Regierung schloss die amerikanische Flugbasis in Karshi-Khanabad und verbesserte ihre Beziehungen zu China, Indien und Russland, von denen das Regime bei seinem Vorgehen gegen Andizhan Unterstützung erfuhr. Ursprünglich verlangten die Demonstrierenden die Freilassung von dreiundzwanzig Geschäftsleuten, die wegen Extremismus, Fundamentalismus und Separatismus angeklagt waren. Die Geschäftsleute verneinten ihre Verstrickung in die ihnen vorgeworfenen Verbindungen.
Die Regierung vollzog die geplante Verurteilung, weil es sich bei den Geschäftsleuten um missliebige Personen handelte, deren ökonomischer Einfluss der Regierung zu groß geworden war. Während der Gerichtsverhandlung säumten viertausend Demonstanten das Gebäude. Am 13. Mai feuerten die Truppen Karimows in die Menge, sie nahmen Frauen und Kinder als lebende Schutzschilde. Unklar war, ob Karimow selbst den Feuerbefehl gegeben hatte. Die Truppen schossen systematisch auf alle Verwundeten. Karimow schob die Schuld für die Schießereien auf islamische Extremisten, die schon immer für die Aufrechterhaltung seines repressiven Regierungssystems herhalten mussten.
Es gab viele Augenzeugen, die zu den Massengräbern befragt wurden. Einige gruben ihre Angehörigen wieder aus, um sie nach islamischem Ritus beerdigen zu können. Als Folge des Andizhan-Massakers wurden viele NGOs in Usbekistan verboten, weil ihnen Einmischung in die politischen Angelegenheiten Usbekistans vorgeworfen wurde. Die Europäische Union verhängte ein Waffenembargo über Usbekistan, der britische Außenminister Straw sprach von einer massiven Menschenrechtsverletzung, Steinmeier erreichte die Zusage seitens usbekischer Offizieller, ein Komitee des Roten Kreuzes zur Untersuchung ins Land zu lassen, man hielt Gespräche aufrecht. Bis in unsere Zeit hatte sich an den Zuständen in Usbekistan nichts geändert.
Ich hatte vorher nie etwas von dem diktatorischen System mitbekommen, wenn man einmal von dem unerfreulichen Erlebnis in Taschkent absah. In Samarkand wurde nie darüber gesprochen. Man hatte dort aber auch nichts davon gespürt.
Fergana war die Südspitze der „usbekischen Raute“. Die Stadt war Hautstadt der Provinz Fergana am Südende des Ferganatales. Sie lag, wie alle Oasenstädte Zentralasiens, an der Seidenstraße. Mit der russischen Expansion kam Fergana unter russischen Einfluss. Die Stadt erfuhr viele Umbenennungen, bis sie 1924, nach einer bolschewistischen Rückeroberung der Region, den Namen Fergana erhielt. Der Ferganakanal wurde 1930 angelegt. Fergana hatte breite, von Schatten spendenden Bäumen gesäumte Avenuen mit zaristischen Häusern aus dem 19. Jahrhundert, die das Taschkent aus der Vorerdbebenzeit zu imitieren schienen. Es gab einen relativ hohen Anteil an Russen in der Bevölkerung im Vergleich zu anderen Städten im Ferganatal. Die Stadt führte ein Gefühl der Sorglosigkeit aus der Zeit vor der Unabhängigkeit Usbekistans fort. Fergana war das wichtigste Zentrum für Ölraffinierung in Usbekistan. Die Stadt wirkte wegen ihres vielen Grüns wie ein großer botanischer Garten, es gab sehr viele Blumen und Rasenflächen. Seit der Seidenstraßen-Ära war Fergana auch für seine Seide und seine Töpferwaren bekannt.
Für mich hieß es, nach einer Übernachtungsmöglichkeit in Kokand zu suchen. Das stellte sich als relativ schwierig heraus. Ich trank zuerst einen Tee in einer Teestube. Es war Nachmittag geworden und ich fuhr vom Bahnhof aus mit einem Bus in die Stadt. Es gab im Zentrum einen parkähnlichen Platz vor dem Palast des Xudajar Khan, dorthin begab ich mich. Da ein Hotel oder sonst eine Möglichkeit zu schlafen nicht in Sicht war, machte ich mich mit dem Gedanken vertraut, im Park zu übernachten. Es war noch früher Abend und ich hoffte, nicht noch einmal in so eine bedrohliche Situation zu kommen wie in Taschkent. Der von dem Palast ausgehende Teil des Parks wies dichten Baumbestand auf, dort würde ich mich auf den Rasen legen. Ich kaufte mir Brot und füllte meine Wasserflasche an einem Brunnen. Dann setzte ich mich in den Park auf eine Bank, aß und trank. Es waren nicht mehr viele Menschen unterwegs, ab und zu patrouillierte eine Polizeistreife, ich würde mich gut verstecken müssen. Gegen 22.00 h verschwand ich hinter einem Gebüsch und breitete meinen Schlafsack aus. Ich war sicher, an der Stelle von niemandem beobachtet werden zu können. Ich machte es mir gemütlich, nahm meine Wertsachen mit in den Schlafsack und schlief sofort ein. Ich blieb in der Nacht tatsächlich unbehelligt.
Ich wachte gegen 6.00 h am Morgen auf, ging zum Brunnen und machte mich frisch. Ich hatte Hunger und kaufte zuerst frisches Brot. Dann füllte ich meine Wasserflasche auf und trank einen kräftigen Schluck. Da ich einmal am Palast des Xudajar Khan war, wartete ich dessen Öffnungszeit ab. Die Sonne schien und es wurde schnell warm. Ich setzte mich wieder auf die Bank vom Vorabend und beobachtete die vorbeilaufenden Menschen, deren Zahl immer größer wurde. Viele liefen gegen 8.30 h zum Palast und gingen hinein.
Ich ließ meinen Rucksack an der Kasse und ging auch in den Palast. Das mochte manchem vielleicht unwürdig erscheinen, dass ich im Park geschlafen und mich am Brunnen gewaschen hatte und dann den Palast besuchte. Ich hatte mir aber fest vorgenommen, so viele kulturelle Besonderheiten wie möglich zu besichtigen, also ging ich in den Palast. Das im Palast befindliche Landesmuseum interessierte mich nicht, weil das eine Plattform für Karimows Propaganda war und die wahren Verhältnisse im Ferganatal verschleierte. Ich war eine knappe Stunde im Palast, als ich nach Süden an die A 373 lief und mit dem Bus Richtung Osten fuhr, so lange, bis ich die Stadt hinter mir gelassen hatte.
Dann stand ich wieder an der Seidenstraße. Ich wollte mir auch von den andern drei Städten der „usbekischen Raute“ ein Bild machen. Es war so, dass die Rautenpunkte quasi durch ihre Diagonalen mit ihrem jeweiligen Gegenüber verbunden waren, am Schnittpunkt der Diagonalen lag Yozyovon, die Inkarnation der geometrischen Anschauung. Es waren circa fünfzig Kilometer bis dorthin. Ich würde mich erst dort entscheiden, ob ich nach Namangan oder nach Fergana führe, Andizhan wollte ich mir zum Schluss ansehen.
Es gab an der A 373 eine lockere Bebauung und viele Felder. Auf der Straße war nicht viel los, ich setzte mich in den Schatten eines Alleebaumes, aß mein Brot und trank aus meiner Wasserflasche. Dann nahm ich mein Messer aus dem Rucksack, schnitt einen mitteldicken Ast von einem Baum und schnitzte mir einen Wanderstock. Dazu brauchte ich circa fünfundvierzig Minuten, in denen ab und zu ein Auto vorbeifuhr und hupte. Ich steckte mein Messer wieder in die Rucksackseitentasche und marschierte, dann mit einem Wanderstock ausgerüstet, die A 373 entlang. Ich lief ungefähr zwei Stunden so, bis ich müde wurde und beschloss, eine Pause zu machen. Ich legte mich am Straßenrand auf das Bankett, dort wuchs üppiges Gras, das nicht gemäht wurde. In der Nähe gab es einige Bauernhöfe, die heruntergekommen aussahen. Ich winkte einem Bauern zu, der vor sein Haus getreten war, um zu sehen, wer sich da auf der Straße herumtrieb. Er winkte zurück. Man sah sehr ausladende Baumwoll- und Weizenfelder, aber nirgendwo war eine moderne landwirtschaftliche Maschine, wie zum Beispiel ein Mähdrescher, zu entdecken. Stattdessen wurde das Getreide von Hand geerntet, die Baumwolle wurde ohnehin von Hand gepflückt. Obwohl das Ferganatal von vielen Bewohnern das „Paradies auf Erden“ genannt wurde, machte es, auch schon in Kokand, einen ärmlichen Eindruck. Die bestehenden Staaten Kirgistan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Kasachstan, die bis 1917 das Generalgouvernement Turkestan gebildet hatten, waren 1924 (Turkmenistan und Usbekistan) und 1936 (Kirgistan, Tadschikistan und Kasachtan) gegründet worden. Das Ferganatal war seitdem auf drei Staaten verteilt: Usbekistan mit 70 % des Ferganatales und 43 % des Staatsgebietes, Tadschikistan mit 15 % des Tales und 18.2 % des Saatsgebietes und Kirgistan mit 15 % des Tales und 42 % des Staatsgebietes. Die Grenzziehungen entsprachen, wie auch im Kaukasus, den politischen Intentionen der Sowjetunion, in jeder der Regionen einen politischen Krisenherd zu schaffen. Es gab bereits zu Zeiten der Sowjetunion mehrere ethnische Konflikte im Ferganatal, so im Gebiet Osh zwischen Kirgisen und Usbeken. Seit Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts gab es mehrere blutige Auseinandersetzungen, wobei die Konflikte wirtschaftlicher und sozialer Natur waren und schnell in ethnische Konflikte umschlugen.
Solche Konflikte ab es angesichts der brisanten Gemengelage im Ferganatal häufig. Verschärft wurde die Situation durch die Radikalisierung islamischer Organisationen, durch die alles durchdringende Korruption und die Verschmelzung der politischen Führung mit der organisierten Kriminalität. Es lohnte sich, einen genaueren Blick auf die Konfliktursachen zu werfen. Vor allem war die desolate wirtschaftliche und soziale Situation hervorzuheben. Die wenigen Industriebetriebe im Ferganatal hatten ihre Arbeit entweder ganz eingestellt oder waren unrentabel. Die Landwirtschaft stellte wegen der permanenten Unterdrückung der unabhängigen Bauern keine Arbeitsplätze bereit. Böden und Wasser waren in dem fruchtbaren Tal knapp, die Bewässerungssysteme funktionierten nicht, die Böden waren durch Pestizide verseucht. Der Handel von Klein- und Mittelbetrieben wurde von den lokalen Behörden durch immer neue Steuern und Abgaben, Einschränkungen, Verbote, Korruption und Behinderung des Grenzverkehrs ständig unter Druck gesetzt. Im kirgisischen Teil waren über 30 %; im usbekischen Teil über 40 % und im tadschikischen Teil über 60 % der arbeitsfähigen Bevölkerung arbeitslos. Die meisten Betroffenen waren junge Menschen bis zu einem Alter von fünfundzwanzig Jahren. Dadurch und durch extrem niedrige Löhne breitete sich im Ferganatal die Massenarmut immer weiter aus. In Kirgistan betrug das monatliche Durchschnittseinkommen zwölf Euro, in Usbekistan zehn Euro und in Tadschikistan vier Euro. Nach den Unruhen in Andizhan wurden Renten und Zuschüsse, nachdem sie längere Zeit gar nicht oder mit Verzögerung gezahlt wurden, wieder rechtzeitig ausbezahlt.
Demografisch gesehen war das Ferganatal sehr jung. Jeder vierte Einwohner war unter achtzehn Jahre alt. Die Geburtenrate war sehr hoch, man schätzte, dass in zehn Jahren 15 Millionen Menschen im Ferganatal lebten. Die Bevölkerungsdichte betrug vierhundert Menschen pro Quadratkilometer. Arbeitslosigkeit und Massenarmut führten zu einer schleichenden Migration der Usbeken in die ebenfalls armen Gebiete im Süden Kirgistans. Das verstärkte die ethnischen Spannungen noch weiter. Durch die eigenwilligen Grenzziehungen unter Stalin wurden im Ferganatal wichtige Verkehrsverbindungen durch Staatsgrenzen unterbrochen. Zwischen Kirgistan und Usbekistan gab es hundertdreißig ungeklärte Grenzabschnitte, zwischen Kirgistan und Tadschikistan siebzig, die fast alle das Ferganatal berührten. Auf kirgisischem Staatsgebiet gab es mehrere Enklaven. Außerdem gab es Ortschaften, in denen die Bewohner zu einem der drei Staaten gehörten, der Zugang zu dem Ort aber nur von einem anderen Staat aus möglich war. An den Grenzen jener Enklaven kam es regelmäßig zu Schikanen, Usbekistan hatte die Grenzen zum Teil vermint. Eine weitere Folge der Grenzstreitigkeiten war die Konkurrenz um bewirtschaftetes Land, die Bewässerungssysteme und die Arbeitsplätze entlang der Grenzen.
Wegen der Untätigkeit der Regierungen nahm die Bevölkerung selbst die Lösung der Probleme in die Hand, legte die Bewässerungssysteme lahm oder besetzte die Böden. Ein unüberschaubares Berggebiet, die kaum kontrollierbaren Grenzen und und Bestechlichkeit der Polizei und Grenzposten erleichterten den Drogenhandel aus Afghanistan. Ein Großteil der Drogen aus Afghanistan ging über Osh, Andizhan und Kasachstan nach Russland und Westeuropa. Im krigisischen und tadschikischen Teil des Ferganatales wurden auch Hanf und Mohn angebaut. In Tadschikistan gab es Labors, in denen aus afghanischem Opium Heroin hergestellt wurde, der Drogenhandel und -schmuggel war für viele Menschen im Ferganatal zur einzigen Einnahmequelle geworden. Fast fünfundzwanzig Prozent der Kirgisen lebten im Ferganatal vom Drogenhandel.
In Usbekistan ließen offizielle Zahlen über verhaftete Drogenschmuggler vermuten, dass auch dort nicht wenige Menschen vom Drogenschmuggel lebten. Der Drogenhandel und -schmuggel wurden von organisierter Kriminalität und lokalen Behörden kontrolliert, oft in enger Zusammenarbeit. Die Drogen hatten sich in den vergangenen Jahren zur Einkommensquelle für radikal-islamische Gruppen entwickelt, die in der organisierten Kriminalität, oft gegen die lokalen staatlichen Behörden, zusammenarbeiteten. Im Ferganatal war der Islam tiefer verwurzelt als in anderen Teilen Zentralasiens. Auch die Sowjetmacht schaffte es nicht, den Islam auszurotten.
Es existierten gegen die staatlichen Behörden viele Untergrundbewegungen, die sich 1996 in Usbekistan zur „Islamischen Bewegung Usbekistans“ zusammenschlossen. Die Islamisten erhielten massive Unterstützung aus Saudi-Arabien und Ägypten, allein in Namangan gab es später tausend Moscheen. Personelle Hilfe, Prediger und Lehrkräfte, kamen ebenfalls aus dem arabischen Raum. Die islamistischen Kräfte besetzten sozialpolitische Felder, die die Regierung vernachlässigte und gewannen dadurch an Kraft, besonders unter den arbeitslosen Jugendlichen, sie wurden deshalb als innenpolitische Bedrohung angesehen. Karimow ging in Usbekistan seit 1992 immer massiver gegen bekennende Muslime vor.
Die zweitstärksten Gruppen waren die „Islamische Partei Turkestans (IPT)“ und die „Hisb-ut-Tachrir“ (Partei der islamischen Befreiung), die weniger wegen ihrer Mitgliederzahl und Organisationsstruktur, als vielmehr wegen der Zunahme ihrer Popularität zur Bedrohung wurden. „Hisb-ut-Tachrir“ machte Überzeugungsarbeit auch bei den gebildeten Schichten, während die „IPT“ Anhänger auch bei den marginalisierten Jugendlichen zu gewinnen suchte. Die „Hisb-ut-Tachrir“ finanzierte sich aus den Spenden ihrer Mitglieder und aus dem Profit der von den Mitgliedern gegründeten Kleinunternehmen. Sie war in Kirgistan und Usbekistan verboten. Die „IPT“ fianzierte sich durch Drogenschmuggel.
Die „Hisb-ut-Tachrir“ predigte Gewaltlosigkeit, ob sie sich daran hielt, war unter Fachleuten umstritten. Der Islamismus im Ferganatal stellte eine große Gefahr für die Stabilisierung dieser Region dar. Die sozialen, religiösen und ethnischen Spannungen im Ferganatal wuchsen weiter, es blieb eine höchst gefährliche Zone, sowohl für das diktatorische Usbekistan, als auch für das durch permanente innere Konflikt geschwächte Tadschikistan und für das politisch instabile Kirgistan. Reformen, die die Lage hätten entspannen können, waren nur in Kirgistan denkbar. Usbekistan setzte unter Karimow auf Militärgewalt mit Unterstützung aus Russland und China und lehnte Reformen strikt ab. Die Zukunft war für das Ferganatal nicht rosig: die Nähe zu Afghanistan, nicht festgelegte und praktisch nicht kontrollierbare Grenzen zwischen Usbekistan, Kirgistan und Tadschikistan, ungelöste soziale Probleme, die traditionell starke Stellung des Islam in der Region und eine große Zahl von leicht rekrutierbaren arbeitslosen jungen Männern, zum Teil ungebildet, ließ erneute Unruhen nicht unwahrscheinlich erscheinen. Zwar war es ruhig im Ferganatal und der Alltag schien seinen gewohnten Lauf zu nehmen. Doch könnte sich dies angesichts der wachsenden sozialen Not und des großen Konfliktpotentials eines Tages ändern.
Ich entschied mich, von Yozyovon nach Namangan zu fahren. Doch erst einmal musste ich kurz hinter Kokand, wo ich immer noch war, eine Mitfahrgelegenheit bekommen.
Da hielt plötzlich ein Wagen, die Beifahrertür sprang auf und der Fahrer schaute mich fragend an. Ich rief: „Yozyovon!“ Der Fahrer nickte und gab mir zu verstehen, dass er nach Andizhan unterwegs wäre. Leider war ein Gespräch kaum möglich, ich sagte „Namangan“ und der Fahrer nickte. Er war mittleren Alters und machte eigentlich einen netten Eindruck. Wir waren aber schon nach einer Dreiviertelstunde in der Rautenmitte und ich stieg aus. Der Fahrer hupte, winkte und fuhr weiter. Ich musste links ab und begab mich an die Straße nach Namangan. Gegenüber gab es eine Art Raiffeisen-Lager, auf dem Hof standen LKWs. Ich ging einfach hinüber und fragte die Fahrer nach Namangan. Einer kam auf mich zu, wies auf seinen LKW und bedeutete mir einzusteigen. Es waren ungefähr achtzig Kilometer zu fahren. Der Fahrer beendete seinen Ladevorgang und fuhr mit mir los, er zeigte mir zwei Stunden an, die er bis Namangan brauchen würde. Ich sollte mich hinten in die Kabine legen, worin ich ja schon Übung hatte. Ich zog meine Kladde aus dem Rucksack und schrieb meine Erlebnisse auf. Anschließend döste ich vor mich hin und schaute ab und zu aus dem Fenster, es gab unendlich weite Baumwoll- und Weizenfelder zu sehen. Hinter Dzamashuy überquerten wir den Syrdarja, den Leben spendenden Fluss aus Kirgistan. Er führte, trotz der vielen Kanalabzweigungen, mächtig Wasser. In Turakurgon ging es rechts ab, von dort waren es noch zwanzig Kilometer bis Namangan. Der freundliche LKW-Fahrer ließ mich mitten im Zentrum raus.
Namangan war die Hauptstadt des Islam im Ferganatal. Man merkte das an der großen Zahl an Moscheen, die dort zu sehen waren. Die Stadt machte einen quirligen Eindruck. Auffällig war, dass es dort kaum Hochhäuser gab, stattdessen gab es eingeschossige kleine Häuser in der Stadt. Das Zentrum sah aus wie ein Viertelkreis, an dessen Spitze die „Mullah-Kirgis“-Madrasa lag. Dieser fast heilig anmutende Stadtbezirk inmitten des Zentrums wirkte sehr ruhig und parkähnlich. Ich lief hinein und setzte mich auf eine der viele Bänke in den Schatten der Bäume, die der Park hatte. Ich kaufte mir Brot und füllte meine Wasserflasche. Es stellte sich wieder das Übernachtungsproblem. Ich sah mich schon im Park schlafen, das hätte mit überhaupt nichts ausgemacht. Es gab ausreichend Rasenflächen unter Bäumen, wo man sich hätte hinlegen können. Das frische Brot schmeckte ausgezeichnet. Namangan hatte viel von einer islamischen Stadt in der Türkei, dachte ich.
Das Ferganatal könnte sich zu einer Hochburg der Islamisten entwickeln, deren Ziel war die Bildung eines Kalifats, nationenübergreifend, unter Einbeziehung der westchinesischen Uiguren. Wie oben beschrieben, gab es bei der Verfolgung dieses Zieles unterschiedliche Vorgehensweisen. Es gab durchaus militante islamistische Splittergruppen, die ihre Hauptaufgabe in der Beseitigung Karimows sahen. Daneben gab es Richtungen, wie die „Hisb-ut-Tachrir“, die die Überzeugung der Bevölkerung auf ihre Fahnen geschrieben hatten, was angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Not ein mühsamer Weg war, „Hisb-ut-Tachrir“ hatte aber großen Zulauf. Von außen wurde immer wieder eine Verbindung zum Terrornetzwerk „El Kaida“ kolportiert, das war aber nur sehr schwer nachzuweisen. Ein Gottesstaat Usbekistan, das wäre das Ende der in sozialistisch-atheistischen Zeiten geschulten staatstragenden Gesellschaftsschichten, einschließlich der Regierungsgruppe um Karimow. Die „Hisb-ut-Tachrir“ war mir sympathisch, weil sie Gewaltlosigkeit vertrat. In Namangan wurde eine von der usbekischen Amtsspache abweichende Sprache gesprochen, das iranisierte Tadschikisch. Das Usbekische war dem in Westchina gesprochenen Uigurisch verwandt. Die in Deutschland im Sauerland festgenommenen Terroristen waren Mitglieder der „Islamischen Dschihad Union“, einem Ableger der „Islamischen Bewegung Usbekistans“. Diese Bewegung bekannte sich schon 2004 zu den Anschlägen in Taschkent, bei denen siebenundvierzig Menschen getötet worden waren. Tatsächlich, so glaubten westliche Beobachter, waren die Anschläge vom usbekischen Geheimdienst lanciert, um die repressive Politik Karimows zu rechtfertigen. Die Wahrheit ließ sich in jenem Wust von Verstrickungen und verästelten Organisationen, die sich zum Islam bekannten, nur sehr schwer herausfinden.
Es liefen viele Menschen durch Namangans Zentrum, auch durch das Madrasa-Viertel. Viele Männer trugen die islamische Tracht, ein langes Gewand, eine Art Hose darunter und Sandalen.
Die Gewänder waren schneeweiß. Viele Männer trugen Vollbärte, fast alle hatten einen Turban auf dem Kopf. Das Gewand nannte sich „Gelabia“, es war eine Art Überwurf, die Hose darunter war ein flatteriges Etwas, das im Schritt bis zu den Knien langte. Sicher war die Kleidung sehr bequem.
Plötzlich setzte sich ein junger Mann zu mir auf die Bank und stellte sich als Ebu vor. Eigentlich hieße er Ebu Yayad, alle würden ihn aber Ebu nennen. Ich sagte, dass ich Paulo hieße. Zum Glück sprach Ebu Englisch! Er trug die islamische Kleidung, ich schätzte ihn auf Anfang zwanzig. Ebu fragte mich, wohin ich unterwegs wäre und woher ich käme. Ich antwortete, dass ich Deutscher wäre und die Seidenstraße entlangpilgerte, um irgendwann in China anzukommen und von dort wieder nach Hause zu fliegen. Warum ich ausgerechnet die Seidenstraße entangreiste, wollte Ebu wissen. Ich sagte, dass ich versuchte, zu mir selbst zu finden, ich hätte in Deutschland meine Schule beendet und stünde vor der Entscheidung, wie es mit mir weiterginge. Wahrscheinlich würde ich Philosophie studieren.
Ebu nickte und sah mich an, als ob er verstünde, was mich bewegte. Dann sagte er, dass ich mich in einer sehr privilegierten Situation befände. Wer könnte es sich schon leisten, so einfach durch die Welt zu reisen, vollkommen sorglos, mit genügend Geld und immer ausreichendem Essen? Ich musste Ebu recht geben, besonders im Ferganatal, diesem scheinbaren Paradies, in dem die materielle Not der Menschen aber sehr groß war, wurde mir meine Situation bewusst. Ich fragte Ebu, was er so in Namangan triebe. Er sagte, dass er Mitglied der „Hisb-ut-Tachrir“ wäre, er würde in Namangan Islamwissenschaften studieren und in seiner freien Zeit durch das Ferganatal ziehen und Mitglieder für seine Gruppe werben. Er müsste dabei extrem vorsichtig sein, denn die „Hisb-ut-Tachrir“ wäre in Usbekistan verboten. Er wüsste nicht, ob er sich nicht gerade mit einem Spitzel des Geheimdienstes unterhielte, nicht einmal bei mir könnte er sich sicher sein. Ich versicherte Ebu, dass ich ein völlig harmloser Tourist wäre und erzählte ihm in groben Zügen meine Erlebnisse bis zum Eintreffen in Namangan.
Ich war schon fast ein Jahr lang unterwegs, es kam mir vor, als wäre das Reisen mein Leben. Ob ich schon eine Übernachtung hätte, wollte Ebu wissen und ich verneinte. Da lud er mich zu sich nach Hause ein, dort könnte ich schlafen. Ich war glücklich. Die Vorbeigehenden schauten verstört zu unserer Bank, ein Muslim unterhielt sich mit einem Europäer, das musste in einer Stadt wie Namangan merkwürdig erscheinen. Ebu sagte, dass er an der Universität gerade Ferien hätte, wenn ich wollte, könnte ich ihn eine Zeit lang auf seinen Reisen durch das Ferganatal begleiten. Er könnte mir eine Menge Sehenswürdigkeiten zeigen, weil er sich schon oft durch die großen Städte bewegt hätte. Ohne lange zu überlegen sagte ich zu, ich wollte ja die „usbekische Raute“ abfahren. Dann gingen wir zu Ebu nach Hause.
Wir liefen nach Südwesten durch ein Gewirr von kleinen Häusern. Nach ungefähr fünfzehn Minuten gelangten wir zu einem villenähnlichen Anwesen, dort wohnte er, sagte Ebu. Als ich ihn erstaunt ansah, erklärte Ebu, dass sein Vater ein reicher Kaufmann wäre, deshalb lebte er zu Hause in ziemlichem Wohlstand. Ich würde seinen Vater später noch kennenlernen, er hätte auch noch einen Bruder und eine Schwester, sagte Ebu. Die wären beide jünger als er, sein Bruder Michail wäre neunzehn und seine Schwester Tamira wäre siebzehn. Wir gingen ins Haus, wo uns Ebus Mutter begrüßte. Sie war eine Frau mittleren Alter, um die fünfzig und machte einen gepflegten Eindruck. Ebu stellte mich vor, seine Mutter bot uns beiden eine Tasse Tee an. Es war inzwischen Abend geworden und es würde bald etwas zu essen geben, sagte Ebus Mutter. Kurze Zeit später erschien Ebus Vater. Er war elegant gekleidet, nach westeuropäischem Zuschnitt. Er begrüßte mich und bat mich zu Tisch. Ich setzte mich, als Ebus Mutter auch schon die Speisen auftrug. Ebus Schwester, ein sehr hübsches Mädchen, half ihr dabei. Dann kam auch Michail, Ebus Bruder, wir gaben uns die Hand und unterhielten und kurz auf Englisch. Er hatte in der Schule Englisch gelernt und konnte sich halbwegs verständigen. Wir unterhielten uns alle ein wenig beim Essen, die ganze Familie konnte Englisch, für den Hausgebrauch reichte das. Ebu erzählte, dass ich ihn auf seiner Reise durch das Ferganatal begleiten würde. Ebus Mutter sagte, dass er vorsichtig sein sollte, die Spitzel Karimows wären überall, wenn sie ihn erwischten, wäre er dran. Auch sein Vater machte Bedenken geltend, hielt Ebu aber für einen vernünftigen Menschen, der sich auf keinen Leichtsinn einließe. Wir saßen nach dem Essen noch eine Zeit zusammen und unterhielten uns. Ebus Vater stellte sich als erklärter Gegner der totalitären Regimes Karimow heraus. Wegen des repressiven Systems hätte er geschäftliche Schwierigkeiten, Kontakte zum Ausland würde ihm der Zoll erschweren, die Steuer- und Abgabenlast wäre sehr hoch. Er käme aber dank guter Kontakte nach England und auch nach Deutschland ganz gut zurecht. Warum ich als Deutscher in ein so armes Land wie Usbekistan reiste, fragte er mich. Ich erzählte von meinem Vorhaben, die Seidenstraße entlangzupilgern. Das fand er großartig. Junge Leute müssten reisen, um ihren Horizont zu erweitern, sie müssten in Kontakt zu anderen Menschen kommen. Ich erzählte von den wichtigsten Stationen meiner Reise und dass ich schon fast ein Jahr unterwegs wäre, ich wollte zu Hause anrufen, um zu sagen, dass es mir gut ginge. Michail sagte, dass er genau wie Ebu studieren wollte, er wüsste aber wie ich noch nicht genau was. Ich sagte Michail, dass ich an Philosophie dächte. Michail dachte auch an etwas Geisteswissenschaftliches, er hätte aber mit seiner endgültigen Entscheidung noch etwas Zeit. Wir gingen früh zu Bett. Ebus Vater müsste am nächsten Morgen früh aufstehen und ich war sehr müde. Tamira, die Schwester, hielt sich bei unserem Gespräch sehr zurück, ich dachte, dass sie vielleicht wegen fehlender Englischkenntnisse schüchtern war. Sie lächelte, schien sich aber in unserer Anwesenheit nicht so wohl zu fühlen. Am nächsten Morgen wollte Ebu nach dem Beten in der Moschee mit mir durch Namangan ziehen und mir die Stadt zeigen. Er sagte mir, dass er nur fünfzehn Minuten zum Beten brauchte, ich sollte so lange vor der Moschee warten.
Der nächste Tag war ein sehr schöner Tag in Namangan. Ebu ging in die kleine Moschee in der Nachbarschaft und betete. Ich wartete in der Zeit draußen und beobachtete die Gläubigen, wie sie in die Moschee gingen, alle trugen ihre „Gelabia“ in Weiß. Es herrschte eine wohltuende Ruhe in der Umgebung, wir waren aber auch fernab von den Hauptstraßen, auf denen es auch an diesem Morgen viel Verkehr gab. Ebus Vater war schon längst aus dem Haus, Ebus Geschwister waren Langschläfer, sie hatten Ferien. Nach einer Viertelstunde kam Ebu wieder aus der Moschee. Wir liefen zur Bushaltestelle und gingen nach Norden. Dort, wo der Bewässerungskanal eine große Schleife beschrieb, stiegen wir auf einen Hügel und verschafften uns so einen schönen Blick auf die Stadt. Wir saßen in der angenehm warmen Morgensonne und Ebu begann, aus der Stadtgeschichte zu erzählen.
Namangan wäre seit dem 15. Jahrhundert im Khanat von Kokand eine Siedlung gewesen und seit jeher ein Zentrum des Islam im Ferganatal. Deshalb wäre in Namangan eine Opposition gegen das säkulare Regime in Taschkent erwachsen. Auch Ebu kämpfte gegen das Regime, wenn auch nicht offen, das wäre viel zu gefährlich. Er betrieb vielmehr Aufklärungsarbeit und führe über Land, um die Menschen auf seine Seite und damit auf die Seite der „Hisb-ut-Tachrir“ zu ziehen. Schon am nächsten Tag wollte er zu einer Veranstaltung nach Andizhan fahren. Wir stiegen den Hügel wieder hinab und nahmen den Bus Richtung Stadtzentrum. Vorher kniete Ebu nieder und wandte sich nach Südwesten, Richtung Mekka, um zu beten. Ich stand neben ihm und sah in sein Gesicht, es war voller Ehrerbietung und Gläubigkeit.
Ebu nahm seine Religion ernst, er verehrte Allah, vermied es aber, andere zu belehren, was ihn sympathisch machte. Im Stadtzentrum angekommen zeigte Ebu mir seine Universität. Er erzählte mir, das bei den Islamwissenschaftlern immer auch Vertreter der Regierung als Spitzel in den Bänken säßen und aufpassten, dass auch ja linientreu verfahren würde. Manche Studenten, so auch er, machten sich gelegentlich einen Spaß daraus, ultraorthodoxe Diskussionsbeiträge vorzubringen, um die Spitzel zu provozieren. Die würden dann immer hellhörig und schrieben mit, was gesagt wurde. Anschließend folgte dann eine Richtigstellung und den Spähern war der Wind aus den Segeln genommen. Ebu war dreiundzwanzig Jahre alt und damit drei Jahre älter als ich. Er studierte im fünften Semester und wusste noch nicht so recht, welchen Beruf er einmal ergreifen sollte. Zu diesem Zeitpunkt war er sehr damit beschäftigt, die Sache der „Hisb-ut-Tachrir“ voranzutreiben und das hieß eben, durch das Ferganatal zu reisen und für seine Sache zu werben. Er musste auch gar nicht messianisch auftreten, die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse sprachen für sich. Wir sahen im Stadtzentrum viele Bettler, auch völlig verwahrloste Frauen mit schreienden Kindern, vermutlich saßen ihre Männer im Gefängnis oder waren tot. In usbekischen Gefängnissen saßen Tausende ohne Prozess, niemand wusste ihre Zahl genau. Ich steckte den Bettlern etwas Geld zu und gab ihnen von meinem Brot. Die Frauen gaben das Brot den Kindern, die es gierig verschlangen. Das wären die Ärmsten der Armen, sagte Ebu, der Staat käme für sie nicht auf, in Usbekistan gäbe es kein soziales Netz wie in den westeuropäichen Ländern. Um diese Menschen würde sich seine Gruppe kümmern, auch mit Speisungen. Das Heer der Armen würde täglich größer, aus seiner Mitte erwüchse starker Widerstand gegen das etablierte System.
Langfristig könnte der Staat nicht mit Repressionen seine Existenz aufrechterhalten, eine Regierung, die gegen das Volk handelte, hätte keine Zukunft. Da musste ich Ebu recht geben, das konnte man aus der Geschichte lernen. Natürlich hatte es immer Opfer gegeben, oft waren es Märtyrer, letztendlich ging aber jedes totalitäre System unter.
In der Nähe des Bahnhofs lagen einige sehr schöne Grundstücke am Wasser. Der soziale Kontrast hätte kaum größer sein können. Am Nachmittag setzten wir uns in eine Teestube im Zentrum.
Ebu sagte, dass wir am nächsten Morgen mit dem Zug nach Andizhan fahren würden, das wäre die schnellste und für ihn auch sicherste Verbindung. Wir sollten nach der Teepause schon einmal zum Bahnhof und Tickets kaufen. Wir liefen quer durch das Zentrum an vielen Bettlern vorbei bis zum Bahnhof. Nachdem wir die Tickets gekauft hatten, nahmen wir den Bus nach Hause. Nach dem Aussteigen begegneten wir wieder Bettlern, ich kaufte schnell neues Brot und verteilte es. Von Ebu aus rief ich nach Deutschland an, sagte, wo ich wäre und dass es mir gut ginge. Dann verabschiedete ich mich und versprach, mich wieder zu melden. In Deutschland war es zu diesem Zeitpunkt Mittag, wir hatte fünf Stunden Zeitverschiebung. Ebus Mutter fragte, wo wir den ganzen Tag über gewesen wären, Ebu sagte, dass er mir die Stadt gezeigt hätte. Wir sollten aber vor dem Abendessen nicht mehr weggehen. Michail und Tamira waren auch zu Hause, sie hatten den ganzen Tag gefaulenzt. Ebu verschwand für fünfzehn Minuten zum Beten auf sein Zimmer. Ich machte mich in der Zeit frisch. Ich schlief in einem komfortablen Gästezimmer, in dem es eine Dusche gab. Als Ebu wieder im Wohnzimmer erschien, hatten seine Mutter und Tamira den Tisch gedeckt. Kurze Zeit später erschien Ebus Vater und schimpfte über den regelnden Staat, überall legte er ihm Steine in den Weg, es gäbe eine Menge Dummköpfe in der Regierung, die von Wirtschaft keine Ahnung hätten. Ebu sagte, dass er mit mir am nächsten Tag für eine Woche verreisen wollte.
Sein Vater entgegnete, dass er bloß vorsichtig sein sollte und setzte auf die Intelligenz seines ältesten Sohnes. Ebu dürfte sich auf keinen Fall zu unüberlegten Gewalttaten hinreißen lassen. Ebu versprach, die Worte seines Vaters im Hinterkopf zu behalten und aufzupassen.
Ich hatte den ganzen Tag über kaum etwas gegessen und richtigen Hunger bekommen. Es gab nach langer Zeit einmal wieder „Plow“, ich glaubte, ich hatte den letzten „Plow“ in Samarkand gegessen. Ebus Mutter war eine sehr gute Köchin. Ich musste an die vielen Bettler denken, die mir während unseres Stadtausflugs begegnet waren. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine solche Armut gesehen. Immer wieder fiel mir der Kontrast auf zwischen dem als Paradies verklärten Ferganatal und der wirtschaftlichen Not seiner Bewohner. Wir unterhielten uns nach dem Essen über solche Dinge. Ebus Vater sagte, dass sich nach dem Zerfall der Sowjetunion vieles zurückentwickelt hätte, die Menschen wären die freie Marktwirtschaft nicht gewohnt gewesen. Die Versorgung während der Sowjetzeit wäre zwar nicht optimal gewesen, die zentralen Verteilungssysteme hätten aber jedem ein, wenn auch bescheidenes, Auskommen garantiert. Nach 1991 hätten die meisten Menschen überhaupt nicht gewusst, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollten. Die katastrophale Armut wäre das Resultat gewesen. Wie er die Zukunft Usbekistans sähe, wollte ich von ihm wissen. Er überlegte nur kurz und sagte dann, Karimow müsste weg, er dächte dabei weniger an eine Revolution als an einen reformerischen Prozess. Die dadurch einzuleitenden Veränderungen nähmen sicher mehr Zeit in Anspruch, es wären aber weniger Opfer zu beklagen, als bei einem gewaltsamen Umsturz, was der zur Folge hätte, hätte man ja in Andizhan gesehen, wo Regierungstruppen blindlings in die Menschenmenge geschossen und Hunderte von Toten in Kauf genommen hätten. Ich ließ die Aussagen von Ebus Vater unkommentiert und gab ihm im Stillen recht. Ebu sagte auch nichts, warum auch immer, vielleicht hielt er die Aussagen seines Vaters auch für richtig. Dennoch war er einer Revolution gegenüber nicht ganz abgeneigt. Seine Gruppe hatte aber der Gewalt abgeschworen. Gegen 22.30 h gingen wir ins Bett.
Wir standen am nächsten morgen um 7.30 h auf, unser Zug würde um 9.00 h abfahren. Wir waren pünktlich am Bahnhof, der Zug fuhr um 9.05 h. Ursprünglich wollte ich ja Andizhan als letzte Stadt an der „usbekischen Raute“ besuchen, aber die Verhältnisse hatten sich geändert. Der Zug hielt viele Mal, bis er nach zwei Stunden in Andizhan einlief. Der Bahnhof lag im Osten der Stadt und zu meinem Erstaunen wurden wir abgeholt. Drei junge Männer standen auf dem Bahnsteig, begrüßten Ebu und umarmten ihn. Ebu stellte mich vor, ich gab den dreien die Hand. Einer der drei konnte gebrochen Englisch, er fragte woher ich käme und wohin ich wollte, ich gab ihm Auskunft. Die drei hatten vor dem Bahnhof ein Auto stehen, mit dem wir in die Stadtmitte fuhren. Ich hatte den Eindruck, dass Ebu so eine Art Chef für die drei war, auf jeden Fall hörten sie auf das, was Ebu sagte und nickten immer nur, wenn er sprach.
Wir erreichten das Zentrum und gingen in eine Veranstaltungshalle, in der vielleicht zweihundert Menschen versammelt waren. Sie sahen alle ziemlich heruntergekommen aus. An der Seite des Eingangsbereiches standen Suppenkübel, aus denen die Menschen bedient wurden, es wurde auch Brot ausgegeben. Natürlich kamen unter dieser Voraussetzung die Leute gern. Aber es gab auch viele unter ihnen, die sich mit den Zielen der „Hisb-ut-Tachrir“ solidarisierten. Als Ebu in das Eingangsportal trat, herrschte plötzlich Stille unter den Anwesenden. Es schien, als würde man ihn kennen und alle schauten erwartungsvoll auf ihn. Dann trat Ebu in den Saal und ging zum Podium. Ich staunte, mein Freund Ebu war ein bekannter Redner! Er begann mit einer allgemeinen Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Lage. Er bekam viel Beifall, fast alle stimmten seinen Analyseergebnissen zu. Besonders der Punkt fand Beifall, wo er das Regierungssystem anprangerte, indem er Karimows Eigenmächtigkeiten, die Willkür seiner Regierung, die Foltermethoden seines Geheimdienstes und die staatlichen Schauprozesse kritisierte. Ebu hatte ungefähr zwanzig Minuten geredet, als er dazu aufrief, in Massen der „Hisb-ut-Tachrir“ beizutreten, Geld zu spenden, die Ideen der Gruppe in das ganze Ferganatal hinauszutragen. Was Ebu da tat war nicht ungefährlich. Hätte sich ein Spitzel im Saal aufgehalten, wäre er vom Rednerpult weg verhaftet worden. So aber bekam er tosenden Applaus. Er hatte einen glücklichen Gesichtsausdruck, seine Augen glänzten, als er nach einer halben Stunde herunterkam und sich geschafft setzte. Ich gratulierte ihm und gab ihm einen Schluck aus meiner Wasserflasche. Dann kam jemand und brachte ihm eine Limonade.
Ich wüsste gar nicht, dass er so berühmt wäre, sagte ich zu Ebu. Er winkte ab. Der ganze Ruhm nützte doch nichts, wenn es dem Volk schlecht ginge.