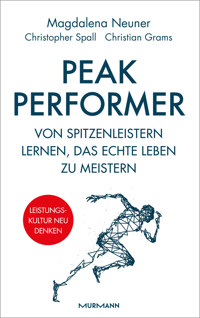
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Murmann Publishers GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Peak Performer« ist das erste Inspirationsbuch für eine sinnvolle Leistungskultur Zwischen leistungslosem Wohlstand und ungesundem 'Höher, Schneller, Weiter' ist der Leistungsbegriff dieser Tage schwer unter Beschuss geraten. Und keins dieser Extreme ist für uns, unsere Kinder und unsere Gesellschaft langfristig förderlich. Das hat auch die Olympiasiegerin und Biathlon-Legende Magdalena Neuner während und nach ihrer Karriere erlebt. Nur logisch also, dass sie sich gemeinsam mit den Unternehmern Christopher Spall und Christian Grams für ein zeitgemäßes Verständnis von Leistung einsetzt. Ihre Botschaft: Jeder kann sein Leben meistern. Aus eigener Kraft. Und dafür muss man nicht partout jede Grenze überschreiten, sondern fokussiert und aus innerem Antrieb handeln. Das ist auch die Botschaft der Peak Performer Stiftung, die von den Autor:innen gemeinsam mit 35 Spitzenleistern aus Sport und Wirtschaft initiiert worden ist. »Peak Performer« ist das erste Inspirationsbuch für eine sinnvolle Leistungskultur. In den Interviews mit Spitzensportler:innen und Unternehmer:innen (u.a. den Extremkletterern Thomas und Alexander Huber, dem Olympiasieger Matthias Steiner oder der Ex-Skirennfahrerin Michaela Kirchgasser) entsteht ein differenziertes Bild, wie man die eigene Lebenskurve heute sinnvoll und ohne zu überziehen steuern kann. Denn nicht nur Magdalena Neuner weiß heute, dass zur Spitzenleistung im Sport auch so manche Schattenseite gehört. Das Buch wirft - erstaunlich offen - ein Schlaglicht auch auf die dunklen Momente von Höchstleistern aus Sport und Wirtschaft. So liefert das Buch nicht nur Ansätze für ein neues Leistungsverständnis, sondern auch Inspiration, das echte Leben mit all seinen Höhen und Tiefen zu meistern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peak Performer
Magdalena Neuner Christopher Spall Christian Grams
PEAKPERFORMER
VON SPITZENLEISTERN LERNEN, DAS ECHTE LEBEN ZU MEISTERN
Content
Zusammendenken, was zusammengehört Intro
Leistungsfreude: Ohne Fleiß kein Preis oder ohne Preis kein Fleiß Kapitel 1
Leistungsgrenzen: Sieh deine Limits oder alles hat Konsequenzen, du musst sie aushalten können Kapitel 2
Leistungskrise: Oben steht, wer Niederlagen als Lernorte begreift oder warum uns kein Tief nachhaltig umhaut Kapitel 3
Leistungsfokus: Ganz bei der Sache sein oder auf was es im Leben ankommt Kapitel 4
Leistungswettbewerb: Immer einen Schritt voraus oder warum die größten Überraschungen nur Normalität darstellen Kapitel 5
Leistungsantrieb: Schubkraft von innen und außen oder die einzigartige Suche nach dem eigenen Gipfel Kapitel 6
Leistungserfolg: Eigene Maßstäbe finden oder mit der Peak Performer-Formel immer vorwärts Kapitel 7
Die Formel für Spitzenleistung
Peak Performer auf einen Blick
Für alle Menschen, die jeden Tag aufs Neue ihr Bestes geben.
Zusammendenken, was zusammengehörtIntro
Der Tag, an dem mein neues Leben begann, war ein schöner Tag im März. Am Vorabend war ich von meinem letzten Biathlon-Weltcup aus dem sibirischen Khanty-Mansiysk nach Hause zurückgekehrt. Trotz sechs Strafrunden und Platz sechs in meinem letzten Rennen hatte ich mir zum dritten Mal den Sieg im Gesamtweltcup gesichert. Doch jetzt war es vorbei. Obwohl ich mit meinen 25 Jahren am Höhepunkt meiner Karriere stand, körperlich und mental so fit wie nie, ging mit dem Saisonfinale 2012 auch meine Karriere als Profisportlerin zu Ende. Ich hatte es so gewollt, etwa zwei Jahre zuvor beschlossen und mit Beginn der letzten Saison offiziell angekündigt.
Ich erinnere mich, wie ich an diesem Morgen an meinem kleinen Küchentisch saß – eine Tasse Kaffee in der Hand, Sonne im Gesicht – und spürte, dass ich etwas nicht mehr spürte. Den Druck, unter dem man als Profisportler steht. Man nimmt ihn nicht wahr, weil er einen ständig begleitet, erst wenn er weg ist, wird einem bewusst, wie omnipräsent er war. Das Gefühl war krass. Befreiend und befremdlich zugleich.
Seit Kindesbeinen an war ich es gewohnt, mich durch einen vorstrukturierten Tag zu hangeln. Von Aufgabe zu Aufgabe. Jetzt musste ich meine Routine selbst gestalten.
Dennoch: Angst, in ein Loch zu fallen, hatte ich nicht, ich hatte mich mental auf den Tag X vorbereitet und etliche Möglichkeiten durchgespielt. Was kann ich, was will ich, wo sehe ich mich? An Ideen mangelte es nicht, ich konnte mir vieles vorstellen: die Eröffnung eines Trachtengeschäfts in meinem Heimatort genauso wie eine längere Reise durch Europa. Zudem hatte ich eine abgeschlossene Berufsausbildung als Bürokauffrau in der Tasche und machte gerade meinen Trainerschein. Dass es anders kam, spielt keine Rolle. Wichtig war zu wissen: Das Ende meiner Profikarriere ist nicht das Ende meines Lebens, ich lande sicher auf meinen Füßen und finde einen Platz. Oder wie mein Mentaltrainer sagt: Selbst wenn du denkst, es geht nicht weiter, es gibt immer mindestens fünf Optionen.
Die Tage füllten sich schneller, als mir lieb war. Ich bekam etliche Anfragen und probierte vieles aus. Ich war zu Gast in Quizsendungen (würde ich wieder machen), Kochsendungen (würde ich nicht wieder machen) und Talkrunden, lernte spannende Menschen kennen, darunter die Journalistin Dunja Hayali, die Sängerin Stefanie Kloß und den ehemaligen Vizekanzler Hans-Dietrich Genscher. Hinzu kamen Verpflichtungen gegenüber Sponsoren und Werbepartnern. In meiner Freizeit schwang ich mich aufs Fahrrad und fuhr so lange, wie ich Lust hatte. Ohne die Vorgabe, so und so viele Kilometer in so und so vielen Minuten, bei diesem und jenem Puls. Ich radelte vor mich hin, bestellte mir unterwegs einen Cappuccino in einem netten Café, fuhr weiter, hüpfte zwischendurch in einen See.
Das Leben fühlte sich unglaublich frei an. Mal abgesehen von meinen Verpflichtungen gegenüber Sponsoren und Werbepartnern, war alles ungezwungen und easy. Dieses Gefühl hielt an, bis mit der Geburt meines ersten Kindes 2014 eine neue Zeit begann. Heute würde ich sagen:
Auf den Startschuss in mein neues Leben folgte der Startschuss in das echte Leben.
Ich fing an, nochmal anders über Dinge nachzudenken, Gewissheiten stärker auf den Prüfstand zu stellen, neue Antworten auf alte Fragen zu suchen, mich selbst zu hinterfragen. Dieser Prozess ist bis heute nicht abgeschlossen. Meine Kinder halten mir einen Spiegel vor, ich wachse mit ihnen mit, bewerte Ziele, Prioritäten und Werte immer wieder neu.
Ein Thema, zu dem ich gerne befragt werde, ist das Thema »Leistungswille«. Für viele Menschen scheine ich noch heute ein Paradebeispiel für Disziplin und Durchhaltevermögen zu sein und damit ein Beleg für ein nach wie vor bestehendes Leistungsverständnis: Nur die Harten kommen in den Garten. Vor dreizehn Jahren hätte ich vollends zugestimmt: Wer ganz nach oben kommen will, muss sich durchbeißen, koste es, was es wolle. Doch inzwischen verspüre ich einen Zwiespalt. Wie viel Druck ist wirklich nötig? Wo verläuft die Grenze zwischen Wettbewerb und falschem Ehrgeiz? Schließen sich Höchstleistung und Selbstfürsorge aus? Was bedeutet überhaupt Peak Performance? Zählt nur die Medaille, oder braucht es nicht individuellere Erfolgsmaßstäbe, um Menschen zu ermutigen, ihr eigenes Potenzial zur Entfaltung zu bringen?
Neben meinen Kindern waren zwei Tiefpunkte ausschlaggebend für meine Nachdenklichkeit. Es ist kein Geheimnis, dass ich nach der Olympiade 2010 und der Geburt meines zweiten Kindes total ausgebrannt war.
An meinem elften Geburtstag sah ich im Fernsehen die Biathletin Uschi Disl glückselig vom Siegerpodest winken, ab diesem Moment war das Ziel »Olympia« in meinem Kopf gesetzt. Doch in der Realität entpuppten sich für mich die Spiele in Vancouver als Schimäre, ein negatives Erlebnis reihte sich ans nächste. Schon beim Trainingslehrgang auf Vancouver Island wenige Wochen zuvor merkte ich, dass ich innerhalb der Damen-Nationalmannschaft kein gutes Standing hatte. Die anderen Mädels hatten kaum mit mir gesprochen, ich konnte und kann das verstehen, wir waren alle Top-Athletinnen mit sehr guten Chancen auf Medaillen – und doch wurde ich am höchsten gehandelt, die Augen richteten sich hauptsächlich auf mich.
Der Einzug ins olympische Dorf war ernüchternd. Ich hatte es mir so schön vorgestellt: Olympia, megatolles Event, Friedenstauben, Einmarsch der Nationen, alle Sportler eine große Familie. Doch stattdessen fand ich mich auf einer halbfertigen Baustelle wieder, die Häuser schnell hochgezogen, die Zimmer spartanisch eingerichtet mit Schrank, Bett und Tisch. Ich erwartete keinen Prunk, mitnichten, aber doch ein bisschen mehr Atmosphäre, schließlich sollten hier junge Menschen fern der Heimat die beste Leistung ihres Lebens abrufen.
Hinzu kamen die vielen Pressekonferenzen und Interviews. Neben Training, Wettkämpfen und ein paar Stunden Schlaf wurde ich von A nach Z geschickt, ständig hatte ich Fragen zu beantworten, um kurz darauf mit meinen Aussagen in gedruckter Form konfrontiert zu werden: Habe ich das wirklich so gesagt, wurde ich richtig verstanden, wo ist der Zusammenhang? Gegen Ende der Spiele legten mir meine Trainer ans Herz, auf eine Nominierung im Staffelrennen doch bitte zu verzichten, da ich im Gegensatz zu den anderen Teammitgliedern schon drei Medaillen gewonnen hatte.
Zurück in Deutschland folgte der große Showdown. Über Frankfurt ging es nach München. In der Ankunftshalle am Flughafen warteten eine Musikkapelle und die Kinder vom Skiclub aus meinem Heimatdorf auf mich, ich habe mich total gefreut, endlich zu Hause, endlich vertraute Gesichter. Doch die Presse hat die Menschen einfach überrannt, es war ein großer Tumult, fast kam es zur Schlägerei, ein Security-Mitarbeiter zog mich aus der Menge und brachte mich in Sicherheit. Ich habe nur noch geheult, doch es gab keine Pause, im Autokorso ging es über die Leopoldstraße zur Abschlussveranstaltung am Münchner Marienplatz.
Nach 36 Stunden ohne richtigen Schlaf stand ich völlig übermüdet oben auf dem Rathausbalkon, lächelte und winkte, gefühlt nur noch ein Schatten meines Selbst. Danach bin ich zu meinem Partner in die Wohnung und habe mich ins Bett gelegt. Desillusioniert und am Ende meiner Kraft.
Vermutlich ist es schwer nachzuvollziehen: Mit zwei Goldmedaillen und einer Silbermedaille um den Hals muss man doch glücklich sein! Doch ich habe mich extrem fremdgesteuert und belastet gefühlt. Plötzlich sprechen Menschen mit dir, weil du eine Medaille gewonnen hast, und plötzlich sprechen Menschen nicht mehr mit dir, weil du eine Medaille gewonnen hast. Ich war mit meinen 22 Jahren nicht darauf vorbereitet und hätte mir Unterstützung gewünscht. Außer Familie und Freunde hat mich keiner gefragt, wie es mir geht, ob alles in Ordnung ist oder ich etwas brauche. Als Mensch war ich in dieser Biathlonwelt nicht existent. Es ging nur um mich als Sportlerin, die bestmöglich zu performen hat. Die Realität hat mich getroffen wie ein Hammerschlag, ich fühlte mich nicht nur um meinen Kindheitstraum betrogen, ich war menschlich enttäuscht.
Bis dato hatte ich mir keine Gedanken über mein Karriereende gemacht. Doch als ich mich so erschöpft durch meine Tage schleppte, spürte ich, dass ich den Schlusspunkt wesentlich früher setzen werde, als ich mir das immer vorgestellt hatte. Ich überlegte, welcher Wettbewerb ein würdiges Finale sein könnte. Klar war: Meine ersten Olympischen Spiele werden die letzten sein, einmal und nie wieder. Stattdessen entschied ich mich für das Saisonende 2012 mit der Weltmeisterschaft in Ruhpolding als Höhepunkt.
Rückblickend war es extrem wichtig, dass ich mir an diesem Tiefpunkt ein konkretes Ziel setzen konnte. Es gab mir die Kraft, wieder auf die Beine zu kommen, mich auszurichten und zu fokussieren. Nach einigen Wochen Pause ohne jeglichen Sport fing ich langsam an zu trainieren, und ich merkte, wie die Leidenschaft zurückkehrte. Das Ende war absehbar, und ich war bereit, noch einmal alles aus mir herauszuholen und meinen Sport in jeder meiner Faser zu spüren.
Damals wusste ich es natürlich nicht, doch die letzten beiden Jahre waren die schönsten meiner sportlichen Laufbahn. Ich machte einen Sprung, körperlich und mental, nahm mich und meine Bedürfnisse ernster, trainierte nach meinem eigenen Plan und beendete meine Laufbahn voller Zufriedenheit. 28 000 Zuschauer im Stadion, entlang der Strecke hielten Fans »Danke Lena«-Plakate in die Luft und verneigten sich vor mir, ich holte zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze und landete damit in der WM-Bestenliste mit insgesamt 17 Medaillen hinter Ole Einar Björndalen auf Rang zwei. Wenn ich mir heute die Pressekonferenz anschaue, merke ich, wie müde, aber auch freigeschwommen ich damals war. Sicher, es hätte noch besser laufen können, doch ich war mit mir im Reinen und musste mir nichts mehr beweisen.
Dennoch reichte die Lernkurve während und nach Olympia nicht aus, um mich vor einem zweiten Burnout zu bewahren.
Nach Karriereende habe ich mit meinem Management weitergearbeitet, damals hatte ich Verträge mit zwölf Werbepartnern, absolvierte in ganz Deutschland Drehs, Fotoshootings, Meet & Greets, Charity-Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen. Mit einem Kind ließ sich das alles noch irgendwie handeln, doch als mein zweites auf die Welt kam, erreichte ich meine Belastungsgrenze extremer als jemals zuvor. Bereits zehn Tage nach der Geburt stand ich wieder vor der Kamera, zu sehr hallten die Worte meines Beraters im Ohr: Wenn du nicht dranbleibst, bist du weg vom Fenster, eine längere Babypause kannst du dir nicht leisten. Ich habe das geglaubt und – ganz wie in meiner Profizeit als Sportlerin – abgeliefert. Was muss, das muss. In dieser Zeit nahm ich extrem ab, mein Körper war übersät von roten Punkten, ich hatte immer das Gefühl, nie richtig gesund zu sein.
Eines Tages saß ich frühmorgens im Auto auf dem Weg zum Flughafen und erlebte eine Panikattacke. Mein Herz raste, Schweiß lief mir von der Stirn. Ich fuhr rechts ran, versuchte mich zu beruhigen, atmete so langsam wie möglich ein und aus und konnte erst nach einer guten halben Stunde weiterfahren. Zu meinem Termin bin ich noch geflogen, doch zurück zu Hause kontaktierte ich einen befreundeten Arzt, ließ mich durchchecken. Das Ergebnis war eindeutig: Pfeiffersches Drüsenfieber, Schilddrüsenüberfunktion, Vitamin- und Mineralmangel, mein Körper war ausgezehrt. Mein Arzt schaute mich an und sagte: Es grenzt an ein Wunder, dass du noch aufrecht gehen kannst, es ist kurz vor knapp.
Neun Monate hat es gedauert, bis ich wieder einigermaßen bei Kräften war, ein Jahr musste ich ganz auf Sport verzichten, um mein Herz nicht dauerhaft zu schädigen. Später titelte ein Boulevardblatt: »Magdalena Neuner – Burnout wegen zweitem Kind.« Ich habe mich sehr geärgert, wie ungerecht das meinem Sohn gegenüber war! Nicht er war schuld an meinem Tiefpunkt, sondern ganz alleine ich.
Die Schuld bei anderen zu suchen, war noch nie meins. Sicher hat das Umfeld einen Einfluss, Eltern, Lehrer, Trainer, der Chef, Kollegen, vermeintliche Freunde – oder abstrakter: die Presse, die Politik, die Weltlage an sich. Wir sind Menschen und stehen in vielerlei Bezügen. Doch im ersten Schritt sollte es aus meiner Sicht um den eigenen Anteil gehen: Inwiefern trage ich durch mein Verhalten selbst dazu bei? Sowohl beim ersten als auch beim zweiten Burnout war ich nicht in der Lage, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, Alarmzeichen ernst zu nehmen, Grenzen zu setzen, »Stopp« statt »Ja« zu sagen.
Ich schildere das so ausführlich, weil es darum geht, zu einem neuen Leistungsverständnis zu kommen. Wie können wir Menschen zu Leistung und Höchstleistung animieren, ohne sie zugleich ins Risiko zu schicken, physisch und psychisch zu verbrennen? Blickt man auf die Zahlen, die von Instituten regelmäßig veröffentlicht werden, scheint es das Eine ohne das Andere fast nicht zu geben. Wieviele Peak Performer rauschen nach der Spitzenleistung in einen Burnout oder leiden unter Selbstzweifeln, Angstzuständen, Panikattacken?
Es ist ein wiederkehrendes Muster: Fahrt aufnehmen, Peak erklimmen, talwärts rauschen. Fahrt aufnehmen, Peak erklimmen, talwärts rauschen. Als Spitzensportler mit begrenzter Halbwertszeit mag die Rechnung aufgehen, doch als Unternehmer oder Topmanager mit wesentlich längerer Karrierelaufbahn ist es ein gefährliches Spiel.
Wie gerne würde ich die Frage, ob ich auch mit weniger Härte mir selbst gegenüber so erfolgreich gewesen wäre, eindeutig beantworten. Aber ich kann es nicht. Ich kann nur versuchen, mehrere Fäden zusammenziehen und mich einer Antwort anzunähern.
•Nachdem ich mich von meinem ersten Burnout erholt hatte, suchte ich das Gespräch mit meinen Trainern. Ich wollte individueller trainieren und nicht mehr an den Lehrgängen der Nationalmannschaft teilnehmen, weil mir das Training zu sehr Schema F war, damals erhielt jeder Athlet denselben Plan. Mit meinem Erfolg bei Olympia hatte ich genug Standing, solche Forderungen zu stellen, und man stimmte zu. Wie bereits erwähnt, waren die zwei Jahre die schönsten in meinem Sportlerleben, und ich beendete meine letzte Saison in Bestform. Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich all die Jahre zuvor das ganz normale Leistungstraining durchlaufen, die Basis war gelegt.
•Rückblickend war mein größtes Defizit meine Unfähigkeit, klipp und klar »Nein« zu sagen, »bis hierher und nicht weiter«. Einerseits. Andererseits brachte mir meine unkomplizierte, meist freundliche, in keiner Weise zickige Art viele Sympathiepunkte bei Journalisten und Fans ein. In all den Jahren gab es in der Presse über mich so gut wie kein abwertendes Wort, keine negativen Schlagzeilen. Und entlang der Strecke konnte ich mich stets auf den Zuspruch der Zuschauer verlassen. Während ich auf der Schießmatte versucht habe, die Massen hinter mir auszublenden, habe ich mich zurück auf der Piste von dem Jubel meiner Fans bewusst tragen lassen. Ihre Rufe haben mich enorm gepusht.
•Wie fragil das Ganze ist, habe ich besonders bei einer Veranstaltung gemerkt. Ich lief an meinen Fans vorbei, sie wollten Autogramme oder mir die Hand schütteln, doch ich musste schnell zur Pressekonferenz sowie Dopingkontrolle und hatte keine Zeit. Prompt kippte die Stimmung und ich hörte statt »Lena, Lena« derbe Beschimpfungen. Zwischen Verehrung und Verachtung liegt ein schmaler Grat. Was mich zu der Frage führt, die ich hier kurz anklingen lassen möchte: Bei allem Hype um Individualität, Selbstbestimmung und Freiheitgrade – wie viel davon gestehen wir Menschen wirklich zu, und wie viel sind wir als Lehrer, Trainer, Eltern oder Gesellschaft bereit zu ertragen?
•Nach meinem Karriereende habe ich zusammen mit meinem Management richtig Gas gegeben, die Angst war groß, zu schnell in Vergessenheit zu geraten. Unser Aktionismus war erfolgreich, neben meinen bestehenden Werbeverträgen sind rasch neue hinzugekommen. Finanziell war das natürlich toll, doch hat alles zu mir gepasst? Heute bin ich meine eigene Chefin, setze mich nicht unnötig unter Druck, lasse mich von niemandem kirre machen und nehme nur Aufträge von Unternehmen an, hinter deren Marke und Produkte ich zu 100 Prozent stehen kann. Die Zeit hat mich gelehrt, dass ich auch hier vertrauen darf: Wenn man weiß, was man will, klären sich die Dinge und fügen sich zu einem stimmigen Ganzen.
Man sieht allein an diesen drei Beispielen: Auf ein Einerseits folgt ein Anderseits, auf ein Ja ein Aber, vermeintliche Nachteile stehen vermeintlichen Vorteilen gegenüber.
Dennoch bin ich mir inzwischen sicher: Ohne Fleiß, Disziplin, Leistungsbereitschaft und Durchhaltevermögen geht es nicht. Um Top-Leistung abzurufen und dann das nächste und übernächste Level zu erreichen, muss es die Extrameile sein. Auch Niederlagen und Misserfolge gehören unbedingt dazu, schon alleine, weil das Verlierenkönnen genauso wichtig wie das Gewinnenkönnen ist. Respektvoll und in aller Fairness.
Ich bin mir inzwischen sicher, dass ein Sich-völliges-Verausgaben nicht notwendig ist. Denn es ist in der Regel stark mit Glaubenssätzen verknüpft, die Menschen unnötig Kraft rauben und in unserer Zeit gleich zweimal nicht passen. »Ich darf nicht anecken«, »Ich darf keine Fehler machen«, »Liebe muss ich mir verdienen«, »Wenn ich um Hilfe bitte, ist das ein Zeichen von Schwäche«, »Ein Peak Performer kennt keinen Schmerz« – es gibt so viele davon.
Mit meinen Kindern spreche ich abends häufig positive Affirmationen: »Ich glaube an mich und habe mich lieb«, »Ich bin sicher und beschützt«, »Ich bin ein Sonnenschein und bin geboren, um glücklich zu sein«, »Das Leben ist schön und ich darf jeden Tag genießen.« Manche mögen darüber schmunzeln, doch ich möchte den negativen Glaubenssätzen, die nach wie vor durch unsere Gesellschaft wabern, etwas gegenüberstellen. Und ich würde meinem jüngeren Ich raten: Höre immer gut auf dich, mache im Zweifel weniger, finde einen Mittelweg. Mentale und körperliche Gesundheit sind ein hohes Gut und wichtiger als jede Medaille – und wer weiß das schon, vielleicht wäre ich noch erfolgreicher gewesen, wenn ich diesen Ratschlag beherzigt hätte, schließlich hat mich nicht mein geliebter Sport in die Knie gezwungen, sondern vor allem das Drumherum, das Geziehe und Gezerre und Besserwissen. Wir kolportieren gerne die immer gleichen knochenharten Heldengeschichten, ohne sie groß zu hinterfragen.
Wenn mich heute der Alltag zu überrollen droht, versuche ich, mich aktiv rauszuziehen. Fahre zum See oder gehe hoch zur Wallgauer Alm. Nur wenige Meter oberhalb der Hüttenwirtschaft steht ein Gipfelkreuz, das meine beiden Großväter geschreinert haben. Hier oben kann mich niemand erreichen, es gibt keinen Empfang, das Handy ruht. Bereits auf dem Weg sortieren sich meine Gedanken, und wenn dann mein Blick über Bergwiesen und Wälder hinüber zum Wettersteingebirge gleitet, spüre ich:
•Wertschätzung gegenüber meiner eigenen Leistung.
•Urvertrauen: Alles wird gut.
•Dankbarkeit, trotz allem, natürlich!
Ich durfte mich ganz und gar meiner Leidenschaft hingeben, war viel draußen, habe ferne Länder bereist, Menschen kennengelernt und Freundschaften geschlossen. Und lebe auch jetzt das Leben, das ich leben möchte. Nicht minder aufregend, aber auch nicht weniger herausfordernd.
Wenn ich abends gegen halb elf auf mein Sofa sinke, die Kinder liegen glücklich im Bett, der Abendbrottisch ist abgeräumt und von den drei Wäschekörben steht nur noch einer herum, kann ich mir inzwischen auf die Schulter klopfen und mir sagen: Was für eine Peak Performance man als Mama jeden Tag und über alle die Jahre vollbringt! Vor allem, weil es nicht mehr nur um einen selbst geht. Als Eltern trägt man die Verantwortung für andere Menschen, muss für sie da sein, ihnen zuhören, sie unterstützen und behutsam und voller Zuversicht in ihr eigenständiges Leben schubsen.
Auch hier käme ich mit eiserner Disziplin und maximaler Härte gegenüber mir selbst nicht weit, es bedarf einer guten Portion Selbstliebe, um dauerhaft die Kraft zu haben, meine Kleinen verlässlich durch ihre Kinder-und Jugendzeit zu begleiten. Als Sportlerin, Testimonial oder Rednerin mag ich austauschbar sein, als Elternteil nicht, einen weiteren Burnout kann ich mir definitiv nicht erlauben. Es geht nicht mehr nur um Wettkämpfe, Medaillen oder Werbedrehs, alles mehr oder weniger vergänglich, sondern um das nachhaltige Wohl meiner Kinder, um das Heranwachsen zu stabilen Persönlichkeiten.
Wenn ich nicht auf mich achte, gehen mir die nötige Flexibilität, Weichheit und zuweilen auch das Bewusstsein verloren, dass jedes Kind anders ist und etwas anderes benötigt.
Ein kleines Beispiel: Als Kind habe ich gleich nach dem Mittagessen mit meinen Hausaufgaben begonnen. Ich wollte sie erledigt wissen, bevor ich ins Training fuhr oder mich mit meinen Freunden traf. Eine Abweichung von diesem Plan habe ich mir eher selten erlaubt, es wäre mir auch nicht in den Sinn gekommen. Doch ich kann meine Strategie nicht meinen Kindern überstülpen. Jedes hat seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Kopf, sein eigenes Tempo, seinen eigenen Rhythmus. Ich musste lernen: Was für mich funktioniert, funktioniert nicht unbedingt für sie.
Die Erinnerung an meine Eltern hat mir geholfen. Auch unser Haus war keine ganz glaubenssatzfreie Zone. In meinem Heimatort mit damals vielleicht 1000 Einwohnern achtete jeder auf jeden, die gebügelte Bluse und die perfekt geflochteten Zöpfe für den sonntäglichen Kirchenbesuch waren eine Selbstverständlichkeit, jeder verstand die allgemeingültige Handlungsmaxime: »Sei nett, ecke nicht an, falle nicht auf.« Man musste sie nicht extra aussprechen. Doch ich hatte das große Glück, dass meine Eltern mir nie vorgeschrieben haben, wie ich etwas zu erledigen habe. Vielmehr gaben sie mir das Gefühl, dass ich meine Ziele erreichen werde, wenn ich sie wirklich erreichen möchte und mein Bestes dafür gebe. Und dass ich für meine Erfolge und Misserfolge, sei es im Sport oder in der Schule, selbstverantwortlich bin. Meine Eins ist meine Eins, meine Fünf ist meine Fünf.
Rückblickend war das eine riesige Leistung. Ich komme aus einem bodenständigen Haushalt. Mein Vater arbeitet als Bankkaufmann bei einer Bank, meine Mutter vermietet Ferienwohnungen und hat sich um uns vier Kinder, ihren körperlich schwerbehinderten Bruder und ihre pflegebedürftige Mutter gekümmert. Es war eine finanzielle Herausforderung, mich und meinen Sport zu unterstützen, nicht nur mein Equipment musste bezahlt werden, sondern auch die vielen Aufenthalte in Pensionen und Hotels an den Wochenenden. Ich denke schon, dass meine Eltern Sorge hatten, ob meine Berufswahl vernünftig ist. Zumal einige meiner Lehrer klar abrieten: Profisportler ist kein Beruf, schon gar nicht für Mädchen! Doch für mich kam nichts anderes infrage, und sie standen felsenfest hinter mir.
Gottseidank hat die Phase des Hoffens und Bangens nicht allzu lange gedauert, es zeigte sich relativ schnell, dass ich tatsächlich das Zeug hatte, vom Sport leben zu können. Aber am Anfang wussten meine Eltern das natürlich nicht. Ich war ein Kind, das mit sechs Jahren zum ersten Mal auf Langlaufskiern und mit neun Jahren zum ersten Mal auf einer Biathlon-Schießmatte stand – und ab da felsenfest überzeugt war: Diese Bretter und dieses Gewehr sind meine Bestimmung.
Die Individualität und das Tempo seiner Kinder zu respektieren und sie in die Eigenverantwortung zu schicken ist nicht einfach, das bekomme ich auch in meinem Umfeld mit. Manchmal fehlt die Geduld, und manchmal hat man zwischendurch auch Angst, dass sie ihren eigenen Weg nicht finden werden, weil vieles nicht immer so ganz klar ist:
•Wo liegen ihre Talente?
•Für was brennen sie, beziehungsweise brennen sie überhaupt für etwas?
•





























