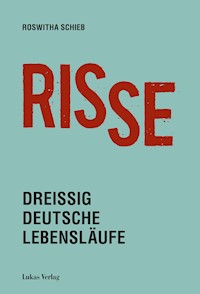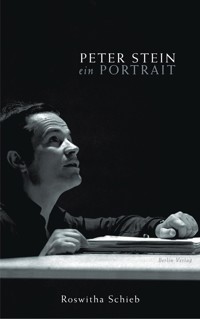
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Peter Stein begann 1967 in München mit der ersten selbstständigen Inszenierung, »Gerettet« von Edward Bond. Es war ein beeindruckender Erfolg und der erste Schritt einer steilen Karriere. Aufgrund des Erfolgs erhielt Stein eine Einladung nach Bremen, um dort »Kabale und Liebe« zu inszenieren. Hier kam es zur Begegnung und einer ersten Zusammenarbeit mit den Schauspielern, die später die Schaubühne in Berlin prägen sollten: Edith Clever, Bruno Ganz und Jutta Lampe. Zurückgekehrt nach München, arbeitete er als Assistent mit Fritz Kortner zusammen, dem er, wie er selbst betont, viel verdankt. Die wichtigste und erfolgreichste Phase seiner Karriere wurde die Schaubühnenzeit in Berlin von 1970 bis 1985 mit den berühmten Inszenierungen von »Peer Gynt«, »Prinz von Homburg«, den Antikenprojekten, Shakespeare und Tschechow. Lange und gründliche Proben, ein enges Verhältnis zu den Schauspielern, die er stark in die Regiearbeit einbezog, die Betonung des Bühnenbildes, Authentizität des Gefühls - das waren die Prinzipien, unter denen Steins Arbeit in Berlin stand. Nach der Berliner Zeit arbeitete Stein, von der deutschen Theaterszene und der Kritik enttäuscht, vor allem im Ausland, inszenierte zunehmend Opern, verwirklichte sein großes Faust-Projekt, mit dem er auch noch einmal nach Deutschland zurückkehrte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Roswitha Schieb
PETER STEINein PORTRAIT
Berlin Verlag
VORWORT
Als ich Peter Stein die Idee unterbreitete, eine Biographie über ihn zu verfassen, reagierte er zunächst ablehnend, mit den Worten: »Eine Biographie? Aber mein Leben ist doch gar nicht interessant!« Das könne schon sein, antwortete ich daraufhin, aber auf sein Werk würde diese Einschätzung ja wohl nicht zutreffen.
Tatsächlich hat Stein, wie Ivan Nagel betont, im Gegensatz zu anderen Regisseuren, ein Werk geschaffen. Gerade innerhalb der mit Beliebigkeiten kämpfenden Welt der Theaterschaffenden zeichnet sich das Œuvre Steins durch künstlerische Kraft und innere Einheit aus, die sich in der Kontinuität wiederkehrender Motive, Themen und Autoren zu erkennen gibt. Den großen historischen Stücken und Autoren wie der »Orestie«, Shakespeare, Racine, Goethe oder Tschechow setzt Stein absichtsvoll zeitgenössische Stücke entgegen, deren Texte er in derselben, der Genauigkeit verpflichteten Weise ernst nimmt, mit derselben Intensität durchdringt. Er besitzt die Fähigkeit, höchste und niedrigste Sprachebenen gleichermaßen auf die Bühne zu bringen. Es ist kein Zufall, daß Stein die »Orestie« und das derbe, zeitgenössische Stück »Klassenfeind« im gleichen Jahr inszenierte. Alle seine Inszenierungen, von der ersten bis zur bisher letzten, tragen seine unbedingt wiedererkennbare Handschrift. Es ist die Handschrift der intelligenten Klarheit, der dramaturgischen Durchdringung, der Verständlichkeit des schauspielerischen Sprechens und Agierens, der Angemessenheit gegenüber dem Stück, auch in Bühnenbild und Kostümen, und der ebenso ernsthaften wie spielerischen Theaterhaftigkeit der Inszenierungen, die von Peter Steins großer und tiefer Liebe zum Medium Theater Zeugnis geben.
Über seinen einprägsamen Inszenierungsstil hinaus sind es immer wiederkehrende Motive, die Steins Werk wie mit Reizleitungsbahnen durchziehen und die einzelnen Inszenierungen in geheimer Weise miteinander verknüpfen: Kampf in allen Formen, Ringkampf, Streit, Machtkampf, Boxkampf, sowie die Spannung zwischen Mutter und Sohn, die von übermäßiger Liebe bis hin zu Muttermord reichen kann, stellen Hauptmotive dar, die dem Steinschen Œuvre einen vitalen Herzschlag verleihen.
Freud warnte vor den Gefahren des Genres der Lebensbeschreibung. »Die biographische Wahrheit«, so schrieb er, »ist nicht zu haben, und wenn man sie hätte, wäre sie nicht zu brauchen.« Das Werk Steins steht immer in engem Zusammenhang mit der Person Steins, ohne jemals privat oder gar privatistisch zu sein. Vielleicht läßt sich Steins Schaffen als die Nachaußenstülpung seiner Biographie mit allen ihren Spannungen und Widersprüchlichkeiten beschreiben. Und noch etwas kommt zur Charakterisierung seines Œuvres hinzu: Es gibt keinen anderen deutschen Regisseur, der, ohne die Gegenwart zu verraten (über die Hälfte der Inszenierungen Steins sind Stücke aus dem 20. Jahrhundert), derart von Geschichte besessen ist wie Peter Stein, der ein geradezu ehrfürchtiges Verhältnis der Geschichte gegenüber hat. Das akribische Ernstnehmen von Geschichte dient ihm als Transzendierung eines engen, öden und beschränkten Jetzt und Heute. Reine Gegenwart sowie die Entschärfung historischer Texte und Zeugnisse, um sie auf ein gegenwärtiges Niveau zu bringen, empfindet Stein als Reduktion. Statt dessen möchte er die historische Distanz und alles Fremde, das damit verbunden ist, nicht einebnen, sondern als bereichernde Kraftquelle, als großangelegte Horizonterweiterung für heute nutzen.
Es gibt noch ein Motiv, das sein Werk durchzieht: Es ist die Sehnsucht nach Arkadien, nach der Utopie als Unort, eine Sehnsucht, so alt wie die Menschheit und niemals erfüllt. Dieser melancholischen Erkenntnis stellt sich Stein. Und doch hat er sein Leben lang versucht, mit seinem Theater, mit seinen Inszenierungen, mit einzelnen Szenen und Bühnenmomenten künstliche Paradiese zu gestalten, die für ihn nur dann erzeugt werden können, wenn er aus der Fülle der theaterhaften Mittel schöpfen kann, und die sich seinem Publikum als gemessen-glühende Bilder zuweilen lebenslang einprägen.
KINDHEIT UND JUGEND
Peter Stein wurde am 1. Oktober 1937 in Berlin geboren. Seine Familie wohnte zunächst in Berlin-Frohnau in der Straße Im Fischgrund, später im Wiesengrund, wo Peter Stein einige Jahre lebte. Als Berlin während des Krieges als zu gefährlich für Kinder galt, wurde er zunächst nach Westpreußen/Pommern verschickt und dann zusammen mit seinem Cousin Hubertus von Stolzmann in Altwarp am Stettiner Haff untergebracht. Der sieben Jahre ältere Bruder Peter Steins, Paulus, ging während des Krieges in Misdroy (Wollin) aufs Gymnasium.
Steins Mutter stammte aus einer Soldatenfamilie. Ihr Vater, Paulus von Stolzmann, war der Mitbegründer der Reichswehr, nach Steins Aussagen ein schlimmer »Kommunistenkiller« im Mansfeldischen. Einer ihrer Brüder, Hans-Joachim von Stolzmann, der Vater von Steins Cousin Hubertus, war General unter Hitler. Daher besaß die Frau dieses Generals, Steins Tante, während des Krieges etliche Privilegien. Da sich während der Bombardierung Berlins keine Kinder unter sechs Jahren in der Stadt aufhalten durften, zog die Mutter mit ihrem Sohn Peter wie oben erwähnt nach Altwarp, wo es einen Truppenübungsplatz gab. Dort waren sie als Gast der Tante, der Generalsfrau, in einem Häuschen einquartiert. Dieser Status als Gast muß für Steins Mutter äußerst belastend gewesen sein. Heute ist Stein der Überzeugung, daß die ihn prägendste Zeit die Kriegs- und unmittelbare Nachkriegszeit gewesen sei, aus der sich seine wichtigsten Eindrücke und Erinnerungen speisen, gegen die alles andere verblasse.
Peter Stein (links) mit Bruder Paulus, 1939
Die meisten Erinnerungen an diese frühe Zeit auf dem Lande, in der Natur von Altwarp, sind freundlich. Es sind Erinnerungen an einen Garten, in dem Mohrrüben wuchsen, an »ein großes Paradies« (Stein). Deutlich steht Stein aber auch eine lebensbedrohliche Begebenheit vor Augen. Beim Bötchen-Spielen fiel er einmal ins Wasser des Haffs, ertrank fast, versuchte, sich in Todesangst an den Holzpollern festzuhalten, versank aber immer wieder im grünschlierigen Wasser, bis er schließlich von Wehrmachtssoldaten, die sich in einer kleinen Hütte aufhielten, gerettet wurde. Nie wird er vergessen, daß diese, nachdem er zitternd wieder an Land war und literweise Wasser ausspuckte, sich über sein Mißgeschick köstlich amüsierten und ihn auslachten. Direkt nach der Wende 1990 fuhr Stein zusammen mit seinem Bruder Paulus und seinem Cousin Hubertus von Stolzmann nach Altwarp, wo er starke Déjà-vu-Erlebnisse hatte: Der kleine Ort Altwarp, das Haff, sogar die Hütte sahen fast genauso aus wie im Jahr 1944. Allerdings wirkte alles etwas heruntergekommener. Als dann plötzlich noch ein Soldat aus der Hütte trat – ein NVA-Soldat –, war es um Stein geschehen. Hemmungslos erzählte er dem verwirrten Soldaten in einem Ausbruch von Sentimentalität seine alten Geschichten, mit denen dieser natürlich nichts anfangen konnte. An ein Picknick mit Bruder und Cousin mit Blick über das Haff erinnert sich Stein voller Innigkeit. Als sie aber in dem Hof des Hauses, in dem sie damals untergebracht waren und das jetzt ganz verfallen war, die vergrabene Kiste mit Silber und Adelsdiplomen suchten, die sie damals dort versteckt hatten, wurden sie von den Bewohnern Altwarps mit Steinen beworfen und verjagt. Die Kiste hatten sie nicht mehr auffinden können. In Prenzlau wiederholte sich dieser Vorgang: Beim Aussteigen aus dem Auto wurden die drei von Ortsansässigen ebenfalls mit Steinen beworfen.
Im Februar 1945 floh die Familie mit dem Pferdeschlitten über das gefrorene Stettiner Haff Richtung Westen. Geschützdonner ertönte im Osten, »im Osten wurde es wieder rot« (Stein). Der siebenjährige Peter Stein ging als Frischoperierter auf die Flucht. Kurz zuvor war er nämlich nach Berlin eingeschmuggelt worden, wo ein Freund seiner Mutter als Chefarzt an der Charité arbeitete. Stein wurde dort an einem Hoden- oder Leistenbruch operiert. Er erlebte einen Volltreffer auf die Charité mit und kommentiert heute dieses Erlebnis spröde: »Das war unschön.« Er befand sich in einem Zimmer mit lauter erwachsenen Männern, mit Kriegsverletzten, Generälen und Hauptleuten. Aufgrund der Privilegien war Stein »natürlich« erster Klasse untergebracht, aber auch in einem Erste-Klasse-Zimmer lagen zehn Personen. Wenn dann die Sirenen heulten und die Angriffe begannen, fingen alle Patienten an zu schreien, sprangen aus dem Bett und liefen durcheinander. Einbeinige humpelten herum. Stein erinnert sich dieser Szenen als einer einzigen Hölle. Wenn dann die Sirenen ertönten, wurden nicht etwa alle, sondern nur die Privilegierten durch das Treppenhaus in den Luftschutzkeller gebracht. Einmal machte es »Rums!«, eine Seite des Treppenhauses war weggebombt, und Stein konnte den Berliner Nachthimmel mit den Sternen sehen. Die Männer brüllten laut. Stein erinnert sich daran als »ganz, ganz furchtbar«. Dann sagte er: »Davon könnte ich stundenlang erzählen, aber das wollen wir bleibenlassen.«
Die Fahrt mit dem Pferdeschlitten über das zugefrorene Haff hat sich ihm tief ins Gedächtnis eingegraben. Die Familie floh nicht in einem Treck, sondern zunächst allein. In den Treck gerieten sie erst später. »Da war natürlich Schluß für jemanden wie mich, da kann man dann die Erwachsenen nicht mehr in irgendeiner Weise als besonders interessant betrachten« (Stein). Denn er sah im Treck Hunderte, Tausende von – wie ihm schien – wahnsinnig gewordenen Erwachsenen. Der allergrößte Skandal war für ihn der Anblick von Leuten in Schlafanzügen, die mit einer Stehlampe in der Hand herumliefen. Anscheinend waren diese Hals über Kopf geflüchtet. Als Kind aber mußte er denken, daß sie verrückt geworden seien, da man doch nicht im Schlafanzug bei dieser Kälte mit einer Stehlampe in der Hand herumlaufen kann, »entsprechend waren das alles Spinner für mich, diese Erwachsenen, totale Spinner, meine Eltern eingeschlossen«. Die Flucht dauerte ungefähr drei, vier Wochen. Wenn noch Züge fuhren, wurden die benutzt, sonst ging es zu Fuß durch das zusammenbrechende Deutschland.
Da Steins Tante, die Generalsfrau, mit ihnen floh, waren sie »am Anfang noch privilegiert«. Die Familie kam immer in den Gepäckwagen direkt hinter der Lokomotive unter, während die nicht-privilegierten Flüchtlinge auf dem Dach der hinteren Waggons saßen und sich an dem Zug anklammerten. Als der Zug in Halle einfuhr, wurde die Stadt gerade von einem Luftangriff erschüttert. Immer, wenn die Sirenen heulten, setzte der Lokführer den Zug sofort in Bewegung, egal, ob die Leute eingestiegen waren oder nicht, und fuhr aus dem Bahnhof heraus. Stein schaute sich von vorne zum hinteren Zugteil um, und plötzlich war dieser ganze hintere Zug weggebombt. Immer wieder gerieten die Züge in Tieffliegerangriffe. Gepäck hatten die Steins keines dabei. Als Frischoperierter wurde Peter Stein von seinem älteren Bruder auf den Schultern getragen. Auch hier wehrt er sich wieder gegen die Erinnerung: »Na ja, lassen wir das, das geht ja nun mächtig in die Tiefenschichten.«
Auf der Flucht gelangte die Familie auch nach Salzburg. Noch heute rührt aus den Erinnerungen Steins an diese Zeit geradezu eine Art Salzburg-Phobie. In Salzburg erlebte er das Kriegsende mit, und fürchterliche Dinge prägten sich dem Siebenjährigen ein. Sofort nach dem Ende des NS-Regimes, nach dem Zusammenbruch des »Tausendjährigen Reichs«, beging die Schwester von Steins Vater, eine weitere Tante Steins, die äußerst hitlerbegeistert war, Selbstmord. Sie erschoß sich auf dem Abort einer Burg und hinterließ einen zwei-, dreijährigen Jungen, Stefan, der als Ziehkind in Steins Familie aufgenommen wurde. Am schlimmsten, geradezu alptraumartig hat Stein zu Kriegsende die Salzach in Erinnerung. Der Fluß führte Hochwasser. Auf der einen Seite fuhren die Panzer der Amerikaner, und die Salzach-Auen bei Wildshut waren überschwemmt. Da trieben Baumstämme, Tierleichen und auch Menschenleichen an, mit denen Stein und andere Kinder spielten. Manchmal blieben die Leichen an Sträuchern hängen und wurden dann mit Stöcken »weggestiekst«. Viele Leute waren damals in der Salzach ertrunken, als sie über die Grenze schwimmen wollten. Viele begingen Selbstmord.
Dort, wo sich in Salzburg heute die Mönchsberg-Tiefgaragen befinden, waren damals Luftschutzkeller. Kaum war Stein mit seiner Familie in Salzburg angekommen, bekam Salzburg den letzten großen schweren Fliegerangriff ab, bei dem auch der Dom zerbombt wurde. Während dieses vernichtenden Angriffs hielt sich Steins Familie in den Luftschutzkellern unter dem Mönchsberg auf.
Als Reichsdeutsche mußten die Angehörigen von Steins Familie Salzburg nach Kriegsende verlassen. Sein Vater erkrankte an Gelbsucht und starb fast daran. Zwei Monate vor Kriegsende, im März 1945, als die Russen nach Berlin kamen, hatte Steins Vater, der Maschinenbauingenieur war, seine Maschinen in drei Züge verladen. Einer dieser Züge kam nie an, der zweite tauchte beschädigt in Blumberg (Baden) auf und der dritte unbeschädigt in Salzburg. In dem Stollen, der heute der Autobahn-Tunnel nach Golling ist, hatte Steins Vater noch kurz vor Kriegsende versucht, seine Produktion weiterzuführen. Er stellte die Maschinen seiner verlagerten Fabrik in dem Tunnel auf und war gerade im Begriff, seine Produktion wieder aufzunehmen, als die Amerikaner einmarschierten. Steins Vater hatte viele Russen beschäftigt, vor denen er nach Kriegsende natürlich Angst hatte. Aber da er vorher oft mit ihnen getrunken hatte, taten sie ihm nichts, denn er war sehr trinkfest und daher bei den Russen anerkannt. »Na, das ist nicht meine, das ist seine Geschichte«, sagt Stein und wehrt damit eine Vertiefung dieses Vater-Themas ab.
1945, mit sieben, acht Jahren, begann Stein mit den amerikanischen Soldaten zu »handeln«. Die Amerikaner wollten von ihm unanständige Wörter wissen, um sich leichter an deutsche Mädchen heranmachen zu können, und boten ihm als Bezahlung für seine Leistungen Schokolade an. Da Stein aber gar keine unanständigen Wörter kannte, versuchte er, die älteren, vierzehnjährigen Bauernjungen danach auszufragen. Als er von ihnen das Wort »Pflaume« gesagt bekam, bezahlten die Amerikaner ihn dafür in Schokolade. Ein weiteres Wort, das er von den Bauernjungen erfuhr, war »mausen«, was ihm aber als unanständiges Wort nicht ganz in Frage zu kommen schien. Um dieses Wort zu überprüfen, benutzte er es scheinbar arglos seiner Mutter gegenüber. Diese sagte nur, daß »mausen« so etwas wie klauen, stehlen, wegnehmen hieße. Trotzdem teilte er es den Amerikanern mit und erhielt wieder Schokolade. Noch dazu krochen Stein und auch andere Jungen in den Flüchtlingsunterkünften umher, die zum Teil nur aus mit Decken und Tüchern abgeteilten Räumen bestanden. Sie wußten genau, wer die sogenannten »Amiliebchen« waren. Also schlichen sie unter den Decken hindurch, wenn diese gerade »beschäftigt« waren, und entwendeten Kekse und Käse, die die amerikanischen Soldaten den Mädchen mitgebracht hatten. Steins Mutter sagte ihrem Sohn später, daß er in dieser wirren Zeit mit den Keksen geholfen habe, die Familie durchzubringen. Den Käse allerdings lieferte er nicht zu Hause ab, sondern aß ihn immer allein auf.
Peter Stein (links) mit Vater und Bruder Paulus, 1944
Im Herbst 1945 fuhr die Familie zunächst in die Nähe von Frankfurt am Main, nach Buchschlag zu Steins Großmutter väterlicherseits. Kurze Zeit darauf wurden sie im Nebendorf Langen einquartiert, weil ihre Unterkunft requiriert worden war. »Da haben wir wieder alles verloren, denn wir hatten ja mittlerweile die Möbel vom Stefan.« Die Familie hatte einen Teil der Möbel von Steins Tante, die sich umgebracht hatte, aus Österreich mitnehmen können.
Steins Mutter allerdings fuhr später, etwa 1946, nach Berlin zurück und »hat ihre eigenen Sachen geklaut«. Sie begab sich allein nach Berlin über die grüne Grenze, was verboten war, und traf sich dort mit dem ehemaligen Fahrer des Vaters. Die Loyalität dieses Fahrers beeindruckte Stein. »So ist das in der Industrie, da gibt es Verbundene, nicht Freunde, aber Verbundene.« Dieser alte Berliner Fahrer des Vaters organisierte einen Transporter und fuhr zusammen mit der Mutter vor dem Haus vor, in dem sie zuletzt gewohnt hatten und in dem nun die Franzosen neue Bewohner einquartiert hatten. Die Mutter und der Fahrer gingen in das Haus und nahmen einfach die Sachen mit, die noch da waren, nichts als ein paar Möbel, während die neuen Bewohner schrien: »Diebstahl! Polizei!« Die Mutter und der Fahrer warfen die Möbel schnell auf den Wagen und fuhren ab, »das heißt, sie haben ihre eigenen Sachen geklaut«. Bei den Möbeln handelte es sich um ein Eßzimmer, »grauenvoll, aus Riopalisander«. Ein Stück davon, ein Zwanziger-Jahre-Teewagen, steht heute noch in Steins Haus in San Pancrazio. Insgesamt waren es wohl sieben oder acht Möbelstücke, die die Mutter aus dem Haus geholt hatte, alles andere war nicht mehr vorhanden, wie Stein bedauernd erzählt, die Bibliothek, die Kunstsammlung, alles, was Wert hatte, war bereits verschwunden, »nur noch das Wertlose war da geblieben, diese Riopalisander-Möbel waren besonders scheußlich«.
1946 wurde Steins Vater nach Blumberg an die Schweizer Grenze gerufen, wo einer der drei Züge mit seinen Maschinen gelandet war. Er sollte die Firma wieder aufbauen und in Gang bringen. Kaum daß er im Winter 1946 dort angekommen war, wurde ihm der Prozeß gemacht. Zwar war der Vater nicht in der Partei, aber er war »Ringleiter« gewesen. In der NS-Zeit mußten die Industriezweige, die ein ganz bestimmtes Produkt herstellten, zum Beispiel Flugzeugmotoren, in einem »Ring« zusammenarbeiten. Steins Vater war also »als junger Spund« »Ringleiter« der Flugzeugindustrie gewesen. Für seinen Bereich hatten ungefähr hundertzwanzigtausend Zwangsarbeiter gearbeitet, »Fremdarbeiter, wie es damals hieß«. Dafür wurde er nun zur Rechenschaft gezogen und aus der Firma entlassen. Er wurde als Mitläufer eingestuft und mußte ein Jahr lang als Streckenarbeiter bei der Bahn arbeiten.
Erst 1946, mit neun Jahren, wurde Stein eingeschult, in einer Zwergschule in Blumberg, in der acht Jahrgänge in einem Klassenzimmer hintereinandersaßen. Pro Jahrgang gab es eine Bankreihe. Innerhalb eines Jahres übersprang Stein mehrere Klassen. Heute meint er, daß er die zehn wichtigsten Jahre seines Lebens immer auf dem Land gelebt habe, zunächst bei der Kinderlandverschickung, dann in Österreich und schließlich in deutschen Dörfern. Den Landkindern fühlte er sich völlig überlegen. Zehn Jahre, zwischen 1943 und 1953, verbrachte er auf dem Land, dann zog er in die Stadt zurück. Erst in seinem italienischen Landsitz San Pancrazio sei ihm aufgegangen, wie sehr ihn diese frühe Zeit geprägt habe. Hier habe er zum ersten Mal seit der Kindheit wieder engen Kontakt zur Natur bekommen, die ihm gar nicht fremd, sondern sehr vertraut gewesen sei.
Mit elf Jahren wechselte Stein zum Fürstlich Fürstenbergischen Gymnasium in Donaueschingen über. In der Schule kam er sehr gut mit, alles flog ihm zu. Seine Schularbeiten machte er nie zu Hause, weil er das als Zeitverschwendung betrachtete, sondern im Schulbus. Er war Klassenprimus und konnte als Berliner mit seinem Mundwerk alle Mitschüler dominieren. Seine Hauptstärke bestand im Reden, daher war er in Fächern wie Deutsch und Religion, später auch in Geschichte, besonders gut und erfolgreich.
Donaueschingen lag in der französischen Zone. Es gab einen Plan der Franzosen, besonders begabte deutsche Kinder auf französische Schulen zu schicken, die für die französischen Besatzungssoldaten eingerichtet waren. Da Stein als guter Schüler auffiel, wurde er auf eine französische Schule nach Konstanz geschickt. Dort hielt er es nicht länger als zwei Tage aus, und zwar nicht bloß deswegen, weil er kein Französisch verstand, sondern vor allem, weil die französischen Kinder sehr frech waren. Sie erschienen Stein als äußerst anmaßend und ganz anders als die geduckten, gedrückten deutschen Kinder. Heute bedauert er sehr, daß er es in der Konstanzer Schule nicht aushalten konnte, »sonst wäre ich ein Franzose geworden«. Steins Verhältnis zur französischen Sprache, seiner ersten Fremdsprache in Donaueschingen, ist äußerst positiv. Die deutsche Sprache habe ihn als grammatikalisches Konstrukt nie interessiert, aber mit der französischen Sprache, die er sehr gerne mag, habe er denken gelernt. Dahingegen habe er zur englischen Sprache ein Verhältnis wie gegenüber einem Gebrauchsgegenstand, einem »Zahnstocher«. Englisch kann er ohne Probleme sprechen, dem Französischen gegenüber aber ist er nach eigenen Aussagen befangen und gerate nach fünf Minuten ins Stottern.
Stein wurde protestantisch erzogen und war bis zur Konfirmation innerlich sehr beteiligt an religiösen Fragen. An jedem Geburtstagsmorgen in seiner Kindheit trat die gesamte Familie an sein Bett und weckte ihn mit allen Strophen des Gesangbuchliedes »Lobet den Herren«. Noch heute, wenn »Lobet den Herren« zu seinem Geburtstag erklingt, wird er von einer weinerlichsentimentalen Stimmung ergriffen. Auch die familiäre Innigkeit zu Weihnachten hat ihn so stark geprägt, daß er die ihm eher oberflächlich erscheinenden Weihnachtsbräuche in Italien meidet und sich nach Bochum zu seiner Schwester begibt. Dort singen sie gemeinsam alle alten Weihnachtslieder, »mindestens fünfzig Stück, die meine Mutter mir beigebracht hat, mit allen Strophen«.
Mit vierzehn Jahren beteiligte sich Peter Stein in glühender Weise am Konfirmations- und Religionsunterricht. Kurz nach der Konfirmation allerdings wandte er sich in ebenso glühender Weise von der Religion ab. Noch heute sagt er: »Wie immer habe ich zuerst ein Stück weit mitgemacht und mich dann davon abgekehrt.« Der sieben Jahre ältere Bruder Paulus wurde protestantischer Pastor, später Dekan, die zehn Jahre jüngere Schwester Elisabeth wurde auch Theologin. Steins ein paar Jahre jüngerer Cousin Stefan, der 1945 nach dem Selbstmord seiner Mutter in die Familie aufgenommen worden war, erhielt gemäß dem Vermächtnis seiner Mutter eine katholische Erziehung. Daher ging regelmäßig ein katholischer Priester im Haus Stein ein und aus, so daß Stein auch der Katholizismus durchaus vertraut ist. Darüber hinaus lebte er lange Jahre in katholischen Gebieten, in Blumberg und in München, und erwarb den größten Teil seiner kunsthistorischen Kenntnisse in katholischen Kirchen, wo er sich oft mit Mönchen unterhielt. Im Zusammenhang mit seiner Inszenierung »Groß und Klein« erzählt Stein noch heute, welchen Stellenwert für ihn die Religion habe. Im Gegensatz zu Edith Clever und Botho Strauß, die beide die Neigung hätten, stellenweise in einen haltlosen Mystizismus abzutauchen, ohne einen tatsächlichen Bezug zur Religion zu haben, seien ihm selber die religiösen Dinge zu wichtig, zu ernst und zu vertraut, als daß er sie einem privatistischen Mystizismus übereignen würde. Viel eher möchte er sie vor solchen Vereinnahmungen schützen. Deutlich erinnert er sich an die Worte seiner Mutter auf dem Sterbebett, die sagte: »Nein, nein, dort drüben ist es gar nicht schön.« Aber sie hielt diese Erkenntnis aus und verzichtete auf Hoffnungen, Versöhnungen und Tröstungen, die sie als falsch empfunden hätte.
Steins heutige Frau, die italienische Schauspielerin Maddalena Crippa, erinnert sich an Steins Familie: »Die Mutter ist 1996 gestorben. Es war sehr anstrengend mit ihr. Diese Mutter war sehr witzig, ironisch und sarkastisch. Peter hatte natürlich die stärkste Beziehung zur Mutter. Zu seinem Vater war die Beziehung schrecklich, auch zum Schluß gab es immer noch Schwierigkeiten und Probleme. Peter hat wegen der Nazizeit viel mit ihm gesprochen und gestritten. Die Mutter kam aus einer total preußischen Familie. So war auch die Erziehung, die Peter gehabt hat. Zwar hat die Mutter auch Skulpturen gemacht, sie war früher selbst auf dem Wege zur Künstlerin und hat dann damit aufgehört, als sie Familie hatte. Zum Beispiel hat sie das Haus in Hannover-Barsinghausen selbst geplant und entworfen. Aber sie war sehr streng. Mit Peter war es allerdings auch schwierig, denn er war ein Kind, das man am liebsten erschossen hätte. Er erzählt oft die Geschichte, daß immer, wenn er etwas Böses getan hat, die Mutter ihn im Bad einsperrte. Und natürlich ging die Mutter nach einer Viertelstunde zu Peter und sagte: Okay, jetzt kannst du rauskommen. Peter aber kommt nicht raus, nach einer Stunde, nach zwei Stunden nicht. Er kommt so lange nicht heraus, bis die Mutter bettelt: Peter, bitte, bitte, komm raus! Das ist furchtbar. Die arme Mutter muß sehr große Schwierigkeiten mit diesem Kind gehabt haben. Sein Bruder Paulus war sieben Jahre älter und seine Schwester Elisabeth zehn Jahre jünger, also war er allein. Und Peter war nicht etwa einer, der viel mit anderen gespielt hat.«
1953 wurde Steins Vater nach Frankfurt am Main in die Zentrale seiner Firma versetzt. Er wurde Direktor vom Gesamtbetrieb Alfred Teves KG, ein Betrieb, der Motorenteile, Bremsen und Kühlschränke herstellte. Der Vater besaß etliche Produktions-patente, das heißt Patente darüber, wie bei einer Herstellung, die zehn Pfennige kostet, ein Pfennig eingespart werden kann, wie Peter Stein es ausdrückt.
Mit fünfzehn Jahren kam Stein nach Frankfurt aufs Lessing-Gymnasium. Es war dasselbe Gymnasium, das auch sein Vater besucht hatte. Dort war alles anders. Viele in der Klasse waren älter, manche, vor allem Vertriebene und Spätheimkehrer, waren bereits erwachsen. Sein Mundwerk nutzte ihm nun gar nichts mehr, weil die anderen in ihrer Entwicklung schon viel weiter waren. Etliche der Mitschüler hatten Freundinnen oder sogar Ehefrauen und sprachen auch andauernd darüber, was Stein sehr verunsicherte. Zunächst war er der zweitletzte in der Klasse. Zwar versuchte er, sich mit Prügeleien durchzusetzen, aber der einzige, den er damit beeindrucken konnte, war der Schüler, der noch schlechter dastand als er. Schließlich aber fand er zu seiner Stärke, der mündlichen Beteiligung, zurück. Sobald er zu reden anfing, zischelten seine Kameraden kaum hörbar: »Stein – Schwätzer – eins – setzen – Stein – Schwätzer – eins – setzen!« In Deutsch war er die einzige Stütze des Unterrichts und schrieb jeden einzelnen Aufsatz »sehr gut«. Als er einmal einen Aufsatz mit der Note »befriedigend« zurückbekam, ging er zum Deutschlehrer, um diesen auf seinen Irrtum hinzuweisen: der Aufsatz sei genausogut wie alle seine anderen Aufsätze zuvor, und er könne die Note nicht akzeptieren. Da der Lehrer aber auf seiner Note bestand, beschloß Stein, sich in Zukunft auch im Unterricht so »befriedigend« zu verhalten wie alle seine Klassenkameraden, und beteiligte sich nicht mehr. Der Lehrer begann zu verzweifeln, weil sein Unterricht nun gänzlich scheiterte. Nach einiger Zeit fragte er Stein, was diese Verweigerung solle, woraufhin dieser sagte, daß, wenn er nur für »befriedigend« gehalten würde, er sich auch dementsprechend verhalten würde. Da war der Lehrer gezwungen zuzugestehen, daß er den Aufsatz vielleicht ein wenig zu streng beurteilt hatte, und sie einigten sich auf einen Kompromiß: der Lehrer gab seine vermeintlich falsche Beurteilung zu, und Stein beteiligte sich wieder am Deutschunterricht. Diese frühe Machtprobe ist bezeichnend für die Kämpfe in Steins weiterem Leben.
Stein weigerte sich, Englisch nachzulernen. In Donaueschingen hatte er ausschließlich Französisch gelernt. Seine Eltern nahmen keinen Einfluß auf seine Weigerung und setzten ihn nicht unter Druck, was Stein ihnen heute noch hoch anrechnet. Zwar lernte er mit Erfolg Latein und Altgriechisch und las »Philoktet« von Sophokles im Original, aber er boykottierte die Englischarbeiten. Er griff den Englischlehrer an, daß ja nicht er, Stein, daran schuld sei, daß in den verschiedenen Besatzungszonen verschiedene Sprachen gelernt würden. Schließlich seien die Besatzungszonen ein Resultat des Krieges und der Judenvernichtung, an der nicht er, sondern die Generation des Lehrers schuld sei. Statt sich am Englischunterricht zu beteiligen, versteckte Stein sich halb hinter seinem Mantel und las aufreizend demonstrativ »Faust II«. Um nicht auch auf dem Abiturzeugnis ein »ungenügend« in Englisch zu haben, sondern ein »befriedigend«, bat er seinen Vater, ihn für eine Zeit nach England zu schicken, damit er dort seine Englisch-Defizite schnell ausgleichen könne. Der Vater lehnte dieses Ansinnen zunächst ab, da ein solcher Aufenthalt zu teuer war. Schließlich aber konnte er den Sprachaufenthalt doch ermöglichen. Zuerst kam Stein zu sehr reichen Leuten ins Haus. Dann wohnte er bei einem Lehrer, lief in London umher und begann stark zu rauchen, etwa vierzig Zigaretten pro Tag. Im Haus des Lehrers wurde er als eines der ganz seltenen Exemplare eines »hun« täglich zum Fünf-Uhr-Tee Verwandten und Bekannten vorgeführt. Zunächst begafften ihn alle »wie einen Gorilla im Zoo«, dann fragten sie ihn, was er mit der Judenvernichtung zu tun habe und wie er überhaupt dazu stünde. Im brüchigsten Englisch versuchte er zu antworten und konfrontierte die Engländer mit der Bombardierung Dresdens, die doch wohl auch nicht mehr nötig gewesen sei. Tatsächlich aber hatte er auf dem Abiturzeugnis ein »befriedigend« in Englisch.
Mit sechzehn Jahren machte Stein in der Schule die Bekanntschaft von Norbert Miller, der ihm zu Hause seine verglasten Bücherregale zeigte. Diese beeindruckten Stein so sehr, daß er seitdem seine Bücher auch immer in verglasten Regalen aufbewahrt. Als Miller ihm von einem seiner Lieblingsautoren, Jean Paul, vorschwärmte, kaufte sich Stein daraufhin in Ostberlin antiquarisch eine Jean-Paul-Ausgabe für wenig Geld und las die ganzen Sommerferien Jean Paul, um danach bei Miller mitreden und Jean Paul nonchalant ablehnen zu können. Nicht nur zur Jean-Paul-Lektüre wurde Stein durch Miller animiert, sondern auch zum Lesen eines 1300 Seiten starken japanischen Romans »Prinz Genji« aus dem 18. Jahrhundert und eines englischen Romans aus dem Mittelalter, »King Arthur’s Death« von Thomas Malory. Nach der Lektüre erlebte Stein starke Glücksmomente vor allem darüber, es geschafft, die dicken Bücher bezwungen zu haben.
Stein schrieb im Abitur (1956) einen »gräßlichen Abituraufsatz über Goethe«. Bei der Abituraushändigung bekam Norbert Miller vom Gymnasium den Erasmus-Preis für Philosophie verliehen. Stein aber, der ölverschmiert und dreckig von Motorreparaturen angestiefelt kam, erhielt ganz unerwartet den Lessing-Preis für Literatur.
Auch Norbert Miller erinnert sich an die gemeinsame Schulzeit: »Peter und ich waren die drei letzten Jahre unserer Schulzeit anfangs in einer gemeinsamen Klasse, die dann nach dem ersten Zeugnis in zwei Parallelklassen auseinandergespalten wurde, aber da das eine alte gemeinsame Klasse war, gab es einen engeren Kontakt. Wir haben uns kennengelernt, wie Schulkinder sich halt kennenlernen. Wir haben uns nicht gerade beim Sport getroffen, das war damals nicht Peters eigentliche Force. Im letzten Schuljahr haben wir uns mehr und öfter gesehen; ich war bei ihm zu Hause, er war bei mir zu Hause. Das sind aber nun richtige Schulkindererinnerungen, die sich an einer Stelle ein wenig verdichteten, weil wir beide etwas angeberhaft waren, wie soll man sagen, nicht high brows, das waren wir eigentlich beide nicht, aber wir insistierten auf bestimmten Formen von literarischer oder artistischer Überbildung. Die war dann gekoppelt mit sehr unterschiedlichen anderen Marotten, die jetzt nichts zur Sache tun. Ich habe ihn um seinen Preis beim Abitur beneidet, weil er Thomas Manns Josephsroman als Lessing-Preis des Lessing-Gymnasiums bekam, während ich mich mit dem weniger bedeutenden Preis für das Griechische begnügen mußte und dafür Werner Jägers ›Paideia‹ bekam, was sicherlich ein außergewöhnlich bildendes Werk war, aber nicht eins, das ich unbedingt haben wollte. Dann hat sich die alte Schulfreundschaft sehr intensiviert, als wir beide gemeinsam sozusagen tentativ angefangen haben zu studieren, keiner von uns wußte ganz genau, was. Wir haben beide in Frankfurt Abitur gemacht, sind beide in Frankfurt an die Uni gezogen.« (2003) Norbert Miller, so betont Stein heute noch, war und ist für ihn ein sehr, sehr wichtiger Mensch, ein Bezugspunkt das ganze Leben hindurch.
Peter Stein (links) mit Familie, 1955
Anders als bei Millers, in deren Haus es sehr viele Bücher und Kunstwerke gab und eine warme, katholisch geprägte Atmosphäre herrschte, war das Haus der Steins eher protestantisch-kühl und sparsam. Die Mutter, die ja alles verloren hatte, kaufte wenig Neues. Die einzige Ausnahme stellten Ende der fünfziger Jahre etliche Bertelsmann-Lesering-Bücher dar.
STUDIUM
Nach dem Abitur im Jahr 1956 studierte Stein zunächst vier Semester in Frankfurt; er blieb also zu Hause wohnen, bis seine Mutter ihn schließlich hinauswarf und er 1958 nach München ging.
In Frankfurt studierte er in derselben sprunghaften Weise, in der er auch in der Schule gelernt hatte. Entweder er machte gar nichts oder sehr, sehr viel. In solchen Phasen belegte er zum Teil fünfundachtzig Wochenstunden, unter anderem das Proseminar »Schicksalsdramen« bei Walter Höllerer, in dem »Familie Schroffenstein« von Kleist und Dramen von Müllner und von Zacharias Werner gelesen und besprochen wurden. Im Gegensatz zu seinen Kommilitonen hatte Stein sofort einen Zugang zu den Dramen. Er konnte sich im Nu die dramatischen Personen einprägen, er merkte sich, welche Figur sich noch auf der Bühne befand, auch wenn sie gar keinen Text hatte. Er hatte also gleich ein Gespür für dramatische Situationen und für dramaturgisches Geschehen. Höllerer bemerkte diese Fähigkeit und förderte und unterstützte ihn.
Stein begann, in Frankfurt um das Studententheater herumzuschleichen, ohne aber richtigen Kontakt zu bekommen. Der Einberufung zur Bundeswehr entzog er sich, indem er zur Musterung in Unterhosen erschien, woraufhin er als Provokateur ausgemustert wurde.
An der Frankfurter Universität bildete Stein zusammen mit Norbert Miller, Margret Stuffmann, Wolfgang Wolters und Vera Pape eine Studentengruppe. Sie nannte sich das »Pentagon« und war von enormem Ehrgeiz und Wettbewerb zwischen den fünf Mitgliedern geprägt. Dieser großen intellektuellen Konkurrenz erinnert Stein sich in wärmster Weise. Und Norbert Miller läßt heute die geistige Landschaft an der Universität Frankfurt um 1956 aus der Perspektive der Erstsemester entstehen: »Wir sind also beide in Frankfurt an die Uni gezogen. Da war unter anderem Höllerer. Zunächst einmal haben wir angefangen zu sagen, daß wir als Grundlage Literatur machen. Da gab es ein paar ältere gediegene Professoren, die uns alle zunächst gar nichts sagten. Wir hatten keine rechte Vorstellung, wer Josef Kunz oder wer Kurt May war, ein ganz wunderbarer, liebenswürdig weltfremder Gelehrter. Das heißt, wir haben ein Semester herumgelungert und geschaut, was los ist, und gingen zu allen möglichen Historikern und Philosophen. Es gab ja ein paar Philosophen und Historiker, für die wir ein besonderes Faible hatten. So zum Sohn von Karl Vossler, dem großen Romanisten, zum sogenannten ›Schönen Otto‹, dem Otto Vossler, der immer noch für mich – für Peter weiß ich das nicht – das Ideal des Universitätslehrers ist, der Mann, der mit unnachahmlicher Grazie seinen VW von Eis säuberte, oder wenn es im Saal Unruhe gab, weil er immer zu leise redete, er noch leiser sprach. Wir konnten alle von ihm unendlich viel lernen. Die erste gemeinsame Überraschung erlebten wir beide, Stein und ich, als wir zu den Übungen zur Hauptvorlesung von Otto Vossler einrückten und dieser sagte: Damit wir uns alle bekannt machen, sagt mal jeder, wer er ist, woher er kommt, woran er arbeitet. Da stellte es sich heraus, es war sein Doktorandenseminar, und als irgendwann die Aufforderung an Peter und mich kam, mußten wir eingestehen, daß wir im ersten Semester seien. Das gehört zu meinen angenehmen Erinnerungen an die mir sonst erspart gebliebene Ordinarienuniversität, daß Vossler die Brille etwas weiter herunterrückte und sagte: Ich wünsche den beiden Herren denn doch viel Vergnügen bei der Unternehmung. Wir waren dann als Erstsemester ein ganzes Semester lang im Doktorandenseminar.
Stein hatte eine Doppelneigung zur Literatur auf der einen Seite, die sehr stark von Anfang an auf Theater und theaterähnliche Themen ausgerichtet war. Das ist nicht unwichtig, weil der ihm immer gemachte Vorwurf des Philologentheaters natürlich damit zusammenhängt, daß er im Gegensatz zu vielen uns bekannten Scheinregisseuren ja tatsächlich versteht, wovon er redet oder wovon die Rede ist. Und die zweite Neigung war die ja für ihn auch zentral wichtige zur Kunst und zur Kunstgeschichte. Ich selbst bin zur Kunstgeschichte durch Peter Stein gekommen, weil sein Mentor Karl August Wirth, der ja am Zentralinstitut für Kunstgeschichte Herausgeber war, viel im Hause Stein verkehrte.« (2003)
Margret Stuffmann erzählt ergänzend, daß seit dem Kriegsende im Hause Stein in der Funktion einer Vize-Tochter eine junge Frau namens Ilse Scheffer beschäftigt war, zu der Stein ein sehr enges Verhältnis hatte. Diese heiratete später Gusti Wirth, der eine Art geistiger Ziehvater für Stein wurde, vor allem was die Kunstgeschichte und die Altphilologie anbelangte.
Weiter erinnert sich Norbert Miller: »Gusti Wirth war natürlich darauf aus, daß Peter ordentlich Kunstgeschichte erlernt, und er brachte mich dann sozusagen zu Harald Keller. Und über Harald Keller laufen alle unsere Freundesbeziehungen aus der Zeit, die Freundschaft mit Wolfgang Wolters, mit Margret Stuffmann datieren alle aus den ersten Semestern, in denen wir dann im wesentlichen zwei Zentren hatten. Das eine war die Kunstgeschichte mit Harald Keller und der ganzen Umgebung, in der wir quasi lebten. Das heißt, das Institut zog uns an, wir waren mittags da, nachmittags da, es gab enge Verbindungen. Das zweite war diejenige zu Walter Höllerer. Höllerer war Privatdozent, frischgebackener Privatdozent, und wir saßen in seinen ersten Vorlesungen. Höllerer war einer der wenigen Leute, für die es so etwas wie die Grundidee der deutschen Universität nicht gab, sondern nur den Gegenstandsbereich Literatur und die literarische Avantgarde. Er war damals ja schon der Herausgeber der ›Akzente‹, damals der Mann, der gerade die Lyrikanthologie ›Transit‹ gemacht hatte und der ein großes dickes Buch über Lachen und Weinen geschrieben hatte. Ich bin zu ihm hingegangen, weil ich seinen Gedichtband ›Der andere Gast‹ kannte. Er zog uns, die wir nichts anderes waren als Zweitsemester, mit anderen Freunden, zu denen der Lyriker Wolfgang Meyer und Hermann Peter Piwitt gehörten, in eine Art lockeren Freundeskreis. Das hat für Peter wie für mich einen sehr großen Vorzug gehabt: Wir haben im Ernst eigentlich die Ordinarienuniversität mit ihren grimmigeren Bedingungen nicht kennengelernt. Wir haben damals die ersten Exkursionen zusammen gemacht, jetzt könnte ich ausführlich werden, aber das trägt zur näheren Erhellung des Lebenslaufes von Peter Stein nur bei, wenn wir ein mehrbändiges Werk schreiben wollen. Wir unternahmen zwei große Exkursionen miteinander. In der ersten gemeinsamen Exkursion, die wir gemacht haben und die nach Belgien ging, bildete sich das heraus, was dann in den Kunsthistorikerzirkeln in Frankfurt das Pentagon hieß. Dazu gehörten Margret Stuffmann, Vera Pape, die danach aus diesem ganzen Metier ausgestiegen ist, Wolfgang Wolters, Peter Stein und ich. Wir hatten einen etwas eigenwilligen ingroup-Zirkel, in dem wir uns die Kunstgeschichte in langen Gesprächen und langen Privatexkursionen klarmachten. Das war ein sehr intensives Zusammenwirken bis etwa ins Ende des vierten Semesters, dann ging Peter Stein nach München, die anderen zwei nach Freiburg und ich folgte Peter nach einem Semester auch nach München. Dann hatten wir ein längeres Intermezzo in München. Das heißt, bei mir war es ein Intermezzo, bei Peter Stein war es der Beginn der Laufbahn.« (2003)
Nach vier Semestern ging Stein 1958 nach München, wo er sich zunächst sehr einsam fühlte, da er niemanden kannte. Über dreißig Jahre später erinnert er sich an den zentralen Prozeß der Selbsteinschätzung, der aus dieser Zeit herrührt: »Ich bin ein musischer Versager. Das ist mir mit einundzwanzig Jahren klargeworden, daß ich kein Schriftsteller, kein Musiker, kein bildender Künstler bin. Ein reproduzierender Künstler ja, ein selbständiger Künstler nein.« (Film »Peter Julius Cäsar Stein«, 1992)
Stein hatte in München eine schauerliche Unterkunft. Er bewohnte das Durchgangszimmer in der Wohnung eines sich andauernd streitenden Münchner Ehepaars. Sobald er sein Zimmer verließ, um in den Flur oder auf die Toilette zu gehen, wurde er von dem Ehepaar wegen der Störung angeschnauzt. Waschen durfte er sich nicht im Bad, sondern nur im Flur an einem kleinen Waschbecken, um das herum Linoleum gelegt war. Sobald ein Tropfen Wasser auf das Linoleum gespritzt war, keifte das Ehepaar ihn sofort an. Deshalb kann Stein sich bis heute in kleinsten Gefäßen waschen, ohne etwas zu verspritzen.
Obwohl er, nach eigenen Aussagen, sehr schüchtern war – »Noch mit 35 Jahren wurde ich knallrot, wenn ich eine Kneipe betrat, in der ich keinen kannte, und dachte, alle starren mich an« –, ging immer seine trotzige, aufbegehrende Provokationslust mit ihm durch. Vor allem in Vorlesungen von Hans Sedlmayr zur Kunstgeschichte und Artur Kutscher über Kleist und Hölderlin stand er auf und kritisierte die Ausführungen der Professoren. Gerade in großen Gruppen, bei Massenveranstaltungen, spielte er geradezu zwanghaft die Rolle des agent provocateur. Teilweise wurde er daraufhin aus den Vorlesungen geworfen, aber unter den Studenten galt er als Held, als Star. Er selbst schämte sich im nachhinein immer für seine Auftritte, da seine Einwürfe und Einwände ohne echten Hintergrund geäußert wurden. Am berühmtesten ist in diesem Zusammenhang die Geschichte mit Hans Sedlmayr. Stein fand großen Gefallen daran, sich vatermörderisch zu gebärden, und suchte sich bei Sedlmayr, der, so Wolfgang Wolters, oft mit einem weißen Pelz in der Uni erschien, Themen wie »Wilhelm Pinder« heraus, um Sedlmayr und die Kunstgeschichte mit ihren NS-Verstrickungen zu konfrontieren.
Zu Steins großem Leidwesen verfolgten ihn »vor allem Schwule«. Einer von diesen überredete ihn, in einem selbstgedrehten Film als Hauptakteur mitzuwirken. Von diesem Film, der sich in Cocteau-Nachfolge befand, existieren noch kleine Schnipsel in einer Schachtel in San Pancrazio. Der fast einstündige Film spielte in der Münchner Opernruine und handelte von Identitätssuche. Stein lief, mit Masken vor dem Gesicht, durch die Ruine, ein älterer Mann, eine Vaterfigur, tauchte auf, dann der Schatten einer Frau, die aber nicht sichtbar wurde und nicht zu erhaschen war. Zum Schluß wurde die Maske abgelegt, eine symbolische Handlung, die eine Konfrontation mit sich selbst bedeuten sollte. Stein bewertete schon damals diesen Film als mißlungen und pathetisch.
Die Atmosphäre der fünfziger Jahre beschreibt Stein als sehr klaustrophobisch, eingeschüchtert und geduckt. Ein geöffneter Hemdknopf galt bereits als Frevel, zwei oder drei bedeuteten fast schon Revolution. Er meint, es sei unvorstellbar und gar nicht hoch genug einzuschätzen, was alles sich durch die 1963 beginnenden Studentenunruhen verändert habe. Es sei eine tatsächliche Umwälzung unvorstellbar weitreichender Art gewesen.
Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre reiste Peter Stein immer wieder in verschiedene europäische Städte, nach Mailand, London, Paris, um sich Theater anzuschauen. Bereitwillig gibt er in einem Interview von 1978 darüber Auskunft: »Schon in Schülerzeiten interessierte ich mich für das Theater. Nur habe ich es relativ weit herausgeschoben, in einen Theaterberuf hineinzugehen, und zwar aus einer Überzeugung, die sich nachträglich als richtig erwiesen hat. Ein zu frühes Hineingehen in praxisbezogene Bindungen führt nur dazu, daß man sich den damit verbundenen Usancen anpaßt und Zwängen unterordnet. Ich habe versucht, mir möglichst lange meinen eigenen Kopf zu machen und etwas zu lernen und mich vor allen Dingen wissenschaftlich auf diesen Beruf vorzubereiten. Aber daß ich zum Theater wollte, war schon seit den berufswahlentscheidenden Jahren um 20, 22 klar. (…) Ich habe mir – übrigens ohne viel Geld – fünf Jahre lang gezielt Theater angeschaut in Europa, weil ich mich für dieses Phänomen Theater interessierte. Diese Jahre haben für mich eine sehr wichtige Rolle gespielt und vielleicht auch verhindert, daß ich allzusehr im bundesrepublikanisch-westberliner Provinzmief hängengeblieben bin. (…) Die entscheidenden Eindrücke kommen vom Piccolo Teatro, von Strehler in seiner Phase bis zu seiner ›Galileo‹-Aufführung, später nicht mehr. Aus Ostberlin vom Berliner Ensemble bis zu der Inszenierung des ›Arturo Ui‹, später nicht mehr. Vom Deutschen Theater bis zu den Aufführungen ›Der Drache‹ und ›Tartüff‹ von Besson, später nicht mehr. Von Aufführungen Peter Brooks in Paris und in London. Das Interesse an Brook ist bis zum heutigen Tag bei mir geblieben. Von einer ganzen Reihe wenig bekannter Regisseure in Paris. Das Pariser Theaterleben hat für mich eine sehr große Rolle gespielt.« (Dieter Kranz 1981, S. 170 f.)
In München bekam Stein endlich Kontakt zur Studiobühne des Studententheaters. Norbert Miller erinnert sich an Steins erste Regieversuche: »Stein bekam nach einem etwas eigenwillig verbrachten universitären Studium, während dem ihn zunehmend der Betrieb langweilte, dann früh Verbindungen zum Studententheater. Im Studium hatte er sich entweder zielgerichtet schwache Dozenten herausgesucht, die ihm dann so auf die Nerven gingen, daß er damit nun gar nichts anfangen konnte, oder er hatte sich, wie im Falle des großen Hans Sedlmayr, wichtige Lehrer vergrault. Einen Sommer, es muß der Sommer 1959 gewesen sein, haben wir im Bad verbracht, mit langen Diskussionen über Sinn oder Unsinn und innere Folgerichtigkeit der Komödie ›Vinzenz und die Freundin bedeutender Männer‹ von Robert Musil. Man kann nicht eben sagen, daß dieses Stück vor dramatischer Brillanz schreit, obwohl es im Dialog ganz außergewöhnlich dicht ist. Es gelang Peter mit zunehmender Besessenheit, die durch Badefreuden kaum noch abgelöst wurde, innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit sich ein Konzept auszudenken, mit dessen Hilfe er – ich glaube nicht mit den allerbesten Schauspielern, aber mit einem riesigen Aufwand an Einfällen, die geordnete Einfälle waren – diese erste Aufführung im Studententheater zu einem wirklichen Erfolg machte. Joachim Kaiser, der damals in der Aufführung war, besprach das Stück erstaunlich positiv.
Wir wohnten ja einander gegenüber, da unten an der Münchner Freiheit, er in der Fendstraße, ich hinter der Münchner Rückversicherung, die damals noch stabiler wirkte als heute. Wir haben uns längere Zeit sehr oft gesehen, wir haben über viele Sachen diskutiert, wir haben viele Theaterstücke miteinander gesehen. Das war sicherlich zwischen uns eine Form der intensivsten Freundschaft, die wir hatten. Danach driftete das zwangsläufig durch unsere verschiedenen Wohnorte auseinander.
Peter betrieb dann eine Weile lang dieses Spiel noch neben der Literaturwissenschaft her – er arbeitete immer noch an dem Plan einer Dissertation –, aber sein Interesse ging sehr stark auf das Theater. Er machte dann im Jahr danach noch eine weitere Inszenierung, das waren kleine, also vernünftigerweise überschaubare, konversationsphantastische Stücke.
Seine erste Inszenierung ›Vincent und die Freundin bedeutender Männer‹ war eigentlich schon Stein, wie er später war, das heißt, es gab ein unglaubliches Maß an genauer Ausleuchtung des Textes, eine phantastische Instrumentierung mit keinem Aufwand des Inszenatorischen.« (2003)
Stein übernahm im Studententheater kleinere Rollen, so einen Kobold, und dann, im Stück »Bibi, der Eintänzer« von Heinrich Mann, den Eintänzer. Als er einmal auftreten sollte, konnte er plötzlich kaum noch gehen. Er stelzte wie ein ganz alter Mann herum und mußte sich in ärztliche Behandlung begeben. Zuerst wurde er auf Geschlechtskrankheiten behandelt, obwohl er genau wußte, daß er sich gar keine geholt haben konnte. Dann wurde schließlich eine schwere rheumatische Erkrankung, die Reitersche Krankheit, diagnostiziert, die auch sein Bruder hatte, der sie, im Gegensatz zu Peter Stein, sein Leben lang nicht loswurde. Stein mußte zur Kur nach Abano Terme fahren und schlich durch den Speisesaal so steif wie ein Neunzigjähriger, woraufhin die anderen Patienten, die alle recht alt waren, nicht etwa Mitleid zeigten, sondern sich persifliert und verspottet vorkamen.
Nachdem sich sein Leiden gebessert hatte, kehrte er nach München zurück. Er gab den Plan auf, bei Helmut Motekat eine Dissertation zum Thema »Die Bilderzählung bei E. T. A. Hoffmann« zu schreiben, und wandte sich nun noch stärker dem Theater zu. Am Studententheater arbeitete er mit der Bühnenbildnerin Moidele Bickel zusammen, die er auf einem Faschingsball kennengelernt hatte. Sie stammt aus einer bayrischen Familie von Lüftelmalern und studierte in München an der Kunstakademie. Durch Malerei-Aufträge konnte sie früh Geld verdienen und fuhr längst ein Auto, als Stein noch immer äußerst knapp bei Kasse war. Zum ersten Mal sah Stein Moidele Bickel, die später jahrzehntelang seine Kostümbildnerin wurde, in einem weißen, selbstentworfenen Brautkleid auf einem Münchner Faschingsball mit dem Thema »Bauernhochzeit im 18. Jahrhundert«. Sie saß da, so beschreibt es Stein, in einem schaumigen weißen Brautkleidtraum, wunderschön und ganz allein, denn sie habe absolut unnahbar gewirkt. Bei den ersten kleinen Inszenierungen Steins entwarf Moidele Bickel das Bühnenbild. So gab es beispielsweise eines, bei dem eine Ecke der Bühne von einem großen Buch eingenommen wurde, das die Spielfläche markierte. Das Publikum saß in zwei anderen Ecken, und die Szenenfolge wurde durch Umblättern der riesigen Seiten hergestellt.
Norbert Miller ist davon überzeugt, daß seit der ersten Studententheater-Inszenierung Steins Handschrift, sein Stil unverkennbar waren.
»Das ist natürlich mit einem nicht-professionellen Theater schwer durchzuziehen, das waren ja an der Studentenbühne alles Laienschauspieler, und zum Teil wirklich schwache Laienschauspieler. Aber die Vorstellung, daß ein Stück nicht dadurch lebt, daß man es nachspielt, daß ein Stück nicht dadurch lebt, daß man es zu Rohmaterial macht, sondern daß man versucht, den gliedernden Gedanken zu haben, von dem aus sich das Stück entschlüsselt, das ist, glaube ich, eine Grundidee, und die kann man nur kriegen, wenn man eben wirklich genau weiß, worum es geht. Dazu muß man sagen, Peter Stein ist von allen mir vertrauten Kunsthistorikern der Mann, der am schärfsten sieht. Ich bin ja nun mit Margret Stuffmann und Wolfgang Wolters, zwei Varianten von sehr unterschiedlichem, wirklich überragendem Sehvermögen befreundet. Aber sozusagen analytisch einen Bau – er war hauptsächlich ein Architekturkunsthistoriker – mit Peter Stein zu betrachten, war immer ein außerordentliches Vergnügen, wenn er etwa anfing, Santa Maria Capitelli von Rainaldi oder den Invalidendom von Mansard zu betrachten. Es war unglaublich, wie rasch und wie zwingend sich für ihn eine architektonische Linie aufbaute, unter genauester Betrachtung, ohne irgendwelche Faxen zu machen, das ist ganz wichtig. Margret Stuffmann sieht instinktsicher, sie sieht alles sofort, sie kann es nicht ohne weiteres verbalisieren, und sie weigert sich auch, bestimmte Arten von langweiliger Logik da hineinzubringen. Peter Stein sieht immer analytisch, er sieht Sachen nicht, die Margret Stuffmann sofort sieht, die einfach sagen würde, die Tafel da oben ist falsch, das Gelb stimmt nicht. So etwas bringt Peter Stein zur Verzweiflung, solche Bemerkungen fand er ganz und gar ungehörig. Diese Beobachtung ist wahnsinnig wichtig, und wer das auf Philologie herunterholzt, ist einfach ein Rindvieh. Und leider haben wir im Moment im Theater eine Verbrüderung einer Horde von wildgewordenen Narren und eine noch viel schlimmere Horde von Akklamateuren, die sich wechselseitig auf diese Weise hochschaukeln.« (2003)
Dieter Giesing, der auch am Studententheater tätig war und die zwei Einakter »Die kahle Sängerin« von Ionesco und »Noch zehn Minuten bis Buffalo« von Günter Grass inszenierte, schlug vor, diese Inszenierung in einem kleinen Boulevardtheater, dem intimen Theater im Hofgarten, im Nachtprogramm herauszubringen. Die Studenten lehnten dieses Ansinnen ab. Bloß Peter Stein sprach sich dafür aus. Später, als Giesing Assistent an den Münchner Kammerspielen war, versuchte er, Stein auch dorthin zu holen, wo dieser dann als Gutachter, Regieassistent und Dramaturgieassistent arbeitete.
An den Münchner Kammerspielen unter dem Chefdramaturgen Ivan Nagel und dem Intendanten August Everding gestaltete sich die Zusammenarbeit mit Giesing sehr intensiv. Schon als junger Mann probte Stein mit großen alten Schauspielern wie Therese Giehse. Zum ersten Mal arbeitete er 1965 mit ihr zusammen bei der Molière-Inszenierung »Heirat wider Willen«. Stein assistierte der Giehse, die Regie führte: »Ein schmales Jüngelchen, neben mir noch schmaler, aufmerksam, wach, genau und beglückend gescheit – wir verstanden uns gleich.« (Therese Giehse 1976, S. 105) Sodann leitete Stein die Proben zu »Die heilige Johanna« von Shaw. Dort war er vor allem für den Chor zuständig, in dem sich als Statisten auch Rainer Werner Faßbinder und Botho Strauß befanden, Studenten, die sich auf diese Weise Geld verdienten. Heute noch erinnert sich Stein daran, daß Botho Strauß den damaligen Regieassistenten als Sklaventreiber wahrgenommen hatte.
FRÜHE INSZENIERUNGEN
Gerettet
1967 inszenierte Stein erstmalig selbständig ein Stück in der Werkraumbühne der Münchner Kammerspiele: »Gerettet« (»Saved«) von Edward Bond. Martin Sperr übertrug das Cockney-Englisch, das in dem Stück gesprochen wird, in den bayrischen Dialekt. Das Bühnenbild und die Kostüme stammten von Jürgen Rose. Die Premiere fand am 15. April 1967 statt.
In »Gerettet« geht es um die gestörten Beziehungen vor allem junger Menschen in einem Arbeiterbezirk. Der linkische, sexuell unsichere Len (Michael König) zieht bei seiner neuen Freundin Pam (Jutta Schwarz) ein, die bei ihren Eltern (Maria Singer und Gustl Bayrhammer) wohnt. Bereits seit Jahren sprechen Pams Eltern nicht mehr miteinander. Pams Zuneigung für Len schlägt sehr bald in Aversion um; sie bringt ihm in zynischer Weise nur noch Verachtung entgegen. Auch nachdem Pam ihm mitgeteilt hat, daß das Kind, das sie erwartet, nicht von ihm, sondern von einem seiner Schlägerkumpane, Fred, ist, hält Len weiterhin zu ihr und später auch zu dem Baby, das Pam nur als Last empfindet. Den grausamen Höhepunkt stellt die Szene dar, in der Lens Kumpel das Baby in einem Park quälen und mißhandeln, bis sie es schließlich zu Tode steinigen. In seinem Vorwort zum Stück schreibt Bond: »Es ist klar, daß die Steinigung eines Babys in einem Londoner Park ein typisch englisches Understatement ist. Verglichen mit der ›strategischen Bombardierung‹ deutscher Städte ist dies eine geringfügige Greueltat, verglichen mit der geistigen und emotionellen Aushungerung der meisten unserer Kinder sind die Konsequenzen belanglos.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!