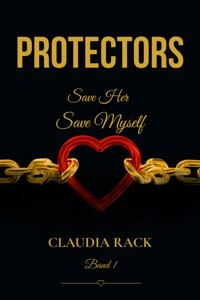
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Protectors – Bodyguards, Kämpfer, Männer mit einer Mission Rouven ist ein Protector, ein Bodyguard, der alles riskiert, um seine Schwester zu retten. Sein erster Auftrag führt ihn zu Josefine, einer Frau, die sein Herz und sein Leben völlig auf den Kopf stellt. Zwischen Gefahr, Intrigen und Spannung entdeckt er Gefühle, die er nie erwartet hätte. Save Her, Save Myself ist ein intensiver Romantic Suspense Roman, der Elemente von Dark Romance, Thriller und Bodyguard Romance vereint. Leser:innen erleben Leidenschaft, nervenaufreibende Missionen und überraschende Wendungen. Lese jetzt den packenden Auftakt der "Protectors"-Reihe und tauche ein in eine Geschichte voller Liebe, Gefahr und Spannung, die dich nicht mehr loslassen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Title Page
Copyright
Copyright © [2025] by [Claudia Rack]
Alle Inhalte dieses Buches, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten. Eine Nutzung ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Rechteinhaberin ist unzulässig.
Covergestaltung: Claudia Rack
Lektorat: Claudias Schreibfeder
www.claudiasschreibfeder.de
Impressum
Verantwortlich für den Inhalt:
Claudia Rack
c/o Block Services
Stuttgarter Str. 106
70736 Stuttgart
Druck: epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Widmung
Für meine Schwester
Deine Inspiration hat mich dazu bewegt, diese Geschichte zu schreiben. Ich hoffe, ich habe deinen Geschmack getroffen.
❦
Für jene, die unsichtbar gemacht wurden. Diese Geschichte gibt euren Stimmen ein Gesicht.
Triggerwarnung
Dieses Buch behandelt ernste Themen, die belastend oder retraumatisierend wirken können. Dazu gehören unter anderem:
Menschenhandel
sexueller und psychischer Missbrauch
physische und psychische Gewalt
Suizidgedanken und -handlungen
Entführung, Bedrohungen und Manipulation
Bitte achte gut auf dich. Wenn dich eines dieser Themen betrifft oder triggern könnte, überlege dir, ob und wann die Lektüre für dich geeignet ist. Deine Sicherheit und dein Wohlbefinden gehen immer vor.
Prolog
Rouven Hale
Die Sonne schien, ich spürte nur unaufhörliche Kälte. Mein Blick haftete auf der Inschrift des Grabes. Mein Verstand weigerte sich, die Realität zu akzeptieren. Es fühlte sich nicht wahr an – diese Leere, die der graue Stein in mir hinterließ. Mit jedem Tag, den ich ohne sie lebte, wurde es realer. Die Trauer wich nie von meiner Seite. Sie folgte mir auf jedem Schritt. Und mit ihr kam das Wissen, dass ich versagt hatte. Ich konnte sie nicht vor dem Tod bewahren, obwohl ich es ihr versprach. Was nützt ein Versprechen, wenn man es nicht halten kann? Nichts.
Josefine 1
Nummer sechzehn
Ich hörte sie zuerst atmen. Leise, stockend, als würde sie versuchen, jedes Geräusch zu vermeiden, das sie verraten könnte. Vielleicht tat sie das. Vielleicht hatte sie gelernt, dass ein Laut zu viele Konsequenzen haben konnte. Ich wusste nicht, wie lange ich in dieser Zelle war. Drei Tage? Vier? Die Dunkelheit war gnadenlos. Und die Stille, sie war kein Schweigen, sie war ein Gewicht. Ich hatte versucht, wach zu bleiben. Wach zu denken. Irgendwann war mein Kopf schwer geworden, mein Körper taub. Und dann hörte ich sie.
„Du bist neu.“
Ihre Stimme war kaum mehr als ein Hauch, brüchig wie Pergament. Ich drehte den Kopf, obwohl ich sie nicht sehen konnte. Da waren Betonwände und keine Fenster. Aber sie war da. Hinter der nächsten Wand. Oder zwei Türen weiter.
„Wer bist du?“, flüsterte ich.
Die Pause, die entstand, nagte an mir. Würde sie mir antworten? Es vergingen Minuten, bis ihre Stimme erneut erklang.
„Malia. Aber hier bin ich Nummer 16.“
Mein Herz setzte kurz aus. Der Name sagte mir etwas. Ich hatte ihn gehört, gelesen, auf Bildschirmen, in Artikeln. Malia Hale. Die verschwundene Schwester einer Familie, die nie aufhörte, nach ihr zu suchen. Aber das waren mindestens fünf Monate, seitdem ich die Berichte gesehen hatte. Ich saß geschockt da und wusste nicht, was ich sagen sollte. Und jetzt war sie hier. Mit mir. Sie lebte. Irgendwie. Ihre Stimme klang, als hätte sie das Leben aufgegeben. Und sie war eine Nummer. Eine von vielen. Ich wusste in dem Moment, dass ich nicht zufällig hier war. Dass das, was mit mir geschah, größer war als ein Überfall. Das war organisiert. Geplant. Ich schluckte schwer.
„Malia Hale?“, hakte ich vorsichtig nach. „Ich habe die Berichte im Fernsehen über dich gesehen. Sie haben nach dir gesucht, über Monate. Vielleicht tun sie es jetzt noch.“
„Malia Hale gibt es nicht mehr. Selbst, wenn sie mich finden sollten, ich bin nicht mehr die, die ich einst war“, sprach sie leise.
„Was ist das hier? Wo sind wir?“, sprudelte es aus mir hervor. Ich hatte keine Ahnung, ob ich die Antworten darauf erfahren wollte. Aber die Ungewissheit behagte mir genauso wenig.
„Es ist besser, wenn du keine Fragen stellst“, erwiderte sie schärfer. Als ob sie Erfahrungen damit gesammelt hätte. Sie hatte die Konsequenzen gespürt. Eine Antwort bekam ich von Malia nicht. Das Schweigen breitete sich über uns aus. Ich wusste, dass sie nichts mehr sagen würde. Ich hatte viele Fragen im Kopf. Einzig der Gedanke daran, dass Malia fünf Monate hier war, löschte den Funken Hoffnung in mir aus. Suchte man nach mir? Hatte mein Vater die Polizei informiert? Oder würde ich ebenfalls für viele Monate eingesperrt sein? Was würde das aus mir machen? Ich schloss die Augen. Die Bilder, die in meinem Kopf entstanden, trösteten mich nicht. Ich erinnerte mich an den Nachtclub. Im „Sanctum“ tummelten sich angesehene Leute, nicht selten traf man dort auf Prominente, die feiern wollten. Der Club hatte einen tadellosen Ruf in Toronto. Das hatte mich veranlasst, einen Besuch zu wagen. Ich wollte an diesem Abend den Kopf freibekommen. Ich wollte mich betrinken, tanzen und ausgelassen sein. Sogar einem harmlosen Flirt gegenüber war ich nicht abgeneigt. Im Nachhinein war das mein Fehler. Ich hatte zu schnell vertraut. Ich war leichtgläubig gewesen, naiv wie ein junger Teenager. Und nun saß ich in einer Zelle, gefangen und orientierungslos. Lange hing ich dem Gedanken nach, bis mein Körper versagte. Die Müdigkeit und das Mittel, das durch meine Blutbahnen jagte, forderten ihren Tribut.
❦
Sie kamen in der Nacht. Oder vielleicht war es Tag. Ich konnte es nicht einschätzen. Zeit bedeutete hier nichts. Nur der Moment zählte. Und der Moment roch nach Angst und Eisen. Zwei Männer öffneten die Tür. Einer groß, stumm, mit einem Tablet in der Hand. Der andere trug Handschuhe und eine Art Uniform ohne Abzeichen. Kein Wort wurde gewechselt, kein Blickkontakt.
„Aufstehen“, sagte der Größere.
Ich blieb sitzen. Nicht aus Widerstand, ich konnte einfach nicht. Mein Körper fühlte sich an, als hätte man mir die Energie ausgesaugt. Er kam näher, packte mich am Arm. Grob, aber nicht brutal. Ich wehrte mich. Ich trat nach ihm, versuchte mich, von ihm loszureißen. Er verzog keine Miene. Er ließ mich spüren, wie nutzlos mein Widerstand war. Sie zerrten mich einen Flur entlang. Links, dann rechts. Sie führten mich durch einen Gang, der genauso roch wie der Raum: nach altem Metall, Desinfektionsmittel und einer Art Schweigen, das krank machte. Jede Tür, an der wir vorbeigingen, war verschlossen. Kein Schreien. Kein Laut. Nur das Summen der Neonröhren über uns. Ich zählte die Schritte. Sechzehn, bis zur nächsten Ecke. Noch eine Tür. Diesmal blieb er stehen.
„Rein.“ Die Stimme war ein Befehl, nicht laut, aber unmissverständlich.
Ich zögerte. Nicht aus Trotz, sondern aus Überlebenstrieb. In mir schrie alles: Lauf! Aber wohin?
Ich wurde in den Raum gestoßen. Das grelle Neonlicht stach mir in die Augen. Ich blinzelte und erkannte die Konturen einer Frau. Ihr Lächeln war perfekt. Es wirkte unnatürlich auf mich. Wie bei jemandem, der gelernt hatte, den Mund zu verziehen, ohne die Augen zu bewegen. Sie trat in den Raum, als gehörte er ihr. Sofort hatte ich das Gefühl, mir gehörte nichts mehr. Nicht an diesem Ort. Nicht bei diesen Leuten.
„Name?“, fragte sie.
Ich sagte nichts. Ich wusste, dass sie ihn kannte.
Sie notierte etwas auf einem Block. Dann sah sie mich lange an, fast neugierig. „Du bist hier, weil dein Vater verhandelt hat – und dann gezögert hat.“
Etwas in mir fror ein. Er wusste, dass ich hier war? „Was … was wollen Sie von mir?“ Meine Stimme klang fremd in meinen Ohren.
„Du bist handelbar“, sagte sie frostig. „Nicht beschädigt. Nicht abhängig. Jung, gebildet, ansehnlich, brauchbar. Es gibt Kunden für alles.“
Ich sah sie entgeistert an. Ich wollte ihren Namen wissen, ihren verdammten Namen. Aber sie gab mir nichts.
„Du kannst es dir leichter machen“, sagte sie, als wäre das ein Angebot. „Oder du brauchst ein paar Tage länger. Manche brauchen länger. Manche geben direkt auf. Und andere sind längst verloren. Denn hier, Josefine Winter, bleibt niemand ewig unangetastet.“
Damals wusste ich noch nicht, wie sehr diese Worte mich verfolgen würden. Immer wieder hallte ihre eisige Stimme nach, wenn ich mich selbst verlor. Die nächsten Minuten überstand ich widerwillig. Jede weitere Sekunde in diesem Raum demütigte mich. Am schlimmsten waren die Fotos, die von mir geschossen wurden. Entblößt, nicht einmal einen Slip ließen sie mir. Es gab kurze, klare Anweisungen von ihr.
„Den Kopf nach rechts. Arme nach oben. Umdrehen.“
Bei jedem Klicken der Kamera fuhr ein Ruck durch mich, und ich presste die Lippen fest aufeinander. Selbst wenn ich es wollte, ich konnte mein Zittern nicht ablegen. Ich wurde begutachtet. Anders konnte ich es nicht betiteln. Wie ein Stück Vieh. Ein Objekt, das für einen Zweck durchleuchtet wurde. Es gab keine Spur von Respekt. Wer immer diese Frau war, mein Hass auf sie nahm stetig zu. Ich prägte mir ihr Aussehen und ihre Stimme ein. Sie hatte lange rote Haare, die hochgesteckt waren. Ihre Frisur wirkte streng auf mich. Es passte perfekt zu ihrem Verhalten. Ihre hellblauen Augen strahlten keine Wärme aus. Nur die kalte, nackte Wahrheit. Da sie einen Arztkittel trug, erkannte ich darunter den Ansatz eines schwarzen Bleistiftrockes und einer hellen Bluse. Ob sie tatsächlich Ärztin war, wusste ich nicht. In ihren schwarzen High Heels fühlte sie sich sicher. Nichts wies darauf hin, dass sie mit den hohen Absätzen Schwierigkeiten hatte. Ich glaubte nicht daran, dass es irgendetwas gab, was diese Frau verunsichern würde.
„Du hast einen fabelhaften Körper, Josefine“, sagte sie zu mir.
Ich sah sie direkt an. War das ihr Ernst? Ihre Stimme hatte ehrlich geklungen. Als unsere Blicke sich begegneten, zerstörte sie den Moment.
„Es wird nicht lange dauern, bis die ersten Angebote eingehen“, ergänzte sie selbstzufrieden.
Ich versteifte mich. „Angebote?“
Sie hob die Hand und vollführte eine kreisende Bewegung. Ihre Geste war klein, aber eindeutig. Dreh dich. Zeig dich. Ich hasste sie in diesem Moment noch mehr. Mittlerweile hatte sie den Fotoapparat mit einer Videokamera ausgetauscht. Alles in mir sträubte sich. Doch ein Blick in ihre kalten Augen und ich wusste, es gab keinen Ausweg. Langsam drehte ich mich im Kreis, den Blick starr nach vorn gerichtet. Das rot blinkende Licht der Videokamera verfolgte mich.
„Sehr schön“, sagte sie.
Ich blieb stehen und beobachtete, wie sie die Kamera auf dem Tisch neben sich ablegte. Sie kritzelte einige Zeilen auf ein Blatt Papier, bevor sie mich direkt ansah. „Ab sofort bist du nicht mehr Josefine Winter“, sprach sie bestimmt.
Ich zuckte zusammen. Sprachlos starrte ich sie an und wartete auf das, was folgen würde.
„Du bist Nummer einundzwanzig. Nichts mehr und nichts weniger. Verstanden?“ Ihre Augen bohrten sich gnadenlos in meine.
Meine Stimme versagte. Es dauerte einige Sekunden, bis ich den Sinn verinnerlichte. Nummer einundzwanzig. Ab sofort war ich eine Nummer. Genauso wie Malia Hale. Seltsamerweise erschreckte mich das zutiefst. Weit mehr noch als die Fotos oder das Video. Wie viele Nummern gab es? Was hatte das konkret zu bedeuten? Mein Instinkt kannte die Antwort. Allerdings wehrte ich mich bewusst dagegen, es anzunehmen. Wenn ich das tat, hatten sie gewonnen. Und wenn es etwas gab, was ich mir in diesem Moment schwor, war es der Gedanke daran, dass ich sie niemals würde gewinnen lassen. Egal, was geschah. Egal, was es aus mir machen würde. Diesen Sieg wollte ich ihnen nicht geben.
Rouven 2
Der Auftrag
Aufrecht saß ich in dem schwarzen Ledersessel. Das rot blinkende Licht am Telefon kündigte meinen Besucher an. In mir keimte kurz der Gedanke auf, ihn nicht einzulassen. Wir hatten Informationen über ihn eingeholt, als er mit seiner Anfrage an uns herantrat. Normalerweise nahmen wir solche Aufträge nicht an. Ich hatte die Agentur gegründet, um mittellosen Menschen zu helfen, die sich nicht anders zu helfen wussten. Zumindest wirkte es nach außen hin so. Der Mann, der unten am Eingang darauf wartete, dass ich ihm öffnete, war alles andere als mittellos. Edward Winter war der CEO eines renommierten Finanzunternehmens. Die Trillium Asset Group war in Toronto bekannt. Das ging über Kanada hinaus. Wieso er auf uns zukam, war mir schleierhaft. Immerhin konnte er sich mit Leichtigkeit anderweitig Hilfe besorgen. Am Geld konnte es nicht liegen. Somit begegnete ich diesem Auftrag mit einer gesunden Skepsis. Wir standen am Anfang und konnten uns keine negative Propaganda leisten. Von daher betätigte ich widerwillig den Knopf am Telefon, der dafür sorgte, dass die Eingangstür sich für den Besuch öffnete. Ich gestand mir ein, dass ich neugierig war. Ich konnte ihn mir zumindest anhören. Ob ich den Auftrag annahm, würde ich später entscheiden. Ich wusste, dass Mr. Winter einige Minuten brauchen würde, bis er vor meinem Büro stand. Unsere angemieteten Büroräume befanden sich im oberen Drittel eines Hochhauses. Im Gebäude befanden sich unterschiedliche Firmen, wie eine Anwaltskanzlei, ein Supportunternehmen für eine IT-Firma oder ein Immobilienmakler. Mein Besuch musste den Aufzug nehmen. Ich nutzte die Zeit, um aufzustehen und mich mit verschränkten Oberarmen vor meinem Schreibtisch zu postieren. Mein Büro war bewusst minimalistisch gehalten – kein überflüssiger Schnickschnack, kein persönlicher Krimskrams. Klare Linien, dunkles Mobiliar und eine Atmosphäre, die gleichermaßen kontrolliert wie einschüchternd wirkte. Die große Fensterfront zog sich über die gesamte Längsseite und bot einen klaren Blick auf die Skyline von Toronto. Der schwere Schreibtisch aus dunklem Holz dominierte den Raum. An den Wänden hingen keine Familienfotos. Stattdessen: ein dezenter Waffenschrank hinter getöntem Glas, ein eingerahmtes Zertifikat des kanadischen Sicherheitsdienstes, daneben ein leiser Hinweis auf militärische Vergangenheit – eine kleine Plakette, unscheinbar, aber mit Bedeutung. Alles, um eine Wirkung zu erzielen. Hier wurde nicht geredet, es wurden Entscheidungen gefällt. Mein Blick richtete sich auf die Glastür, sobald eine dunkle Silhouette zu erkennen war. Kurz darauf ertönte das Klopfen an der Bürotür. Sobald ich den Besuch hereinbat, betrat Mr. Winter mein Büro. In Sekundenschnelle nahm ich den Mann vor mir in Augenschein. Edward Winter war in einem gesetzten Alter. Unseren Informationen zufolge musste er mittlerweile zweiundsechzig Jahre alt sein. Braune Augen sahen mich hinter einer Brille an und wiesen eine Spur von Unsicherheit auf. Sein graues Haar war kurz und leicht gewellt. Seine schlanke Statur steckte in einem dunkelblauen Anzug. Ich schätzte ihn auf einen Meter fünfundsiebzig. Mir war sofort bewusst, dass er niemals in einer Jeans zu sehen war. Ganz der CEO stolzierte er auf mich zu und streckte mir die Hand entgegen. Die Unsicherheit in seinem Blick wurde von aufrichtigem Interesse abgelöst.
„Sie müssen Rouven Hale sein“, meinte er freundlich und schüttelte kurz meine Hand. Ich hielt den Händedruck ebenfalls kurz, aber bestimmt.
„Mr. Winter nehme ich an“, erwiderte ich. Nichts an meiner Stimme ließ erkennen, dass ich über ihn Bescheid wusste. Ein kurzes Nicken bestätigte meine Aussage. „Bitte“, wies ich auf den Sessel vor meinem Schreibtisch, „nehmen Sie Platz.“ Geschmeidig umrundete ich den Tisch und setzte mich in meinen Sessel, damit wir uns in die Augen schauen konnten. Seine Aufmerksamkeit lag bei mir, sobald er Platz nahm. Das gefiel mir. Ich mochte es nicht, wenn man mir nicht einen gewissen Respekt entgegenbrachte. Vor allem, wenn die Person etwas von mir wollte. „Ihre Aussage am Telefon klang recht vage, Mr. Winter. Bitte erzählen Sie mir, worum genau es geht, wobei ich Ihnen helfen kann.“
Edward Winter nickte eifrig, die Hand verschwand in der Innentasche seiner Anzugjacke. Als er sie hervorzog, registrierte ich das Foto in seiner Hand. Vorerst sah ich die Rückseite. Ich beobachtete seine Reaktion, sobald er das Bild darauf betrachtete. In seinem Blick las ich Sorge und Angst, um die Person, die darauf abgebildet war.
„Ich habe es absichtlich nicht weiter ausgeführt, da ich es nicht an die große Glocke hängen möchte“, sagte er und legte das Bild auf dem Schreibtisch ab. Die Frontseite zeigte nach oben. Langsam schob er das Bild in meine Richtung, bis es direkt vor mir lag.
„Das ist meine Tochter, Josefine Winter. Sie wird seit drei Tagen vermisst“, erklärte er mir.
Ich hörte mit einem Ohr zu und ließ mir nicht anmerken, welche Wirkung die Frau auf dem Foto auf mich hatte. Seine Tochter hatte seine braunen Augen, sie wirkten auf mich tiefbraun, beinahe schwarz. Ich war fasziniert von ihnen. Oder lag es an dem Blick, den sie auf dem Foto zeigte? Ihr Blick drückte das aus, was mich innerlich sofort ansprach. Tiefgründig, geheimnisvoll, mit einer Spur von Leichtigkeit darin, die ich nicht damit in Einklang bringen konnte. Ich analysierte jedes Detail ihres Gesichtes. Hohe Wangenknochen, vollmundige Lippen, dunkles, langes Haar und leicht gebräunte Haut. Sie war makellos. Sofort fragte ich mich, wie ihre Stimme klang. Oder wie sie aussah, sobald sie ein Lächeln zeigte.
„Ich weiß, dass ich zur Polizei gehen sollte. Allerdings würde das unweigerlich die Presse auf den Plan rufen. Ich möchte meine Firma gern außen vorlassen. Wir können solche Schlagzeilen nicht gebrauchen. Es würde meine Position schwächen. Ich möchte das nicht weiter ausführen, Mr. Hale. Es reicht, wenn Sie wissen, dass ich Wert auf Diskretion lege. Ich nehme an, dass es um Geld geht. Ich bin ein bekannter Geschäftsmann, weit über die Landesgrenzen hinaus. Es kommen eine Menge Leute dafür infrage“, erklärte er mir, während ich weiter auf das Foto starrte.
Langsam hob ich den Blick und betrachtete ihn mit nüchterner Miene. Ein kurzes Nicken meinerseits gab ihm zu verstehen, dass ich verstand. „Gab es eine Geldforderung?“, hakte ich nach.
„Nein“, sagte Mr. Winter fahrig. „Ich rechne jeden Moment damit. Mir ist bewusst, dass Ihre Agentur mit Leuten wie mir nicht gern zusammenarbeitet. In Ihrem Portfolio wird klar zum Ausdruck gebracht, dass Sie Menschen helfen, die über wenig Mittel verfügen. Ihre Firma ist neu auf dem Markt. Sie sind weitestgehend unbekannt.“ Die Unsicherheit in seinem Blick flammte kurz erneut auf.
„Das ist richtig“, antwortete ich und schob das Foto beiseite. Ich beugte mich vor, faltete meine Hände ineinander und legte sie vor mir auf dem Tisch ab. „Also hoffen Sie darauf, dass wir unbemerkt agieren können, um Ihre Tochter zu finden“, drang ich zum Kern seiner Aussage vor.
„Genau“, kam es direkt über seinen Mund. „Ich weiß, dass Sie nicht jeden Auftrag annehmen. Ich hoffe darauf, dass Sie eine Ausnahme machen. Meine Tochter ist das Einzige, was mir von der Familie geblieben ist. Ihre Mutter starb bei ihrer Geburt. Josefine ist mein kleines Mädchen, verstehen Sie? Ich muss sie finden.“ Hoffnungsvoll sah er mir in die Augen. „Geld spielt keine Rolle, Mr. Hale. Ich bin sicher, dass Sie die Bezahlung gebrauchen können, jetzt, wo Sie eine eigene Firma gegründet haben“, spielte er auf sein Vermögen an.
Mein Kiefer zuckte kurz. „Die Protectors sind nicht auf Almosen aus, Mr. Winter“, erwiderte ich streng.
„Natürlich, das ist mir bewusst“, unterbrach er mich eifrig. „Ich wollte damit nicht andeuten, dass …“, versuchte er zu beschwichtigen, bis ich die Hand hob und ihn stoppte.
„Sollten wir den Auftrag annehmen, tun wir das, weil wir es wollen. Nicht weil wir darauf angewiesen sind. Ich gebe zu, dass ich neugierig bin. Sie sollten wissen, dass in ihren Kreisen normalerweise innerhalb von vierundzwanzig Stunden eine Geldforderung bei Entführungen eingeht. Die Tatsache, dass das nicht geschah, lässt mich eher vermuten, dass ein anderer Grund vorliegt.“
Edward Winter sah mich ungläubig an. Innerhalb von Sekunden veränderte sich seine Miene. Jetzt konnte ich die echte Sorge in seinen Gesichtszügen erkennen. Da war er. Der liebende Vater, der seine Tochter vermisste und beschützen wollte. In diesem Augenblick fiel ich eine Entscheidung.
„Sie glauben doch nicht, dass Josefine …“, stoppte er abrupt. Er sog den Atem tief ein.
„Sie müssen auf alles gefasst sein“, gab ich ihm, zu verstehen, „bei solchen Entführungen ist es ein schlechtes Zeichen, wenn keine Kontaktaufnahme zu den Entführern vorliegt. Könnte es sein, dass sie für ein paar Tage verreist ist? Hat Ihre Tochter Feinde? Gibt es jemanden in ihrem Umfeld, der ihr schaden möchte?“
„Nicht dass ich wüsste“, kam es geschockt über seine Lippen. „Sie ist nicht verreist. Das hätte sie mir mitgeteilt. Josefine ist bei allen beliebt. Sie hat nicht viele Freunde. Es gibt keinen Mann an ihrer Seite, soweit ich das sagen kann.“ Fahrig fuhr er sich mit der Hand über das Gesicht.
„Ex-Freund?“, hakte ich direkt nach, ohne auf seine Besorgnis näher einzugehen. Ich brauchte ihn bei klarem Verstand.
Seine Augen schossen zu mir. Der Glanz darin zeugte davon, dass er nicht mehr lange durchhielt. Ich wisperte ein stilles Gebet, dass er damit warten möge. Ich hatte keine Ahnung, wie ich damit umgehen sollte. Ein in Tränen aufgelöster Vater. Ich schüttelte mich gedanklich.
„Das kann ich nicht sagen“, sagte Mr. Winter überrascht. Ihm schien in diesem Augenblick bewusst zu werden, dass er nicht alles von seiner geliebten Tochter wusste. Ich fand es nicht weiter verwunderlich. Es war normal. Ab einem bestimmten Alter weihte man seine Eltern nicht mehr in alles ein. Ich nickte langsam und betrachtete erneut das Foto von ihr. Drei Tage. Das war eine lange Zeit, in der lebensbedrohliche Ereignisse geschehen konnten. Ich rechnete gedanklich zurück. Fünf Monate. In fünf Monaten war es eher unwahrscheinlich, eine vermisste Person lebend oder unversehrt aufzufinden. Ich kannte die Statistiken in- und auswendig. Ungeachtet dessen war ich nicht bereit, aufzugeben. Ich sah den Mann vor mir direkt an und schätzte ihn ähnlich ein. Er würde ebenfalls weitersuchen, auch wenn Monate vergangen waren. Diese Eigenschaft schienen wir gemeinsam zu haben. Ich verdrängte den Gedanken und konzentrierte mich auf Mr. Winter. „Ich werde Ihr Anliegen mit meinem Team besprechen. Sollten wir den Auftrag annehmen, rufe ich Sie an.“ Ich stand auf und ging langsam auf die Tür zu. Ein klares Zeichen, dass unser Gespräch beendet war. Ich musste mich nicht vergewissern, ob er den Wink verstand. Ich hörte das Rascheln seiner Kleidung, sobald er sich in Bewegung setzte. Ich riss die Bürotür auf.
„Wie lange werden Sie brauchen?“, fragte er mich, sobald er neben mir stand.
„Maximal vierundzwanzig Stunden“, meinte ich neutral, „Sie sollten vorher nichts unternehmen. Warten Sie auf meinen Anruf, Mr. Winter“, betonte ich.
Mr. Winter nickte leicht, senkte den Kopf und ging an mir vorbei aus meinem Büro. Ich blickte ihm nach, bis die Aufzugtüren sich hinter ihm schlossen. Ich konnte ihn besser verstehen, als er glaubte. Ein Familienmitglied auf diese Art zu verlieren, war entsetzlich. Und ich wusste, dass dieses beklemmende Gefühl ansteigen würde. Je länger seine Tochter vermisst wurde, desto mehr zerriss es ihn von innen heraus. Ich dachte, dass ich es gut im Griff hatte. Doch dieses Gespräch setzte mir mehr zu als angenommen. Die Erinnerungen in meinem Kopf bahnten sich zielstrebig ihren Weg. Egal wie sehr ich versuchte, es aufzuhalten. Mit angespanntem Kiefer schnappte ich mir das Handy vom Schreibtisch und entsperrte es. Meine Finger flogen über die Tastatur, als ich den anderen eine Nachricht schickte. Innerhalb von Sekunden erklang der mir bekannte Ton vom Handy. Jeder von ihnen bestätigte meine Order. Es wurde Zeit für ein Teammeeting.
Rouven 3
Wenn Warten unerträglich wird
Eine Stunde später parkte ich meinen schwarzen Chevrolet Suburban auf dem Innenhof unserer Einsatzzentrale. Es war ungewöhnlich, dass ich als Letzter ankam. Die Autos meiner Teammitglieder standen in Reih und Glied – schienen auf meine Ankunft zu warten. Wir hatten lange nach einem passenden Ort für unsere Zentrale gesucht. Unsere Entscheidung fiel auf ein altes Fabrikgebäude in Port Lands. Klarer Vorteil: Es lag abgeschieden, wirkte nach außen unscheinbar und lag direkt in der Nähe des Hafens. Ansonsten gab es im Umkreis Industriegebäude. Jeder, der vorbeikam, würde annehmen, das Gebäude stünde leer. Der Parkplatz war von vorn nicht einsehbar. Wir mussten erst in eine Querstraße fahren, um zu unserem versteckten Parkplatz zu gelangen. Die Bewegungskameras, die an der Fassade angebracht waren, fielen kaum auf. Nur ein Profi oder jemand, der gezielt danach suchte, würde sie finden können. Ich ging mit gemischten Gefühlen auf den Eingang zu. Das folgende Gespräch mit den Jungs würde nicht einfach werden. Ich blickte direkt in die Kamera, bis die Tür mit einem leisen Klicken aufschwang. Sobald man einen Fuß ins Innere setzte, wurde unmissverständlich klar, dass das Gebäude nicht für eine Industriefirma gedacht war. Jede weitere Tür war mit Scannern versehen, zu denen nur wir die Zugangscodes kannten. Ein Lastenaufzug führte in den versteckten Keller. Dort befanden sich die Waffenkammer, die Trainingsräume, der IT-Raum und eine medizinische Behandlungseinrichtung für Notfälle. Im oberen Bereich ging ich direkt auf den Einsatzbesprechungsraum zu. Bis auf eine Sitzecke gab es nichts weiter zu sehen. Der Keller war das Herz unserer Zentrale.
Meine Schritte beschleunigten sich, sobald ich die Konturen der Jungs im Raum erkannte. Sie saßen am ovalen Tisch auf ihren Stühlen und sprachen ausgelassen miteinander. Mein Blick fiel beim Betreten des Raumes direkt auf die große Leinwand. Das surrende Summen des „Echo-Frame“-Systems erfüllte den Raum. Auf der riesigen Display-Wand pulsierte links das Interface: Namen, Gesichter, Bewegungsprofile. Rechts sahen wir digitale Karten von Toronto. Sechs Augenpaare richteten sich auf mich. Maurice, Desmond und Dylan sahen mich prüfend an und verstummten. Wir vier bildeten „The Protectors“, offiziell eine private Bodyguard-Agentur. In Wahrheit waren wir ein Schattennetzwerk mit Zugriff auf Informationen, Waffen und Menschen, die vom Radar verschwunden waren. Jeder von uns brachte spezielle Erfahrungen mit, die unabdingbar für unsere Arbeit waren. Dylan Graves war unser jüngstes Mitglied. Ein ehemaliger Soldat und aus meiner Sicht ein Draufgänger. Eins ums andere Mal musste ich ihn zur Räson bringen. Seine verdammte Sturheit stellte sich mir oft in den Weg. Maurice Quinn war berechnend und unser Stratege. Seine Entscheidungen retteten uns oft das Leben. Wenn er Pläne entwarf, hörten selbst die Draufgänger zu. Er hatte diesen Blick, als würde er drei Züge weiterdenken, während die anderen noch ihre Waffen zogen. Und Desmond Shaw sagte wenig. Wenn er den Raum betrat, wurde es still – als wüsste jeder, dass der Mann mehr erlebt hatte, als er je erzählen würde. Er war ein ehemaliger Agent im Geheimdienst, verschlossen und schien eine dunkle Vergangenheit zu tragen. Ich war bisher nicht dahintergekommen, was genau ihm widerfahren war. Oft geschah es, dass er gedanklich nicht auf der Höhe war und sich distanzierte. Er war ein begnadeter Hacker. Seine Fähigkeiten waren für uns Gold wert. Ich war ihr Boss und hatte das Sagen, obwohl ich mich nicht so fühlte. Viele Entscheidungen trafen wir gemeinsam, selbst wenn es in Streit ausartete. Letztlich verfolgten wir alle dasselbe Ziel und das schweißte uns zusammen. Mit Maurice war ich länger befreundet. Er sagte sofort zu, als ich ihm von meinen Plänen berichtete und ihn anwarb. Desmond und Dylan fanden wir später und es brauchte seine Zeit, bis wir einander vertrauten. Mittlerweile gab es unsere Truppe seit zwei Monaten. Erst seit einem Monat traten wir öffentlich als Bodyguards auf.
„So, wie du aussiehst, ist das Gespräch mit Mr. Winter nicht gut gelaufen“, sprach Maurice mich direkt an.
Ich schlenderte zum Kopfende des Tisches und verzichtete darauf, Platz zu nehmen. Ich blieb stehen, die Hände in den Hosentaschen meines dunkelgrauen Anzuges gesteckt. Ich sah meine Jungs nacheinander an und konnte die Anspannung spüren, die im Raum lag. Offenbar konnte ich mich nicht so gut verstellen, wie ich dachte. Oder es lag daran, dass wir uns kannten und mein Unterbewusstsein es nicht für nötig hielt, die Fassade aufrechtzuerhalten.
„Das Gespräch verlief bestens“, erwiderte ich monoton. „Es ist der Auftrag von ihm, der mich nicht in Ruhe lässt.“ In meinem Kopf erschien das Bild von Josefine Winter, bis es sich in das meiner jüngeren Schwester verwandelte. „Seine Tochter wird seit drei Tagen vermisst.“ Ich sagte nichts weiter. In den Gesichtern der Jungs war die Erkenntnis angekommen. Spätestens jetzt wussten sie, weshalb ich so merkwürdig auftrat.
„Wir sind noch nicht so weit“, erklang es sofort von Maurice. Seine blauen Augen fixierten mich warnend.
Desmond sog scharf den Atem ein und Dylan grinste frech vor sich hin. Da war sie, die Auseinandersetzung, die ich prophezeite.
„Wie lange sollen wir noch warten?“, fragte Dylan provokant und hielt dem Blick von Maurice stand. Seine Frisur – irgendwo zwischen Rebellion und High Fashion – erinnerte an einen Irokesen, gestylt mit der Selbstsicherheit eines Mannes, der nie anecken musste, um aufzufallen. Es waren eher seine grauen Augen und seine Tattoos am Hals, die herausstachen. Von unseren Trainingseinheiten wusste ich, dass er am Oberkörper weitere Tattoos besaß. Desmond wirkte auf mich wie der charmante Nachbarsjunge, dem die Mädchen reihenweise nachliefen. Mit seinen dunklen Haaren, die stets ein wenig zerzaust aussahen, und seinen hellblauen Augen fiel er auf. Ein Umstand, den er hasste. Und Maurice könnte als Firmenboss durchgehen, mit seinem markanten Kinn und den stechenden blauen Augen. Seine schwarzen, kurzen Haare waren stets gestylt und wirkten aalglatt. Durch seinen gestutzten Schnauzer, wirkte er auf andere als streng und unnahbar. Ich war eher der dunkle Typ. Dunkelbraune Augen, die oft als schwarz betitelt wurden. Meine schwarzen Haare trug ich kurz und überließ dem Friseur den Style. Wenn ich etwas Markantes zu meinem Aussehen benennen sollte, würde ich meinen Dreitagebart wählen. Ich konnte nicht einmal sagen, wann ich das letzte Mal keinen Bart trug.
„Wir haben nicht länger als vierundzwanzig Stunden, um eine Entscheidung zu fällen“, sprach ich weiter.
„Du vermutest sie dahinter, richtig? Was bringt dich auf die Idee?“, schaltete sich Desmond ein.
Ich zuckte mit den Schultern. „Ich habe ein merkwürdiges Gefühl, seitdem ich mit dem Vater sprach. Mir ist bewusst, dass das nichts sagen muss“, ergänzte ich sofort, um Desmond zu stoppen, der gerade den Mund öffnete, um etwas zu erwidern.





























