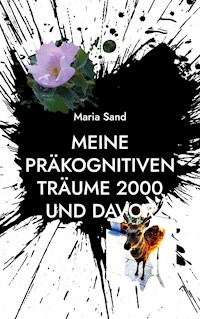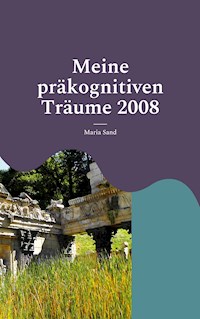Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Buch ist eine Auseinandersetzung mit der Feindschaft zwischen Przybyszewski und Strindberg. Die beiden berühmten Männer waren anfangs scheinbar Freunde, doch schon bald gab es Differenzen. Przybyszewski stellte sich als rachsüchtiger Feind heraus. Offenbar war er ein Narzisst, der Zurückweisung nicht ertragen konnte. Was sich auch im Umgang mit anderen Personen deutlich zeigte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rette sich wer kann!
Stanisław Przybyszewski wurde am 7. Mai 1868 in Preußen geboren. Sein Vater war Dorfschullehrer. Sehr viel mehr weiß man über seine Kindheit nicht. Denn was er darüber behauptete, darf man nicht alles einfach als Wahrheit hinnehmen. Denn mit der Wahrheit nahm er es nicht so genau.
Über sein weiteres Leben ist einiges mehr bekannt. Was ihm nicht angenehm gewesen sein dürfte war, dass seine Kritiker nicht unbedingt mit seiner Selbstdarstellung überein stimmten.
Liest man was Wikipedia über ihn schreibt, erhält man den Eindruck, dieser Mann sei ein lieber, netter Mensch gewesen, der Großes geleistet hat und zu Unrecht in Vergessenheit geriet. Doch die Realität sah doch etwas anders aus. Seine Zeitgenossen hielten nicht alle sehr viel von ihm. Bis auf gewisse Ausnahmen natürlich. Zwar wird behauptet, er habe Freunde gehabt. Doch es waren eher Saufkumpane, mit denen er sich unter anderem im "schwarzen Ferkel", in München, regelmäßig traf. Gleichgesinnte, unter denen einige waren, die wie er auch, Frauen hassten.
Zu diesen Saufkumpanen zählte auch Strindberg, denn ohne den hätte es diese Gruppe vermutlich gar nicht gegeben. Aus einem einfachen Grund: er zahlte meistens die Zeche. Obwohl er selbst immer wieder große finanzielle Schwierigkeiten hatte. Mit Geld konnte er nämlich nicht umgehen. In dieser Hinsicht unterschied er sich nicht von Przybyszewski. Dass sich dort viele Leute trafen war kein Wunder, gab es doch für alle häufig Getränke gratis. Die Runde zerfiel, als Strindberg abreiste. Der Gönner verschwand.
Schon bald danach distanzierte sich Strindberg von den sogenannten Freunden, die zum Teil gefährliche Psychopathen waren.
Man suchte und fand manchmal Gönner und Förderer in derartigen Kreisen und man konnte sich wichtig fühlen, egal ob die eigenen Werke ein größeres Publikum erreichten, oder nicht. Es war sozusagen eine doppelte Hilfestellung, denn nicht jeder konnte von seinen Werken leben. Was bei den meisten von ihnen der Fall war. Sehr oft erreichten sie auch nicht ihr Ziel, berühmt zu werden, oder jedenfalls nicht in dem Ausmaß, dass man davon hätte leben können. Zumindest konnte man später sagen man war dabei, gehörte dazu.
Von Geldnot waren die meisten Künstler, Dichter und Schriftsteller betroffen und selbst Nietzsche konnte seine Werke nicht an den Mann, oder an die Frau bringen und musste deshalb anfangs einige wenige Exemplare verschenken, um überhaupt gelesen zu werden. Damals war er noch nicht die "Lichtgestalt", für die man ihn heute hält. Berühmt wurde der Philosoph nur, weil er von einer kleinen Gruppe entdeckt und gefördert wurde. Man rührte für ihn die Werbetrommel und das half. Ansonsten hätte man ihn übersehen, oder nicht genug geschätzt. Werbung macht sich eben bezahlt. Wenn einige Menschen an etwas, oder an jemanden glauben, schließen sich viele an. Schon bald wird aus einem Niemand eine wichtige Persönlichkeit, die große Weisheiten verkündet.
Der Schriftsteller und Maler Max Dauthendey zählte ebenfalls zum Ferkel Kreis. Er hatte dadurch natürlich auch Kontakt zu Przybyszewski. Dessen Beziehung zu Dagny Juel und das Verhältnis von ihr zu Munch, hat er als Dreiecksgeschichte in seiner Komödie "Maja" (1911) verarbeitet. Einer seiner Aussprüche sagt mehr und deutlicher als jede wissenschaftliche Abhandlung, worum es so manchem bei diesen Zirkeln in erster Linie ging. Als er auf sich alleingestellt war, schrieb er folgendes an seine Frau.
Am 16. April 1903:„Denn ich bin hier unter so jungen dummen Leuten, die alle rechnen und nie künstlerisch auszugeben verstehen. Es sind eben alles junge, egoistische Menschen, die wie Schulknaben disputieren und handeln.“
– Geibig, S. 36
Ohne passenden "Gönnerkreis" fiel ihm das Leben schwer, wie so vielen anderen seiner Kumpane auch. Seinen Lebensunterhalt bestritt er deshalb größtenteils aus Leihgaben und Geschenken, Vorschüssen und seltenen Honoraren. Als Künstler hielt er sich für berechtigt, einen gehobenen Anspruch für seine Lebensweise zu stellen und gegenüber dem Eigentum Anderer eine gewisse Unempfindlichkeit an den Tag zu legen. Seine Freundin, die Malerin Gertrud Rostosky verkaufte sogar Bilder, um den Erlös Dauthendey zur Verfügung zu stellen.
(1)
Selbstverständlich hatte auch Przybyszewski ständig finanzielle Probleme. Da war die Freundschaft mit einem bereits bekannten, erfolgreichen Schriftsteller und Dichter ganz praktisch. Was er wirklich über Strindberg dachte, erfuhr man erst nachträglich, als er seine Sicht der angeblichen Freundschaft in einem Buch so darstellte:
In seinem Buch „Ferne komm ich her - Erinnerungen an Berlin und Krakau“ (Igel Verlag) schrieb er eine vernichtende und zum Teil verlogene Kritik über Strindberg. Er versuchte gleichzeitig sich selbst besser darzustellen, als er war. Niemand hatte erwartet, gerade von ihm so viel Schlechtes über Strindberg zu behaupten. Hatte er sich doch zuvor als guter Freund dargestellt. Doch ein Narzisst ist kein Freund für andere, weil er nicht fähig ist, Gefühle für andere Lebewesen zu empfinden. Ein Narzisst war er mit Sicherheit.
Wie der Pole mit anderen Menschen umging, zeigt eine kleine Episode.
Eine so bedeutende Summe, meinte er (es ging um 600 Kronen), müsse er der Kasse seines Geschäfts entnehmen und könne sie deshalb nur gegen eine sichere Deckung verleihen. Przybyszewski war erbost, ging die Bedingung aber ein. Ha, war das ein Wechsel. Krakaus ganze Halbwelt, die gesamte Ziganerie, hatte unterschrieben; etwa zwanzig Namen bürgten für die ausgestellte Summe. Stach übergab den Wechsel und kassierte das Geld, worauf er mit Gabryelski Katz und Maus zu spielen begann. Er machte ihm zweideutige Komplimente, dass er, Herr Zdzisław Gabryelski, der große Herr, dieser subtile Mensch, sich mit diesem Wechsel einen ganz hervorragenden Spaß erlaubt hatte: Es freute ihn, dass man ihn verdächtigte, ein solches Schwein zu sein, von einem Freund, einen Wechsel zu verlangen. Jetzt sollte er es den anderen aber zeigen, den Wechsel in großzügiger Weise zerreißen usw. Przybyszewski brachte es tatsächlich fertig, dass Gabryelski – von Spott und Hohn verfolgt – mit gequältem Gesicht den Wechsel hervorholte und zerriss. Worauf ihn Przybyszewski gerührt umarmte und die ganze Gesellschaft zu Turlinski einlud. Hier bestellte er zwanzig Flaschen Champagner, bezahlte alles im Voraus (natürlich mit dem so schwer erkämpften Geld), ließ alle Flaschen öffnen, schielte dabei mit einem sadistischen Grinsen zum vor Wut blass werdenden Gabryelski und sonnte sich in dessen Qualen."
Die Zechbrüder hatten kaum am Champagner genippt, als Przybyszewski das Zeichen zum Lokalwechsel gab und Jedenfalls begab man sich in eine nahegelegene Kneipe, wo die Exekution am übriggebliebenen Kapital stattfand.
(2)
Der Name den Strindberg in seinem Roman dem später feindlichen Przybyszewski verpasste, war Popovski. Sicher nicht um sich über dessen Namen lustig zu machen, sondern der Einfachheit halber. Oder er bezeichnete ihn als "der Pole", was ich hier übernommen habe. Im Freundeskreis nannte man ihn Stachu, wie er auch als Kind gerufen wurde, weil offenbar niemand den polnischen Namen aussprechen konnte, oder man bezeichnete ihn als "der geniale Pole".
Przybyszewski war Satanist, zumindest hielten ihn andere dafür, was er aber nicht so sah, Säufer und Frauenhasser. Sex war ihm wichtig, was daraus resultierte weniger: seine Kinder. Ein Vater war er nicht. Nur ein Erzeuger. Was aus den Kindern wurde, kümmerte ihn nicht. Offenbar hatte er Erfolg bei Frauen, obwohl er kein Hehl aus seinem Hass ihnen gegenüber machte.
Wie der Pole selbst schreibt, versuchte er Strindberg mit schwarzer Magie und mit Fernbeeinflussung bekannt zu machen. Was bei diesem zeitweise zu Psychosen führte, vor allem aufgrund des exzessiven Drogenkonsums, welchen weder Strindberg, noch irgendwer sonst und schon gar nicht Przybyszewski, als solchen erkannte. Was letzterem vermutlich auch egal gewesen wäre, denn ihm ging es darum, andere Menschen zu beherrschen und psychisch zu vernichten. Das fiel ihm nicht schwer, weil in seinem Umfeld neben Alkohol auch Drogen und sogar ein Nervengift im Absinth (Thujon) konsumiert wurden. So war es möglich, auch ohne großes Zutun, Menschen psychisch fertig zu machen.
Damals für jeden einfach in der Apotheke erhältlich und von Ärzten zum Teil verschrieben, erhielt man so ziemlich alles, was heutzutage verboten ist. Dazu eben noch Thujon, ein Nervengift im Absinth, den man sowieso in jedem Beisl bekam.
Viele Menschen wurden unbewusst zu Drogenabhängigen gemacht und endeten im Elend, oder auf der Psychiatrie, wenn sie sich nicht gleich das Leben nahmen. Strindberg war nur einer dieser zahlreichen Geschädigten. Vermutlich teilten auch alle seine echten und falschen Freunde sein Schicksal. Er hatte das Glück - im Gegensatz zu vielen anderen - die Gefahr zumindest teilweise zu erkennen. Deshalb hörte er wenigstens gegen Ende seines Lebens auf, Absinth zu trinken.
Es ist schwer, die Literaten, Dichter und Künstler der damaligen Zeit richtig einzuschätzen. Denn die meisten von ihnen waren durch diese leicht erhältlichen und allgemein akzeptierten Drogen und Gifte geschädigt. Man erinnere sich, dass selbst der Arzt und Psychiater Freud unter einer Suchtkrankheit litt.
„Es scheint, als sei die gesamte europäische Elite der Literatur und der bildenden Künste im Absinthrausch durch das ausgehende 19. und beginnende 20. Jahrhundert getorkelt.“, schreiben dazu Hannes Bertschi und Marcus Reckewitz, Von Absinth bis Zabaione, Argon Verlag.
Moderne Absinthtrinker meinen: Der Absinth-Rausch ist einfach etwas ganz besonderes... sollte man auf jeden Fall ausprobiert haben!
(5)
Dabei ist der Absinth, der heute verkauft wird, im Gegensatz zum damaligen, absolut harmlos.
Viele berühmte Künstler konsumierten Absinth und viele Künstler widmeten dem Getränk ihre Bilder. Oscar Wilde schrieb: “Das erste Stadium ist wie normales Trinken, im zweiten fängt man an, ungeheuerliche, grausame Dinge zu sehen, aber wenn man es schafft, nicht aufzugeben, kommt man in das dritte Stadium, in dem man Dinge sieht, die man sehen möchte, wundervolle, sonderbare Dinge”, so beschrieb Oscar Wilde die Besonderheit des Absinths.
(6)