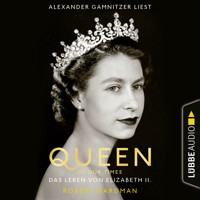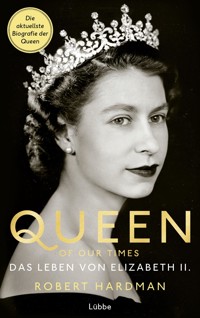
24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Pflichtbewusstsein der Queen war legendär, ihr Leben stand 70 Jahre lang im Dienst der Krone. Sie repräsentierte das Ende des Kolonialzeitalters, die Werte einer langen Partnerschaft, stille Zuversicht in herausfordernden Zeiten und vieles mehr. Was wird ihr Vermächtnis sein? Robert Hardman legt mit Queen of Our Times ein ebenso umfangreiches wie intimes Porträt vor, taucht tief in die jüngere englische Geschichte und das Leben von Elizabeth II. ein. Das Insiderwissen des englischen Hofexperten findet international Beachtung, er steht persönlich mit den Royals in Verbindung und zählt zum inneren Kreis des Palasts. Eine Jahrhundertbiografie, auf die Fans schon lange gewartet haben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 817
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Das Pflichtbewusstsein der Queen ist legendär, ihr Leben steht seit 70 Jahren im Dienst der Krone. Sie repräsentiert das Ende des Koloniezeitalters, die Werte einer langen Partnerschaft, stille Zuversicht in herausfordernden Zeiten und vieles mehr. Was wird ihr Vermächtnis sein? Robert Hardman legt mit Eine Jahrhundertbiografie, auf die Fans schon lange gewartet haben!
Über den Autor
Robert Hardman (*1965) ist ein renommierter Autor, Dokumentarfilmer und Journalist, sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf dem englischen Königshaus und historischen Themen. Im Lauf der Zeit hat er sich ein besonderes Verhältnis zum englischen Hof erarbeitet und genießt ungewöhnliches Vertrauen. Er interviewte unter anderem den Prince of Wales für die BBC-Produktion »Charles at 60«, Prinz Philip für das Format »The Duke: In His Own Words« und Princess Anne für die Dokumentation »The Princess Royal at 70«, die bei ITV ausgestrahlt wurde. Hardman schreibt regelmäßig für die britische Tageszeitung Daily Mail und auch deutsche Medien (Tagesschau, SZ, Focus …) greifen gern auf seine besondere Expertise zuück. Seine Arbeit ist preisgekrönt. Queen of Our Times ist sein viertes Buch.
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der englischen Originalausgabe »Queen of Our Times«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2022 by Robert Hardman
Published by arrangement with United Agents LLP
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Jakob Arnold, Düsseldorf
Umschlaggestaltung: Thomas Krämer nach einem Originalentwurf von © Stuart Wilson, Pan Macmillan Art Department
Umschlagmotive: © HM Queen Elizabeth II. Photo by Dorothy Wilding. Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021; © Max Mumby/Indigo/Getty Images (Rückseite)
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-4262-7
luebbe.de
lesejury.de
Einleitung
»Sie lebt im Hier und Heute«
Selbst für einen nobelpreisgekrönten Staatsführer der freien Welt war es einer der großartigsten Abende seines Lebens gewesen. Zurück in seiner Suite im Buckingham Palace wollte Barack Obama den Moment einfach nur genießen. Ihm zu Ehren hatte Queen Elizabeth II. soeben ein Staatsbankett gegeben. Doch was diesen Abend zu einem so einmaligen Erlebnis gemacht hatte, war nicht etwa die Zurschaustellung des goldenen und silbernen Tafelgeschirrs aus der Grand-Service-Sammlung von George IV. oder die exklusive Qualität des Échézeaux Grand Cru 1990 Romanée-Conti. Nein, es war das innige Verhältnis, das er mit seiner Gastgeberin aufgebaut hatte, die kenntnisreich über viele seiner Vorgänger zu erzählen wusste. Obama hatte sich prächtig amüsiert, doch die Queen war schließlich müde geworden und wollte ins Bett. Sie nahm ihren Schatzkanzler zur Seite und bat ihn, den Präsidenten möglichst diskret darauf hinzuweisen, dass es Zeit sei, ins Bett zu gehen. »Ich sagte nur: ›Ja, Ma’am‹«, erinnert sich George Osborne. »Ich blickte zu ihm rüber, sah ihn fröhlich plaudernd mit einem Glas in der Hand und dachte: Wie soll ich das denn anstellen? Ich konnte ihn doch nicht einfach unterbrechen nach dem Motto ›Verzeihung, aber die Queen will, dass Sie schlafen gehen.‹«1
Zum Glück rettete ihn der Privatsekretär der Queen, der das Bankett galant beendete.
Aufgekratzt wie er war, lud der Präsident seine beiden engsten Mitarbeiter zu einer bescheidenen After-Party in die Belgische Suite, in der die Queen all ihre Staatsgäste beherbergt. Es gab noch einiges zu tun. Schon morgen sollte Obama als erster US-Präsident in der Geschichte vor beiden Kammern des britischen Parlaments sprechen. Während sich die First Lady, Michelle Obama, im angrenzenden Schlafraum, dem Orleans Room, für die Nacht zurechtmachte, saß der Präsident mit seinen Beratern im Salon, der als Eighteenth Century Room bekannt ist, und feilte noch am letzten Schliff seiner großen Rede.
»Obama wollte mit einer umfassenden Verteidigung der westlichen Werte aufwarten«, schrieb sein Hauptredenschreiber Ben Rhodes später, »aber erst einmal wollte er – wie alle, die soeben im Buckingham Palace gespeist hatten – über den Abend sprechen.«
Vor allen Dingen über seine Gastgeberin. »Ich liebe die Queen wirklich sehr«, sinnierte Obama. »Sie ist wie Toot, meine Großmutter. Zuvorkommend. Geradeheraus. Bei allem, was sie denkt. Sie hat was gegen Dummköpfe.«2
In diesem Moment gab es eine kleine Unterbrechung. Ein Palast-Butler kam herein und informierte über einen Eindringling. »Verzeihen Sie, Mr. President«, flüsterte der Mann im Frack. »Da ist eine Maus.« Ohne mit der Wimper zu zucken erwiderte der Präsident: »Verraten Sie das bloß nicht der First Lady.« Der Butler beteuerte ihm, alles würde getan werden, um den ungebetenen kleinen Gast zu fangen. »Schon gut, solange Sie es bloß nicht der First Lady erzählen«, wiederholte Obama. »Es störte ihn überhaupt nicht, bis auf die Tatsache, dass Michelle Obama Angst vor Mäusen hatte«, erinnert sich Rhodes weiter.3
Tatsächlich trug die Mäusejagd nur zu der prunkvollen, surrealen Atmosphäre bei. »Vielleicht geht das Empire ja doch langsam unter«, sagte Rhodes. Obama lachte: »Nein, hier ist noch eine ganze Menge los. Haben Sie den Klunker der Queen gesehen?« Er ließ seinen Blick schweifen, betrachtete die Gemälde an den Wänden des Eighteenth Century Room – »Diana und Actaeon« von Thomas Gainsborough, ein paar Canalettos, Amerikas alten Feind »George III.«, ein Porträtgemälde von Johann Zoffany. Dabei wurde ihm die Beständigkeit der Monarchie gegenüber der Flüchtigkeit der Politik des 21. Jahrhunderts bewusst. »Es ist gerade mal ein paar Jahre her, da saß ich im Senat des Staates Illinois«, scherzte der Präsident, »und lebte in einer Etagenwohnung.«
Zeitig ins Bett geschickt und in einem Haus mit Ungeziefer hätte man Obama wohl kaum verübelt, wenn er seinen Aufenthalt im Palast eher als Enttäuschung empfunden hätte.
Tatsächlich aber bestärkte diese Erfahrung seine Hochachtung für eine der eindrucksvollsten führenden Persönlichkeiten der Welt, die er während seiner gesamten Präsidentschaft getroffen hatte. Zum ersten Mal waren sich die beiden ein Jahr zuvor begegnet, wo die Queen und Michelle Obama sich im Rahmen eines Empfangs bei einer Plauderei über schmerzende Füße vom langen Stehen sichtlich nähergekommen waren – »Wir waren einfach nur zwei müde Frauen, deren Schuhe drückten«, kommentierte die First Lady der USA diesen Moment später.4 Es war das erste von vielen weiteren Treffen. In ihren Memoiren spricht Michelle Obama liebevoll von »unserer Freundin, der Queen«, von der sie eine Lektion fürs Leben gelernt hat: »Während vieler Besuche zeigte sie mir, dass Menschlichkeit wichtiger ist als Protokolle oder Formalitäten.«5
Ähnlich empfand das der Präsident. »Sie entwickelten eine echte Verbundenheit. Er sah, wie die Queen alles tat, damit ein schwarzer amerikanischer Präsident sich willkommen fühlte. Sie behandelte ihn sehr viel besser als jeden anderen Staatsführer, das können Sie mir glauben«, sagt Rhodes, ohne Namen zu nennen. »Das war richtig stark von ihr. Sie und Prinz Philip – zwei, die in puncto Alter und Ethnie von den Obamas nicht verschiedener hätten sein können – versuchten wirklich alles, um eine echte Freundschaft aufzubauen. Obama war hin und weg. Sie konnte ihm Aufschluss geben über all jene Leute, mit denen er zu tun haben und zusammenarbeiten würde. Und sie wusste über jeden US-Präsidenten etwas zu erzählen, bis zu Eisenhower.«6
Im Jahr 2016 wurde Präsident Obama als Hauptredner zur Trauerfeier für den verstorbenen israelischen Staatspräsidenten und Premierminister Schimon Peres nach Jerusalem eingeladen. Er würdigte ihn als einen der »Giganten des 20. Jahrhunderts, die ich die Ehre hatte kennenzulernen«, und sah ihn in einer Reihe mit Nelson Mandela und Queen Elizabeth. Sie seien, so Obama weiter, »Staatsoberhäupter, die so viel erlebt und gesehen haben, deren Leben so bedeutsame Epochen umspannt, dass sie es nicht nötig haben, sich zu profilieren, oder ihr Handeln danach auszurichten, was gerade populär ist; Menschen, die mit Tiefgang und Wissen sprechen und sich nicht auf Phrasen verlegen. Umfragewerte oder kurzlebige Trends interessieren sie nicht.«
Und dies erklärt, warum auch heute, in ihrem zehnten Lebensjahrzehnt, von einer Queen-Dämmerung keineswegs die Rede sein kann. Vielmehr erscheint sie im Zenit ihrer Größe und Macht, während ihre Regentschaft zugleich Eingang in die Rekord- und Geschichtsbücher findet. »Ich denke, das liegt daran, dass Ihre Majestät in einer sehr fragmentierten Medien-, Nachrichten- und Prominentenlandschaft eine Konstante ist«, sagt Simon Lord McDonald, ehemaliger Chef des Diplomatischen Dienstes. »Jeder hat eine sehr frühe Erinnerung an die Queen. Sie ist verlässlich und ehrwürdig, und damit will man sich gerne verbunden sehen.« Er denkt zurück an seine ersten Tage als neuer britischer Botschafter in Berlin und an ein Treffen mit dem damaligen BILD-Chefredakteur. »Seine erste Frage war: ›Wann beehrt uns denn Ihre Majestät wieder? Es ist schon fast zehn Jahre her. Da wird es doch Zeit!‹«
*
Es war lange Zeit Usus, die Regentschaft als eine Reihe großer Umbrüche zu kartieren. Und verständlicherweise richten Biografen und Dokumentarfilmer ihr Interesse auf die Schlüsseldramen ihrer sieben Jahrzehnte als Queen: auf Princess Margarets verbotene Romanze mit Oberst Peter Townsend, auf die Suez-Krise, den Mord an Lord Mountbatten, auf königliche Hochzeiten oder die Zwistigkeiten mit Mrs. Thatcher, auf das Feuer von Windsor Castle, auf royale Scheidungen und den Tod von Diana, Princess of Wales, gefolgt vom Verlust von Princess Margaret und der Königinmutter sowie neuerdings auch auf das Verschwinden von Prince Andrew, dem Duke of York, und Prince Harry, dem Duke von Sussex, von der royalen Bühne.
Aber die Queen hat auch zahlreiche Kritiker. Es gab von jeher einen Teil der britischen Bevölkerung (der sich irgendwo zwischen einem Fünftel und einem Viertel bewegt), der sie durch ein gewähltes Staatsoberhaupt ersetzt sehen will. Darüber hinaus hat die Queen auch viel an harscher persönlicher Kritik einstecken müssen. Seit Lord Altrinchams Angriff auf ihre »höfische Oberschicht«-Haltung und ihr »Schülersprecherinnen«-Gehabe Ende der fünfziger Jahre wurde sie auch für ihren Modestil, ihre Personalauswahl, ihr Finanzgebaren oder auch ihre Kindererziehung attackiert. Vor allem in den 1990er-Jahren wurde sie wegen ihrer öffentlich wahrgenommenen Passivität angesichts fortlaufender Familiendramen kritisiert. Sogar ihre wohlwollende Biografin Elizabeth Longford bemerkte, dass sie zwar »nie einen Fehltritt begangen, aber auch nie einen Fuß vorwärts gesetzt« habe.7 Im Jahr 2015, als Queen Elizabeth II. dabei war, Queen Victoria, die bis dahin dienstälteste Monarchin der britischen Geschichte, zu überrunden, beschrieb Guardian-Kolumnistin Polly Toynbee sie als eine »veraltete Herrin des Nichts«,8 und der Historiker Dr. David Starkey erzählte den Lesern der britischen Programmzeitschrift Radio Times: »Sie hat nichts getan oder gesagt, an das sich später einmal irgendwer erinnern wird. Ihrem Zeitalter wird man später einmal nicht ihren Namen geben. Und auch sonst nichts, wenn Sie mich fragen.«9
Das Narrativ von der »Queen in der Krise« wurde durch ein weiteres Drama verstärkt, diesmal einem wirklichen. 2016 ging die erste Episode der von Netflix produzierten Dramaserie The Crown auf Sendung, die Begebenheiten aus dem Leben der Queen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dramatisiert, oft mit fraglicher Genauigkeit. Die meisten bedeutenden Persönlichkeiten der Geschichte sind irgendwann als Figuren in einem Drama zu sehen, wenige aber machen diese Erfahrung noch zu Lebzeiten und noch wenigere, während sie noch im Amt sind. The Crown hat die Sichtbarkeit der Monarchie sicherlich verstärkt, fragt sich nur, zu welchem Preis für ihr Ansehen und für das öffentliche Verständnis realer Ereignisse, in die reale Menschen verwickelt sind? Die Debatte darüber wird noch jahrelang andauern, da die Serie die weltweite Wahrnehmung von Elizabeth II. und ihrer Familie auch weiterhin beeinflussen wird, ob zum Besseren oder Schlechteren.
Doch das Porträt einer tristen, trägen und von allen Seiten belagerten Elizabeth II., zermürbt von einem Rückschlag nach dem anderen, scheint nicht zu passen zu einer Monarchin, die gerade erst das achte Jahrzehnt auf dem Thron begonnen hat. Wie wir noch sehen werden, war ihre Rolle in der Geschichte des modernen Großbritanniens und des Commonwealth alles andere als unbedeutend und nicht selten ein Paradebeispiel für einen klugen und besonnenen Einsatz von sanfter Macht. Im Vorfeld ihres Platin-Jubiläums sah sie sich mit zwei der größten Herausforderungen ihrer Regentschaft konfrontiert, und zwar mit der Covid-19-Pandemie und dem Tod von Prinz Philip. Eine zermürbte, der Welt überdrüssigen Monarchin, wie sie in The Crown gezeichnet wird, wäre von diesen beiden Ereignissen sicherlich völlig überfordert gewesen. Doch die Queen verschwand nicht von der Bildfläche. Sie schien vielmehr einen neuen Sinn in ihrer Aufgabe zu finden, was wohl an einer unscheinbaren Tatsache liegt, die das Narrativ der Serie für gewöhnlich übersieht. Eine Tatsache, die vielleicht erklärlich macht, wieso und weshalb die Monarchie nicht unterzukriegen ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die Queen es liebt, die Queen zu sein. Das in der Serie gezeichnete Bild von der krisenanfälligen Monarchie, die mit einem goldenen Mühlstein um den Hals an sich selbst schwer zu tragen hat, verkennt die Tatsache, dass sie die meiste Zeit ihrer Regentschaft fest und sicher im Sattel saß; dass selbst in dunkelsten Zeiten die Unterstützung für die Monarchie alles andere bei Weitem überwog. Es geht hinweg über das, was ein altgedienter Hofbediensteter den »unermesslichen, unerklärbaren gesellschaftlichen Wert« einer »pulsierenden Institution« nennt, »die die Kapillaren der nationalen Seele tiefer und häufiger durchdringt als jede andere, und zwar dadurch, dass sie sich den alltäglichen Bedürfnissen des Landes annimmt: dass sie Menschen dankt, denen ein Dank bedarf, dass sie Orte besucht, denen ein Besuch bedarf.«
Erst recht jetzt, in einem Alter, in dem andere längst im Ruhestand sind, zeigt sich mehr denn je, dass die Queen ihren Job wirklich liebt.10
»Ich glaube, die Queen erlebt ihre Aufgabe als überaus sinnvoll«, sagt der frühere britische Premierminister Tony Blair. »Und sie macht ihre Sache gut, weil sie glaubt, dass sie wirklich wichtig ist, und wer liebt, was er tut, wer Sinn und Zweck in seinem Tun erkennt, der geht auch darin auf.«
»Ja, das tut sie, da bin ich ganz sicher«, bestätigt auch der ehemalige US-Präsident George W. Bush. »Irgendwann im Leben macht es sich bemerkbar, wenn dir der Job keinen Spaß macht, wenn er dich belastet und auslaugt, wenn er so hart ist, dass du ihn nicht bewältigen kannst – und das gilt für jeden Job.«11
Dabei gab es, wie wir sehen werden, durchaus Momente, in denen sie an ihre Grenzen stieß, was sie sich jedoch kaum anmerken ließ. Bis heute, mehr als achtzig Jahre nach ihrem ersten öffentlichen Auftritt gibt es nur einen einzigen Bildbeweis dafür, dass sie der Schlaf übermannte, während sie gerade Dienst tat. Und zwar 2004, als sie auf Staatsbesuch in Deutschland war. Während eines Kurzvortrags mit dem Titel »Neue biologische und medizinische Erkenntnisse mittels Magneten« an der Medizinischen Fakultät der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität war sie für zehn Sekunden eingenickt.12
*
Die Monarchie folgt nicht dem kurzlebigen Takt des politischen Lebens. In Zeiten nationaler Talfahrten oder Krisen ging das Ansehen der Queen oft in die entgegengesetzte Richtung, wie etwa während der wirtschaftlichen Turbulenzen in den 1970er-Jahren oder der Covid-19-Pandemie 2020. »Dass wir in den 1970er-Jahren, als wir in echten Schwierigkeiten steckten, immer noch hohes Ansehen genossen, haben wir teils ihr und der Monarchie zu verdanken«, sagt der ehemalige Kabinettsminister, der Marquess of Salisbury.13
Und das Königshaus folgt auch keinem Zehnjahresturnus. Die Geschichte ihrer noch andauernden Regentschaft geht nicht konform mit seriell abzählbaren Dekaden. Sie folgt eher einer parabelförmigen Kurve, die mit dem Punkt ihrer Krönung zur Queen ansteigt und Anfang der 1960er-Jahre, als die königliche Familie als unbedeutend und abgehoben angesehen wurde, wieder abfällt. Ab Ende der 1960er-Jahre ging es wieder stetig bergauf, bis die Kurve Anfang der 1990er-Jahre, mit Beginn einer langanhaltenden wirtschaftlichen Depression, erneut steil nach unten stürzte. 2002 stieg die Verlaufskurve dann wieder an, bis 2019, als neue Familienkrisen dazwischenkamen.
Durch eine andere Linse betrachtet können die siebzig Jahre, seit die Queen 1952 das Erbe ihres Vaters angetreten und den Thron bestiegen hat, als ein Schauspiel in zwei Akten gesehen werden. Der erste Akt zeigt eine deutliche Phase der Lehrjahre, als sie noch im Schatten der Generation ihres Vaters stand und dessen Fußstapfen folgte. Ein alterfahrener Bediensteter am Hof bezeichnet diese Zeit als »die unvollendete Regentschaft«. Der zweite Akt beginnt, als ihr die Lehrmeisterin Erfahrung sowie neue Berater und äußere Ereignisse das nötige Selbstvertrauen gaben, die Institution nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Dies passierte natürlich nicht über Nacht, vollzog sich aber recht zügig, sodass sie bis zum Übergang der 1960er- in die 1970er-Jahre begann, die royale Show nach ihrer eigenen Fasson zu gestalten. Und dies tut sie bis heute.
Oft heißt es, die Queen sei »außergewöhnlich«. Kein Wunder, in Anbetracht ihrer langen Lebens- und Regierungszeit. Als kleine Prinzessin spielte sie zu Füßen von George V. und saß auf dem Schoß der Kinder von Queen Victoria. Als junge Königin empfing sie auf ihren Reisen noch Veteranen des Burenkriegs.
Großbritannien war damals eine weitgehend monokulturelle, monochrome Gesellschaft. Die Hälfte der Nationen auf dieser Erde mussten in ihrer heutigen Form erst noch entstehen, und britische Truppen kämpften immer noch im Koreakrieg. Dass ein- und dieselbe Person über all die Zeit, von damals bis heute, das Zepter schwingt, das ist in der Tat »außergewöhnlich«.
»Die Queen ist immer eine Konstante in unser aller Leben gewesen«, sagt Sir John Major, der älteste unter ihren heute noch lebenden Premierministern. »Die neuen Medien machen sie nahbarer (und menschlicher) als jedes andere Staatsoberhaupt vor ihr. In vielen Dingen lebt sie ein Leben wie die meisten anderen Menschen auch.«
Ihr hohes Alter ist jedoch nur ein kleiner Teil dessen, was sie so außergewöhnlich macht. Nicht minder beeindruckend ist ihre körperliche Kondition, die ihre Dienerschaft auf drei Dinge zurückführt: gute Gesundheit, fester Glaube und Prinz Philip. »Die Queen ist stark wie ein Yak«,14 pflegte ihr ehemaliger Privatsekretär Lord Charteris zu sagen, und weiter: »Sie schläft gut, sie hat sehr gute Beine, und sie kann lange stehen.« Womit wir wieder bei der einfachen Tatsache wären, dass die Queen es einfach liebt, die Queen zu sein. Anders als die Queen in den Spiel- und Dokumentarfilmen, die sich nach einem ungezwungeneren Leben sehnt, ist die echte Queen in Wahrheit von ihrem Job und ihrer Rolle so erfüllt wie eh und je, während sie ihrem hundertsten Geburtstag entgegensieht.
*
Der offensichtliche Maßstab, an dem Queen Elizabeth II. immer gemessen werden wird, ist der von Victoria: Sie war ebenfalls regierende Königin und neben Elizabeth II. die einzig andere unter den britischen Monarchen, die mehr als sechzig Jahre lang den Thron innehatte. Um sich einen schnellen Überblick über die Unterschiede zwischen den beiden zu verschaffen, reicht ein kleiner Spaziergang durch und um Windsor Castle. Unterhalb des Heinrich-VIII-Tors steht unübersehbar mitten auf der Kreuzung von Castle Hill und High Street in Windsor die herrschaftliche (und gebieterische) Statue der Königin Victoria mit Reichsapfel und Zepter, die zu ihrem Goldenen Thronjubiläum enthüllt wurde. Weniger bekannt ist die Statue zum Goldenen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. im Großen Park von Windsor Castle. Die überlebensgroße Bronzeskulptur des britischen Künstlers Philip Jackson, die erst 2003 enthüllt wurde, zeigt sie Mitte der 1970er-Jahre auf dem Rücken eines nicht näher bezeichneten Pferdes. Dass nur wenige Menschen die Statue zu sehen bekommen, liegt daran, dass die Queen und Prinz Philip, der Duke of Edinburgh und Ranger of Windsor Great Park, gemeinsam beschlossen haben, sie an einer abgelegenen Stelle im Park aufzustellen, die für Besucher nur umständlich über eine kleine Nebenstraße erreichbar ist. Ansonsten führt der Weg über die als Long Walk bekannte Baumallee, von wo aus der Besucher durch die Bäume hindurch das imposante, italianisierte Royal Mausoleum sieht, das Victoria für sich und Albert auf dem Royal Burial Ground von Frogmore, dem privaten Friedhof der königlichen Familie, erbauen ließ. Da sie nicht neben den anderen Monarchen in der St. George’s Chapel begraben werden wollte, ließ Victoria ihren eigenen Grabmalbau aus Marmor und Granit errichten. Elizabeth II. hingegen hat überhaupt nichts dergleichen in Auftrag gegeben, weder für sich selbst noch für Prinz Philip. Vielmehr hat sie seit Langem schon entschieden, dass sie die Ewigkeit einmal in einer kleinen Ecke der königlichen Gruft in der Grabkapelle von Windsor Castle verbringen möchte, die noch nicht einmal ihren Namen trägt – in der St George’s Chapel. Dort, im königlichen Familiengrab, neben ihren Eltern und ihrem Gemahl, will auch sie ihre letzte Ruhe finden. Warum kein prachtvolles Marmorgrab für sich selbst? Als man ihr einmal erzählte, dass ein schottischer Grundbesitzer ein paar Bäume in Form seiner Initialen hatte pflanzen lassen, sagte sie nur: »Wie ordinär.«15
Victoria war von Natur aus resolut, streitlustig gar, hievte einen von ihr favorisierten Kandidaten energisch in das Bischofsamt oder hielt ihrem Premierminister Vorträge über ihre »strikte Abneigung gegen die sogenannten und höchst abwegigen ›Frauenrechte‹.«16 Ganz anders Elizabeth II. Sie ist von Natur aus nicht interventionistisch. Dennoch lässt sie sich nicht unterbuttern. »Wenn es um neue Dinge geht, kann sie sehr viel besser sagen, was ihr daran nicht passt, als wie sie es genau haben möchte. Sie hat ein gutes Gespür«, sagt ihr ehemaliger Pressesprecher Charles Anson. »Sie ist offen für neue Ideen, sofern man ihr überzeugende Argumente dafür bietet, von sich aus vorbringen würde sie aber nie eines.«
Die königliche Grundposition könnte man eher als verhalten vorsichtig bezeichnen denn als risikoscheu. Daher auch der Entschluss der Queen, in der James-Bond-Parodie zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2012 in London mitzuwirken. Risikoscheu wäre eine prompte Absage gewesen, als man ihr antrug, für einen Sketch an der Seite von Schauspieler Daniel Craig alias 007 aufzutreten. Schließlich könnte die Krone vor aller Welt an Würde verlieren. Die Produzenten der Show hatten die Idee zunächst dem Leiter des Londoner Organisationskomitees, Lord Coe, unterbreitet. Er griff die Idee auf und wandte sich damit an die Olympionikin der königlichen Familie, Prinzessin Anne, die ihn ermutigte, sie doch der Queen vorzulegen. Und eigentlich hatten alle in seinem Team mit einer höflichen Absage gerechnet, als sie die Anfrage an das Büro Ihrer Königlichen Majestät sandten. »Lustigerweise war die Sache schnell entschieden, ein echter Schnellschuss«, erklärte Sir Edward Young, damals stellvertretender Privatsekretär von Queen Elizabeth II. »Entweder Ja oder Nein.«17 Und die Queen entschied aus dem Bauch heraus, unter einer Bedingung: dass ihre kleine Sprechrolle, nur ein kleiner Satz, umgeschrieben wird. Anstatt »Guten Abend, James« bestand sie auf »Guten Abend, Mr. Bond«, was sie authentischer fand.18 Ihr gefeierter Auftritt in der James-Bond-Parodie spiegelt sehr schön wider, was der frühere US-Präsident George W. Bush für eine ihrer liebenswertesten Eigenschaften hält: »Ich mag sie, weil sie ihren Job ernst nimmt. Ohne sich selbst dabei allzu ernst zu nehmen.«19 So etwas hat von Queen Victoria niemand je behauptet.
Wären die Höflinge der Viktorianischen Zeit zu Beginn der Regentschaft von Queen Elizabeth II. im Buckingham Palace erwacht, wären ihnen viele Dinge angenehm vertraut gewesen – die gleichen starren Hierarchien, die gleichen sorgsam gehüteten Privilegien, die gleiche Dominanz der Adelsfamilien, die den Palast am Laufen halten, sogar die gleiche Ausstattung der Palastküchen (bis heute verwenden die königlichen Küchenmeister Kupferkochtöpfe mit der Gravur VR). Doch im Verlauf der gegenwärtigen Regentschaft hat es eine gleichsam kulturelle Revolution quer durch den gesamten Hofstaat gegeben. Personalwesen und Gehälter orientieren sich an Industrienormen. Personal wird nach Qualifikation und Erfahrung eingestellt. Diener und Butler haben sich als Berufsbezeichnungen erhalten ebenso wie das »Livree«, der Frack in Rot oder Schwarz (Schwarz kennzeichnet den höheren Dienstrang). Neu allerdings ist, dass viele Frauen darunter sind, nicht wenige mit Universitätsabschluss.
Dennoch ähnelt der Ort in seiner gesamten Struktur immer noch in bemerkenswerter Weise dem Hofstaat unter der Herrschaft von Königin Victoria.
An der Spitze des Britischen Hofes steht der Lord Chamberlain, oft verglichen mit einem nicht geschäftsführenden Vorsitzenden (eine Frau konnte sich für dieses Amt noch nicht durchsetzen). Er wird auf Teilzeitbasis eingestellt, um den gesamten Betrieb zu leiten. Ihm unterstehen die fünf Departments, die die Maschinerie der Monarchie am Laufen halten. Das wichtigste Department unter ihnen ist das Private Secretary’s Office, das sich mit allen verfassungspolitischen und regierungsstaatlichen Angelegenheiten befasst. Die Queen hat stets drei Privatsekretäre (Principal Private Secretary, Deputy Private Secretary und Assistant Private Secretary), sodass rund um die Uhr mindestens einer von ihnen im Dienst und »anwesend« ist. Sie stellen ihr Programm zusammen, befüllen ihre roten Schatullen mit wichtigen Akten und stehen in Verbindung mit den vierzehn weiteren Nationen, deren Staatsoberhaupt sie ist. Und die Privatsekretäre lernen schnell, dass nahezu jeder Routinevorgang seine Berechtigung hat. Einer ihrer ehemaligen Privatsekretäre erinnert sich bis heute beschämt an eine unbedachte Bemerkung zu Beginn seiner Karriere im Palast, als er sich bereit machte, die Queen zu einer Versammlung der königlichen Rechnungsführer zu begleiten: »Es gab einen Empfang für die Commonwealth Auditors’ Association, und ich sagte zur Queen, dass dies doch ziemlich langweilig für sie sein muss. Sie hat mich scharf zurechtgewiesen.«20 Er wurde nicht nur für seine grobe Unhöflichkeit getadelt, sondern auch dafür, das Wesentliche nicht begriffen zu haben. »Die Queen sagte, ›Das ist nicht langweilig. Das ist interessant und wichtig, denn das sind die Leute, die in einigen herausfordernden Ländern die Maßstäbe setzen und die Korruption bekämpfen. Sie brauchen alle Unterstützung und Ermutigung, die sie von mir und dieser Veranstaltung bekommen.‹ Mit anderen Worten, sie sieht die Bedeutung des eigenen Tuns in einem breiteren Zusammenhang.«
Das Household’s Department ist für Beköstigung und Haushaltsführung zuständig. Dazu gehören sämtliche offizielle und private Veranstaltungen, samt Versorgung mit Speisen und Getränken, und zwar nicht nur für die Queen, sondern auch für das kleine Heer all derer, die für sie arbeiten. Vor jeder offiziellen Veranstaltung überprüft die Queen die Arrangements gerne persönlich, einschließlich der Speisekarten (wobei die ihre stets in französischer, die des Prince of Wales in englischer Sprache abgefasst ist) und sogar der Blumen.
Die Queen weiß durchaus um den theatralischen Aspekt der Bewirtung für ein gelungenes Staatsbankett. Als Brigadier Sir Geoffrey Hardy-Roberts, ehemaliger Master of the Household, sich einmal besorgt äußerte, die auf goldenen Tellern servierten Gerichte könnten schneller erkalten, entgegnete sie, die »Leute kommen nicht her, um ein warmes Essen zu bekommen, sondern um von goldenen Tellern zu speisen«.21 Gäste des Staatsbanketts sollten jedoch rasch essen. Das Bedienungspersonal orientiert sich an der Gastgeberin und weist langsam Speisende höflich darauf hin, dass die Königin es nicht mag, wenn man mehr mit Reden denn mit Essen beschäftigt ist. Baroness Trumpington besuchte die Königin nach einer Kabinettsumbildung im Jahr 1985, und das Gespräch kam auf die damalige Premierministerin Margaret Thatcher. »Sie bleibt zu lange und redet zu viel«, klamüserte die Queen. »Sie hat zu viel Zeit unter Männern verbracht.«22
Das Department für die königlichen Finanzen (Royal Finance Department), genannt Privy Purse and Treasurer’s Office (auf Deutsch in etwa die »Königliche Privatschatulle«), wird vom Keeper of the Privy Purse geleitet, dem königlichen Schatzmeister. Königin Victoria und ihre Nachfolger hatten dieses wichtige Amt stets einem ehemaligen Offizier aus dem Armeekorps mit guten Beziehungen anvertraut, 1996 jedoch begann Queen Elizabeth II. die neue Tradition, hierfür einen erfahrenen Buchführer zu beschäftigen.
Im Lord Chamberlain’s Office indes bleibt militärische Expertise weiterhin hochgeschätzt. So gab es vor einigen Jahren den Vorschlag, dieses Department entsprechend umzubenennen. Zum einen, so hieß es, ist es eindeutig nicht das »Büro« des Lord Chamberlain. Vielmehr geht es dort die meiste Zeit um die Organisation und Koordination von Veranstaltungen und Feierlichkeiten, um die Parlamentseröffnung etwa, um Staatsbesuche, Amtseinsetzungen und Ordensverleihungen. Und daher braucht es militärische Präzision und Potenz. Zum anderen wird dieses Department stets von einem hochrangigen ehemaligen Armeeoffizier geleitet. Da der kleine Stab des Departments aber auch royale Beerdigungen und Hochzeiten organisiert, die zeremonielle Leibwache der Queen administriert, royale Geistliche, royale Leibärzte oder den Marshal of the Diplomatic Corps (Verbindungsoffizier der Krone zu den Botschaftern) beruft und sogar die als »Swan Upping« bekannte Zeremonie der traditionellen jährlichen Schwanenzählung auf der Themse durchführt, erwies sich eine sinnvolle Neubenennung als schlicht unmöglich. Das multifunktionale Department behielt also seinen Namen, heißt weiterhin Lord Chamberlain’s Office, und die Queen war froh darüber. Zu diesem Department gehört auch der Königliche Oberstallmeister. Er ist zuständig für sämtliche (bodengebundene) Transportmittel zur Beförderung Ihrer Majestät, einschließlich der Gold State Coach, der Krönungskutsche, die der Queen besonders am Herzen liegt, und die in einer kleinen Ecke der königlichen Stallungen steht, den sogenannten Royal Mews. Die Royal Mews sind weitläufige Hofstallungen hinter dem Buckingham Palace und ein georgianischer Palast für sich. Der prunkvollste Teil ist der in Marmor gefasste Komplex mit Stallungen für die Pferde und darüberliegenden Wohnungen der Stallmeister und Pferdeknechte samt ihren Familien. Hier befindet sich auch die repräsentative Reitschule aus dem 19. Jahrhundert. Besuchertouren führen auch um die Stallungen herum zu einer unscheinbaren Garage im hinteren Teil des Geländes, wo die weniger prunkvollen Karossen untergebracht sind: die Autos der königlichen Familie.
Das fünfte Department, die Royal Collection, ist eine relativ neue Einrichtung. Die Schätze dieser Kunstsammlung sind im Besitz Ihrer Majestät und wurden bis zu ihrer Regentschaft von einer Handvoll Kunsthistorikern verwaltet. 1993 wurde eine Wohlfahrtsorganisation gegründet, um die Royal Collection im Namen der Nation zu bewahren und zu erhalten. Royal Collection Trust verwaltet heute die in dreizehn königlichen Residenzen befindlichen Kunstgegenstände, annähernd eine Million. Dazu gehören Gemälde von Rembrandt und Anthonis van Dyck, Werke von Leonardo da Vinci und Raffael sowie Möbel, Uhren, Wandteppiche, Waffen und abertausende Stücke feinsten Porzellans.
Einige sagen, die Queen sei nicht sonderlich an Kunst interessiert. Dennoch hat ein Leiter der Sammlung sie einmal als große Kuratorin bezeichnet, ähnlich wie Victoria.23 Unter ihrer Ägide ist die Sammlung zugänglicher und sichtbarer geworden. Wechselnde Ausstellungen und gut besuchte Souvenirshops erwirtschaften zweistellige Millionenbeträge, die in die Sammlung reinvestiert werden, die ohne staatliche Subventionen auskommt. Die Queen mag vielleicht keine große Leidenschaft für Opern oder avantgardistische Kunst haben. Aber sie ist dennoch stolz darauf, eine Kunstmäzenin zu sein, auch wenn das eine oder andere nicht ihrem persönlichen Geschmack entspricht. Das Wichtigste dabei ist, dass auch andere die Sammlungen sehen und schätzen können.
Der königliche Haushalt beschäftigt mehr als eintausend Mitarbeiter. Und alle wissen, dass es bei einem Zusammentreffen mit der »Chefin« zwei Fettnäpfchen zu vermeiden gilt – »The Line« (die »Linie« tunlichst nicht überschreiten) und »The Look« (den »Blick« tunlichst nicht erhalten). »Es ist ein vernichtender Blick … er misst dich von oben bis unten, es war schrecklich, als es mich das erste Mal traf«, sagt ein sehr hochrangiger Berater. Auch ein anderer Hofbediensteter im Ruhestand erinnert sich noch gut an den eisigen Blick nach einem kleinen Durcheinander der zeitlichen Abläufe bei einem Staatsbankett. Nach einer Entschuldigung am nächsten Tag war die Sache wieder gut, aber es waren unangenehme vierundzwanzig Stunden gewesen. Auslöser des stummen Tadels können Inkompetenz oder auch Übereifrigkeit sein. Wie Tony Blair in seinen Memoiren schrieb: »Gelegentlich kann sie fast kumpelhaft mit dir sein, aber versuche das ja nicht umgekehrt, sonst trifft dich »›The Look‹«, schrieb Tony Blair in seinen Memoiren.24
Dass sie in ihren geschäftlichen Beziehungen Abstand und Distanz wahrt, mag den Eindruck von Unnahbarkeit erwecken, dient aber als Schutz. Die Queen und ihre Familie wissen, dass jeder ihrer Mitarbeiter früher oder später weiterziehen wird. Der Eindruck von Distanz hat durchaus Vorteile in einer Institution, wo es immer einige gibt, die nach kleinsten Anzeichen persönlicher Bevorzugung spähen. »Eine ihrer größten Gaben war, niemals den Anschein zu erwecken, ein Mitglied des Haushalts lieber zu mögen als ein anderes«, erinnert sich Sir William Heseltine, ehemaliger Privatsekretär der Königin. »Der Hofstaat ist traditionell Brutstätte von Eifersüchteleien und Menschen, die mit Argusaugen darauf lauern, wer favorisiert wird und wer nicht. Nach siebenundzwanzig Jahren im Dienst hatte ich ein gutes Auge dafür, wen sie mochte und wen nicht.«25
Dabei kommt ihr sehr gelegen, dass sie von Natur aus kein gefühlsbetonter Mensch ist, im Unterschied zum Großteil ihrer Familie, einschließlich ihrer Eltern. »Wenn man neben Queen Mum saß, konnte man sie binnen Sekunden dazu bringen, über de Gaulle zu plaudern«, sagt ein ehemaliger Hofbediensteter. »Sie liebte es, in Erinnerungen zu schwelgen.« Nicht so die Queen. »Sie lebt im Hier und Heute, ergeht sich gelegentlich in Erinnerungen, wenn es ihr angebracht scheint, aber nicht stets und ständig«, sagt ein ehemaliger hochrangiger Berater. Darin liegt ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen Elizabeth II. und Victoria. Letztere liebte es, in nostalgischen Erinnerungen zu schwelgen, sich mit Günstlingen zu umgeben und, in vorgerücktem Alter, die Vergangenheit Stück für Stück zu konservieren. Die heutige Queen bevorzugt den Weg nach vorne. Während viele aus ihrer Familie, einschließlich Prinz Charles, romantische Seelen sind, ist die Queen eine Realistin.
Aber natürlich versteht sie, dass die Leute hören wollen, wie sie als Kind zur Teestunde den Geschichten von J. M. Barrie gelauscht hat,26 mit Churchill zusammengearbeitet hat, der englischen Fußballnationalmannschaft den WM-Pokal überreicht hat, den ersten Menschen auf dem Mond getroffen hat und den ersten Bezwinger des Mount Everest, Sir Edmund Hillary, geehrt hat. Auf Anfrage teilt sie ihre Erinnerungen gerne.
Ein ehemaliger hochrangiger Politiker sagt, die Queen habe sich stets auf das gerade anstehende Thema konzentriert, während er selbst immer versucht habe, im Gespräch den Rückwärtsgang einzulegen, in der Hoffnung, ihr eine weitere Anekdote entlocken zu können. »Manchmal konnte man sie dazu bringen, über die Vergangenheit zu sprechen und ein paar trockene Bemerkungen über diesen oder jenes zu machen«, sagt er. »Aber man musste das Gespräch definitiv darauf hinlenken. Wollte ich herausfinden, was sie von Margaret Thatcher oder Richard Nixon hält, oder von sonst irgendwem, der mir gerade einfiel, musste ich es geschickt einfädeln und so was sagen wie ›Oh, so was Ähnliches ist auch Premier Heath passiert‹, nur um ihre Sicht darauf zu hören.«27
»Sie wurde schon oft auf die Probe gestellt und ist aus jeder Krise gestärkt hervorgegangen, und so hat sie eine wirklich weit gespannte Sicht der Dinge«, sagt Präsident George W. Bush. »Wenn man es mit jemandem zu tun hat, der in der Vergangenheit verhaftet ist, kann das sehr ermüdend sein. Das Schöne bei ihr aber ist, dass sie im Hier und Heute lebt.«28
Das ist der Grund, warum die Queen im Gegensatz zu anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zeitlos ist, und dies umso mehr in ihren späteren Jahren. Sie mag gealtert sein wie jeder andere auch, aber selbst nach sieben Jahrzehnten Regentschaft ist sie nicht aus der Zeit gefallen. Für künftige Historiker wird sie ein Faszinosum sein. Wie schon ihr Vater und Großvater vor ihr wurde auch sie nicht geboren, um einmal auf dem Thron zu sitzen. George V. trat erst nach dem Tod seines älteren Bruders im Jahr 1892 in die direkte Linie der Thronfolge ein. Bis zur Abdankung Edwards VIII. war für George VI., den jüngeren Sohn, nur eine Nebenrolle auf Lebenszeit an der königlichen Peripherie vorgesehen. Auch als Elizabeth die Thronfolge antrat, sah sie sich mit einer außerordentlichen Aufgabe konfrontiert, wie noch kein neu gekröntes Haupt je zuvor: den Niedergang des British Empire zu verwalten. Ihre fünf Vorgänger trugen allesamt zusätzlich den Kaisertitel, Emperor oder Empress of India.
Und schon seit viel längerer Zeit war von allen Monarchen erwartet worden, dass sie expandieren, erobern oder zumindest ihr Territorium verteidigen. Die neue Queen jedoch wurde gekrönt im Wissen und der Erwartung, dass sie ihr Hoheitsgebiet schrumpfen lassen würde; dass sie entgegen der ausgerufenen Losung in der Nationalhymne »Land of Hope and Glory« (»Land der Hoffnung und des Ruhmes«) handeln würde: »Weiter noch und weiter sollen Deine Grenzen ausgedehnt werden.« Und es ist (bis heute) ihre Pflicht, Macht abzutreten und Souveränität mit einem Lächeln und einem freundlichen Händedruck zu übergeben.
Zu Beginn ihrer Regentschaft wurde noch von ihr erwartet, dass sie ihre Premierminister persönlich auswählt oder dass sie über die Auflösung des Parlaments entscheidet. Doch damit ist jetzt Schluss.
Auf dem Papier zumindest mag dies wie ein langer, schrittweiser Rückzug an allen Fronten erscheinen. Und auf der Leinwand wie eine lange Abfolge von Krisen und Rückschlägen. Beides mag stimmen. Doch wird man über all jene, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis hinein ins 21. Jahrhundert gelebt haben, einmal sagen, sie haben unter einer der wirklich Großen gelebt.
1 Interview mit dem Autor.
2 Ben Rhodes, The World As It Is (Bodley Head, 2018), S. 150.
3 Interview mit dem Autor. Michelle Obama, Becoming (Penguin, 2021), S. 318.
4 Michelle Obama, Becoming (Penguin, 2021), S. 318.
5 Ibid., S. 421.
6 Interview mit dem Autor.
7 Graham Turner, Elizabeth: The Woman and the Queen (Macmillan, 2002), S. 15.
8 Guardian, 1. September 2015.
9 Mail Online, zitierend Radio Times, 1. September 2015.
10 Interview mit dem Autor.
11 Interview mit dem Autor.
12 Daily Telegraph, 5. November 2004.
13 Interview mit dem Autor.
14 Turner, S. 195.
15 Private Unterhaltung.
16 A. N. Wilson, Victoria: A Life (Atlantic, 2015) S. 334, zitierend Gladstone-Aufsätze.
17 Our Queen, ITV, 2013.
18 Angela Kelly, The Other Side of the Coin (HarperCollins, 2019), S. 168.
19 Interview mit dem Autor.
20 Vertrauliches Gespräch.
21 Kenneth Rose, The Journals, Vol. II (Weidenfeld & Nicolson, 2019), S. 150.
22 Ibid., S. 163.
23 Robert Hardman, Our Queen (Arrow, 2012), S. 260.
24 Tony Blair, A Journey (Hutchinson, 2010), S. 563.
25 Interview mit dem Autor.
26 Bei einem Besuch zum Tee in Glamis Castle saß der Schöpfer von Peter Pan, J. M. Barrie, neben Prinzessin Margaret und fragte sie, ob der Keks auf dem Teller ihr gehöre oder ihm. »Er gehört dir und mir«, antwortete Margaret. Und wie sowohl Marion Crawford als auch Kenneth Rose später geschrieben haben, baute Barrie diese Zeile später in sein Stück The Boy David ein und versprach der Prinzessin einen Penny für jede Aufführung. Die »Tantiemen« wurden nach Barries Tod im Jahr 1937 ordnungsgemäß ausgezahlt.
27 Interview mit dem Autor.
28 Interview mit dem Autor.
TEIL I
PRINZESSIN
Kapitel 1
1926 – 1936
»Catching Happy Days«
Am 26. Januar 1926 drängten vierzig Wissenschaftler und eine Handvoll Journalisten in der Frith Street im Londoner West End in eine Dachbodenwerkstatt, um zuzuschauen, wie ein Laufbursche namens William Taynton auf einem Bildschirm Grimassen schnitt. Die britische Tageszeitung The Times schrieb später, das Bild sei »schwach und oft verschwommen« gewesen. Nichtsdestotrotz, es war ein Meilenstein des 20. Jahrhunderts. »Es ist möglich«, hieß es in dem Artikel weiter, »die Einzelheiten von Bewegungen unmittelbar zu übertragen und sofort wiederzugeben«. Die kleine Runde war gerade Zeuge der Geburt des Fernsehers geworden, des »Televisors«, wie der schottische Erfinder und Elektroingenieur John Logie Baird das erste mechanische Fernsehgerät nannte.29
Drei Monate später, keine Meile von dort entfernt, gab es einen ähnlich historischen Moment – einen, der ebenfalls bis heute Nachhall findet. In den frühen Morgenstunden des 21. April, einem Mittwoch, erblickte eine Prinzessin das Licht der Welt. Dass die erste Monarchin des Fernsehzeitalters zur gleichen Zeit geboren wurde wie das Medium, durch das sie der ganzen Welt bekannt werden würde, mag aus heutiger Sicht recht passend scheinen. Gleichwohl verkörpert sie auf ihre ganz eigene Weise Dauerhaftigkeit und Konstanz über alle zeitlichen Veränderungen und Epochen hinweg. Sie steht für eine ganze Nation, die das Trauma der erlittenen Verluste im Ersten Weltkrieg noch nicht verwunden hatte. Die Hälfte der Bevölkerung war noch unter der Herrschaft von Königin Victoria geboren worden (deren Sohn Arthur, Duke of Connaught and Strethearn, einer der Taufpaten des neugeborenen Babys sein würde). In Alabama stand die autobiografische Geschichte von Cudjoe Lewis, dem letzten bekannten Überlebenden, der auf dem letzten Sklavenschiff aus Afrika in die Vereinigten Staaten verschleppt worden war, kurz vor der Veröffentlichung im Journal of American Folklore. So sah die Welt aus, in die Princess Elizabeth Alexandra Mary of Kent hineingeboren wurde.
Ihre Mutter, die Duchess of York, hatte sich sehnlichst eine Tochter gewünscht. Und auch ihr Vater, Prinz Albert, seinerzeit Duke of York, war überglücklich. »Ihr ahnt gar nicht, welch große Freude die Geburt unserer kleinen Tochter für Elizabeth und mich ist«, schrieb er an seine Mutter, Queen Mary.30
Das neugeborene Mädchen stand an dritter Stelle der britischen Thronfolge, und wohl kaum jemand rechnete damit, dass sie den Thron jemals besteigen würde. Auf König George V. würde zunächst ihr Onkel Edward folgen, der Prince of Wales, genannt »David«, der damals begehrteste Junggeselle der Welt. Und der wiederum würde eines Tages eine eigene Familie gründen, so die allgemeine Annahme. Wer jedoch den echten David kannte, seinen ausschweifenden Lebensstil, seinen Hang zu Affären mit verheirateten Frauen, dem dürfte klar gewesen sein, dass er wohl nie einen Erben hervorbringen würde. Und selbst dann konnte man davon ausgehen, dass der nächstjüngere seiner drei Brüder, »Bertie«, der Duke of York, mehrere Kinder haben würde, darunter bestimmt auch einen Sohn, der sich in der Erbfolge vor seine Schwester schieben würde.
Doch wer die Geschichte kennt, der weiß auch, dass King George III. fünfzehn Kinder hatte, es am Ende aber die älteste Tochter eines seiner jüngeren Söhne war, die einmal als Retterin der Monarchie den Thron bestieg. »Ich habe das Gefühl, dieses Kind wird Königin von England und vielleicht der letzte Souverän«, notierte der Tagebuchschreiber Chips Channon, als er die traditionellen königlichen Salutschüsse für das neugeborene Mädchen aus dem Hause York hörte.31
Ein ähnlicher Gedanke würde König George V. zu gegebener Zeit auch kommen. Vorerst aber konnten der König und die königliche Familie sich an der Geburt einer kleinen Prinzessin inmitten einer schweren nationalen Krise erfreuen: Der Kohleabbau war nicht nur für die Produktion im Inland und im Empire von entscheidender Bedeutung, sondern beschäftigte auch mehr Menschen als jeder andere Industriezweig in Großbritannien. Angesichts rückläufiger Produktionsleistungen und billiger Konkurrenz aus Übersee planten die Kohlegrubenbesitzer niedrigere Löhne und längere Arbeitszeiten. Eine eigens für diesen Industriezweig eingesetzte Königliche Kommission war zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Der Gewerkschaftsverband Trades Union Congress (TUC) beschloss, dass es an der Zeit war, zugunsten der Bergleute das gesamte System herauszufordern, und rief für den 3. Mai 1926, eine Minute vor Mitternacht, zu einem Generalstreik auf, der die gesamte industrielle Produktion und Fördertechnik zum Stillstand brachte.
Durch die heutige Brille betrachtet, übersieht man leicht die schiere Panik der britischen Mittel- und Oberschicht zur damaligen Zeit. Seit der Bolschewistischen Revolution und Hinrichtung der russischen Zarenfamilie durch die Bolschewiki waren noch keine zehn Jahre vergangen. Und die Sowjetunion war gerade mal vier Jahre alt. Könnte Großbritannien nun das Gleiche bevorstehen? Als Zeitungen wie die Daily Mail vor einer bevorstehenden Revolution warnten, stellten die Druckereien die Druckpressen ab. Der unverhohlene revolutionäre Eifer einiger Gewerkschaftsaktivisten war so groß, dass die Führung der Labour Party (Arbeiterpartei) sich weigerte, den Streik zu unterstützen. Der König war sich durchaus bewusst, dass ein Funke der Konfrontation genügte, um katastrophale Unruhen zu entfachen. »Versuchen Sie doch selbst einmal, von den Löhnen der Bergleute zu leben, bevor Sie über sie richten«, lautete seine scharfe Replik an den Grubenbesitzer Earl of Durham.32 Und er drängte den konservativen Premierminister Stanley Baldwin, aggressive Maßnahmen gegen Gewerkschaftsführer oder deren Gelder zu vermeiden. Und weil alle Seiten einen kühlen Kopf bewahrten, brach der TUC den Streik nach gut einer Woche ab und ließ den schwer gebeutelten Bergleuten keine andere Wahl, als monatelang allein (und vergeblich) weiterzukämpfen. »Vom Streik der letzten neun Tage waren vier Millionen Menschen betroffen, doch es fiel kein einziger Schuss und niemand wurde getötet«, schrieb der König in privaten Aufzeichnungen. »Dies zeigt, was für ein großartiges Volk wir sind.«33
Die daraus resultierende Bitterkeit aufseiten der politischen Linken und in den Bergbaurevieren in ganz Großbritannien wirkten über Generationen hinweg nach, wie der royale Neuzuwachs noch selbst erfahren sollte. Wohl aber hatte der Abzug des Sturms einen ungleich fröhlicheren Rahmen für die Taufe am 29. Mai 1926 im Buckingham-Palast geschaffen. Dort, im Beisein des Königspaares und der ausgewählten Taufpaten, heulte sich die kleine Elizabeth die Augen aus und musste mit Dillwasser beruhigt werden. »Es war das letzte Mal, dass Elizabeth in aller Öffentlichkeit eine Szene machte«, schrieb Sarah Bradford, eine ihrer späteren Biografinnen.34
Elizabeth war erst drei Monate alt, als verlautbart wurde, dass ihre Eltern, Duke und Duchess of York, zu einer großen Überseereise nach Neuseeland und Australien aufbrechen würden. Die neuen Parlamentsgebäude in Australiens Hauptstadt Canberra sollten offiziell eröffnet werden. Und da Edward, der Prince of Wales, gerade erst von einer Weltreise zurückgekehrt war, übernahm Elizabeths Vater, der Duke of York, diese Aufgabe. Für ihn war es eine wichtige Bewährungsprobe: Seit seiner Kindheit litt er an einer Sprachstörung. Er war Stotterer, was ihm öffentliche Redeauftritte zur Qual machte, schlaflose Nächte und lange im Vorfeld große Angst bereitete. Nichtsdestotrotz gehörte das Redehalten zu den royalen Pflichten, und von allen Kindern, die George V. hatte, war der Duke of York das pflichteifrigste. Im Oktober 1926 hatte es ein erstes Treffen mit dem australischen Sprachtherapeuten Lionel Logue gegeben. Logues Arbeit mit seinem königlichen Patienten zeigte schon bald Erfolge (und diente als Vorlage für den Film The King’s Speech, Die Rede des Königs 2010). Plötzlich scheute der Duke die Reise nach Australien nicht mehr, er freute sich vielmehr darauf.35 Die Duchess hingegen tat sich schwer damit, ihre Tochter zurückzulassen, empfand die Abreise als geradezu qualvoll. »Die Kleine spielte so süß mit den Knöpfen an Berties Uniform, dass es mir schier das Herz brach«, schrieb sie an Queen Mary, kaum dass das Schiff im Januar 1927 abgelegt hatte. Es war ihre bislang härteste Prüfung auf der Kehrseite der königlichen Medaille.
Die Abwesenheit des herzoglichen Paares hatte aber auch etwas Positives. Elizabeth blieb in der Obhut ihrer Großeltern väterlicherseits, die sie abgöttisch liebten. Die gestrenge Queen Mary, die höchst selten eine weiche Seite zeigte, war hingerissen von diesem »süßen kleinen Wesen mit der holden Gesichtsfarbe und dem bezaubernden hellen Haar«.36 Und ihr ruppiger Gemahl, König-Kaiser George V., war ebenfalls völlig vernarrt. Zu seinen eigenen Kindern hingegen hatte er ein eher distanziertes und sehr angespanntes Verhältnis, wie zahlreiche Historiker beschreiben. Sie waren in York Cottage aufgewachsen, einem bescheidenen, unattraktiven Landsitz auf dem Anwesen in Sandringham. In den ersten Jahren wurden sie in die Hände eines sadistischen Kindermädchens gegeben, das David malträtierte und zwickte, bis er vor den Augen seiner Eltern in Tränen ausbrach, während Bertie »in einem Maße ignoriert wurde, dass man es fast schon als Vernachlässigung bezeichnen konnte«.37 Das schweißte die beiden älteren Brüdern und ihre Schwester, Prinzessin Mary, fest zusammen. Im Laufe der Zeit, als jüngere Geschwister hinzukamen, herrschten dann weniger autoritäre Erziehungsmethoden, doch die Angst vor ihrem Vater blieb ihnen ein Leben lang. Princess Elizabeth hingegen konnte nichts verkehrt machen. »Da ist es ja, das kleine Kindchen!«, rief Queen Mary jeden Tag hocherfreut, wenn man ihr die Kleine brachte, während der König den abwesenden Eltern jeden durchstoßenden Milchzahn stolz vermeldete.38
Diese besonders innige Beziehung Elizabeths zu ihrem Großvater sollte sich fortsetzen, auch als ihre Eltern längst wieder von ihrer Reise zurück waren (auf der sie gut drei Tonnen Spielzeug für ihre kleine Tochter geschenkt bekommen hatten).39 Als der König 1928 ins südenglische Seebad Bognor geschickt wurde, um sich dort von einer schweren Lungenoperation zu erholen, empfahlen ihm die Ärzte zur schnelleren Genesung die Gesellschaft seiner Enkelin. Er hatte seine helle Freude daran, ihr beim Sandburgenbauen zuzuschauen. Und ihr Großvater war es auch, der seiner kleinen Prinzessin zum vierten Geburtstag ihr erstes Pony schenkte, ein Shetland-Pony namens Peggy, und damit eine lebenslange Leidenschaft entfachte. Obwohl ihre Eltern sehr darauf aus waren, sie nicht zu verwöhnen, hatten auch sie gerne ihren Spaß mit ihr. Eines Tages, auf Schloss Windsor, war sie hellauf begeistert, als der Wachoffizier auf ihren Kinderwagen zumarschierte und fragte: »Haben wir die Erlaubnis Ihrer Königlichen Hoheit wegtreten zu dürfen?« »Aber ja!« antwortete sie und fügte hinzu: »Hat Lilibet das nicht schön laut gesagt?«40
Von ihrem Großvater, König George V., soll auch ihr Kosename stammen, den sie in der Familie behalten sollte. Andere wiederum sagen, dass »Lilibet« aus »Tillabet«41 entstand, wie sie sich selbst als kleines Mädchen nannte, da sie ihren Vornamen nicht richtig aussprechen konnte – so oder so, »Lilibet« blieb haften.
Mit der Geburt ihrer Schwester Margaret am 21. August 1930 endete die bis dahin konkurrenzlose Zuwendung, die sie seitens ihrer Familie erfahren hatte. Die Duchess of York hatte ihre zweite Tochter auf Glamis Castle zur Welt bringen wollen, dem schottischen Wohnsitz ihres Vaters, des Earl of Strathmore, und der Familie Bowes-Lyon seit dem 14. Jahrhundert. Dort, in der berühmten, märchengleichen Festung inmitten der fruchtbaren, bewaldeten Talebene von Strathmore nördlich der Stadt Dundee, hatte sie eine glückliche Kindheit verbracht.
Zum ersten Mal seit mehr als drei Jahrhunderten war ein Kind in direkter Erbfolge nördlich der englischen Grenze geboren worden, was in Schottland sicherlich sehr gut ankam. Aber es war auch ein offenes Geheimnis, dass die Yorks (wie auch der Rest der Familie) auf einen Jungen gehofft hatten. Und dem Volk schwante allmählich, dass es bei einem Altersabstand von vier Jahren zwischen den beiden Prinzessinnen vielleicht nie einen Sohn und männlichen Thronerben geben würde. Im darauffolgenden Jahr, im Februar 1931, wurde erstmals ein großes Stück dieser Erde nach der kleinen Elizabeth benannt – das Princess-Elizabeth-Land auf dem Kontinent Antarktika (ein zweites, knapp 440000 km2 großes Gebiet kam zu Ehren ihres diamantenen Thronjubiläums hinzu und erhielt den Namen Queen-Elizabeth Land). Ein Jahr danach, 1931, erschien sie, im Rüschenkleidchen und mit einem Spielzeug in der Hand, erstmals auf einer Briefmarke, auf der 6-Cent-Marke im Ausgabegebiet Neufundland, das bis 1948 unter kolonialer Verwaltung stand.
Die sich langsam verändernde öffentliche Wahrnehmung der königlichen Familie machte umso deutlicher, dass Edward, Prince of Wales immer noch weit entfernt davon war, sich eine Frau zu nehmen. Im Gegenteil, sein berüchtigter Lebensstil als ewiger Playboy der Nation hatte im Königshaus schon lange für Verzweiflung gesorgt.
Als er 1928 auf seiner Afrikareise erfuhr, dass der König ernsthaft erkrankt sei und er umgehend die Heimreise antreten solle, zeigte er sich unbeeindruckt. »Ich glaube kein Wort davon«, sagte er zu seinem Privatsekretär Sir Alan »Tommy« Lascelles, der entsetzt darüber war und dies auch nicht verhehlte. »Er sah mich an«, schrieb Lascelles später, »ging wortlos hinaus und verbrachte den Rest des Abends mit der von Erfolg gekrönten Verführung einer Mrs. Barnes, Gattin des örtlichen Polizeichefs, wie er mir am nächsten Morgen selbst erzählte.«42 Zurück in London suchte Lascelles das Gespräch mit seinem Dienstherrn, dem Prince of Wales, und hielt ihm dessen Verhalten vor. Dies würde ihn, so warnte er den Prinzen, »den Thron von England kosten.« Lascelles quittierte daraufhin den Dienst, und der Prinz bemerkte: »Ich denke mal, Tatsache ist, dass ich definitiv der Falsche bin, um Prince of Wales zu sein.« So beliebt Edward auch war, frei von Selbstzweifeln war er nicht.43
Das Leben im Hause York ging derweil seinen glücklichen und geordneten Gang. Laut der vom Palast autorisierten Erzählung »The Story of Princess Elizabeth« von 193044 aus der Feder des Kindermädchens Anne Ring hatte Princess Elizabeth ihre kleine Konkurrenz im royalen Kinderzimmer freudig begrüßt. »Ich bin vier und habe eine kleine Schwester bekommen, Margaret Rose, aber ich werde sie Bud nennen [kleine Knospe]«, erzählte die Prinzessin einem Besucher. »Wieso denn Bud?« »Nun ja«, sinnierte sie, »eine richtige Rose ist sie ja noch nicht. Erst mal nur eine kleine Knospe.«
Nach ihrer Rückkehr aus Australien waren der Duke und die Duchess mit der kleinen Elizabeth umgezogen, in die Piccadilly Street 145, nahe Hyde Park Corner. Das Kinderzimmer war das unangefochtene Reich von Clara Knight. Sie war das Inbild einer klassischen britischen Nanny, ein und derselben Familie auf Lebenszeit verbunden, ohne sich jemals zu beschweren, scheinbar nie ohne ihre Dienstkleidung oder außer Dienst, mit der ehrenden Anredeform »Mrs.« (obwohl zeitlebens unverheiratet). Für ihre beiden Schützlinge war und blieb sie »Alah« (oder »Ahla« oder »Allah«) – eine kindliche Verballhornung ihres Vornamens Clara. »Sie war um einiges königlicher als ihre jungen Königseltern«, erinnerte sich später Marion Crawford, eine Gouvernante der Prinzessinnen.45 Neben Alah gab es noch ein weiteres Kindermädchen, eine ebenso loyale, rothaarige schottische Eisenbahnertochter namens Margaret MacDonald, die die Prinzessinnen »Bobo« nannten.
Mit der Ankunft der kleinen Prinzessin Margaret teilten sich die beiden Kindermädchen auf, Alah nahm sich der jüngeren Margaret an, während Bobo sich mit Elizabeth beschäftigte. Die enge Verbundenheit der beiden blieb fast siebzig Jahre lang bestehen, bis zu Bobos Tod im Jahr 1993.
Im Unterschied zu vielen Kindern ihrer Generation und ihres Standes sahen die beiden Prinzessinnen ihre Eltern sehr viel öfter als nur vor dem abendlichen Schlafengehen. Jeden Morgen (bis zum Tag der Hochzeit von Princess Elizabeth) begannen die Mädchen den Tag mit einem Besuch des elterlichen Schlafzimmers, um zusammen »herumzualbern«, wie Marion Crawford es nannte.46 Es ist bezeichnend, dass im Speisesaal des Hauses, der nach vorne raus auf den Piccadilly Circus ging, kein Gemälde eines alten Meisters und auch kein Porträt eines Ahnen hing. Nein, den Ehrenplatz bekam ein bezauberndes Porträtgemälde von Edmond Brock, auf dem die dreijährige Princess Elizabeth mit einem Hund zu sehen ist.47 Es ist bis heute in der Familie geblieben (nicht Teil der Königlichen Sammlung) und findet sich als eines ihrer persönlichen Lieblingsbilder in einer privaten Ecke des Buckingham Palace.
1931 überließ der König den Yorks die Royal Lodge im Windsor Great Park als Landhaus. Das »Cottage« (die Hütte), wie er den einstigen Zierbau nannte, musste von Grund auf erneuert werden. Bald aber wurde es zu einem vielgeliebten Rückzugsort und blieb das Zuhause der Duchess of York (der späteren Queen Mum) bis ans Ende ihres langen Lebens. Der Duke entdeckte seine Leidenschaft fürs Gärtnern und spannte am Wochenende Familie, Personal und sogar seinen Privatdetektiv ein, um quer durch das große Gelände mit anzupacken.48 Einen Grund mehr, diesen Ort zu lieben, bekamen die kleinen Mädchen an Elizabeths sechstem Geburtstag, als das walisische Volk ihrer Prinzessin ein ganz besonderes Geschenk machte: ein zweistöckiges, reetgedecktes Puppenhaus in Kindergröße. Das kleine Häuschen, »Y Bwthyn Bach« genannt, war nicht bloß ein Spielhaus, sondern ein wahres Kunstwerk, so außergewöhnlich wie Queen Marys »Puppenhaus«.49 Neben Strom und sanitären Anlagen gab es darin ein funktionierendes Radio, eine Miniatur-Gesamtausgabe der englischen Kinderbuchautorin Beatrix Potter, ein Ölgemälde mit dem Bildnis der Duchess of York, personalisierte Bettwäsche, ein Schiff mit Elizabeths Wappen auf dem Pergamentsegel sowie eine liliputanische Schenkungsurkunde des Lord Mayor of Cardiff an »HRH Princess Elizabeth of York, nachstehend ›Beschenkte‹ genannt«.50
In der realen Welt jenseits dieses märchenhaften Gartens war der König einmal mehr in Angst und Sorge. Beim Blick ins Ausland sah er eine weltweite Wirtschaftskrise, Chaos auf den Märkten und den Aufstieg von Diktatoren. Zu Hause, im eigenen Land, gab es wachsende Arbeitslosigkeit, ein Ansturm auf das Pfund und eine Spaltung innerhalb der Labour-Minderheitsregierung. George V. sah sich daher veranlasst einzugreifen, was heute kaum vorstellbar wäre. Denn es war der Monarch höchstselbst, der eine parteiübergreifende Koalition mit sanftem Druck dazu brachte, eine »nationale« Regierung unter Labour-Parteiführer James Ramsay MacDonald zu bilden – der daraufhin rasch aus der eigenen Partei ausgeschlossen wurde. Der König verteidigte sein Vorgehen später mit der Begründung, es habe sich um einen nationalen Notstand gehandelt. Der Rechts- und Verfassungshistoriker Professor Vernon Bogdanor allerdings glaubt, dass der König damit seine Befugnisse überschritten habe. »Obwohl die Märkte sich prächtig entwickelten, war die nationale Regierung nicht wirklich national, da die Labour Party sie nicht unterstützte«, argumentiert er. Der König habe daher Partei ergriffen.51 Andere beharrten, er sei im Recht gewesen. In seiner Studie über die konstitutionelle Monarchie legt Charles Douglas-Home (ehemaliger Redakteur der Times) dar, dass Großbritannien nur wenige Stunden vom Staatsbankrott entfernt gewesen sei: »Der König hat nichts weiter getan, als seinen Einfluss geltend zu machen, indem er Politikern, die in einer Angelegenheit, in der sie im Alleingang vielleicht unentschlossen gewesen wären, eine klare und geradlinige Orientierung brauchten, Unterstützung und Rat (apodiktischen Rat vielleicht) bot.52
In der Öffentlichkeit war der König bestrebt, das Bild von einer Familie zu zeichnen, die mit Hingabe ihre Pflichten wahrnimmt. Aus Sandringham hielt er Ende 1932 die erste Weihnachtsansprache an die Nation. Die Worte stammten aus der Feder von Rudyard Kipling und vermittelten eher den Eindruck einer ungezwungenen Plauderei vor dem Kamin und weniger einer steifen Ansprache an das Empire. »Allen Männern und Frauen, so abgeschnitten von Schnee, Wüste oder dem Meer, dass nur Stimmen aus der Luft sie erreichen können (…)« – mit diesen Worten begann der König seine Rede. Die Übertragung war wie heute noch für 15.00 Uhr angesetzt – die beste Sendezeit, um die meisten Menschen in den Ländern des Empire zu erreichen.
Am darauffolgenden Osterfest erschien ein neues Gesicht im königlichen Kinderzimmer. Die Yorks hatten beschlossen, dass es an der Zeit sei, mit der schulischen Ausbildung ihrer Töchter zu beginnen. Man hatte ihnen eine Gouvernante empfohlen, die das Ausbildungsseminar für Lehrerinnen gerade erst absolviert hatte. Marion Crawford, so ihr Name, hatte zuvor für Freunde der Familie gearbeitet und eine der Schwestern der Duchess schwer beeindruckt. Und sie hatte noch viele weitere Eigenschaften, die den Yorks gefielen: Sie sprach mit den Kindern auf Augenhöhe und stammte aus Schottland, das höchste Gütesiegel in Sachen Erziehung von Königskindern. Auch die Tatsache, dass sie erst dreiundzwanzig Jahre alt war, sprach für sie, zumal der Duke selbst in seiner Kindheit unter etlichen älteren Hauslehrern zu leiden gehabt hatte. »Er wollte jemanden, der jung und dynamisch ist«, wie Marion Crawford es später einmal formulierte.53 Die neue Gouvernante kam im Frühjahr 1933 für einen Monat auf Probe, wurde kurzum in »Crawfie« umbenannt und blieb ganze siebzehn Jahre. Sie kannte alle königlichen Geheimnisse, vom Kindergarten- bis ins Erwachsenenalter, und sie wahrte sie, bis sie mit dem Angebot auf ein lebenslanges Wohnrecht im Kensington Palace in den Ruhestand eintrat. Ab diesem Zeitpunkt jedoch wurde ihr Name zum Synonym für schamlose Indiskretion, als sie ihre Memoiren in ihrem Buch The Little Princesses niederschrieb.
Mit der neuen Gouvernante hielt bald auch ein gewisser Ernst Einzug ins Kinderzimmer, wo es dank Alah und Bobo immer fröhlich zuging, wie Crawford bemerkte: Princess Elizabeth ritt auf imaginären Ponys (und alle, ob Crawfie oder der König, mussten das Pferdchen spielen). Sie mochte es, alles sauber und ordentlich zu halten und spielte gerne mit Kehrschaufel und Besen, einem Weihnachtsgeschenk von Queen Marys Hofdame, der Countess of Airlie.54 Von klein auf sollten den Prinzessinnen Sparsamkeit und Genügsamkeit anerzogen werden. Sie hatten sogar eine spezielle Schachtel, um darin Geschenkpapiere und Bänder zur Wiederverwendung aufzubewahren.55
Crawfies Aufgabe bestand darin, die Mädchen zum Lernen zu erziehen: Der Stundenplan für Elizabeth wurde von Queen Mary sorgfältig geprüft, die sehr viel Wert auf ausreichend Stunden in Mathematik und Geschichte legte. Die sehr an Ahnenforschung interessierte Mary, die ihre Familienstammbäume ebenso eifrig studierte wie der König seine Briefmarkenalben, hatte darauf bestanden, dass Genealogie »für Kinder hochinteressant« sei. Erleichtert war Crawfie jedoch darüber, dass ihr Französisch erspart blieb. Dafür hatten die Yorks eine extra Lehrerin eingestellt, die Elizabeth allerdings gar nicht passte. »Eines Tages drangen merkwürdige Geräusche aus dem Schulzimmer«, erinnerte sich Crawfie. Sie ging hinein und sah, dass sich Lilibet »vor lauter Langeweile« ein volles Tintenfass über den Kopf geleert hatte.56 Als schließlich auch Margaret dem Kinderwagen entwachsen war, gesellte sie sich zu ihrer Schwester ins Schulzimmer. Auch Ausflüge standen auf dem Lehrplan, wie etwa eine Fahrt mit der Londoner U-Bahn. Zwei klar definierte Charaktere begannen sich herauszubilden: Elizabeth, das fleißige und gehorsame Kind, das sich stets schützend vor ihre kleine Schwester Margaret stellte, die frech und schlagfertig war, stets nach Aufmerksamkeit heischte und einen imaginären Freund namens »Cousin Halifax« hatte. Für gewöhnlich verstanden sie sich gut, hatten aber, wie alle Geschwister, ihre kleinen Reibereien und balgten sich auch mal. Und auch hier, so Crawfie, zeigte sich, wie grundverschieden und doch unzertrennlich sie waren: Elizabeth setzte »blitzschnell einen linken Haken«, während Margaret eher zubiss.57