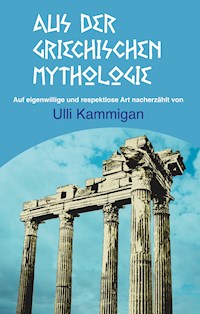7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ulli Kammigan wird 1943 in der Nähe Hamburgs geboren. Seit 1949 lebt er mit einigen Unterbrechungen in Niendorf, einem Stadtteil im Nordwesten Hamburgs. Er erlebt hier eine Kindheit am Rande des ehemaligen Ohemoores, die mit großer Armut verbunden ist, die er aber voller Lebensfreude mit Humor und einem Schuss Ironie und Sarkasmus schildert. Auf die gleiche Art beschreibt er die Veränderungen des Stadtteils. Er studiert in Hamburg Mathematik und Erziehungswissenschaften und wird Lehrer für Mathematik, Physik, Sport und Schwimmen an einer Hamburger Gesamtschule, heute Stadtteilschule.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Unser Haus im Ohmoor 43 in den 60er-Jahren (im Hintergrund: das kleine Häuschen von Oma Christine)
Inhalt
Vorwort zur erweiterten Auflage
Else und Paul
Oma Christine
Die Pantherbande
Mädchen sind die besseren Menschen
Onkel Bert
Asyl für Ursel
Die neue Klasse
Freunde fürs Leben
In der Schule tut sich etwas
Beruf und Berufung
Die kleinen Französinnen
Das Busmuckel
Aufbruch zu neuen Ufern
Die Hausfreundin
Mit fünfzig um die Häuser
Nicht Tristan – sondern Tanzen und Isolde
Julius Leber und nichts anderes
Nachruf auf Else
Bandscheiben-Marathon
Karibik, Kanada und das Kreuz des Südens
Krishna, Kängurus und Krokodile
Die H-A-N-F-Reise
Nachwort (2019) – Da waren’s nur noch drei
Mein Dank gilt vor allem Katja Sengelmann, die mir wertvolle Tipps zum Schreiben gegeben hat, und meinen Freunden Axel, Mecki, Piet und Robert, die mit »Weißt du noch, Kämmi …?« dazu beigetragen haben, etliche Erinnerungslücken zu schließen.
Vorwort zur erweiterten Auflage
In dieser überarbeiteten Auflage habe ich die Namen einiger Personen und gelegentlich die ihnen zugeordneten Texte so verändert, dass eine Identifizierung für Außenstehende schwierig ist. Ich kann natürlich alles verändern und dem Leser mit erfundenen Geschichten die Hucke voll lügen. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Doch das will ich nicht. Also gehe ich das Risiko ein, dass sich Personen trotzdem hierin wiederfinden.
Das, was ich geschrieben habe, ist meine subjektive Sicht der Dinge und die muss nicht die richtige sein. Menschen, die hierin vorkommen und sich wiedererkennen, obwohl ich die Namen geändert habe, haben möglicherweise eine andere Sicht.
Ich habe mich bemüht, alles so aufzuschreiben, wie ich es empfunden und erlebt habe. Es gibt einige wenige Begebenheiten, die von mir so geschildert wurden, wie sie hätten sein können, aber vielleicht nicht genauso waren, weil ich nicht selbst dabei war. Ich habe meine Biografiekursleiterin im Ohr, die sagte: »Mensch, Ulli, das ist der Hammer, das musst du unbedingt ausbauen.«
Ulli Kammigan, im Herbst 2014
Else und Paul
Als ich geboren wurde, war es eine Katastrophe für Hamburg.
Also schaffte man mich, noch fest eingebaut im Bauch meiner Mutter, in ein außerhalb der Stadt gelegenes, aber der Stadt gehörendes Krankenhaus.
Hier ging die Entbindung relativ störungsfrei vor sich, während die Engländer kurz vorher ihr hoch explosives Eisen auf Hamburg abgeworfen hatten und etliche Stadtteile in Schutt und Asche legten. Es war September 1943 und sie nannten ihre Altmetallentsorgung Unternehmen Gomorrha.
Womit dann auch geklärt ist, dass es weniger meine Geburt war, die für Hamburg eine Katastrophe bedeutete, sondern dass sich die Katastrophe unabhängig von meiner Geburt kurz vorher über Hamburg abgespielt hatte.
Doch dieses Drama muss ich mir so sehr zu Herzen genommen haben, dass ich prompt mit einem Herzfehler zur Welt kam und länger als geplant im Hamburger Krankenhaus in Wintermoor in der Lüneburger Heide verbringen musste. Die damalige Medizin traute sich noch nicht, an Babyherzen herumzuoperieren. Christiaan Barnard war gerade 20 und hatte noch nicht einmal sein Medizinstudium angefangen. Er brauchte schließlich noch 24 Jahre, bis er in der Lage war, die erste Herztransplantation auszuführen. Also schüttelte man ob meines Daseins nur den Kopf und betete zum Hakenkreuz (das ist das Ding, was damals für viele Menschen Gott ersetzte), dass sich das Loch in der Herzkammer von allein schließen würde. Das tat es denn auch, obwohl Gott in meiner Familie nicht sonderlich angesagt war und das Hakenkreuz noch weniger. Denn schließlich war der Mann, den fast alle für meinen Vater hielten, überzeugter Kommunist und daher natürlich auch Atheist. Und da er zu der Zeit gerade einmal nicht im KoLaFu (Konzentrationslager Fuhlsbüttel) saß, wurde ich nicht Florian genannt, wie es meine Mutter gern gehabt hätte, sondern Ulrich, nach dem berühmten adligen Kämpfer gegen Staat und Kirche, Lutherfreund und Obrigkeitsfeind Ulrich von Hutten. Meine Mutter allerdings war in diesen Dingen nicht so bewandert und war der irrigen Meinung, dass der Name Ulrich grundsätzlich mit Doppel-l geschrieben würde. Also hieß ich fortan Ullrich.
Ich wurde daher mit einiger Verspätung in den Kreis der Familie in Hamburg-Dulsberg in der Tonndorfer Straße aufgenommen.
Diese Familie bestand neben meiner Mutter Else aus Franz Kammigan, ihrem Mann, dem Kommunisten, meinen beiden zehn und acht Jahre älteren Schwestern Ursula und Elke und meinem vier Jahre vorher geborenen Bruder Thomas, benannt nach Thomas Müntzer, Ur-Christ mit kommunistischem Gedankengut, ebenfalls zu Luthers Zeiten. Dann gab es noch Paul. Paul hieß mit vollständigem Namen Paul Seytres und war, wie man unschwer dem Namen entnehmen kann, Franzose. Was macht, fragt man sich da, ein Franzose, damals Erzfeind des Nazi-Deutschlands, in einer Hamburger Familie, deren Familienoberhaupt aktiv gegen Hitler und sein faschistisches Regime agitierte und zwei KZ-Aufenthalte überlebte? Franz Kammigan wurde aus dem zweiten Aufenthalt im KolaFu nur entlassen, weil man ihm nichts nachweisen konnte. Meine Großmutter hatte eine Vervielfältigungsmaschine zum Herstellen von Flugblättern rechtzeitig im Niendorfer Moor, dem Ohemoor versenkt. Und dann brauchte man ihn, denn er war nach langer Arbeitslosigkeit in einer verantwortungsvollen Position als Chemotechniker, so hieß das damals, bei der Hamburger Firma Kopperschmidt angestellt, einer Firma, die in Hamburg Farben herstellte und im Südschwarzwald in unterirdischen Anlagen Flugzeugkanzeln aus Plexiglas.
Nun, was der Franzose Paul alles so machte, wird der Leser vielleicht schon vermuten, aber eigentlich sollte er malen. Er war nämlich als Kriegsgefangener einer Malerfirma zugeteilt, bei der er tagsüber arbeiten musste. Und da unsere Wohnung nach einem Bombeneinschlag im Nachbarhaus Ende 1942 stark renovierungsbedürftig war, hatte der Hausbesitzer eben diese Malerfirma beauftragt, das Heim meiner Familie wieder wohnlich herzurichten. Also malte Paul nicht nur, sondern machte sich auch sonst unentbehrlich und half in der Familie, wo er nur konnte.
Wer also glaubt, Konrad Adenauer und Charles de Gaulle hätten die deutsch-französische Freundschaft begründet, der irrt. Es waren vielmehr Else und Paul, nur durfte das zu der damaligen Zeit keiner wissen. Natürlich wusste Franz davon, aber als überzeugter Kommunist hielt auch er selbst nicht viel – eigentlich gar nichts – von ehelicher Treue. Die Einstellungen von Franz und wohl auch von Else zur Ehe entsprachen ganz denen, die von den Kommunisten der zwanziger Jahre propagiert worden waren.
Nachdem die Ärzte des Krankenhauses in Wintermoor mir die Transportfähigkeit bescheinigt hatten, nahm ich also meinen Platz als siebentes Familienmitglied in der Tonndorfer Straße ein, die heute Bredstedter Straße heißt.
Doch Pauls und mein Gastspiel im halb zerstörten Hamburg war nur ein kurzes.
Paul haute ab nach Frankreich, wo er mit heimlicher Unterstützung von Franz und Else heil ankam, und Franz wurde von der Firma Kopperschmidt in den Südschwarzwald versetzt.
Mit drei Monaten gelangte ich in ein kleines Kaff mit Namen Aulfingen. Dort wohnte die Familie vorübergehend im Rathaus über der Wohnung des Bürgermeisters, denn auch in kleinen Kaffs im Südschwarzwald herrschte Wohnungsmangel. Franz mietete einen Dachboden in einem Bauernhaus und baute ihn zu einer Wohnung aus; er war nämlich nicht nur künstlerisch begabt, wie Hunderte von Aquarellen, Ölzeichnungen und Linolschnitten bewiesen, sondern auch handwerklich sehr geschickt.
Hier, im Süden des Schwarzwaldes, verbrachte ich die meiste Zeit im Kinderwagen, der ununterbrochen draußen vor der Tür stand, wenn man den unzähligen kleinen Schwarzweißfotografien Glauben schenken darf. Dieser Wagen nebst Inhalt blieb sogar draußen vor der Tür als die Engländer Tieffliegerangriffe auf die benachbarte Bahnlinie flogen. Meine älteste Schwester war vor lauter Angst ins Haus geflüchtet und hatte mich schlicht vergessen, was ihr einen mächtigen Rüffel von ihrem Vater einbrachte. Vielleicht dachte sie auch, dieses nervende, weil ewig plärrende, kleine Monster könne gut einmal ein bisschen Krach von außerhalb ab.
Hier lernte ich auch laufen und natürlich sprechen. Offenbar hatten mich dabei all die Tanten und Onkel, die ständig in den Kinderwagen hereinguckten und in Entzückensschreie ausbrachen wegen des ach so niedlichen Buben mit den wunderschönen dunklen Locken, mehr beeindruckt als die eigene Sippe, denn ich sprach bald reines Schwäbisch, ganz im Gegensatz zu dem Rest der Familie, die ihre hamburgische Herkunft nicht verleugnen konnte.
Dann war der Krieg zu Ende, von dem ich eigentlich gar nichts mitbekommen hatte, jedenfalls nicht bewusst.
Als die französischen Panzer vorrückten, überredete Franz Kammigan den Pfarrer und den Bürgermeister des Dorfes, mit denen er befreundet war, die weiße Fahne der Kapitulation zu hissen, obwohl in den umliegenden Wäldern sich noch Verbände der SS aufhielten. Somit war es ihm zu verdanken, dass der Ort vor größerem Schaden bewahrt blieb.
Französische Panzer zogen durch das Dorf und die Vorhänge mussten geschlossen bleiben.
Irgendeine hysterische Frau rannte in einem schwarzen Armeemantel über die Straße und wurde prompt erschossen, weil man sie für einen deutschen Soldaten gehalten hatte.
Die Besatzungssoldaten inspizierten auch unsere Wohnung, nahmen ein paar Kleinigkeiten mit, für die man in der Kommandantur Verwendung hatte, aber ließen uns im Wesentlichen in Ruhe.
Aus Erzählungen meiner Familie weiß ich, dass es nun mit der Nahrungsmittelversorgung knapp wurde.
Meine Geschwister sammelten mit ihrem Vater Holz und Tannenzapfen in den umliegenden Wäldern sowie Bucheckern und Pilze, die Mutti dann trocknete, um sie später zu Mahlzeiten zu verarbeiten.
Bei den Bauern wurde mit angepackt, man half bei der Kartoffelernte und sammelte im Sommer die Reste der Ähren auf den Feldern. Elke ging bei den Bauern betteln und nahm auch gelegentlich ihren Bruder Thomas mit. Sie kam fast immer mit etwas zum Essen nach Hause ganz im Gegensatz zu ihrer älteren Schwester, die leer ausging. Sie bekam so gut wie nie etwas von den Bauern; ihr fehlte einfach das Talent zum Hamstern, so nannte man damals das Betteln bei den Bauern. Irgendwie gab es also immer etwas zu essen und die große Not, wie sie zum Beispiel die Hamburger erlebten, litten wir nicht.
Der Schwarzwald gehörte dann zu der französischen Besatzungszone und meine zweite Feindberührung bestand darin, dass mir ein schwarzer Mann liebevoll über den Kopf strich. Er war einer der französischen Besatzungssoldaten aus Afrika, denen der Ruf vorausging, ausgesprochen kinderlieb zu sein. An die erste Feindberührung hatte ich naturgemäß keine Erinnerung, fand sie doch exakt neun Monate vor meiner Geburt statt.
Nach vier Jahren übersiedelte die Familie in den benachbarten Ort Blumberg, mit dem sich meine zweiten eigenen Erinnerungen verbinden. Die ersten sollten erst sehr viel später wieder auftauchen, als ich bereits 15 Jahre alt war und mit der Schulklasse einen der ersten Antikriegsfilme des Nachkriegsdeutschlands ansah. Aber dazu komme ich später.
Mit Blumberg verbinde ich Baden, Schlittenfahren und karierte Tischdecken. Baden war überhaupt nicht mein Ding. Erstens musste ich mindestens zwanzig Minuten mit meinen Geschwistern zu der Badestelle an der Wutach gehen, in einem Tempo, das meine Geschwister bestimmten, und zweitens konnte ich der Badestelle überhaupt nichts abgewinnen. Es fehlte ihr einfach der gewohnte Badewannenrand aus Zink mit Griffen zum Festhalten, und das Wasser hatte eine Temperatur, die weit unter meiner Wohlfühlgrenze lag. Ich galt folglich als extrem wasserscheu.
Schlittenfahren war da schon eher meine Sache. Es gab den Buchberg und den Eichberg und im Winter immer Schnee. Vom Buchberg konnte man durch den kleinen Weg bis fast vors Haus rodeln. Man überquerte dabei zwar zwei Straßen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier eines der fünf Autos vorbeikam, die die Blumberger Bevölkerung ihr Eigen nannte, war außerordentlich gering.
Besonders angesagt war es, lange Schlittenketten zu bilden. Dazu musste man sich bäuchlings auf den Schlitten legen und sich mit den Füßen seitwärts in die beiden vorderen Kufenbögen des nachfolgenden Schlittens einhaken. Diese Methode hätte jeden Orthopäden oder Unfallchirurgen in Entzücken versetzt, versprach sie ihm doch immense Verdienstmöglichkeiten. Aber, soweit ich mich erinnern kann, kamen dabei nur ein paar Schlitten zu Schaden.
Die karierten Tischdecken waren nicht nur Tischdecken und Sesselbezüge, sondern auch Fenstervorhänge und alles Mögliche, was an Stoffteilen so in einer Wohnung herumhängt, einschließlich der Schürzen meiner Mutter. Die Kammigans mussten wohl gerade ihre karierte Phase durchmachen, zwar nicht kleinkariert, aber immerhin kariert, und da ich noch recht kurz war, flatterte das alles in meiner Augenhöhe herum.
Franz Kammigan war dann damit beschäftigt, die Blumberger KPD zu gründen, und dabei tauchte irgendwann Liesel auf. Liesel war jünger als meine Mutter und wohnte bei uns. Bald trat ich mit meinen kleinen Kinderfüßen heftig ins Fettnäpfchen. Ich deutete nämlich vor versammelter Familienmannschaft auf ihren schon leicht angeschwollenen Bauch und fragte, ob da ein Kind drin sei. Mein älterer Bruder hatte mir irgend so etwas gesteckt. Ich konnte anschließend weder die Aufregung verstehen noch die Ermahnung, dass man solche Fragen nicht stellt, und am wenigsten konnte ich verstehen, dass mein Bruder stinkesauer auf mich war, weil er eine Tracht Prügel bezogen hatte.
Liesel war zwar nicht die Erste, die auftauchte; es gab da vorher schon Brummelchen, Inge, Ti und Hänschen, lauter Labormiezen der noch existierenden Farbenfabrik, in der Franz Kammigan in verantwortlicher Position stand, wohl ganz besonders den jungen Laborantinnen gegenüber. Aber sie war die Erste, deren Bauch schwoll.
Es dauerte noch einige Monate, dann brachte Liesel Heiko zur Welt, und Franz und Else ließen sich scheiden. Es war Frühjahr 1949, man teilte die vier Kinder unter sich auf, und es begann der soziale Abstieg. Die neu gegründete Bundesrepublik hatte für Kommunisten keine Verwendung, und die Arbeitslosigkeit von Franz, der inzwischen Liesel geheiratet hatte, bestimmte die nächsten Jahre das Leben von Liesel, meinen beiden Schwestern, und schließlich das von Heiko und Kai, den Kindern von Franz und Liesel. Kai wurde etwa zwei Jahre nach Heiko geboren.
Else, mit dem Makel einer geschiedenen Frau behaftet, und das war zu der Zeit ein großer Makel, setzte sich, Thomas und mich in die Eisenbahn und fuhr zurück nach Hamburg zu ihren Eltern Johannes und Christine Kettner in Hamburg-Niendorf, in den Wikingerweg 55. Hier am Rande des Ohemoores sollte ich meine gesamte Kindheit, ja, sogar fast mein ganzes Leben verbringen.
Oma Christine
Auch Else war erst einmal arbeitslos. Sie hatte zwar einen richtigen Beruf gelernt; sie war Buchhalterin, aber der Arbeitsmarkt lag 1949 danieder. Und eine Frau mit zwei kleinen Gören und ohne Mann war für jeden Arbeitgeber ein Albtraum. Also lebte Else mit uns beiden Jungs und Oma Christine von dem kärglichen Gehalt, das Opa Johannes als Krankenpfleger im Hafenkrankenhaus bezog. Aber immerhin gab es da ein großes Grundstück voller Obstbäume und Gemüsebeete und ein winzig kleines Häuschen, das noch Franz Kammigan in den 30er-Jahren mit aufgebaut hatte.
Oma Christine, schon über sechzig, war nicht gerade begeistert über den Familienzuwachs. Zumal sie immer noch große Stücke auf Franz Kammigan hielt, der schließlich ihr Eigenheim gebaut hatte. Er hatte es zwar nicht allein getan, ihr Sohn Carl, unser Onkel Calli, der zwei Jahre jüngere Bruder meiner Mutter, hatte ebenfalls dazu beigetragen. Schließlich hatte er den Beruf des Architekten erlernt. Aber das vergaß sie. Ebenso verdrängte sie die Tatsache, dass beim Bau des Hauses, aus Mangel an Bausand und Geld, der Zement mit dem extrem feinkörnigen schneeweißen Sand, der sich in etwa zweieinhalb Metern Tiefe überall unter dem Grundstück befand, zu Mörtel vermischt wurde. Die Folge war, dass wir uns im Giebelbereich möglichst nicht gegen die Wand lehnen durften. Es konnte passieren, dass man ein paar Ziegelsteine durch die Wand nach außen schob.
Christine war also nicht gut auf ihre Tochter, auf uns beiden Jungen und überhaupt auf alle und jeden, darunter auch ihren Mann Johannes, zu sprechen. Möglicherweise lag das an ihrer ausgesprochen miserablen Kindheit.
Sie wurde am 21. Dezember 1887 geboren. Als zweites Kind einer Familie von elf Kindern, eigentlich dreizehn, denn zwei waren schon frühzeitig gestorben, hatte sie bereits als junges Mädchen die Betreuung sämtlicher Geschwister übernehmen müssen. Ihre Mutter, Friederike Johanne Luise Sophie Schwenke, geborene Schramm, war als Köksch, das ist die norddeutsche Bezeichnung für eine Küchenmagd, bei feinen Herrschaften angestellt, die sich entschlossen, nach Amerika auszuwandern. Friederike packte die Gelegenheit beim Schopfe und wanderte mit. Zurück blieben zehn Kinder und ein Mann, der, obwohl er nur ein einfacher Schuster war, furchtbar vornehm tat, weswegen er auch überall im Stadtteil der Lord von Hoheluft hieß. In Wirklichkeit aber war er ein rechter Tunichtgut, der sich um nichts kümmerte, vor allem nicht um seine zehn Kinder.
Friederike war durchaus keine Rabenmutter. Sie stellte sich vor, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten genau das große Geld zu machen, das ihr Mann immer vorgab zu besitzen, und dann die Familie nachkommen zu lassen. Kurz gesagt: Sie kam nicht dazu, großes Geld zu machen, weil sie unter entsetzlichem Heimweh litt. Stattdessen kehrte sie wenig später reich an Erfahrungen, aber arm wie eine Kirchenmaus in den Schoß der Familie zurück. Die Herrschaften hatten ihr die Rückfahrt bezahlt. Der Lord vom Hoheluft war darüber so erfreut, dass kurz darauf auch das elfte Kind, meine mir wohl bekannte Tante, eigentlich Großtante Mauschi geboren wurde.
Christine musste also die Familie zusammenhalten. Da gab es zwar noch ihre ältere Schwester Agnes, aber Agnes hatte es geschickt verstanden, die Last der Verantwortung auf Christines schmale Schultern abzuwälzen, indem sie sich flugs nach Dänemark abgesetzt hatte, um dort einen Dänen namens Anton Hojberg zu heiraten.
Großtante Agnes entwickelte sich später zu meiner Lieblingstante. Sie kam immer einmal zu Besuch nach Niendorf, manchmal allein, denn ihr Mann Anton war schon frühzeitig verstorben, manchmal mit ihrer Tochter Karla, die dicke Zigarren rauchte, und ihrem verzogenen Enkelkind Hans, genannt Hansemann. Gelegentlich kam auch ihr Sohn Herbert mit Frau und seinen zwei Mädchen auf dem Motorrad mit Beiwagen aus Dänemark auf dem Weg nach Italien vorbei.
Tante Agnes war anders als Oma und alle ihre Geschwister und Brüder, die beide Kriege überlebt hatten.
Sie war gütig. Und sie war natürlich für mich exotisch, denn sie sprach mit stark dänischem Akzent. Sie erzählte uns nie, wie gut wir es doch hätten und wie schwer sie es als Kind gehabt habe, wie wir es nur zu oft von Tante Mimi, Mauschi, Manda und Onkel Ernst vorgebetet bekamen.
Tante Agnes war so, wie ich mir meine Oma immer gewünscht hätte. Sie konnte lachen. Ich kann mich nicht erinnern, jemals Oma Christine oder eines ihrer Geschwister lachen gesehen zu haben.
Tante Agnes verzog ihr Enkelkind, und wenn Oma Christine sich wieder über uns Kinder aufregte, höre ich noch heute Tante Agnes und ihr »Noo, Christine, lass mal gut sein«, was sie mit dänischem Akzent aussprach.
Sie lud mich ein nach Kopenhagen. Als ich vierzehn war, fuhr ich in den Sommerferien mit dem Fahrrad zu ihr und übernachtete unterwegs in Jugendherbergen. Sie zeigte mir Kopenhagen und wir hatten eine herrliche Zeit miteinander.
Leider starb sie einige Jahre später.
Doch zurück zu unserer Ankunft aus dem Schwarzwald im Frühjahr 1949.
Es wurde eng in dem kleinen Haus am Rande des Ohemoores. Christine, im Erziehen von Kindern nach den Idealen des auslaufenden neunzehnten Jahrhunderts wohl geübt, machte sich daran, uns, besonders aber meinen inzwischen zehn Jahre alten Bruder, zu drangsalieren. Unser Pech war, dass ein halbes Jahr nach unserer Ankunft in Hamburg ihr Mann starb, der bis dahin als Opfer ihrer nicht verarbeiteten Kindheit hergehalten hatte, wie mir viele Jahre später die Nachbarin, Frau Apel, erzählte. Oma hackte ständig auf ihm herum, und er konnte ihr nichts recht machen.
Christines allererste Erziehungsprämisse war, dass Kinder im Garten zu arbeiten hatten, und der Garten war groß: Etwa zweitausend Quadratmeter von ihr und Johannes im Schweiße ihrer beider Angesichte, wie wir hundertfach zu hören bekamen, urbar gemachtes Land, mit Obstbäumen und Büschen und voller Bohnen-, Erbsen-, Karotten-, Kohl- und anderer Gemüsebeete und dazu zirka eintausend Quadratmeter wildes Heideland. Die Grenze zur Straße bildete ein alter Holzlattenzaun. Eine Holzpforte mit dem Adressschild Johs Kettner – Johannes Kettner darauf zu schreiben, war wohl zu teuer gewesen – führte auf einen zirka 50 Meter langen Sandweg, der zu beiden Seiten von einer Bodendeckerpflanze, etwa zehn Zentimeter breit, in schnurgerader Linie begrenzt wurde. Dieser Weg knickte vor dem kleinen Haus nach rechts ab und führte dann an der Terrasse vor der Veranda vorbei bis hinters Haus zu den beiden Schuppen.
Gleich hinter dem Gartenzaun stand auf der linken Seite ein großer alter Kirschbaum, eine Glaskirsche. Dahinter folgten in größeren Abständen diverse Apfelbäume, eine Kochbirne, ein kleiner Quittenbaum und kurz vor dem kleinen Häuschen ein Birnbaum, dessen Früchte der Marke Bürgermeister ein besonderes Objekt meiner Begierde war. Rechts von der Pforte begann der Garten mit einem Feld für Kartoffeln. Dahinter folgten an der rechten Grundstücksgrenze ein Süßkirschenbaum und eine Reihe von Sauerkirschen. Zwischen Weg und Baumreihe war wieder ein Feld zum Anpflanzen diverser Gemüse und Kohlsorten, das am Ende in ein Spargelbeet überging. Zum Haus hin versperrte ein großer Rhododendron die Sicht, dessen Ableger noch heute in meinem Garten als inzwischen große Büsche überlebt haben. Links und rechts von dem kleinen Haus wuchs Flieder, der auf der rechten Seite eine Laube umrahmte, die aber, soweit ich mich erinnern kann, nie benutzt wurde.
Ins Haus gelangte man durch einen Vorbau, eine nach allen Seiten geschlossene Veranda. Auf der Fensterbank rechts von der Tür begrüßte den Eintretenden jahrein jahraus Lieschen. Lieschen war außerordentlich fleißig, weshalb sie auch Fleißiges Lieschen hieß. Es war eine etwa einen halben Meter hohe, buschähnliche Pflanze, die ununterbrochen blühte.
Ich weiß von Bekannten, dass auch sie sich an eine solche Pflanze erinnern. Aber heute scheint es sie nicht mehr zu geben. Das was heute unter Bezeichnung Fleißiges Lieschen oder lateinisch Impatiens angeboten wird, ist eine kleine, mickrige und außerdem nur einjährige Pflanze.
Von der Veranda aus ging es links in einen kleinen Flur mit einer Garderobe. Hier drängelte sich auf dem Fensterbrett eine Unmenge von Topfpflanzen. Darunter Alpenveilchen, Sansevieria und ein hässliches Dickblattgewächs, das vielen unter der Bezeichnung Geldbaum bekannt ist, aber von Oma als russische Eiche bezeichnet wurde. Schließlich stand da noch das buschige Schiefblatt. Letzteres war eine Busch-Begonie, deren Klonkinder, also durch vegetative Vermehrung gezogene Ableger, sich noch heute auf der Fensterbank meines Arbeitszimmers langweilen.
Geradeaus vom Flur kam man in die gute Stube, in der nur ein Sofa, ein Tisch mit zwei Stühlen, ein kleines Buffet und ein Bord mit einem Volksempfänger aus der Nazizeit Platz hatten. In der Ecke hinter der Tür war der gusseiserne Bollerofen. Die Wand hinter dem Sofa verzierte ein Ölgemälde von Franz Kammigan, das eine Baumgruppe vor einem Wald während der Schneeschmelze zeigte, und über dem Büffet rechts hing in einem vergoldeten Rahmen ein Kunstdruck von Max Klinger: die Elfe und der Bär. Darauf war eine nackte Frau auf einem Baum zu sehen, die mit einem Stock einen Bären ärgerte. Das Bild faszinierte mich natürlich, während ich dem Franz Kammigan nichts abgewinnen konnte. Das Klingerbild hängt heute in meinem Wohnzimmer.
Durch die Tür zur Rechten betrat man vom Flur aus die kleine Küche mit dem damals üblichen großen Kohleherd mit Backofen und Messingstange rundherum. Von der rechten hinteren Seite der Küche gelangte man in eine Speisekammer. Sie bildete den hinteren Teil des Veranda-Anbaus. Gegenüber der Tür zur Speisekammer führte eine dritte Tür in die Kammer, in der Oma später ihr Bett hatte. Von dieser kleinen Kammer kletterte man über eine steile Leiter durch eine offene Luke unters Dach. Der Vorraum oben war völlig kahl. Man sah auf die Holzsparren und die Dachpfannen. Hier schlief ich eine Zeitlang auf einem Feldbett. Hinter einer richtigen Tür öffnete sich das eigentliche Schlafzimmer mit einem Fenster zur entfernten Straße hin. Das Zimmer war ebenfalls äußerst spartanisch eingerichtet. Zwei alte Holzbetten, in denen Thomas und Mutti schliefen, standen jeweils an den schrägen Seitenwänden. Neben beiden befand sich jeweils ein hoher Nachtschrank. Hinter der Tür hatte eine Waschkommode mit einer Marmorplatte und einem kleinen Marmoraufsatz Platz. Ein großer Porzellankrug mit Wasser und eine Schüssel dienten der morgendlichen Wäsche. Fließend Wasser hatten wir damals noch nicht. Das Wasser bezogen wir aus einer Gartenpumpe hinter dem Haus.
An das kleine Häuschen schloss ein noch kleinerer Hühnerstall an, mit einem Vorraum für Gartengeräte, Tierfutter, Kohlenlager und Plumpsklo. Abgetrennt davon war ein zweiter offener Stall, in dem die Kaninchen untergebracht waren. Die weiteren 50 Meter Gartenlänge waren wieder in Obstbäume und freie Flächen für Gemüse unterteilt.
Dahinter fing unsere Kinderwelt an: wildes Heide- und Torfland, dazwischen kleine Birken und Gestrüpp. Hier ging unser Grundstück auf der rechten Seite ohne sichtbare Grenze zum Nachbargrundstück der Familie Apel über. Hinter Apels Grundstück begann das Moor.
Hier hätten wir uns wohl nur aufgehalten, wenn da nicht diese riesigen Flächen bestellbaren Landes auf Omas Grundstück gewesen wären, und die mussten ständig von Unkraut freigehalten werden. Zum Unkrautjäten befand sie auch mich nicht zu klein; auch zum Jauche ausfahren kamen wir Kinder ihr gerade recht. Letzteres war das Schrecklichste, was wir uns vorstellen konnten. Das Plumpsklo im Schuppen hatte nämlich eine tiefe Grube, in die einmal im Jahr ein Wasserschlauch gehalten wurde, um die Brühe zu verdünnen. Dann wurden von unserem Leiterwagen die Seitenteile entfernt, sodass nur noch Deichsel, Räder und zwei Bodenbretter übrig blieben. Auf diese Bretter wurden drei Blecheimer gestellt, die mit einem kleinen Zinkeimer an einer langen Stange aus der Jauchegrube mit der stinkenden Brühe gefüllt wurden. Der Wagen wurde dann mit der herumschwappenden Flüssigkeit durch den Garten gezogen bis zu der Stelle, wo zuerst Christine allein, später mein Bruder, das Land unter den Obstbäumen umgrub. Dann wurde der Inhalt der Eimer in die jeweilige Grabefurche entleert. Mir war jedes Mal speiübel, aber die Äpfel-, Kirsch-, Pflaumenund Zwetschgenbäume dankten es uns im Folgejahr mit Unmengen wurmzerfressener Früchte.
Auch die Obsternte hatte so ihre Tücken. Die Erntesaison wurde damit eröffnet, dass Thomas und ich je einen Korb in die Hand bekamen und das heruntergefallene, weil wurmstichige Obst aufsammelten. Großzügig erlaubte uns Oma Christine, davon zu essen. Wir durften sogar mit einem Messer die von einer kleinen weißen Made okkupierten Teile entfernen und dem Recycling, sprich: Kompost zuführen. Später pflückten wir sogar die Äpfel, Birnen, Pflaumen und Zwetschgen richtig vom Baum, die es wider Erwarten geschafft hatten, jeglichem Wurmbefall, Fäulnis, Sturm und anderen widrigen Umständen, wie Äpfelklauen, bis in den späten Herbst hinein zu widerstehen. Aber wehe, wenn wir die Frechheit besaßen, bei der Ernte oder später von diesem Obst zu essen! Es wurde säuberlich in Körben gelagert. Einen Teil verarbeitete Oma zu Mus, Suppe oder Kompott, oder es wurde eingemacht. Den nicht unbeträchtlichen Rest gab sie erst zum Verzehr frei, wenn auch er von der Fäulnis befallen war oder die Maden und Würmer ihr Domizil gewechselt hatten und sich voll Schadenfreude über die von Thomas und mir so heiß begehrten noch genießbaren Obstsorten hermachten.
Ein- oder zweimal in der Erntesaison erschien Onkel Calli, der Bruder von Mutti. Er inspizierte wohlwollend die im Schuppen lagernden Kisten mit Obst, und dann machte er etwas, was Thomas noch heute die Zornesröte ins Gesicht treibt, wenn wir uns zusammen daran erinnern. Er packte nämlich ein bis zwei Kisten Obst in den Beiwagen seines Motorrades und düste die zwei Kilometer ab nach Hause, nach Schnelsen, in die Oldesloer Straße. Oma ließ es zu, und Thomas war erbost, denn zum Obstpflücken hatte Onkel Calli natürlich nie Zeit. Er musste ja schwer in einem Architektenbüro arbeiten.
Oma wachte also mit Argusaugen über den gesamten Obstbestand, ob noch an den Bäumen hängend oder bereits im Schuppen lagernd. Doch diese scheinbar lückenlose Überwachung hatte eine Schwachstelle. Das war jeder zweite und dritte Dienstag im Monat. Dienstags pflegte Oma nämlich Skat zu spielen mit zwei Damen in ihrem Alter mit Namen Lina und Frau Kaiser, abwechselnd bei uns oder bei den Skatdamen zu Hause. An zwei dieser Dienstage war Oma also aushäusig. Folglich fielen auch immer genau dienstags Unmengen von Staren über die fast reifen Kirschen her, bis Thomas und ich Bauchschmerzen bekamen, und böse Äpfel-, Birnen- und Pflaumendiebe machten sich genau an diesen Tagen auf, um die Bäume zu besteigen und sich an dem Obst gütlich zu tun.
Unsere Neigung, fauliges und wurmzerfressenes Obst zu verzehren, nahm folglich rapide ab, und Oma hielt uns für undankbare Briten. Brit war bei ihr ein Synonym für Gauner, ungezogener Mensch, der nur Fisimatenten im Kopf hatte. Woher ersteres Schimpfwort stammt, ist leicht nachzuvollziehen, hatte sie doch zwei Weltkriege erlebt und nicht ganz bewältigt. Das letztere Wort ist den älteren Hamburgern durchaus geläufig, und ist ein Synonym für Unsinn machen. Es muss noch aus der napoleonischen Besatzungszeit Hamburgs stammen, als die schneidigen Franzosen die Hamburger Deerns aufforderten, »visitez ma tente«, vermutlich, um dort Fisimatenten zu machen. Christine hatte noch mehr solcher Verballhornungen der französischen Sprache auf Lager. So gab es zu besonderen Festtagen wie Weihnachten den köstlichen Zitronenfrommasch, den Thomas und ich, in völliger Unkenntnis jeglicher Fremdsprachen außer Plattdeutsch respektlos mit Zitronen vorm Arsch bezeichneten. Dies war nicht etwa, wie der Kenner der französischen Zunge vermutet, eine Art Käse, also frommage, sondern eine Cremespeise aus Zitronen, Zucker und geschlagenem Eiweiß.
Oma Christine bestimmte auch exakt die Mengen, die ein Kind an Essen zu sich zu nehmen hatte. Die Mahlzeiten, meistens irgendeine Gemüsezubereitung in einer Mehlpampe mit den Rohstoffen aus dem Garten, wurden uns beiden genau zugeteilt und mussten aufgegessen werden. Für Thomas war es in der Regel zu wenig, denn er befand sich zu dieser Zeit in einer starken Wachstumsphase und hatte daher ständig Hunger. Den versuchte er dadurch zu beheben, dass er heimlich Zucker aus der Zuckerdose verspeiste und dafür verprügelt wurde. Es war für uns unbegreiflich, wieso Oma sogar die Zuckermenge im Zuckertopf kontrollieren konnte.
Ich hatte genau das entgegengesetzte Problem mit der Nahrungsaufnahme. Ich hasste Gemüse. Es war schließlich dafür verantwortlich, dass ich zwischen diesem grässlichen Zeug Unkraut jäten musste, während meine Altersgenossen spielen konnten. Neben Rosenkohl, Blumenkohl und Spargel – wir hatten auch ein paar Spargelbeete, die besonderer Pflege bedurften – feindete ich mich besonders mit Wirsingkohl an. Der wurde mit Hammelfett zubereitet. Und weil ich lustlos und endlos auf meinem Teller herumstocherte, wurde das Zeug kalt. Wirsingkohl mit kaltem Hammeltalg führte zur endgültigen Feindschaft zwischen mir und allem, was Kohl heißt, bis auf den heutigen Tag.
Es gab hin und wieder auch Fleisch, besonders zu Festtagen. Wir hatten ja in den ersten Jahren noch Hühner, Kaninchen und sogar zwei Schafe. Doch genau dieses Fleisch war für mich gar kein richtiges. Ich mochte es nicht, genau so wenig wie das Gemüse aus dem Garten. Was die Schafe anging, so fand ich ihr Fett, nämlich Hammeltalg, im Wirsingkohl wieder. Grässlich! Siehe oben!
Hühnerfleisch mochte ich nur so lange, bis ich Thomas beim Schlachten helfen musste. Ich musste das Huhn an beiden Beinen halten und Thomas legte den Hals des Tieres auf den Hauklotz. Dann schlug er mit einem Beil zu. Mit Entsetzen nahm ich wahr, dass das Huhn auch ohne Kopf noch mit den Flügeln schlug und ließ erschreckt das Tier los. Das fiel auf seine Füße und rannte noch einige Meter durch die Gegend, bis es umfiel. Dieses Störtebeker-Huhn dann zu verzehren, empfand ich schon als Kannibalismus.
Zum Kaninchenschlachten kam Milchmann Timm. Ich musste zwar nicht beim Schlachten dabei sein, aber ich sah später das abgehäutete und ausgenommene Kaninchen im Schuppen hängen; das Kaninchen, welches ich vorher immer gestreichelt und mit Löwenzahn und Kartoffelschale gefüttert hatte. Also hatte auch Kaninchenfleisch bei mir keine Chance, als richtiges Fleisch durchzugehen.
Nicht nur Thomas, sondern auch ich wurde von Oma gelegentlich vermöbelt. Es kam zwar nicht oft vor, aber manchmal war ich einfach zu gierig und wartete nicht auf den Dienstag, um Obst von den eigenen Bäumen zu klauen. Wenn sie mich dann erwischte, gab es was mit dem Teppichklopfer auf den Hintern.
Ich schrie Zeter und Mordio und wollte Oma so deutlich machen, dass ich kurz vor dem Exitus stünde. In Wirklichkeit tat es nicht sonderlich weh. Oma hatte erstens nicht viel Kraft und zweitens schlug sie auf meine kurze Lederhose, die meinen Allerwertesten gut schützte. Aber ich durfte sie auf keinen Fall merken lassen, dass ihre Erziehungsmaßnahme keinen großen Eindruck auf mich machte.
Dass Kinder ein natürliches Bedürfnis zum Spielen mit anderen Kindern hatten, war für Christine nicht nachvollziehbar. Als ich später Freunde, unter anderem auch Schulfreunde hatte, bestand ein absolutes Verbot, diese fremden Kinder mit nach Hause oder auch nur aufs Grundstück zu bringen. Das Einzige, was sie tolerierte, war, dass diese fremden Gören den hinteren, noch wilden Teil des Grundstücks entweihten. Die Ausnahme von dieser Regel bildete Robert
Robert war mein erster Freund in Hamburg, den ich kurz nach unserer Ankunft aus Süddeutschland im Sommer 1949 kennenlernte. Er wohnte in derselben Straße, zwei Häuser weiter, das waren aber immerhin 200 Meter, denn neben uns war nur noch das Grundstück der Nachbarfamilie Apel. Dann kam Moor- und Heidelandschaft und schließlich das Grundstück, auf dem Robert mit seiner Oma hauste.
Mein neuer Freund war ein Jahr jünger als ich und konnte überhaupt nicht begreifen, wieso ich die meisten meiner Sätze mit einem gell beendete. Ich konnte ihm den Sinn dieses Nachsatzes auch nicht erklären: »Das war eben so, gell!« Überhaupt fand er meine Sprache etwas merkwürdig, war allerdings verblüfft darüber, dass er mich zum größten Teil verstehen konnte. Also stuften wir unsere Sprachbarriere als nicht unüberwindbar ein und wurden dicke Freunde, bis auf den heutigen Tag.
Robert lebte allein mit seiner Mutter und Oma, später nur mit der Oma, in einer noch kleineren Behausung als unsere. Aber sie war ebenfalls ein Haus aus Stein und bestand aus drei Räumen. Man betrat durch eine Haustür direkt die Küche. Hier stand an der Wand zum Wohnzimmer ein Kohleofen. Durch eine Tür gegenüber dem Eingang betrat man das kleine Wohnzimmer mit Schrank, Couch, Tisch, einer kleinen Kommode und einem Kachelofen. Durch eine zweite Tür gelangte man vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer. Alle drei Räume lagen hintereinander und hatten je etwa acht Quadratmeter.
Das Klo war in einem Holzschuppen untergebracht, der bis zum Ende des Krieges als Wohnung gedient hatte, als es das Haus noch nicht gab. Im Garten hinter dem Haus war die Wasserpumpe. Das Grundwasser war stark eisenhaltig und daher immer etwas bräunlich und zum Kaffeekochen wenig geeignet. Das Kaffeewasser holte Robert, als er schon groß genug dafür war, in einem Eimer von den Nachbarn auf der anderen Seite der Straße. Deren Grundstück reichte nämlich bis zur nächsten Parallelstraße, die Erikastraße, und hatte von dort einen Wasseranschluss ans städtische Netz. Auch Roberts Grundstück von insgesamt dreitausend Quadratmetern bestand, wie unseres, im hinteren Teil aus Torf- und Heideland.
Tagsüber ging Robert in den Kindergarten am Niendorfer Kirchenweg, dem heutigen Behrenberg-Gossler-Haus, auch, als er bereits in der Schule war. Jeden Morgen brachte seine Mutter ihn dorthin und holte ihn abends wieder ab.
Später verschwand seine Mutter, erst in einen anderen Stadtteil, dann nach Schweden und England, und über einen Vater wurde erst gar nicht geredet. Seine Oma zog ihn also allein groß, und dafür arbeitete sie tagsüber in einer Fabrik, die Marzipan und Nougat herstellte.
Durch ihn, genauer durch seine Oma, lernte ich diese für mich bislang völlig unbekannten Köstlichkeiten in Form von Marzipan- und Nougat-Rohmasse kennen, jedenfalls um die Weihnachtszeit herum. Meine Verehrung für diese Frau, die außerdem immer freundlich zu mir war, kannte keine Grenzen. Außerdem hatte sie den Vorzug, zu den alten Niendorfern zu gehören, den einzigen Menschen, die von meiner Großmutter akzeptiert wurden. Und weil das so war, stimmte meine Oma einer Vereinbarung zu, nach der Robert nicht mehr in den schrecklichen Kindergarten gehen musste, sondern sich tagsüber bei uns aufhalten durfte. Da sie dieses fremde Kind ja nicht als Arbeitskraft im Garten einsetzen konnte, hatte auch ich mehr Möglichkeiten, dem Unkrautjäten zu entkommen.
Oma Christine war auf Grund ihrer eigenen harten Kindheit eine Frau mit festen Meinungen und Vorstellungen und stand nach dem Tode ihres Mannes vor der Aufgabe, den viel zu großen Garten entsprechend ihrer Vorstellungen in Schuss zu halten. Diese Vorstellungen waren detailliert; so hatte darin eine Rasenfläche nur einen sehr begrenzten Platz, nämlich etwa 50 Quadratmeter unmittelbar vor ihrem kleinen Häuschen. Die restlichen 1950 Quadratmeter mussten ständig von Unkraut freigehalten werden, umgegraben, geharkt, in Beete eingeteilt, gedüngt, bepflanzt, mit Samen oder Setzlingen versehen und überhaupt gepflegt werden. Sie selbst gönnte sich dabei keine Ruhe, und sie sah nicht wirklich ein, dass sie von zwei halbwüchsigen Jungen nicht immer das Gleiche erwarten durfte.
Irgendwann schritt meine Mutter ein. Ich war schon ein Schulkind von etwa 9 Jahren, als Oma mich vom Spiel auf dem hinteren Teil des Grundstücks zurückrief, weil ich das Stück unter dem Birnbaum von Unkraut befreien sollte. Ich hielt das natürlich für besonders unfair, da sie selbst mir kurz vorher die Erlaubnis zum Spielen erteilt hatte. Also sagte sie mir zu, dass ich, wenn ich das genau festgelegte Stück Land vom Unkraut befreit hätte, wieder zu meinen Freunden könne. Das war ein Wort. Ich legte mich mächtig ins Zeug und hatte meine Arbeit in einem Bruchteil der Zeit erledigt, die ich gewöhnlich dafür benötigte. Das hatte Oma nicht erwartet, zumal auch die Qualität der Unkrautvernichtung nichts zu wünschen übrig ließ. Dann machte sie einen schwerwiegenden Fehler. Sie verlangte nämlich von mir, nun noch ein weiteres Beet zu bearbeiten. Widerspruch war zwecklos. Mit Tränen vor Wut und Enttäuschung in den Augen begann ich unter ihrer Aufsicht mit der neuen Arbeit. Kaum war sie jedoch nach hinten verschwunden, lief ich fort. Ich lief ungefähr zwei Kilometer weit zu einem Schulfreund, bei dem ich ab und zu schon einmal gespielt hatte, erzählte unter Tränen die Geschichte, traf natürlich auf großes Verständnis, denn auch er hatte, wie die meisten meiner Schulkameraden, Angst vor der strengen alten Frau. Ich durfte mich auf seinem Grundstück verstecken. Dort blieb ich bis zum Abend, als mein Bruder kam und mich zurückholte.
Mein Verschwinden hatte zu Hause inzwischen für Aufregung gesorgt, insbesondere, als meine Mutter von der Arbeit nach Hause kam und von der Geschichte erfuhr. Da es aber nicht viele Möglichkeiten gab, wo ich hätte hingehen können, wurde Thomas beauftragt, alle diese Orte aufzusuchen und fand mich dann auch relativ schnell. Ich hatte natürlich Angst vor den Folgen meiner Flucht, insbesondere vor Omas Reaktion. Aber sie sagte kein Wort und ich wurde ins Bett geschickt.
An diesem Abend hatte Else einen heftigen Disput mit ihrer Mutter, der Konsequenzen haben sollte.
Sie machte ihr klar, dass das Spielen bei Kindern keine unnütze Zeitverschwendung, sondern wichtig war, unter anderem für die Entwicklung ihrer Fantasie.
Das konnte Oma gar nicht verstehen. Fantasie stand für sie auf der gleichen Ebene wie das Unkraut im Garten: zu nichts nütze. Aber sie gab ein bisschen nach, nur, um dem ständigen Streit mit ihrer Tochter zu entgehen.
Doch Oma konnte auch Fremden gegenüber richtig rabiat werden.
Es gibt aus dem Zeitraum zwischen meinem sechsten und elften Lebensjahr nur wenige Fotos von mir, so etwas wie einen Fotoapparat konnten wir uns natürlich nicht leisten, und nur eines, auf dem ich zu erkennen bin, ohne dass man ein Elektronenmikroskop aktivieren müsste. Es zeigt mich als Achtjährigen in einem Mantel, den meine Mutter aus dem Stoff eines alten Armeemantels von Opa genäht hatte. Der Mantel hatte einen breiten, runden Kragen und wurde von vier überdimensionalen Knöpfen vorn zusammengehalten. Er war dunkelblaugrau. Das kann man allerdings auf dem Schwarzweißfoto nicht sehen. Das Foto ist auf der Straße entstanden, die zu meinem Freund Robert führt. Da lief ich nämlich einem Mann mit einem Fotoapparat in die Arme. Der knipste mich. Dann fragte er mich, wo ich wohne, denn er wollte später das Foto meinen Eltern verkaufen. Ich gab bereitwillig Auskunft.
Einige Tage später duckte sich ein fremder Mann vor unserer Haustür furchtsam unter den wütenden Beschimpfungen meiner Oma: Wie er dazu käme, Geld zu verlangen für etwas so Unnützes wie ein Foto von Ulemann, das sie überdies gar nicht bestellt hätte. Dann rannte sie zurück ins Haus, um mit dem Teppichklopfer zurückzukommen, den sie drohend gegen den Eindringling schwang. Um sie zu beruhigen, drückte er ihr schnell eines der Fotos in die Hand und machte sich schleunigst vom Acker.
Ulemann! So nannte man mich in der Familie. Als ich etwa neun oder zehn Jahre alt war, fand ich es an der Zeit, dass man mich bei meinem richtigen Namen rief. Es dauerte mindestens ein Jahr, bis ich auch dem letzten Familienmitglied die grässliche Verniedlichung abgewöhnt hatte. Thomas war natürlich der Letzte, vor allem deswegen, weil er wusste, man konnte mich mit diesem Namen ärgern, denn das tat er gern und häufig.
Die Pantherbande
Thomas und ich mussten zwar viel im Garten arbeiten, aber fürs Spielen blieb immer noch Raum. Natürlich besonders im Spätherbst und im frühen Frühjahr, wenn die Gartenarbeit ruhte.
Unser gesamter Spielbereich maß eine Fläche von vielen Quadratkilometern.
Dazu muss erwähnt werden, dass Anfang der 50er-Jahre die Stadt Hamburg auf die glorreiche Idee kam, das Ohemoor trockenzulegen. Zuerst begann man, die etwa zwei Meter dicke Torfschicht zu gewaltigen Halden, den Torfbergen, wie wir sie nannten, zusammenzuschieben. Dann wurden tiefe Entwässerungsgräben ausgehoben, Schotterstraßen angelegt und gewaltige Dampfmaschinen herbeigeschafft, von denen je eine an den gegenüberliegenden Enden eines großen Feldes postiert wurden. Diese Maschinen zogen an langen Stahlseilen einen riesigen Pflug zwischen sich hin und her, der den Untergrund bis auf über 1,50 Meter Tiefe umpflügte. Auf dem so erschlossenen Land wurden bäuerliche Vertriebene aus dem Osten angesiedelt, die das Land bestellen sollten. Gleichzeitig wurde das Gebiet mit elektrischem Strom und fließend Wasser versorgt. Bei letzterem machte allerdings der Hamburger Senat schlapp, oder der Rotary-Club, der einen großen Teil der Kultivierung des Ohemoores finanzierte, meinte, es sei nun genug Geld geflossen. Jedenfalls waren wir und unser Nachbar Apel die letzten, die an das städtische Wassernetz angeschlossen wurden. Die Folge war, dass täglich einmal ein Trecker mit einem großen Wassertank bis an den Hydranten vor unserem Grundstück fuhr, der die neuen Ohemoorsiedler mit dem notwendigen Nass versorgte. Wir Kinder durften manchmal oben auf dem Trecker ein Stück mitfahren.
Auch hatte man kleinere Flecken bei der Trockenlegung ausgespart, da hierfür die gewaltigen Maschinen etwas überdimensioniert waren. Dazu gehörte auch das schon erwähnte kleine Moorgebiet zwischen dem Grundstück unseres Nachbarn Apel und Roberts Oma.
Gleichzeitig fiel der rührigen Hamburger Stadtverwaltung ein, dass noch vor dem Weltkrieg, nämlich genau 1937, die Nazis ein Großhamburgisches Gesetz verabschiedet hatten, in dessen Folge unter anderen auch Niendorf, das vorher zu Pinneberg gehörte, nun ein Stadtteil Groß-Hamburgs geworden war. Und pingelig, wie die Hamburger Verwaltung nun einmal ist, meinte man auch, dass es nicht angehen könne, dass in Hamburg zwei Straßen in verschiedenen Stadtteilen denselben Namen trugen. So wurden Anfang der 50er-Jahre unter anderem die Erikastraße und die Jägerstraße, die von Niendorfs Norden bis zum alten Ortskern im Süden führten, in König-Heinrich-Weg und Paul-Sorge-Straße umbenannt, und unser Wikingerweg erhielt den Namen Ohmoor. Zudem schien es so, als ob den ehemaligen Herren des Grundbuchamtes bei der Zahlenfolge von 1 bis 55 nicht alle Zahlen geläufig wären. So wohnten wir fortan nicht mehr im Wikingerweg Nr. 55, sondern im Ohmoor 43.
Dieses ehemalige Moorgebiet war unser Spielplatz. Wir fingen Molche und Frösche, die sich zu Hunderten in den immer noch vorhandenen Tümpeln tummelten. Wir holten uns ständig einen Nassen, das war unser Ausdruck dafür, nasse Füße zu bekommen. Es war zu schön, auf den moorigen, mit Flechten und Moosen zugewachsenen ehemaligen Tümpeln zu wippen.
Wir klauten unserem hinteren Nachbarn die verrosteten eisernen Pfosten, klägliche Überreste eines Vorkriegszaunes. Letztere brachten wir auf dem schon erwähnten Leiterwagen zum Schrotthändler bei den Rieselfeldern. Der entlohnte uns je nach Gewicht mit einem Betrag zwischen 20 Pfennig und einer Mark. Das teilten wir unter uns auf und waren eine kurze Zeit reich.
Wir, das war die Pantherbande. Oberkommandierender und absolutistischer Herrscher war mein Bruder Thomas, der Älteste unserer Gruppe. Da natürlich Cowboy- und Indianerspielen angesagt war, hieß er Falkenauge. Dann gab es Adlerauge Horst, den Nachbarjungen, ein Jahr jünger als der Boss, immer etwas linkisch und bei Thomas nicht gerade in großem Ansehen. Brauner Bär Günther wohnte ein paar Häuser weiter auf der anderen Seite der Straße, war noch ein Jahr jünger, aber wohlgelitten bei unserem Despoten, denn er war handwerklich sehr geschickt. Dann kam ich, Tigerauge und Dummbeutel des ganzen Haufens, wenn es nach Thomas ging. Und es ging nach ihm. Mein Freund Robert, der Flinke Hirsch, hatte es viel leichter. Als Zweitjüngster wurde ihm vieles nachgesehen und aus einem unerfindlichen Grund mochte unser Herrscher ihn besonders. Unser Benjamin hieß Klaus, genannt Blesende Meser. Als Jüngster war er gerade in die Schule gekommen und konnte noch nicht richtig Blitzendes Messer schreiben, was wir ihm so übel nahmen, das er fortan mit dem Schreibfehler leben musste. Dann gab es noch Petra, die Rote Rose. Petra war etwas Besseres. Ihre Eltern hatten einmal einen richtig hohen Zaun um ihr Grundstück, dem allerdings jetzt die Eisenpfähle fehlten. Petra, eigentlich ihre Eltern, galten also bei uns als reich, und sie besaß sogar eine richtige Schaukel. Sie spielte auch nicht ständig mit uns, und Thomas war, so glaube ich, immer mal ein bisschen verliebt in sie. Sie war etwa gleich alt, aber sie kam bald aufs Gymnasium, das damals noch Oberschule hieß, und entschwand damit unseren Niederungen.
Außer im Sommer endete ein Spieltag im Moor damit, dass die Laternen angingen. Damit waren die Straßenlaternen in unserer Straße gemeint, die man kilometerweit über das Moor sehen konnte. Im gesamten Bereich von unserer Straße bis zur Landesgrenze Hamburgs gab es anfangs noch keine Versorgung mit Elektrizität. Es gab auch kaum Bäume, die die Sicht behinderten. Allenfalls begannen hier und da die ersten Birken zu wachsen. Wenn also die Laternen angingen, mussten wir nach Hause, denn eine Uhr besaßen wir natürlich nicht.
Im Sommer wurden wir nach Hause gerufen, denn dann gingen die Straßenlaternen viel zu spät an. Das war meist so zwischen sieben und halb acht. Am Abend oder auch tagsüber, wenn wir nach Hause kommen sollten, riefen unsere Großmütter oder Mütter laut über das Moor: »Uuu-le-maaan!« oder »Rooo-bert!« Das war über die gesamte noch freie Fläche des Moorgebiets zu hören. Wir antworteten dann mit einem endlos gedehnten »Jaa-aa«. Dann wusste man zu Hause, dass wir in der nächsten Viertelstunde dort eintrudeln würden.
Im Frühjahr sammelten wir das Heu wilder Gräser und bauten daraus Hütten. Dazu wurden kleine Birken abgeschnitten, in die Erde gesteckt, quer verflochten und die Zwischenräume mit dem trockenen Heu gefüllt. Die beste Hütte war die, die innen ganz dunkel war. Man kroch durch ein schmales Loch am Boden hinein und hatte gerade so viel Platz darin, um der Länge nach zu liegen, allenfalls zu hocken.