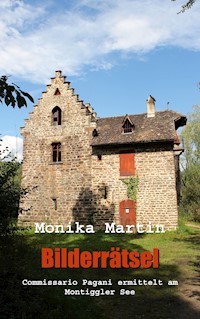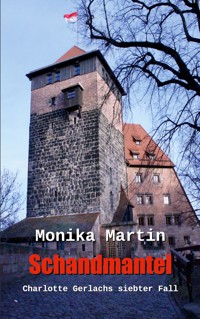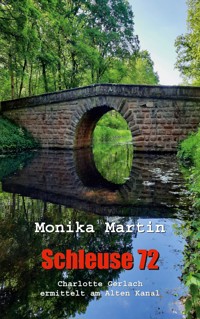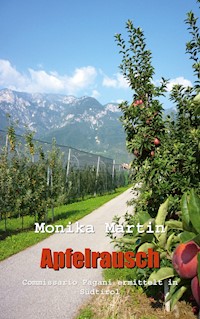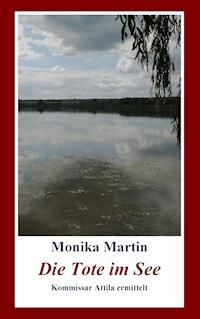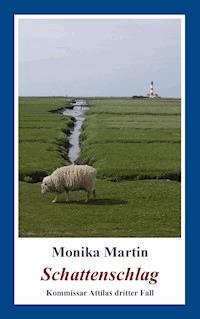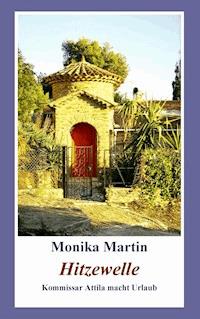Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In den frühen Morgenstunden des Aschermittwochs wird in der Nürnberger Altstadt hinter dem Albrecht-Dürer-Denkmal die Leiche eines jungen Mannes in einem Engelskostüm gefunden. Es handelt sich um einen Drogendealer, der in der Szene als Rauschgoldengel bekannt ist. Charlotte Gerlach ermittelt im Drogenmilieu und stößt auf eine Spur, die in die Nürnberger Unterwelt führt: in die Felsengänge ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch:
In den frühen Morgenstunden des Aschermittwochs wird in der Nürnberger Altstadt hinter dem Albrecht-Dürer-Denkmal die Leiche eines jungen Mannes in einem Engelskostüm gefunden. Es handelt sich um einen Drogendealer, der in der Szene als Rauschgoldengel bekannt ist. Charlotte Gerlach ermittelt im Drogenmilieu und stößt auf eine Spur, die in die Nürnberger Unterwelt führt: in die Felsengänge…
Die Autorin:
Monika Martin, Jahrgang 1969, ist Sozialpädagogin und führt seit 1996 für das Institut für Regionalgeschichte, Geschichte für Alle e.V., historische Stadtrundgänge in Nürnberg durch.
„Rauschgoldengel“ ist der zweite Krimi aus der Reihe „Krimis mit Geschichte“, in der die Autorin ihre literarische Tätigkeit mit ihrem regionalgeschichtlichen Engagement zu einem Kriminalroman mit Fakten aus der Nürnberger Stadtgeschichte verbindet.
Monika Martin lebt mit ihrer Familie in Schwanstetten bei Nürnberg.
Außerdem von Monika Martin bei Books on Demand erschienen:
Aus der Reihe „Krimis mit Geschichte“:
„Hochgericht“, Dezember 2014
Aus der Reihe „Ermitteln, wo andere Urlaub machen“:
„Die Tote im See“, August 2008
„Hitzewelle“, August 2010
„Schattenschlag“, Februar 2012
„Apfelrausch“, August 2013
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
1
Er atmete tief ein und schloss die Augen.
Diese Luft, diese frische, reine, feuchte, immer gleiche Luft begeisterte ihn jedes Mal aufs Neue. Jenseits aller Hektik des Alltags, fern von Lärm und Gestank, weit weg von allen Verpflichtungen und Erwartungen entfaltete diese Luft ihre heilsame, entspannende, ja nahezu therapeutische Wirkung. Mit jedem Atemzug füllten sich seine Lungen bis in den letzten Winkel, legte sich die wohltuende Feuchtigkeit wie ein heilender Film um seine Bronchien.
Hier unten schien die Zeit still zu stehen.
Hier war immer alles gleich, gleich still, gleich dunkel, gleich kühl, gleich schön – und doch…
Trotz aller Entspannung blieb dennoch immer ein kribbelndes Gefühl der… nein, nicht direkt der Angst, es war vielmehr ein leichtes Schaudern, ein wohliges Unwohlsein, eine angenehme Beklemmung.
Immerhin befand er sich in einem über 25.000 Quadratmeter großen Labyrinth an Gängen und Räumen, 16 Meter unter der Oberfläche, mitten in einem gigantischen, löchrigen Sandsteinfelsen.
Eine leichte Gänsehaut überzog seinen Rücken. Er schüttelte sich, zog sich seine dicke Fleecejacke fester um den Körper und lauschte in die tiefe Stille.
Er hörte sein Blut rauschen, seinen leisen Atem, das Klopfen seines Herzens.
Es war lange her, dass er zum letzten Mal hier unten war.
Eigentlich viel zu lange.
Aber er hatte es nicht gekonnt, hätte es nicht ausgehalten. Es war viel passiert seit damals, seit…
Er versuchte mit aller Kraft, die Erinnerung beiseite zu schieben, wollte nicht daran denken, hatte alles verdrängt, mit vielen Abertausenden von Gedanken, Erlebnissen, Ereignissen überlagert, weit weg geschoben in den letzten Winkel seines Gedächtnisses.
Und doch war sie immer da, ließ sich nicht ganz vernichten, saß wie ein Stachel in seinem Unterbewusstsein.
Jetzt, da er wieder hier unten war, kam sie plötzlich mit einer Wucht zurück, die ihn schlichtweg überwältigte.
Eine Welle der Panik erfasste ihn, Schweiß trat ihm aus allen Poren, er schnappte nach Luft. Der Lichtkegel seiner Taschenlampe verschwamm vor seinen Augen, seine Knie wurden weich, er sank zu Boden.
2
Es war heiß und stickig.
Milchig weiße Nebelschwaden waberten durch den düsteren Raum und lösten sich nur zögerlich auf. Grelle Blitze zuckten, helle Strahlen gleißenden Lichts durchschnitten die Dunkelheit. Überall standen finstere Gestalten mit schwarzen Umhängen, furchterregenden Fratzen, grell gefärbtem, wirrem Haar. Manche lehnten alleine an der kalten, nackten Wand, andere trafen sich in kleinen Grüppchen oder standen eingequetscht in einer riesigen Menge rhythmisch zuckender Körper. Ohrenbetäubend laute Musik und das tiefe Wummern der Bässe machte jede Konversation unmöglich.
Eine junge Frau in einem weiten, schwarz schimmernden Mantel und hohem, spitzem Hut, unter dem silbrig glänzendes Haar hervorquoll, durchquerte den Raum und steuerte zielsicher auf einen hohen Tresen zu. Mit verschiedenen Handzeichen rief sie eine mächtige, ganz in weiße Tücher gewickelte Gestalt herbei, legte einige Münzen auf den Tisch und deutete auf einen Turm Getränkekästen. Die Mumie, von der lediglich die tiefblauen Augen zu sehen waren, reichte der Frau zwei Flaschen mit roter Flüssigkeit und ließ die Münzen in seine Kasse fallen. Mit den Getränken in der Hand kämpfte sich die Frau wieder zurück, vorbei an gruseligen Zombies, blutverschmierten Vampiren und schauerlichen Frankensteinen.
In einer Ecke kauerte eine schlanke Hexe in einem eng anliegenden, dunkelroten, kurzen Kleid, schwarzen Netzstrumpfhosen und einer Vielzahl verschieden großer Spinnen im langen, blonden Haar. Die Schminke war verlaufen, die Augen rot verweint.
Charlotte Gerlach packte ihre Freundin energisch am Arm und schob sie in Richtung Ausgang.
Eiskalte, von dichten Nikotinschwaden durchsetzte Luft schlug den beiden Frauen entgegen. So froh Charlotte auch über das Rauchverbot in Restaurants und Diskotheken war, so nervig fand sie die Tatsache, dass die Formulierung „ich geh mal raus an die frische Luft“ einfach nicht mehr der Wahrheit entsprach – zumindest was die unmittelbare Nähe der Eingangstür betraf.
Zitternd reichte sie ihrer Freundin eine Limonadenflasche und wickelte sich fester in ihren Hexenumhang. Vielleicht hätte sie doch besser die gefütterten Stiefel anziehen sollen, denn es hatte einige Grad unter Null und der Schnee türmte sich links und rechts des mühsam freigeräumten Eingangs.
„Trink mal einen Schluck und reiß dich endlich zusammen!“, schimpfte sie ungehalten. „DU wolltest unbedingt zur Rosenmontags-Grusel-Party in den Hirsch – und das auch noch mit dem Fahrrad! Ich hätte es mir bei dieser Affenkälte lieber zu Hause auf dem Sofa gemütlich gemacht!“
Sandra Watzlawick versank immer tiefer in ihrem schwarzen Schal und wagte es kaum, ihre Freundin anzusehen.
„Tut mir leid“, stieß sie unter dicken weißen Atemwolken hervor.
„Seit über zwei Stunden stehe ich mir jetzt gelangweilt Löcher in den Bauch! Du willst nicht tanzen, dich nicht unterhalten und tust so, als wäre ich gar nicht da!“
Charlotte redete sich förmlich in Rage.
„Die ganze Zeit starrst du nur auf den Eingang und hoffst, dass dieser Heini endlich kommt. ER KOMMT NICHT!
Kapier das endlich!“
Sandra weinte laut. Dicke Tränen rannen ihr über das schwarz geschminkte Gesicht.
„Er hat es mir versprochen“, jammerte sie unglücklich.
„Ach! Er hat dir schon so manches versprochen und das Wenigste davon gehalten. Dieser Typ ist einfach unzuverlässig, unberechenbar, narzisstisch, egoistisch,…“
„Es reicht!“, rief Sandra verzweifelt. „Ich weiß, dass du nichts von ihm hältst.“
„Sandra“, setzte Charlotte nach, „du bist Anfang 30, kein Teenager mehr. Warum tust du dir das an?“
„Du verstehst gar nichts!“, schrie Sandra. „Ich liebe ihn! Lass mich endlich in Ruhe mit deinen Vorwürfen! Du hörst dich an wie meine Mutter!“
Damit ließ sie Charlotte stehen und verschwand schluchzend in der Menschenmenge.
„Was war das denn?“, ertönte eine etwas dumpf klingende Stimme.
Ein Mann in einem schwarzen Anzug mit aufgedrucktem Skelett trat an Charlotte heran und nahm seine Totenkopfmaske ab. Hervor kam das verschwitzte, hochrote Gesicht von Tim Brettschneider, Charlottes Freund.
„Habt ihr euch gestritten?“
„Ach, die kann mich mal!“, rief Charlotte wütend. „Der Frau ist nicht mehr zu helfen!“
„Was ist denn passiert?“, fragte Tim, nahm seiner Freundin die Flasche aus der Hand und trank sie in einem Schluck aus.
„Ach, ich kann das nicht mehr hören. Ihr neuer Freund hat sie versetzt. Wieder mal.“
Tim blickte sie verwundert an.
„Du hast mir gar nicht erzählt, dass sie einen Freund hat.“
„Das ist auch so eine Marotte. Keiner darf es wissen, alles ist topsecret. So ein Blödsinn.“ Charlotte war außer sich. „Mir ist völlig schleierhaft, was sie an diesem Typ findet!“
„Wer ist es denn? Kennst du ihn?“ fragte Tim schlotternd und hüpfte von einem Bein auf das andere. Seine Lippen waren schon ganz blau, an der Nasenspitze hing ein Wassertropfen.
„Natürlich nicht. Niemand kennt ihn.“
„Wollen wir nicht drinnen weiterreden? Hier draußen friert man ja fest.“
Charlotte schüttelte den Kopf. „Mir reicht es für heute. Ich will nach Hause. Kommst du mit?“
„Das klingt verlockend, wäre da nur nicht die Aussicht auf eine kleine Radtour bei gefühlt zweistelligen Minusgraden und mannshohen Schneebergen“, grinste Tim und schnitt eine Grimasse.
Charlotte beruhigte sich langsam.
„Über das Problem habe ich auch schon nachgedacht und bin zu folgendem Ergebnis gekommen.“
„Du klingelst unseren Chauffeur aus dem Bett?“
„Fast. Ich spendiere uns ein Taxi. Die Räder können wir ja morgen abholen.“
Eine Viertelstunde später saßen sie im deutlich überheizten Taxi auf dem Weg zu ihrer Wohnung in der Altstadt.
„Was ist denn mit Sandra los? So kenne ich sie gar nicht“, fragte Tim, nachdem er es endlich geschafft hatte, sich trotz seines weiten Kostüms den Sicherheitsgurt anzulegen.
„Ich auch nicht“, stimmte Charlotte besorgt zu. „Seit sie mit diesem Magnus zusammen ist, ist sie kaum noch wiederzuerkennen.“
„Inwiefern?“
„Sie ist gar nicht mehr richtig ansprechbar, unternimmt kaum noch etwas“, erklärte Charlotte. „Sie sitzt nur noch zu Hause und wartet darauf, dass er kommt oder sich meldet.“
„Wer ist das überhaupt? Weißt du etwas über ihn?“
„Außer seinem Vornamen nichts, das ist ja das Komische. Keiner darf ihn kennenlernen, sie trifft sich immer nur alleine mit ihm - und das ausschließlich bei ihr zu Hause.“
„Hat er etwas zu verbergen?“
Charlotte zuckte ratlos mit den Schultern. „Offensichtlich, sonst würde er kein solches Geheimnis um seine Person machen.“
Tim stieß sie schmunzelnd in die Seite.
„Erwacht da etwa wieder die Kriminalhauptkommissarin in dir? Mitten in der Nacht? Am Feierabend?“
„Jetzt hör aber auf! Du musst doch zugeben, dass es nicht ganz normal ist, wenn jemand so gar nichts von sich preisgeben will, oder?“
„Komisch ist das schon. Da gebe ich dir recht. Weiß man denn, was dieser Magnus beruflich macht?“
„Angeblich hat er mal Sozialwissenschaften studiert und einige Semester Betriebswirtschaft. Aber einen Abschluss hat er meines Wissens nach keinen.“
„Und womit verdient er sein Geld? Oder hat er reiche Eltern?“
„Das weiß ich auch nicht so genau“, räumte Charlotte ein.
„Sandra spricht nicht besonders gerne darüber.“
„Wahrscheinlich weiß sie es gar nicht“, mutmaßte Tim, als das Taxi über das Kopfsteinpflaster beim Unschlittplatz holperte.
„Sie können uns hier aussteigen lassen“, bot Charlotte dem Taxifahrer an und kramte ihre Geldbörse hervor. „Dann müssen Sie nicht durch die engen Gassen kurven.“
Charlotte und Tim bewohnten eine Altbauwohnung in der Unteren Wörthstraße, einer der wenigen Gassen Nürnbergs, die weitgehend vom verheerenden Bombardement des Zweiten Weltkriegs verschont geblieben waren. Sie lag idyllisch am südlichen Ufer der friedlich dahinfließenden Pegnitz, in unmittelbarer Nähe des Hauptmarktes.
Die beiden genossen die zentrale und doch ruhige Lage sehr und nahmen dafür gerne etwas weniger Komfort in Kauf. Immerhin hatten sie eine Toilette in der Wohnung, fließend kaltes und warmes Wasser und im Winter ein kuschelig warmes Wohnzimmer. Das Wichtigste war, dass Charlotte zu Fuß zur Arbeit gehen konnte, denn das Polizeipräsidium am Jakobsplatz lag nur etwa zehn Gehminuten entfernt.
„Deine Freundin Sandra hat offensichtlich ein Faible für schwierige Beziehungen, was?“, griff Tim das Thema wieder auf, als sie wenig später nebeneinander im Bett lagen. „Ihr Exmann war doch auch nicht gerade einfach, oder?“
„Alles andere als das.“ Charlotte gähnte herzhaft. „Ich glaube, er schikaniert sie immer noch, obwohl sie bereits seit über zwei Jahren geschieden sind. Irgendwie ist sie vom Pech verfolgt. Die Arme.“
„Na, da hast du ja mit mir einen Glücksgriff gemacht, was?“, meinte Tim augenzwinkernd.
„Aber natürlich, Schatz“, murmelte sie und schlief augenblicklich ein.
3
Er fror.
Sein Kopf schmerzte. Zitternd öffnete er die Augen und konnte nichts erkennen außer undurchdringlicher Finsternis.
Stöhnend setzte er sich auf.
Was war passiert?
Es war feucht und kühl und dunkel. Kein Geräusch war zu hören.
Langsam kam die Erinnerung zurück.
Er war im Keller, in den Felsengängen, hatte eine Nachricht bekommen, sollte sich hier mit jemandem treffen.
Dann war er offenbar ohnmächtig geworden.
Hektisch tastete er den Boden um sich herum ab. Wo war die Taschenlampe? Zu seiner grenzenlosen Erleichterung fand er sie unmittelbar neben sich, schaltete sie ein und sah sich um.
Er saß noch immer dort, wo er das Bewusstsein verloren hatte. Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass nur zehn Minuten vergangen waren.
Vorsichtig versuchte er aufzustehen, ging aber gleich wieder in die Hocke, denn es wurde ihm erneut schwarz vor Augen. Im Schneckentempo krabbelte er zur nächsten Wand und zog sich daran hoch. Er atmete tief durch, versuchte ruhig zu werden, seinen Kreislauf zu stabilisieren.
Mit Mühe sammelte er seine Gedanken.
Da war eine Nachricht auf seinem Handy gewesen, von einem alten Freund, zu dem er seit Jahren keinen Kontakt mehr gehabt hatte. Er solle heute Abend in den Keller kommen, der alten Zeiten wegen. Es gebe interessante Neuigkeiten, außerdem sei seit damals so viel Zeit vergangen.
Er hatte sich gewundert, war aber neugierig geworden.
Schließlich hatte er sich auf den Weg gemacht. Wie damals hatte er auch diesmal warten müssen, bis die letzte Gruppe mit ihrem Führer den Keller verlassen hatte, bevor er sich Zugang zu den Gewölben hatte verschaffen können.
Mit einem Mal hatte er sich um über 20 Jahre zurückversetzt gefühlt, in eine Zeit, als er oft hier unten unterwegs gewesen war. All der Nervenkitzel, die aufregende Gewissheit, etwas Verbotenes zu tun, die unbestimmte Gefahr auf der einen und das Geborgensein auf der anderen Seite. Alles war wieder da gewesen – auch die Erinnerung an…
So stand er jetzt da, alleine, an den bröseligen Sandstein der kühlen Wand gelehnt, überwältigt von all den Eindrücken und Emotionen, von den verdrängten Ereignissen der Vergangenheit.
Mit wackeligen Beinen machte er sich auf den Weg zum Treffpunkt. Zielsicher durchschritt er Gang für Gang, nahm unzählige Abzweigungen und bewegte sich immer weiter hinein in das Labyrinth, immer tiefer hinunter in das Innere des Burgbergs. Zu Beginn hingen noch in regelmäßigen Abständen Infotafeln für die verschiedenen Führungen an den Wänden, doch je weiter er kam, desto spärlicher wurden sie, bis er schließlich in einen Bereich kam, der nicht öffentlich zugänglich war.
Hier lag Schutt und Geröll auf dem Boden, altes Holz, kaputte Stühle und Kartons. Man hatte sich keine Mühe gegeben, diesen Teil der Anlage aufzuräumen und zur Besichtigung freizugeben. Hierher verirrte sich nur selten jemand, daran hatte sich auch in den vergangenen Jahren wenig geändert.
Vorsichtig bahnte er sich einen Weg durch den Müll, zwängte sich durch einen schmalen Durchgang und stand vor einer niedrigen, massiven Holztür.
Er war am Ziel.
Alles war noch so wie damals.
Fast alles, denn das wuchtige Vorhängeschloss war verschwunden, was ihn sehr wunderte, denn sie hatten immer viel Wert darauf gelegt, den Raum ordnungsgemäß abzusperren.
Offensichtlich wurde er bereits erwartet.
Langsam schob er die Tür einen Spalt auf und leuchtete in den kleinen Raum hinein. Ein Schwall abgestandene Luft kam ihm entgegen, eine Mischung aus gammeligen Essensresten, Bier und feuchten Matratzen.
Niemand war da.
Er ging hinein.
Ein kurzes Lächeln huschte über sein Gesicht. Es war aufregend gewesen damals. Sie hatten viel Zeit hier unten verbracht, hatten sich regelmäßig getroffen, sich großartig gefühlt in ihrem Geheimversteck, das nicht einmal ihre Eltern kannten. Niemand hatte davon gewusst, sie hatten keinen mitbringen, niemanden einweihen dürfen in ihr Geheimnis. Durch Zufall hatten sie den versteckten Zugang und wenig später diesen verlassenen Raum entdeckt, der beinahe an ein Verlies erinnerte.
Hätte jemand davon erfahren, wäre es vermutlich vorbei gewesen.
Plötzlich war ein Geräusch zu hören.
Sein Herz schlug einen Takt schneller, er atmete flacher. Da kam jemand!
Natürlich kam da jemand, deshalb war er ja hier, er wartete auf einen Freund, einen alten Freund, mit dem er sich treffen wollte.
Warum also war sein Körper in Hab-Acht-Stellung, beschlich ihn ein Anflug von Angst?
„Hallo?“, rief er mit einem leichten Zittern in der Stimme in Richtung Tür. „Bist du das?“
Im nächsten Moment wurde ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen.
Er war gefangen!
4
Ein lautes, penetrantes Geräusch riss Charlotte aus dem Schlaf. Es war schrill, durchdringend, lästig – und hörte einfach nicht auf. Immer und immer wieder bohrte es sich ungnädig durch die Trommelfelle direkt hinein in den schmerzenden Kopf. Genervt presste sich Charlotte ihre Bettdecke auf die Ohren, aber das Klingeln fand auch durch die dicke Schicht Daunenfedern seinen Weg in ihr Bewusstsein.
„Tim“, presste sie mühsam hervor. Ein schneller Blick auf den Wecker verriet ihr, warum sie so unfassbar müde war: 6:30 Uhr! Sie hatte gerade einmal vier Stunden geschlafen. Stöhnend tastete sie mit der rechten Hand die zweite Betthälfte ab.
Leer. Das Bett neben ihr war leer.
Konnte es wirklich sein, dass jemand so ein leidenschaftlicher Frühaufsteher war, dass er bereits nach vier Stunden Schlaf schon wieder Energie hatte? Aufstehen und die Welt verbessern wollte?
Und immer wieder das fürchterliche Klingeln.
Charlotte rollte sich jammernd unter ihrer Zudecke zusammen, versuchte gerade, sich an den Gedanken zu gewöhnen, jetzt aufstehen zu müssen, als das Geräusch plötzlich verstummte.
Was blieb, war lediglich ein leises Summen in ihren Ohren. Sonst war es still. Wunderbar still. Für wenige Sekunden.
Da waren Stimmen im Treppenhaus, ein Schlüssel im Schloss…
„Komm erstmal rein“, flüsterte Tim rücksichtsvoll.
„Charlotte schläft bestimmt noch.“
Tim und eine weitere Person schlichen nahezu geräuschlos in die Küche und schlossen die Tür.
Hatte sie nicht das Knistern einer Papiertüte gehört?
Wurde nicht eben die Kaffeemaschine eingeschaltet?
Wer war da in der Küche?
„Na gut!“, grummelte Charlotte genervt. „Dann stehe ich auf. Ist ja auch egal, dass ich heute frei habe und ausschlafen könnte.“
Schwungvoll schlug sie die Decke zurück, schwang die Beine über den Bettrand, zog sich die bunten Stricksocken über und schlüpfte in ihre flauschige Fleecejacke. Egal wer da zu nachtschlafender Zeit mit ihrem Freund in der Küche frühstückte, der oder diejenige würde nun eine ungewaschene, unausgeschlafene Charlotte im Schlafanzug ertragen müssen.
Mürrisch öffnete sie die Küchentür.
„Guten Morgen, Schatz“, begrüßte sie ein gut gelaunter Tim mit leuchtenden Augen und von der Kälte geröteten Wangen. Augenscheinlich war er bereits beim Bäcker gewesen, denn auf dem Tisch stand der Brotkorb mit knusprig frischen Brötchen. „Darf ich dir auch einen Cappuccino machen?“
„Ja, gerne“, murmelte sie und bemerkte erst jetzt die zusammengesunkene Gestalt auf dem Küchenstuhl.
„Sandra!“, entfuhr es ihr erschrocken. „Wie siehst du denn aus?“
Sandra trug noch immer ihr Kostüm, die Haare waren verfilzt, das Gesicht verschmiert. Sie zitterte am ganzen Leib. Tränen rannen ihr über die Wangen.
Sie bot ein Bild des Jammers.
„Warst du noch gar nicht zu Hause?“
Charlotte war schlagartig wach, reichte der Freundin ein Taschentuch und setzte sich betroffen zu ihr an den Tisch.
Bei dem bedauernswerten Zustand, in dem sich ihre Freundin befand, war der Streit der vergangenen Nacht vergessen.
„Was ist denn passiert?“
Sandra starrte zu Boden und schwieg.
Charlotte warf Tim einen fragenden Blick zu.
„Ich kam gerade vom Brötchenholen zurück, da stand sie klingelnd vor der Haustür.“
Vorsichtig stellte er eine große Tasse Kaffee vor Sandra ab.
„Trink erst einmal. Du zitterst ja vor Kälte.“
Sandra nahm die heiße Tasse in ihre blaugefrorenen Hände.
„Warst du etwa die ganze Nacht draußen?“, fragte Charlotte mit einem leicht vorwurfsvollen Unterton in der Stimme, doch auch dieser Versuch, das Gespräch in Gang zu bringen, scheiterte.
„Wenn du nicht sagst, was los ist, kann ich dir auch nicht helfen“, setzte sie nach, stand auf und holte drei Gläser Marmelade aus dem Schrank.
Sie spürte, wie sie langsam wieder ungeduldig wurde. So gern sie Sandra auch mochte, es war manchmal richtig anstrengend, mit ihr befreundet zu sein.
Sie war ein solcher Pechvogel, zog das Unglück förmlich an – und weidete sich dann darin. Sie konnte jammern und wehklagen, ließ sich bemuttern, bemitleiden und versorgen wie ein kleines Kind. Und immer wieder geriet sie an Männer, die sie ausnutzten, nicht ernst nahmen, mit ihr spielten.
Als sie vor acht Jahren den über 15 Jahre älteren Konstantin von Stetten kennenlernte, war das Desaster in Charlottes Augen schon vorprogrammiert. Konstantin wollte angeblich eine starke, selbstbewusste Frau, mit der er sich messen konnte. Sandra aber war zu schwach für ihn, hatte ihm nichts zu bieten, konnte ihm nichts recht machen. Warum er sie geheiratet hatte, war Charlotte schleierhaft. Die Ehe wurde zur Quälerei für alle Beteiligten – nicht zuletzt für Charlotte, bei der sich Sandra regelmäßig ausgeweint hatte. Als sich Sandra nach über fünf Jahren endlich dazu durchgerungen hatte, die Scheidung einzureichen, war sie emotional am Ende. Sie konnte ihren Beruf als Krankenschwester nicht mehr ausüben und ging regelmäßig zur Therapie.
Konstantin ließ ihr auch dann keine Ruhe. Immer wieder drangsalierte er sie, versuchte weiterhin, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten. Die gescheiterte Ehe war natürlich auch unangenehm für sein Ego. Er, der sonst immer alles im Griff hatte, sollte plötzlich jeglichen Einfluss auf seine Frau verlieren? Das konnte er nicht zulassen.
Sandra war kurz davor gewesen, den Scheidungsantrag zurückzuziehen. Allein dem Engagement Charlottes und der Anwältin war es zu verdanken, dass die Trennung auch vollzogen wurde.
In den letzten Monaten schien es Sandra wieder besser zu gehen. Sie hatte einen neuen Job, der ihr sehr viel Spaß machte und wirkte deutlich ausgeglichener – bis sie diesen Magnus kennengelernt hatte.
„Er ist nicht gekommen und meldet sich auch nicht“, wisperte sie kaum hörbar. „Dabei hat er es versprochen.“
Charlotte warf Tim einen flehenden Blick zu. Er verstand sofort, was gemeint war und verließ mit seiner Kaffeetasse die Küche. „Ich muss noch korrigieren“, verkündete er. „Ihr kommt doch sicher alleine zurecht?“
„Ich mache mir solche Sorgen, dass ihm etwas passiert ist“, brach es aus Sandra heraus, kaum, dass sich die Tür hinter Tim geschlossen hatte. „Es muss etwas passiert sein, das spüre ich!“
Sandras verzweifelte Miene versetzte Charlotte einen Stich. Die Freundin tat ihr so leid. Auf der anderen Seite hatte sie keine Ahnung, wie sie helfen konnte. Am liebsten würde sie mit ihr verreisen. Einfach für eine Woche auf die Malediven oder vielleicht doch nur in den Bayerischen Wald. Hauptsache weg von hier, weg von dem ganzen Durcheinander, dem ganzen Stress.
„Du musst mir helfen“, flehte Sandra und begann wieder zu schluchzen.
„Aber wie denn?“ Charlotte schmierte sich Butter und Marmelade auf eine Brötchenhälfte und biss mit großem Appetit hinein. Sie ahnte, dass sie an diesem Morgen noch viel Kraft brauchen würde.
„Was sollen wir denn tun?“, fragte sie mit vollen Backen.
„Wir müssen ihn suchen!“
Plötzlich waren Sandras Lebensgeister erwacht. Erwartungsvoll blickte sie Charlotte mit weit aufgerissenen Augen an, wischte sich die Tränen ab und sprang auf.
„Jetzt!“
„Aber…“
„Kein Aber! Ich will nicht länger herumsitzen und darauf warten, dass etwas passiert! Ich muss endlich selbst aktiv werden!“
Charlotte traute ihren Augen kaum.
Gerade noch hatte sie einem Häufchen Elend gegenüber gesessen, plötzlich stand da eine junge Frau voller Energie und Tatendrang.
„Zieh dich an, wir fahren zu seiner Wohnung!“
Charlotte verschluckte sich beinahe an ihrem Brötchen. Was war das denn für ein Kommandoton?
„Bitte“, setzte Sandra versöhnlich hinzu. „Ich will endlich wissen, was da los ist. Und dazu brauche ich deine Hilfe.“
Charlotte seufzte. Was blieb ihr anderes übrig?
„Gib mir noch zehn Minuten.“
Wenig später saßen sie erneut in einem Taxi – diesmal auf dem Weg zum Hirsch in die Südstadt, wo sie am vergangenen Abend ihre Fahrräder abgestellt hatten. Da keine von beiden ein Auto hatte, waren sie bei jedem Wetter das ganze Jahr mit dem Fahrrad unterwegs. Bei der angespannten Parksituation in der Stadt war das auch sehr vernünftig. Charlotte hatte mit Mühe die Freundin dazu überreden können, statt des Faschingskostüms doch vernünftige Kleidung anzuziehen und sich die Schminke aus dem Gesicht zu waschen. Dadurch, dass sie etwa die gleiche Figur hatten, konnte sich Sandra aus Charlottes Kleiderschrank etwas Passendes aussuchen.
„Weißt du denn, wo er wohnt?“, fragte Charlotte, als sie mit kalten Fingern ihr Fahrrad aufsperrte.
„Ja, in der Okenstraße 17.“
„Hat er dir das gesagt?“
„Nicht direkt“, gab Sandra verlegen zu. „Ich habe mal gehört, wie er es am Telefon jemandem gesagt hat.“
„Na dann! Auf geht´s. Es ist ja nicht so weit“, meinte Charlotte und verkniff sich jeden weiteren Kommentar.
Dick in ihre Daunenjacken, Lammfellhandschuhe und Strickmützen gepackt strampelten die beiden Frauen auf schneeglatter Fahrbahn in Richtung Norden. Nach etwa einem Kilometer erreichten sie eine kleine Querstraße der Gibitzenhofstraße – die Okenstraße. Hier im Herzen der Südstadt sahen die vierstöckigen Mietshäuser alle gleich aus.
Gelegentlich stand ein einsamer, kahler Baum am Straßenrand, als hätte er sich versehentlich hierher verirrt.
Charlotte kannte die Gegend, hatte sie doch selbst einige Jahre hier gewohnt – direkt an der Hauptstraße mit zwei Fahrbahnen in jede Richtung und der Straßenbahn in der Mitte. Es war immer laut, zu laut für Charlottes Geschmack. Die Leute hatten gesagt, sie würde sich schon an den Lärmpegel gewöhnen, aber auch nach Jahren hatte sich nicht die geringste Gewöhnung eingestellt. Um so glücklicher war sie, als sie zusammen mit Tim in die kleine Gasse in der Altstadt gezogen war, zentral gelegen und doch ruhig.
Vor dem Haus mit der Nummer 17 stiegen sie ab.
„Wie heißt er mit Nachnamen?“, fragte Charlotte, während sie den Blick auf das messingfarbene Klingelschild geheftet hatte.
„Larsson, Magnus Larsson“, antwortete Sandra und hüpfte nervös von einem Bein auf das andere.
War es richtig, Magnus einfach zu besuchen, obwohl es ganz klar war, dass er nicht wollte, dass jemand zu ihm nach Hause kam? Wie würde er reagieren? Würde er sie überhaupt hereinlassen?
Egal, das Risiko mussten sie eingehen. Sie musste einfach wissen, warum er sich am vergangenen Abend nicht gemeldet hatte, musste wissen, ob es ihm gut ging.
„Hier steht kein Magnus Larsson“, wunderte sich Charlotte.
„Bist du sicher, dass die Adresse stimmt?
„Ja, ich meine, ich denke schon, dass ich richtig gehört habe, aber warum,…“, stotterte Sandra irritiert und scannte noch einmal das Klingelschild nach dem gesuchten Namen ab.
Nichts.
Was war da los?
Hatte er sie belogen? Oder hatte sie sich nur verhört?
„Das kann doch nicht sein. Was sollen wir denn jetzt tun?“
In diesem Moment öffnete sich die Tür und ein älteres Paar trat auf die Straße heraus.
„Suchen Sie jemanden?“, fragte die Frau freundlich.
„Ja, wir wollen zu Herrn Larsson“, versuchte Charlotte ihr Glück. „Kennen Sie ihn?“
Die Frau schaute ihren Mann fragend an. „Wie soll der Mann heißen?“
„Larsson, Magnus Larsson.“
„Hier wohnt kein Larsson, ganz sicher nicht. Wissen Sie, wir wohnen seit über 50 Jahren in dieser Wohnung, und mein Mann ist seit etwa 20 Jahren der Hausmeister. Wir kennen jeden Mieter im Haus. Das tut mir leid. Vielleicht haben Sie sich ja in der Hausnummer geirrt?“
„Ja, das kann sein. Trotzdem vielen Dank und einen schönen Tag noch.“
Sandra blickte den beiden mit versteinerter Miene hinterher.
Charlotte versuchte, die Freundin aufzumuntern. „Wie wäre es mit einem zweiten Frühstück? Fahren wir doch zu dir, das ist ja nicht weit. Vielleicht hat er bei dir zu Hause auf deinem Festnetzanschluss eine Nachricht hinterlassen?“
„Ja“, rief Sandra hoffnungsvoll, „du hast recht! Ich fahre hier durch die Kälte, dabei versucht er vielleicht die ganze Zeit, mich daheim zu erreichen.“
So schnell es ihre klammen Finger zuließen, sperrte sie ihr Fahrrad wieder auf, schwang sich auf den Sattel und trat in die Pedale. „Ich fahre schon vor!“, rief sie noch schnell über die Schulter. „Bist du so lieb und bringst mir zwei Dinkelbrötchen mit?“
Und weg war sie.
„Na prima“, murmelte Charlotte missmutig vor sich hin und folgte der Freundin.
Dieser Magnus wurde ihr immer unsympathischer, obwohl sie ihn gar nicht kannte. Sie konnte diese Spielchen nicht ausstehen. Er wusste sicher alles über Sandra, während sie so gut wie nichts über ihn wusste – nicht einmal seine Adresse. Charlotte war sich sicher, dass sich Sandra nicht verhört hatte. Er hatte Okenstraße 17 gesagt, ein Haus, in dem definitiv kein Magnus Larsson wohnte.
Seufzend setzte sie sich auf ihr Rad und steuerte auf den nächsten Bäcker zu. Doch das zweite Frühstück musste warten, denn Sandra kam ihr bereits schon wieder entgegen gefahren.
„Er hat sich nicht gemeldet“, rief ihr Sandra zu. „Wir fahren jetzt zu Franky in die Findelwiesenstraße.“
Charlotte stöhnte.
Es war wirklich nicht das schönste Wetter für eine ausgedehnte Radtour durch die grauen Häuserschluchten der Nürnberger Südstadt, die selbst bei herrlichstem Frühlingswetter kein gern gewähltes Ausflugsziel waren. Aber am Faschingsdienstagmorgen bei einigen Grad unter Null war es schon fast eine Höchststrafe.
„Wer ist Franky?“, schrie sie der Freundin hinterher, doch sie erhielt keine Antwort.
Wenige Minuten später stieg sie keuchend vom Rad. Ihr Unterhemd war samt T-Shirt bereits durchgeschwitzt, der dicke Schal fühlte sich feucht an. Trotzdem öffnete sie ihre Jacke und spürte sofort, wie die Kälte auf ihren erhitzten Körper traf.
Das konnte nicht gesund sein.
Schnell schloss sie den Reißverschluss wieder und folgte Sandra, die bereits ungeduldig wartete.
„Er macht nicht auf“, jammerte sie. „Womöglich sind sie gemeinsam verschwunden?“
„Jetzt beruhige dich doch“, entgegnete Charlotte mindestens ebenso ungeduldig. Dieser jammervolle, elende Ton in Sandras Stimme machte sie wahnsinnig. Mag sein, dass Sandra verliebt war und sich Sorgen machte. Aber es ging in diesem Fall um einen äußerst unzuverlässigen Zeitgenossen, der Sandra aller Wahrscheinlichkeit nach nicht einen Bruchteil von der Zuneigung entgegen brachte, die sie an ihn verschwendete.
Er hatte die Verabredung mit ihr einfach vergessen, war mit seinen Freunden am Rosenmontag versumpft und schlief gerade irgendwo seinen Rausch aus – vermutlich hier in dieser Wohnung in der Findelwiesenstraße 1.
„Schau mal auf die Uhr. Es ist noch vor neun. Wahrscheinlich schläft dieser Franky noch. Wer ist das überhaupt?“
„Es ist Magnus` bester Freund. Er weiß bestimmt, wo er ist“, gab Sandra zurück und drückte erneut mehrmals auf die Klingel neben dem schlampig aufgeklebten Schildchen, auf dem nur noch schwach der Name Dix zu lesen war.
Frank Dix, sinnierte Charlotte, auch kein Allerweltsname.
Sie begann zu frieren. „Komm jetzt, wir frühstücken und versuchen es nachher noch einmal.“
„Ich muss wissen, was los ist“, entgegnete Sandra, ohne sich umzudrehen. „Du kannst ja nach Hause fahren, ich schaffe das schon.“
„So ein Quatsch.“ Charlotte verdrehte genervt die Augen. „Ich lasse dich doch jetzt nicht alleine hier stehen.“
Plötzlich ertönte ein leiser Summton.
„Na also“, meinte Sandra erleichtert, öffnete die schwere Tür und ging ins dunkle, muffige Treppenhaus.
„Wer ist da und was wollen Sie mitten in der Nacht?“, hörte man eine raue, verschlafene, alles andere als gut gelaunte Stimme. Eine Wohnungstür im Erdgeschoss war einen Spalt breit geöffnet. Im Dämmerlicht konnte man einen großen, schlanken, unrasierten Mann in Boxershorts und mit zerzaustem Haar erkennen. Aus der Wohnung drang eine Wolke unangenehmer Gerüche, eine Mischung aus Zigarettenrauch, Alkohol und nassem Hund.
Charlotte trat unwillkürlich einen Schritt zurück, doch Sandra schien dieser Angriff auf ihren Geruchssinn nichts auszumachen.
„Bist du Franky?“, fragte sie erwartungsvoll.
Der Mann musterte sie skeptisch von oben nach unten.
„Wer will das wissen?“
„Ich bin Sandra“, erklärte sie. „Sandra Watzlawick.“
„Na und, Sandra Watzlawick, sollte ich dich kennen?“, fragte er spöttisch.
„Ich bin die Freundin von Magnus“, ergänzte sie schnell. „Er muss doch von mir erzählt haben. Schließlich bist du doch sein bester Freund.“
Franky lachte schallend und öffnete dabei die Tür noch etwas weiter, was zur Folge hatte, dass eine weitere Duftwolke aus der Wohnung strömte und zudem auch noch einige Ursachen des strengen Geruchs sichtbar wurden.
Im Flur lagen zwei große Schäferhunde auf schmutzigen, fleckigen Kissen zwischen Bergen von Müll und starrten die Besucher aus müden Augen an. Das kleine Stückchen Teppich, das nicht von Müll bedeckt war, war von kleinen, runden Brandlöchern durchsetzt.
Aschenbecher schienen in diesem Haushalt ebenso verzichtbare Accessoires zu sein wie Besen, Staubsauger oder Putzlappen.
Charlotte konnte nur mit Mühe einen Brechreiz unterdrücken.
„Das hat er dir erzählt, der Idiot?“, presste Franky unter Gelächter hervor. Dabei präsentierte er eine Galerie reparaturbedürftiger, oder gar nicht mehr vorhandener Zähne, die bei einer möglichen Berührung mit einer Zahnbürste vermutlich sofort alle vor Schreck herausfallen würden. Dabei schätzte ihn Charlotte erst auf etwa 30 Jahre. Es war schon erschütternd, wie unwichtig manchen Leuten die eigene Gesundheit war. Wahrscheinlich hatte dieser Mann nicht einmal eine Krankenversicherung.
„Wie meinst du das?“, fragte Sandra vorsichtig nach.
Charlotte wollte das, was jetzt kam, gar nicht hören, aber Franky legte bereits los, natürlich ohne Rücksicht auf Sandras Gemütszustand.
„Du bist also seine Freundin?“, fragte er höhnisch. „Hat er dir auch von all seinen anderen Freundinnen erzählt? Ich weiß gar nicht, wieviel er momentan am laufen hat, der
Frauenheld.“
„Aber…“, stammelte Sandra mit Tränen in den Augen.
„Nichts aber, Kleines, du bist auf ihn hereingefallen, wie die anderen auch. Und das mit dem besten Freund würde ich auch ganz anders sehen.“
Er kam jetzt ganz nah an Sandra heran. Charlotte wandte sich angewidert ab.
„Magnus hat keine besten Freunde, er hat nämlich gar keine Freunde, verstehst du? Und jetzt lass mich schlafen!“
„Weißt du, wo er ist?“, rief ihm Sandra noch hinterher, kurz bevor er die Tür schließen konnte.
Franky drehte sich um und grinste überheblich.
„Man weiß nie, wo er ist.“
Krachend fiel die Tür ins Schloss.
5
Er erwachte, wusste zunächst nicht, wo er sich befand, blickte auf die Uhr: 6:45 Uhr.
Was war passiert?
Die Erkenntnis traf ihn wie ein Keulenhieb.
Er war gefangen, saß in einem feuchten Loch tief unten in den Felsengängen, tief unter der Stadt, in einem Raum, den so gut wie niemand kannte.
Man hatte ihn hierher gelockt und eingesperrt.
Er sollte sich eigentlich mit einem Freund treffen, doch niemand war gekommen.
Noch Stunden später hatte er die Hoffnung gehabt, sein Freund würde jeden Augenblick lachend in der Tür stehen und ihm fröhlich über seinen gelungenen Scherz auf die Schulter klopfen, um anschließend gemeinsam mit ihm in der Vergangenheit zu schwelgen. Niemand war gekommen.
Er war wütend geworden, hatte gebrüllt, getobt, sich die Fäuste an der Tür blutig geschlagen. Schließlich war er wohl vor Erschöpfung eingeschlafen.
Panisch warf er einen Blick auf das kleine, grüne Display eines schwarzen Kästchens, das an seinem Gürtel befestigt war – die Insulinpumpe.
Er war Diabetiker und trug seit einigen Jahren diese Pumpe, die seinem Körper in kurzen Abständen geringe Mengen Insulin verabreichte. In verschiedenen Schulungen und Seminaren hatte er gelernt, mit der Krankheit zu leben. Er war sehr gut auf das Medikament eingestellt und führte nahezu das Leben eines Gesunden – vorausgesetzt er hatte Zugang zu ausreichend Insulin.
Wie oft schon hatte er sich ausgemalt, was passieren würde, wenn er beim Joggen im Wald zusammenbrechen würde, denn beim Sport nahm er die Pumpe immer ab.
Was, wenn er entführt würde?
Er hatte diese Horrorszenarien nie zu Ende gedacht, zu beängstigend war die Vorstellung immer gewesen.
Jetzt war sie Realität!
Er saß gefangen in diesem Raum und musste hoffen, dass sein Insulinvorrat reichen würde, bis er wieder frei kam – vorausgesetzt man würde ihn überhaupt finden.
Eine Gänsehaut überzog seinen Rücken, der Schweiß brach ihm aus allen Poren, er konnte regelrecht spüren, wie sich das Adrenalin in jeder Faser seines Körpers ausbreitete und seinen Blutzuckerspiegel nach oben drückte.
„Ruhig, ganz ruhig“, murmelte er vor sich hin und versuchte die aufkeimende Panik in den Griff zu bekommen.
Mit zitternden Fingern fischte er sein Messgerät aus der Tasche, pikste sich in die Fingerkuppe, entnahm mit einem Teststreifen einen Tropfen Blut und steckte es in das Messgerät. Der Wert war nur leicht erhöht – noch!
Ein Blick auf das Display der Pumpe verriet ihm, wieviel Insulin in der Kartusche noch vorrätig war: 46 Resteinheiten, das würde für etwas mehr als drei Tage reichen – vorausgesetzt er würde nichts essen.
Bei jeder Zufuhr von Kohlenhydraten würde sein Körper mehr Insulin brauchen, was ihm dann am Ende fehlen würde.
Er schluckte, als ihm bewusst wurde, dass er sich nun würde entscheiden müssen: Entweder er aß nichts, dann reichte der Vorrat aus, um ihn etwa vier Tage am Leben zu erhalten, oder er nahm etwas zu sich, dann war die Kartusche schon entsprechend früher leer.
Er atmete tief durch, zwang sich, ruhig zu bleiben, sah sich in seinem Gefängnis um.
Es gab die feuchte Matratze, auf der er gerade saß, ein wackeliges Regal mit einigen Schokoriegeln, Salzgebäck, Chipstüten und Dosen mit Red Bull, einem koffeinhaltigen, zuckersüßen Aufputschgetränk. Am Boden standen zwei Flaschen Wasser und ein halbvoller Kasten Cola. In der Ecke entdeckte er eine Campingtoilette, von der Decke baumelte ein Kabel mit einer nackten Glühbirne, die schummriges Licht verbreitete.
Zumindest musste er nicht im Dunkeln sitzen.
Er war alleine.
16 Meter unter der Erde.
Man hatte ihn hierher gelockt, um ihn, ja, was hatte man mit ihm vor?
Wollte man ihn hier unten verrecken lassen?
Angst kroch in ihm hoch.
Entsetzliche Angst.
Er sprang auf, trommelte mit beiden Fäusten an die Tür, schrie, was seine Lungen hergaben, obwohl er wusste, dass ihn niemand hören konnte.
Verzweifelt durchsuchte er den Raum nach einem Brecheisen, einer Eisenstange oder etwas Ähnlichem, mit dem er die Tür aufbrechen konnte.
Sein Blick fiel auf das Regal. Es war aus mehreren Metallteilen zusammengeschraubt.
Vielleicht konnte er die Böden abnehmen und die Seitenträger als Brecheisen benutzen?
Hektisch fegte er alle Tüten und Dosen herunter, drehte das Gestell um und entdeckte auf der Unterseite, dass die Böden mit rostigen Schrauben fixiert waren. Ohne Werkzeug würde er die Muttern nie lösen können.
Ein kurzer Blick durch sein Gefängnis machte ihm schnell klar, dass kein gut gefüllter Werkzeugkoffer auf ihn wartete, kein Schraubenschlüssel, keine Zange, nicht einmal ein kleines Taschenmesser.
Nichts.
Dann musste es so gehen.
Er packte das Regal, versuchte, das Ende eines Seitenträgers in den winzigen Türspalt zu stecken, doch der Spalt war zu schmal.
Außer sich vor Wut schlug er mit dem Metallgestell auf die Tür ein.
Er tobte und schrie.
Vergeblich!
Die Tür blieb verschlossen.
Er war alleine, von der Außenwelt abgeschnitten.
Lebendig begraben!
6
Dunkelheit, Kälte und dichter Nebel lagen wie ein schützender Film über der langsam erwachenden Stadt. Nach dem Faschingstrubel der vergangenen Tage hing der Geruch nach Schwefel und Alkohol noch in den Ritzen, schien der Lärm der Feiernden, das Knallen der Böller und Dröhnen der Musik noch immer zwischen den Mauern nachzuhallen.
Am Aschermittwoch ist alles vorbei… von wegen.
Da fängt alles erst an.
Zumindest für Manfred Wenninger und seine Kollegen von der Stadtreinigung. Die Männer und Frauen in den dicken, orangeroten Anzügen mit den breiten Reflektorstreifen und den gefütterten Mützen auf den müden Köpfen waren bereits seit einer Stunde unterwegs, um die Hinterlassenschaften der Nachtschwärmer zu beseitigen. Fluchend stocherten sie mit den langen Borsten ihrer groben Besen im Schnee nach Pappbechern, Papiertüten und Plastikflaschen.
Diese Wetterlage war so ziemlich das Schlimmste, was ihnen am Aschermittwoch passieren konnte:
Schnee und Frost.
Tagsüber würde der Schnee etwas antauen – es waren für heute erstmals Plusgrade gemeldet – nur um nachts dann wieder festzufrieren, zusammen mit all dem Müll. Womöglich würde der ganze Dreck dann auch noch mit einer dichten Neuschneedecke zugeschneit werden. Wenn dann endlich Tauwetter einsetzte, hätte man eine unerträgliche Mischung aus Schneematsch und altem, halb vergammeltem, schmierigem Müll. Und dann würde es wieder heißen, die Stadtreinigung habe versagt.
Nein! Manfred Wenninger wollte dieses Horrorszenario unter allen Umständen vermeiden und hatte seine Mitarbeiter heute bereits eine Stunde früher als sonst zum Dienst eingeteilt. Schließlich nahm er seinen Job ernst und ließ sich keine Nachlässigkeit vorwerfen.
Obwohl die Stadtreinigung seit Jahren schon mit modernen Kehrfahrzeugen ausgestattet war, war heute auf dem steilen, eisglatten und verschneiten Kopfsteinpflaster des Burgberges Handarbeit gefragt.
Die orangeroten Gestalten hatten ihr Fahrzeug auf dem Sebalder Platz abgestellt und arbeiteten sich nun schweigend, wie einst Beppo Straßenkehrer in Michael Endes Roman Momo, in Richtung Dürerplatz voran.
„Franz!“, rief Manfred Wenninger einem seiner Kollegen zu und deutete auf einen ansehnlichen Müllhaufen, den er eben aufgeschichtet hatte. „Ich hab wieder einen!“
Franz Schobert, dem wegen seines Namens immer wieder scherzhalber ein außergewöhnliches musikalisches Talent unterstellt wurde, winkte zurück und schob seine riesige Schubkarre den Berg hinauf.
Während Franz Schobert den vorbereiteten Haufen in seine bereits mehr als halbvolle Karre schaufelte, wandte sich Manfred den nächsten Böllerresten, Fast-Food-Tüten und Zigarettenschachteln zu.
Er liebte seinen Job, liebte das gleichförmige, rhythmische Kehren an der frischen Luft, liebte die sauberen Straßen, die er hinterließ. Es hatte beinahe etwas Meditatives, Beruhigendes. Er konnte seine Gedanken schweifen lassen, überlegen, was er nach Dienstschluss machen, wohin er im nächsten Urlaub fahren möchte.
Inzwischen hatte er das Dürer-Denkmal erreicht.
Mächtig und imposant stand Albrecht in seinem edlen Mantel und mit wallendem Haar auf einem steinernen Sockel und blickte hinab auf seine Stadt. Im Sommer saßen fast die ganze Nacht junge Leute auf den Stufen zu seinen Füßen, rauchten, tranken Bier oder ließen sich ein Bratwurstbrötchen schmecken.
Schade eigentlich, dass der Platz um den berühmtesten Sohn der Stadt herum so langweilig war, so wenig imposant und mächtig, so gar nicht der Prominenz des Mannes in Stein angemessen. Parkende Autos, gleichförmige Wohnhäuser aus den 50er Jahren, eine Apotheke. Vielleicht tröstete es ihn, dass er direkt hinüber zur Agnesgasse sehen konnte, jener schmalen, hübschen Gasse, die nach seiner Frau benannt worden war, wenngleich man Agnes Dürer auch eine Mitschuld am frühen Ableben ihres Gatten nachsagte. Sie sei ein pöses weip gewesen und habe an seinem Herzen genagt, hieß es.
Manfred musste lächeln.
Er interessierte sich sehr für die Geschichte Nürnbergs und liebte solche Anekdoten. Erst kürzlich hatte er erfahren, dass der steinerne Mantel des Künstlers am Rücken einen Flicken hat, ein Zeichen dafür, dass es seine Frau wohl mit ihren hauswirtschaftlichen Pflichten nicht ganz ernst genommen haben musste.
Langsam umrundete er den Sockel und stieß plötzlich mit seinem Besen an einen Turnschuh.