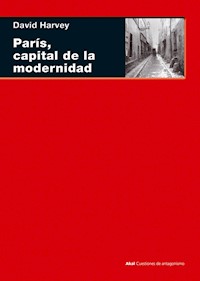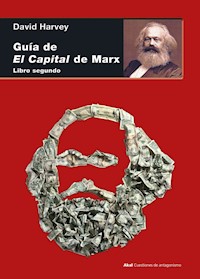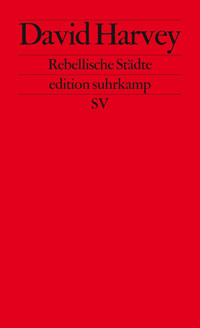
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dass Städte politische Räume sind, verrät bereits die Herkunft des Wortes Politik vom griechischen »polis«. In Städten wird regiert und demonstriert, zuletzt in Kairo oder New York. In Städte wird aber auch investiert, Geld verwandelt sich in Häuser, in Wolkenkratzer und Vorortsiedlungen. Und schließlich ist Stadtplanung spätestens seit dem Umbau von Paris durch Georges-Eugènes Haussmann immer zugleich ein Instrument der politischen Kontrolle. All diesen Themen geht David Harvey in »Rebellische Städte» nach. Er befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Hochhausboom und Wirtschaftskrise, mit dem rasanten Wachstum chinesischer Städte und erkundet das emanzipatorische Potenzial urbaner Protestbewegungen wie »Occupy Wall Street« und »Recht auf Stadt«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Dass Städte politische Räume sind, verrät bereits die Herkunft des Wortes Politik vom griechischen polis. In Städten wird regiert und demonstriert, zuletzt in Kairo oder New York, Athen oder Madrid. In Städte wird aber auch investiert, Geld verwandelt sich in Häuser, in Wolkenkratzer und Vorortsiedlungen. Und schließlich ist Stadtplanung spätestens seit dem Umbau von Paris durch Georges-Eugène Haussmann immer zugleich ein Instrument der politischen Kontrolle. All diesen Themen geht David Harvey in Rebellische Städte nach. Er befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Hochhausboom und Wirtschaftskrise, mit dem rasanten Wachstum chinesischer Städte und erkundet das emanzipatorische Potenzial urbaner Protestbewegungen wie Occupy Wall Street und Recht auf Stadt.
David Harvey, geboren 1935, ist einer der einflussreichsten Sozialwissenschaftler der Gegenwart. Der überzeugte Marxist lehrte unter anderem in Oxford, an der Johns Hopkins University in Baltimore und an der London School of Economics. Er gilt als meistzitierter Geograf der Welt.
David Harvey
Rebellische Städte
Vom Recht auf Stadt zur urbanen Revolution
Aus dem Englischen von Yasemin Dinçer
Suhrkamp
Die Originalausgabe dieses Buches erschien unter dem Titel Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution 2012 bei Verso (London/New York). Die Originalausgabe enthält als eine Art Anhang zwei zusätzliche, eher journalistisch angelegte Kapitel zu den Protesten in London im Jahr 2011 und zu Occupy Wall Street, die nicht in die deutsche Ausgabe übernommen wurden.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Deutsche Erstausgabe
© Suhrkamp Verlag Berlin 2013
© David Harvey 2012
Suhrkamp Taschenbuch Verlag
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-78620-8
www.suhrkamp.de
Inhalt
Vorwort: Henri Lefebvres Vision
Erster Teil: Das Recht auf Stadt
1. Das Recht auf Stadt
2. Die urbanen Wurzeln kapitalistischer Krisen
3. Die Erschaffung der urbanen Allmende
4. Die Kunst der Rente
Zweiter Teil: Rebellische Städte
5. Die Stadt für den antikapitalistischen Kampf zurückerobern
Bildnachweise
Anmerkungen
Für Delfina und alle, die auch gerade irgendwo auf der Welt ihr Studium abschließen.
Vorwort Henri Lefebvres Vision
Irgendwann Mitte der siebziger Jahre entdeckte ich in Paris ein Plakat der Écologistes, einer radikalen Stadtteilbewegung für ein ökologisch bewussteres urbanes Leben, auf dem sie ihre alternative Vision für die Stadt darstellten. Es zeigte ein herrlich spielerisches Panorama des durch ein reges Nachbarschaftsleben wieder aufgeblühten alten Paris mit Blumen auf den Balkonen, Plätzen, auf denen sich Erwachsene und Kinder tummelten, kleinen Geschäften und Werkstätten, deren Türen allen offenstanden, Dutzenden Cafés, sprudelnden Springbrunnen, Menschen, die sich am Flussufer vergnügten, und mehreren Gemeinschaftsgärten (womöglich habe ich diesen Teil in meiner Erinnerung dazugedichtet); ein Paris, in dem man offenkundig noch genügend Zeit hatte, um sich zu unterhalten oder seine Pfeife zu rauchen (eine Angewohnheit, die zu jener Zeit noch nicht verteufelt wurde, wie ich zu meinem Leidwesen feststellen musste, als ich einmal an einem Nachbarschaftstreffen der Écologistes in einem mit dichtem Rauch gefüllten Raum teilnahm). Ich fand das Plakat großartig, doch nach einigen Jahren war es so zerfleddert und zerrissen, dass ich es zu meinem großen Bedauern wegwerfen musste. Ich wünschte, ich hätte es noch! Man sollte es neu drucken lassen.
Dieses Bild stand in einem drastischen Gegensatz zum neuen Paris, das gerade im Entstehen war und dabei das alte zu verschlingen drohte. Die hohen »Gebäuderiesen« um die Place d’Italie herum drohten in die Altstadt vorzudringen und dem scheußlichen Tour Montparnasse die Hand zu reichen. Hinzu kamen die geplante Schnellstraße am linken Seine-Ufer, die seelenlosen Hochhäuser des sozialen Wohnungsbaus (habitation à loyer modéré oder kurz HLM) draußen im 13. Arrondissement und in den Vorstädten, die monopolisierte Kommodifizierung auf den Straßen, der Zusammenbruch des dynamischen Stadtteillebens, das früher das Marais mit seinen vielen kleinen Handwerksbetrieben geprägt hatte, die zerfallenden Häuser von Belleville und die phantastische Architektur der Place des Vosges, die auf die Straßen bröckelte. Ich stieß auf eine weitere Zeichnung (dieses Mal von Jean-François Batellier, einem politischen Karikaturisten). Sie zeigte einen Mähdrescher, der die alten Viertel von Paris zerstört und verschlingt und hinter sich ordentlich aufgereihte HLM-Hochhäuser zurücklässt. Ich verwendete sie als Schlüsselbild in meinem Buch The Condition of Postmodernity (1989).
Paris befand sich seit Mitte der sechziger Jahre sichtbar in einer Existenzkrise. Das Alte konnte nicht fortbestehen, doch das Neue war einfach zu scheußlich, abweisend und trist, um ausführlicher darüber nachzudenken. Jean-Luc Godards Film Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß von 1967 fängt das Bewusstsein dieser Zeit wunderbar ein. Er zeigt verheiratete Mütter, die sowohl aus Langeweile als auch aus finanzieller Not einer täglichen Routine der Prostitution nachgehen, vor dem Hintergrund der Invasion von Paris durch amerikanisches Unternehmenskapital, des Vietnamkriegs (einst eine französische Angelegenheit, die jedoch damals schon von den Amerikanern übernommen worden war), eines Baubooms bei Autobahnen und Hochhäusern und des einsetzenden blindwütigen Konsums in den Straßen und Geschäften der Stadt. Ich jedenfalls konnte mit Godards philosophischem Ansatz nichts anfangen – mit dieser Art zweifelndem, wehmütigem, an Wittgenstein erinnerndem Vorläufer der Postmoderne, in der weder im Zentrum des Selbst noch dem der Gesellschaft irgendetwas von Bestand ist.
Ebenfalls 1967 schrieb Henri Lefebvre seinen grundlegenden Essay Le droit à la ville. Dieses Recht, beteuerte er, war sowohl ein Aufschrei als auch eine Forderung. Der Aufschrei war eine Antwort auf den existenziellen Schmerz, den das Verdorren des alltäglichen Stadtlebens verursachte. Die Forderung war eigentlich mehr ein Befehl, dieser Krise fest ins Auge zu blicken und ein alternatives urbanes Leben zu entwerfen, das weniger entfremdet, sinnstiftender, spielerischer, dabei aber – wie immer bei Lefebvre – auch konfliktreich und dialektisch ist, offen für das Entstehende, für Begegnungen (beängstigender und angenehmer Art) und für das ständige Streben nach dem bislang unbekannten Neuen.1
Wir Akademiker verstehen uns darauf, die Genealogie von Ideen zu rekonstruieren. Wir können also Lefebvres Arbeiten aus jener Zeit nehmen und hier ein wenig Heidegger ausfindig machen, dort Nietzsche, an anderer Stelle Fourier, eine implizite Kritik an Althusser und Foucault sowie, natürlich, den unvermeidlichen, von Marx gesetzten Rahmen. Die Tatsache, dass dieser Essay zum hundertjährigen Jubiläum der Veröffentlichung des ersten Bandes von DasKapital erschien, scheint erwähnenswert, da sie, wie wir noch feststellen werden, von einiger politischer Bedeutung ist. Was wir Akademiker allerdings häufig übersehen, ist die Rolle, die die auf den Straßen um uns herum aufkommende Empfindsamkeit spielt, das unvermeidliche Gefühl des Verlusts, das durch die Zerstörungen hervorgerufen wird, und das, was geschieht, wenn ganze Viertel (wie Les Halles) umgewandelt werden oder grands ensembles scheinbar aus dem Nichts entstehen. Diese Gefühle verbinden sich oft mit der Erregung oder dem Zorn, die sich bei Straßendemonstrationen gegen die verschiedensten Dinge Bahn brechen, mit den Hoffnungen, die man in Bezug auf die Wiederbelebung von Stadtteilen durch Immigranten setzt (man denke an die vorzüglichen vietnamesischen Restaurants inmitten der Sozialwohnungen im 13. Arrondissement), und mit der Verzweiflung, die aus der tristen Hoffnungslosigkeit der Ausgrenzung erwächst, aus den Repressionen der Polizei und aus der Situation arbeitsloser Jugendlicher, verloren in der reinen Langeweile und Vernachlässigung der seelenlosen Vorstädte, die schließlich zum Schauplatz aufgebrachter Unruhen werden.
Ich bin mir sicher, dass Lefebvre sich all dessen zutiefst bewusst war – und zwar nicht nur aufgrund seiner offenkundigen früheren Begeisterung für die Situationisten und deren theoretische Verbundenheit mit der Idee einer Psychogeografie der Stadt, mit dem Erlebnis des Umherschweifens (dérive) im urbanen Raum von Paris und dem Ausgesetztsein gegenüber dem Spektakel. Er brauchte wahrscheinlich nur seine Wohnung in der Rue Rambuteau zu verlassen, um all seine Sinne anzuregen. Aus diesem Grund halte ich es für äußerst bedeutsam, dass er Le droit à la ville vor Aufstand in Frankreich aus dem Mai 1968 geschrieben hat. Der Essay bildet eine Situation ab, in der solch ein Aufstand nicht nur möglich, sondern nahezu unausweichlich erscheint (und Lefebvre trug in Nanterre seinen eigenen kleinen Teil dazu bei). Dennoch finden die urbanen Wurzeln der Achtundsechziger-Bewegung in späteren Darstellungen der Ereignisse kaum Beachtung. Ich vermute, dass die damals existierenden städtischen sozialen Bewegungen – beispielsweise die Umweltbewegung – mit dieser Revolte verschmolzen und auf komplizierte, wenn auch verborgene Weise dazu beitrugen, ihre politischen und kulturellen Forderungen auszuformulieren. Außerdem vermute ich, auch wenn ich es nicht beweisen kann, dass die kulturellen Transformationen, die in der Folge im urbanen Leben stattfanden, als das nackte Kapital sich die Maske des Warenfetischismus, des Nischenmarketings und des stadtkulturellen Konsumismus überzog, bei Weitem nicht unschuldig an der Befriedung waren, die bald nach 1968 einsetzte (zum Beispiel wandelte sich die von Jean-Paul Sartre und anderen gegründete Zeitung Libération ab Mitte der siebziger Jahre zu einem Blatt, das kulturell zwar radikal und individualistisch, politisch aber lauwarm, wenn nicht gar feindlich eingestellt war gegenüber einer ernsthaft linken und kollektivistischen Politik).
Ich merke diese Dinge an, da die Idee des Rechts auf Stadt in den letzten zehn Jahren ein gewisses Revival erlebt hat und dieser Umstand nicht durch das intellektuelle Vermächtnis Lefebvres (so wichtig dieses auch sein mag) erklärt werden kann. Was auf den Straßen und innerhalb der sozialen Bewegungen der Städte passiert ist, hat viel größere Bedeutung. Und ich bin mir sicher, dass Lefebvre als großer Dialektiker und immanenter Kritiker des urbanen Alltagslebens dem zustimmen würde. Beispielsweise muss die Tatsache, dass das merkwürdige Aufeinanderprallen von Neoliberalismus und Demokratisierung im Brasilien der neunziger Jahre Bestimmungen in der brasilianischen Verfassung von 2001 hervorgebracht hat, die das Recht auf Stadt garantieren, der Kraft und Bedeutung zugeschrieben werden, die urbane soziale Bewegungen (vor allem in Bezug auf die Wohnverhältnisse) für den Demokratisierungsprozess haben. Dieser verfassungsrechtliche Moment trug zur Festigung und Beförderung einer aktiven Mentalität der »rebellischen Bürgerschaft« (wie der Anthropologe James Holston es nennt) bei, was nicht auf Lefebvres Vermächtnis zurückzuführen ist, sondern auf die andauernden Kämpfe darum, wer die Beschaffenheit des urbanen Alltagslebens formen darf.2 Und wenn Konzepte wie jenes der »Bürgerhaushalte«, die es normalen Stadtbewohnern ermöglichen, sich im Rahmen demokratischer Entscheidungsprozesse direkt an der Verteilung der städtischen Haushaltsmittel zu beteiligen, so viele begeistern, hängt das damit zusammen, dass viele Menschen eine Antwort auf einen internationalen Kapitalismus suchen, der die neoliberale Reformagenda auf brutale Weise durchsetzt und dessen Angriffe auf die alltägliche Lebensqualität sich seit den frühen Neunzigern zuspitzen. Es überrascht auch nicht, dass dieses Modell ausgerechnet im brasilianischen Porto Alegre entwickelt wurde – dem zentralen Ort des Weltsozialforums.
Ein anderes Beispiel: Als die verschiedensten sozialen Bewegungen im Juni 2007 beim US-Sozialforum in Atlanta zusammenkamen und sich – unter anderem inspiriert durch die Erfolge der sozialen Bewegungen in Brasilien – entschlossen, ein landesweites Bündnis für das Recht auf Stadt zu gründen (mit aktiven Ortsgruppen in Städten wie New York und Los Angeles), kannten die meisten Teilnehmer nicht einmal Lefebvres Namen. Sie waren nach Jahren der Anstrengungen in ihren jeweiligen Problemfeldern (Obdachlosigkeit, Gentrifizierung und Verdrängung, Kriminalisierung der Armen und Andersartigen und so weiter) jeweils für sich zu dem Schluss gekommen, dass der Kampf um die Stadt als Ganzes den Rahmen für ihre eigenen Kämpfe bildete. Sie glaubten, dass sie gemeinsam mehr erreichen konnten. Und wenn sich an anderen Orten ähnliche Bewegungen finden lassen, hat auch das nicht einfach mit einer Art Treue zu Lefebvres Gedanken zu tun, sondern damit, dass seine Gedanken, genau wie ihre eigenen, anfänglich den Straßen und Vierteln der notleidenden Städte entsprungen waren. Folglich werden in einem kürzlich erschienenen Sammelband Aktivitäten von Bewegungen für das Recht auf Stadt (wenn auch verschiedener Ausrichtungen) in Dutzenden Städten rund um den Globus registriert.3
Halten wir also noch einmal fest: Die Vorstellung von einem Recht auf Stadt entspringt nicht vorrangig irgendwelchen intellektuellen Interessen und Modeerscheinungen (auch wenn es davon genügend gibt, wie wir wissen). Sie erhebt sich ursprünglich aus den Straßen und Stadtvierteln, als Ruf der Unterdrückten nach Hilfe und Unterstützung in verzweifelten Situationen. Wie reagieren also die Akademiker und Intellektuellen (sowohl die organischen als auch die traditionellen, wie Gramsci sagen würde) auf diesen Aufschrei und diese Forderung? Hier erscheint eine Betrachtung von Lefebvres Antwort hilfreich – nicht etwa, weil sie eine Blaupause liefern würde (unsere heutige Lage unterscheidet sich zu stark von der in den sechziger Jahren, und die Straßen von Mumbai, Los Angeles, São Paulo und Johannesburg sind nicht die Straßen von Paris), sondern weil seine dialektische Methode der immanenten kritischen Untersuchung eine Inspirationsquelle dafür liefern kann, wie wir auf diesen Aufschrei und diese Forderung reagieren könnten.
Insbesondere nach seiner 1965 veröffentlichten Studie über die Pariser Kommune (die zum Teil durch die Thesen der Situationisten beeinflusst wurde) verstand Lefebvre nur zu gut, dass revolutionäre Bewegungen oft, wenn nicht gar immer, eine urbane Dimension annehmen. Damit stand er im Widerspruch zur kommunistischen Partei, der zufolge das Proletariat aus den Fabriken die Vorhut des revolutionären Wandels darstellte. Wenn Lefebvre dem hundertsten Jahrestag der Publikation von Marx’ Kapital mit einer Abhandlung zum Recht auf Stadt gedachte, dann war er damit sicher auf eine Provokation des konventionellen marxistischen Denkens aus, das dem Urbanen nie viel Bedeutung innerhalb der revolutionären Strategie beigemessen hatte, obgleich es die Pariser Kommune als zentrales Ereignis in der Geschichte dieser Bewegung betrachtete.
Indem er in seinem Text immer wieder die »Arbeiterklasse« als Akteur des revolutionären Wandels heraufbeschwor, legte Lefebvre stillschweigend nahe, dass die revolutionäre Arbeiterklasse eher auf städtischen als nur auf Fabrikarbeitern gründete. Wie er später bemerkte, ist dies eine ganz andere Art von sozialer Formation – fragmentarisch und gespalten, vielfältig in ihren Zielen und Bedürfnissen, eher wandernd, desorganisiert und flüchtig als fest verwurzelt. Dieser These habe ich schon immer zugestimmt (sogar noch bevor ich Lefebvre gelesen hatte), und spätere Arbeiten innerhalb der Stadtsoziologie (vor allem von Manuel Castells, einem ehemaligen, wenn auch abtrünnigen Schüler Lefebvres) erweiterten diese Idee. Doch noch immer tut sich ein großer Teil der traditionellen Linken schwer, was die Auseinandersetzung mit dem revolutionären Potenzial urbaner sozialer Bewegungen angeht. Diese werden häufig als rein reformistische Versuche abgetan, spezielle (statt systembedingte) Probleme zu bewältigen, womit sie weder revolutionäre noch authentische Klassenbewegungen wären.
Daher besteht eine gewisse Kontinuität zwischen Lefebvres situationistischer Streitschrift und den Arbeiten derer von uns, die heute versuchen, das Recht auf Stadt aus einer revolutionären statt reformistischen Perspektive heraus zu betrachten. Womöglich hat sich die Logik hinter Lefebvres Position in unserer Zeit noch verschärft. In weiten Teilen der fortgeschrittenen kapitalistischen Welt sind die Fabriken entweder ganz verschwunden oder so sehr reduziert worden, dass die klassische industrielle Arbeiterklasse stark geschwächt wurde. Die wichtige und stetig wachsende Arbeit, das urbane Leben herzustellen und aufrechtzuerhalten, wird vermehrt von ungesicherten, oft in Teilzeit beschäftigten und desorganisierten schlecht bezahlten Arbeitskräften geleistet. Das sogenannte »Prekariat« hat das traditionelle »Proletariat« ersetzt. Wenn es heute eine revolutionäre Bewegung in unserem Teil der Welt (im Gegensatz zum sich industrialisierenden China) geben soll, muss mit dem problematischen und desorganisierten »Prekariat« gerechnet werden. Wie diese verschiedenen Gruppen sich zu einer revolutionären Kraft organisieren könnten, stellt ein großes politisches Problem dar. Ein Teil der Aufgabe besteht darin, die Ursprünge und das Wesen ihrer Aufschreie und Forderungen zu verstehen.
Ich weiß nicht, wie Lefebvre auf die auf dem Plakat dargestellte Vision der Écologistes reagiert hätte. Wahrscheinlich hätte er, genau wie ich, über diese spielerische Vision gelächelt, doch seine Thesen zur Stadt, die er in Le droit à la ville und Die Revolution der Städte (1970) erörterte, legen nahe, dass er auch ihre nostalgische Sehnsucht nach einem Urbanismus kritisiert hätte, der so nie existiert hat. Denn Lefebvres zentrale Schlussfolgerung lautete, dass die Stadt, wie wir sie einst gekannt und uns vorgestellt hatten, rasch verschwunden und nicht wiederherzustellen war. Ich würde dem zustimmen und diese Position sogar noch mit mehr Nachdruck vorbringen, da Lefebvre sich nur sehr wenig Mühe gab, die miserablen Lebensbedingungen der Massen in einigen seiner Lieblingsstädte der Vergangenheit (die toskanischen Städte der italienischen Renaissance) darzustellen. Er befasste sich auch nicht näher mit der Tatsache, dass 1945 die meisten Einwohner von Paris ohne Innentoilette in scheußlichen Wohnverhältnissen (im Winter mussten sie frieren, im Sommer war es heiß wie im Backofen) in zerfallenden Vierteln lebten, wogegen etwas getan werden musste und – zumindest im Laufe der sechziger Jahre – auch getan wurde. Das Problem dabei war, dass die Veränderungen von einem dirigistischen französischen Staat ohne den geringsten demokratischen Beitrag oder auch nur einen Hauch spielerischer Phantasie organisiert und ausgeführt wurden und dass sie bloß dazu dienten, ein von Klassenprivilegien und Herrschaft geprägtes Verhältnis in die physische Stadtlandschaft einzugravieren.
Lefebvre erkannte ebenfalls, dass die Beziehung zwischen dem Urbanen und dem Dörflichen – oder, wie die Briten es gern nennen, zwischen Stadt und Land – einem radikalen Wandel unterlag, der den traditionellen Bauernstand verschwinden ließ und das Land urbanisierte, allerdings auf eine Art und Weise, die eine neue Konsumhaltung gegenüber der Natur (von Wochenenden und Freizeit auf dem Land bis zu den ausgedehnten begrünten Vororten) und – im Gegensatz zu einer bäuerlichen Subsistenzwirtschaft – eine kapitalistische, ja produktivistische Haltung gegenüber der Versorgung urbaner Märkte mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen ermöglichte. Überdies sah er voraus, dass dieser Prozess sich globalisieren würde und dass unter diesen Bedingungen die Frage nach dem Recht auf Stadt (konstruiert als ausgeprägter oder genau bestimmbarer Gegenstand) einer vageren Frage nach dem Recht auf urbanes Leben weichen musste, die sich in seinem Denken später in die allgemeinere Frage nach dem Recht auf die Produktion des Raumes (La production de l’espace, 1974) verwandelte.
Das Verblassen der Trennlinie zwischen Stadt und Land ist weltweit in unterschiedlichem Tempo vorangeschritten, doch ohne Zweifel ist dabei die von Lefebvre vorausgesehene Richtung eingeschlagen worden. Die jüngste, chaotische Urbanisierung Chinas ist dafür ein typisches Beispiel: Der Anteil der Landbevölkerung sank von 74 Prozent im Jahr 1990 auf etwa 50 Prozent im Jahr 2010, und die Einwohnerzahl des Verwaltungsgebiets der Stadt Chongqing hat sich in einem halben Jahrhundert um fast 30 Millionen vergrößert. Auch wenn in der Weltwirtschaft noch viele Orte übrig geblieben sind, an denen dieser Prozess längst nicht abgeschlossen ist, wird die Masse der Menschheit zunehmend von der Gärung und den Gegenströmungen des urbanisierten Lebens verschluckt.
Dies stellt uns vor ein Problem: Das Recht auf Stadt zu beanspruchen bedeutet faktisch, ein Recht auf etwas zu beanspruchen, das nicht mehr existiert (wenn es überhaupt je wirklich existiert hat). Zudem ist das Recht auf Stadt ein leerer Signifikant. Alles hängt davon ab, wer ihn mit einer Bedeutung füllen darf. Die Finanziers und Bauunternehmer können darauf Anspruch erheben und haben auch jedes Recht dazu. Es gilt aber ebenso für die Obdachlosen und die sans-papiers. Wir müssen uns unvermeidlich die Frage stellen, wessen Rechte identifiziert werden, wobei wir anerkennen, wie Marx es im Kapital ausdrückt, dass zwischen gleichen Rechten die Gewalt entscheidet. Die Definition des Rechts selbst ist Gegenstand eines Kampfes, und dieser muss den Kampf um die Verwirklichung dieses Rechts begleiten.
Die traditionelle Stadt ist von der zügellosen kapitalistischen Entwicklung zerstört worden, sie ist dem endlosen Bedürfnis, überakkumuliertes Kapital zu investieren, zum Opfer gefallen, so dass wir uns auf ein endlos wucherndes urbanes Wachstum zubewegen, das keine Rücksicht auf die sozialen, ökologischen oder politischen Konsequenzen nimmt. Lefebvre zufolge ist es unsere politische Aufgabe, aus dem furchtbaren Chaos heraus, welches das Amok laufende, globalisierende und urbanisierende Kapital anrichtet, eine völlig andere Art von Stadt zu entwerfen bzw. wiederherzustellen. Dies ist jedoch nicht möglich ohne die Bildung einer starken antikapitalistischen Bewegung, die die Transformation des städtischen Alltags zum Hauptziel hat.
Wie Lefebvre aus der Geschichte der Pariser Kommune bekannt war, handelt es sich beim Sozialismus, Kommunismus oder auch Anarchismus um ein unmögliches Unterfangen, solange es auf eine einzelne Stadt beschränkt bleibt. Die Kräfte der bürgerlichen Reaktion haben es dann einfach zu leicht, die Stadt zu umzingeln, ihre Versorgungswege zu unterbrechen, sie auszuhungern oder gar in sie einzumarschieren und alle, die ihnen Widerstand leisten, niederzumetzeln (wie 1871 in Paris geschehen). Das bedeutet indes nicht, dass wir die Stadt als Brutkasten revolutionärer Ideen, Ideale und Bewegungen aufgeben müssen. Nur wenn die Politik sich auf die Produktion und Reproduktion des urbanen Lebens als zentralen Arbeitsprozess konzentriert, aus dem revolutionäre Impulse entstehen, wird es möglich sein, antikapitalistische Kämpfe zu mobilisieren, die das Alltagsleben radikal verändern können. Erst wenn sich die Einsicht durchgesetzt hat, dass diejenigen, die das städtische Leben aufbauen und aufrechterhalten, einen primären Anspruch auf das haben, was sie produzieren, und dass sie unter anderem das nichtentfremdete Recht darauf beanspruchen, die Stadt stärker nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten, werden wir zu einer sinnvollen Politik des Urbanen gelangen. Lefebvre scheint zu rufen: »Die Stadt mag tot sein, lang lebe die Stadt!«
Jagt man mit dem Recht auf Stadt also einem Hirngespinst hinterher? In rein materieller Hinsicht ist das sicher der Fall. Doch politische Kämpfe werden ebenso sehr von Visionen wie von praktischem Denken angeregt. Die Gruppen innerhalb der Allianz für das Recht auf Stadt bestehen aus einkommensschwachen Mietern in nichtweißen Gemeinden, die für eine ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechende Entwicklung kämpfen; Obdachlosen, die sich für ihr Recht auf Wohnraum und die Versorgung mit grundlegenden öffentlichen Gütern organisieren; nichtweißen LGBT*-Jugendlichen, die für ihr Recht auf sichere öffentliche Räume eintreten. Innerhalb der kollektiven politischen Plattform, die das Bündnis für New York gestaltet hat, wurde eine klarere und umfassendere Definition von Öffentlichkeit angestrebt, die nicht nur den sogenannten öffentlichen Raum tatsächlich einnehmen darf, sondern auch ermächtigt werden kann, neue gemeinschaftliche Orte für das Zusammenkommen und politische Aktionen zu schaffen. Die ikonische und symbolische Geschichte des Begriffs »Stadt« ist tief verwurzelt im Streben nach politischen Bedeutungen. Die Stadt Gottes, die Stadt auf dem Hügel, die Beziehung zwischen Stadt und Bürgerschaft – die Stadt als Objekt utopischer Sehnsüchte, als entscheidender Ort der Zugehörigkeit in einer sich ständig verlagernden raum-zeitlichen Ordnung – verleihen dem Begriff eine politische Bedeutung, die eine überaus mächtige politische Vorstellungswelt aktiviert. Doch laut Lefebvre, der in dieser Hinsicht gewiss den Situationisten zustimmt, wenn nicht gar folgt, gibt es im urbanen Raum bereits die unterschiedlichsten sozialen Praktiken, die vor alternativen Möglichkeiten ihrerseits nur so strotzen.
Lefebvres Konzept der Heterotopie (das sich vollkommen von Foucaults unterscheidet) steckt soziale Möglichkeitsräume ab, in denen »etwas anderes« nicht nur möglich, sondern grundlegend dafür ist, welche Richtung eine revolutionäre Entwicklung nimmt. Dieses »Andere« entsteht nicht notwendigerweise aus einem bewussten Vorhaben, sondern einfach aus dem heraus, was Menschen tun, fühlen, empfinden und zu artikulieren lernen, während sie in ihrem Alltag nach Sinn suchen. Solche Praktiken lassen überall heterotopische Räume entstehen. Wir müssen nicht auf die große Revolution warten, um diese Räume zu konstituieren. In Lefebvres Theorie revolutionärer Bewegungen stellt es sich genau andersherum dar: Ihm geht es darum, dass unterschiedliche heterotopische Gruppen im Moment eines plötzlichen Aufstands zusammentreffen und, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick, erkennen, dass sie durch kollektives Handeln die Möglichkeit haben, etwas radikal Neues zu erschaffen.
Dieses Zusammentreffen wird für Lefebvre durch die Suche nach Zentralität, nach einem zentralen Ort symbolisiert. Die traditionellen politischen Zentren der Städte sind zerstört worden. Es gibt allerdings die Sehnsucht, sie wiederherzustellen, und der entsprechende Impuls kommt immer wieder zum Vorschein, was dann weitreichende politische Auswirkungen zur Folge hat, wie wir kürzlich auf den zentralen Plätzen von Kairo, Madrid, Athen und Barcelona, im New Yorker Zuccotti Park und sogar in Madison, im US-Bundesstaat Wisconsin, gesehen haben. Wie sonst und wo sonst können wir zusammenkommen, um unserem kollektiven Aufschrei und unseren Forderungen Gehör zu verschaffen?
An diesem Punkt zerschellt jedoch die urbane Revolutionsromantik, die heute so viele Menschen Lefebvre zuschreiben und an ihm lieben, am Felsen seines Verständnisses der realen kapitalistischen Gegebenheiten und der Macht des Kapitals. Ein spontaner Moment alternativer Visionen ist immer flüchtig; wenn es nicht gelingt, die Flut zu nutzen, geht der Augenblick ohne Zweifel vorüber (wie Lefebvre 1968 in den Straßen von Paris selbst beobachten konnte). Dasselbe gilt für die heterotopischen Orte der Abweichung, die den revolutionären Bewegungen Nährboden bieten. In Die Revolution der Städte beschrieb er das Spannungsfeld (nicht so sehr die Alternative) zwischen Heterotopie (urbanen Praktiken), Isotopie (der durchgesetzten, rationalisierten räumlichen Ordnung des Kapitalismus und des Staates) und der Utopie als expressivem Begehren. »Der Unterschied ›Isotopie-Heterotopie‹ kann«, so sein Argument, »nur richtig verstanden werden, wenn er dynamisch begriffen wird. […] Anomische Gruppen formen heterotopische Räume, deren sich die herrschende Praxis früher oder später erneut bemächtigt.«4
Lefebvre war sich der Macht und Stärke der vorherrschenden Praktiken zu bewusst, um nicht zu erkennen, dass das Ziel letztendlich darin bestehen muss, diese Praktiken durch eine viel breitere revolutionäre Bewegung abzuschaffen. Das gesamte kapitalistische System der permanenten Akkumulation muss mitsamt der es begleitenden Strukturen der ausbeuterischen Klassen- und Staatsmacht umgestürzt und ersetzt werden. Das Recht auf Stadt zu beanspruchen ist eine Zwischenstation auf dem Weg zu diesem Ziel. Es kann niemals das Ziel an sich sein, auch wenn es zunehmend als einer der verheißungsvollsten Wege dorthin erscheint.
*
Das Kürzel LGBT steht im Englischen für lesbian, gay, bisexual, transgender and queer; Anmerkung der Übersetzerin.
Erster Teil: Das Recht auf Stadt
1. Das Recht auf Stadt
Wir leben in einer Zeit, in der die Ideale der Menschenrechte in den Mittelpunkt sowohl der Politik als auch der Ethik gerückt sind. Eine Menge politischer Energie wird aufgewendet, um sie zu fördern, zu schützen und ihre Bedeutung für die Gestaltung einer besseren Welt zu artikulieren. Die meisten der kursierenden Konzepte sind individualistisch und eigentumsbezogen und stellen daher weder die hegemoniale (neo)liberale Marktlogik noch die neoliberalen Formen der Rechtmäßigkeit und des staatlichen Handelns infrage. Wir leben schließlich in einer Welt, in der das Recht auf Privateigentum und die Profitrate alle anderen denkbaren Rechtsvorstellungen übertrumpfen. Gelegentlich nimmt das Ideal der Menschenrechte eine kollektive Wende, etwa wenn die Rechte von Arbeitern, Frauen, Homosexuellen und Minderheiten in den Vordergrund rücken (ein Vermächtnis der traditionellen Arbeiterbewegung und auch der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der sechziger Jahre, die kollektiv ausgerichtet war und ein globales Echo fand). Solche Kämpfe für kollektive Rechte haben hin und wieder bedeutsame Ergebnisse hervorgebracht.
An dieser Stelle möchte ich nun ein kollektives Recht anderen Typs untersuchen – das Recht auf Stadt. Ich tue dies im Kontext eines neu erwachten Interesses an Henri Lefebvres Gedanken zu diesem Thema sowie des Aufkommens unterschiedlicher sozialer Bewegungen, die heute weltweit Anspruch auf dieses Recht erheben. Wie kann dieses Recht nun also definiert werden?
Der berühmte amerikanische Stadtsoziologe Robert Park schrieb einmal, die Stadt sei »der konsequenteste und insgesamt erfolgreichste Versuch des Menschen, die Welt, in der er lebt, nach seinen eigenen Vorstellungen umzugestalten. Doch wenn die Stadt die vom Menschen erschaffene Welt ist, dann ist sie auch die Welt, in der er fortan zu leben verdammt ist. Folglich hat sich der Mensch, auf indirektem Wege und ohne deutliches Bewusstsein für die Natur seiner Aufgabe, in der Erschaffung der Stadt selbst neu erschaffen.«1 Wenn Park recht hat, kann die Frage, in welcher Art von Stadt wir leben wollen, nicht von der Frage getrennt werden, welche Art von Menschen wir sein wollen, welche Arten von sozialen Beziehungen wir anstreben, welches Verhältnis zur Natur wir pflegen, welchen Lebensstil wir uns wünschen, an welchen ästhetischen Werten wir festhalten. Das Recht auf Stadt ist also weit mehr als das Recht auf individuellen oder gemeinschaftlichen Zugriff auf die Ressourcen, welche die Stadt verkörpert: Es ist das Recht, die Stadt nach unseren eigenen Wünschen zu verändern und neu zu erfinden. Darüber hinaus ist es ein kollektives anstelle eines individuellen Rechts, da das Neuerfinden der Stadt unvermeidlich von der Ausübung einer kollektiven Macht über die Urbanisierungsprozesse abhängt. Die Freiheit, uns selbst und unsere Städte zu erschaffen und immer wieder neu zu erschaffen, ist meiner Ansicht nach eins der kostbarsten und dennoch am meisten vernachlässigten unserer Menschenrechte. Wie sollen wir dieses Recht also am besten in Anspruch nehmen?
Da wir, wie Park betont, bisher nur ein vages Verständnis von der Natur unserer Aufgabe besitzen, ist es sinnvoll, zunächst darüber nachzudenken, wie wir im Verlauf der Geschichte durch einen von machtvollen gesellschaftlichen Kräften vorangetriebenen urbanen Prozess erschaffen und erneuert worden sind. Das erstaunliche Tempo und Ausmaß der Urbanisierung in den letzten hundert Jahren bedeutet beispielsweise, dass wir bereits mehrere Male neu erschaffen wurden, ohne zu wissen, weshalb oder wie. Hat diese dramatische Urbanisierung einen Beitrag zum menschlichen Wohlbefinden geleistet? Hat sie uns zu besseren Menschen gemacht, oder uns in einer Welt der Anomie und Entfremdung, der Wut und Enttäuschung hängengelassen? Sind wir zu Monaden geworden, die in einem urbanen Meer umhergespült werden? Fragen dieser Art beschäftigten alle möglichen Autoren des 19. Jahrhunderts, etwa Friedrich Engels und Georg Simmel, die scharfsinnig die stereotypen urbanen Rollen kritisierten, die damals in Reaktion auf die rasante Urbanisierung entstanden.2 Heutzutage ist es nicht schwer, angesichts einer sogar noch rasanteren Transformation der Städte die verschiedensten Formen des urbanen Unbehagens, der Angst, aber auch der Erregung aufzulisten. Doch aus irgendeinem Grund scheint uns der Mut zu einer systematischen Kritik zu fehlen. Der Sog des Wandels überwältigt uns, obgleich sich offensichtliche Probleme anbahnen. Was sollen wir etwa von der immensen Konzentration von Wohlstand, Privilegien und Konsumgütern in nahezu allen Städten der Erde halten, einer Erde, die selbst die Vereinten Nationen mittlerweile als Planeten der explodierenden Slums bezeichnen?3
Das Recht auf Stadt in dem Sinne zu beanspruchen, der mir hier vorschwebt, bedeutet, grundsätzlich und radikal die Macht einzufordern, Urbanisierungsprozesse zu gestalten und mitzuentscheiden, wenn es darum geht, auf welche Art und Weise unsere Städte erschaffen und erneuert werden sollen. Seit ihren Anfängen sind Städte durch die geografische und gesellschaftliche Konzentration von Mehrprodukten entstanden. Die Urbanisierung war also schon immer gewissermaßen ein Klassenphänomen, da Überschüsse irgendwo irgendwem entzogen wurden, während die Kontrolle über ihre Verwendung typischerweise in den Händen weniger lag (etwa einer religiösen Oligarchie oder eines Kriegers mit imperialen Ambitionen). An dieser allgemeinen Situation ändert sich im Kapitalismus selbstverständlich nichts, allerdings ist nun eine ganz andere Dynamik im Gang. Wie Marx uns erklärt, beruht der Kapitalismus auf dem ständigen Streben nach Mehrwert (Profit). Doch um Mehrwert zu erzeugen, müssen Kapitalisten ein Mehrprodukt erzeugen. Das bedeutet, dass der Kapitalismus fortwährend das Mehrprodukt erzeugt, das die Urbanisierung benötigt. Umgekehrt gilt dasselbe. Der Kapitalismus benötigt die Urbanisierung, um das Mehrprodukt zu absorbieren, das er fortwährend erzeugt. Auf diese Weise entsteht ein innerer Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Kapitalismus und der Urbanisierung. Daher überrascht es kaum, dass die logistischen Wachstumskurven der kapitalistischen Produktion historisch weitgehend parallel zu den logistischen Kurven der Verstädterung der Weltbevölkerung verlaufen.
Sehen wir uns ein wenig genauer an, was Kapitalisten tun. Am Anfang des Tages besitzen sie eine bestimmte Geldsumme und am Ende des Tages besitzen sie eine höhere (ihren Profit). Am nächsten Tag müssen sie entscheiden, was sie mit dem überschüssigen Geld tun sollen, das sie am Tag zuvor eingenommen haben. Sie stehen vor einem faustischen Dilemma: Sollen sie das Geld reinvestieren, um noch mehr davon zu bekommen, oder sollen sie ihren Überschuss für Vergnügungen ausgeben? Die Gesetze der Konkurrenz zwingen sie zur Reinvestition, denn wenn sie nicht reinvestieren, werden andere es ganz sicher tun. Damit ein Kapitalist ein Kapitalist bleibt, muss er einen Teil seines Überschusses reinvestieren, um noch mehr Überschuss zu erwirtschaften. Erfolgreiche Kapitalisten erwirtschaften normalerweise mehr als genug, um sowohl in Wachstum zu investieren als auch ihren Wunsch nach Vergnügung zu stillen. Das Ergebnis der beständigen Reinvestition ist jedoch die Ausweitung der Überschussproduktion. Wichtiger noch, sie zieht eine exponentielle Ausweitung nach sich – daher all die logistischen Wachstumskurven (zu Geld, Kapital, Produktion und Bevölkerung), die mit der Geschichte der Kapitalakkumulation verbunden sind.
Die Politik des Kapitalismus wird beeinflusst von dem ständigen Bedürfnis, profitable Terrains für die Produktion und Absorption von Kapitalüberschüssen zu finden. Auf dem Weg zu einer kontinuierlichen und reibungslosen Expansion begegnet dem Kapitalisten jedoch eine Reihe von Hindernissen. Herrscht ein Mangel an Arbeitskräften und sind die Löhne zu hoch, müssen entweder die vorhandenen Arbeitskräfte diszipliniert (Erzeugung von Arbeitslosigkeit durch technologischen Fortschritt und Angriffe auf die Macht der organisierten Arbeiterklasse – wie sie Margaret Thatcher und Ronald Reagan in den achtziger Jahren durchführten – sind zwei der wichtigsten Methoden) oder neue Arbeitskräfte gefunden werden (durch Immigration, Kapitalexport oder die Proletarisierung von Bevölkerungsteilen, die davon zuvor nicht betroffen waren). Es gilt, neue Produktionsmittel und vor allem neue natürliche Ressourcen ausfindig zu machen. Dadurch wird die Umwelt einem immer größeren Druck ausgesetzt, die nötigen Rohstoffe zu liefern und die unvermeidlichen Abfälle zu absorbieren. Die Gesetze der Konkurrenz bringen außerdem ständig neue Technologien und Organisationsformen hervor, da Kapitalisten mit höherer Produktivität diejenigen überholen, die unterlegene Methoden anwenden. Innovationen bringen neue Wünsche und Bedürfnisse hervor, sie reduzieren die Umschlagszeit des Kapitals und die Reibungsverluste, die mit räumlichen Distanzen einhergehen. Dadurch wird die geografische Reichweite ausgedehnt, die dem Kapitalisten auf der Suche nach einem breiteren Angebot an Arbeitskräften, Rohstoffen etc. zur Verfügung steht. Gibt es in einem bestehenden Markt nicht genügend Kaufkraft, müssen neue Märkte gefunden werden, indem man den Außenhandel forciert, neue Produkte und Lebensstile bewirbt, neue Kreditinstrumente entwickelt und schuldenfinanzierte Staatsausgaben steigert. Ist die Profitrate schließlich zu niedrig, gibt es immer noch Auswege: die staatliche Regulierung des »ruinösen Wettbewerbs«, Monopolbildung (Fusionen und Übernahmen) und der Export von Kapital in Regionen, die größere Renditen versprechen.
Wenn sich auch nur eine der obengenannten Hürden für die kontinuierliche Zirkulation und Expansion des Kapitals nicht überwinden lässt, wird die Kapitalakkumulation blockiert, und die Kapitalisten geraten in eine Krise. Das Kapital kann nicht profitabel reinvestiert werden, die Akkumulation stagniert oder geht zurück, das Kapital wird entwertet (bzw. geht verloren) und in manchen Fällen sogar physisch zerstört. Die Entwertung kann verschiedene Formen annehmen: Sie kann überschüssige Waren betreffen, die dann kaum noch etwas wert sind oder vernichtet werden müssen; die Produktionsleistung wird zurückgefahren, so dass Produktionsvermögen brachliegt; schließlich kann auch das Geld selbst durch Inflation abgewertet werden. Und natürlich verliert in einer solchen Krise angesichts massiver Arbeitslosigkeit die Arbeitskraft ebenfalls deutlich an Wert. Inwiefern können wir also sagen, dass die kapitalistische Urbanisierung von dem Bedürfnis angetrieben wurde, diese Barrieren zu umgehen und das Terrain für profitable kapitalistische Aktivitäten auszuweiten? Die These, die ich hier vertreten möchte, lautet, dass sie (zusammen mit anderen Faktoren wie etwa den Rüstungsausgaben) bei der Absorption des Mehrprodukts, das Kapitalisten in ihrem Streben nach Mehrwert permanent produzieren, eine besonders wichtige Rolle spielt.4
Betrachten wir zunächst die Situation im Paris des Zweiten Kaiserreichs. Die Krise von 1848 war eine der ersten Krisen, die eindeutig durch ungenutzte Überschüsse an Kapital und Arbeitskräften ausgelöst wurde, und sie erstreckte sich über ganz Europa. In Paris schlug sie besonders hart zu, was eine gescheiterte Revolution der unbeschäftigten Arbeiter und bürgerlicher Utopisten hervorrief, die eine sozialistische Republik als Mittel gegen kapitalistische Habgier und Ungleichheit ansahen. Die Bourgeoisie drängte die Revolutionäre gewaltsam zurück, konnte die Krise aber nicht meistern. Nach einem Staatsstreich 1851 regierte ab 1852 Napoleon III. Um sein politisches Überleben zu sichern, setzte der autoritäre Kaiser auf die umfassende Unterdrückung alternativer politischer Bewegungen. Er wusste allerdings auch, dass er sich des Problems der Absorption des Kapitalüberschusses annehmen musste, weshalb er enorme Infrastrukturmaßnahmen im In- und Ausland ankündigte. Im Ausland betraf dies die Errichtung neuer Bahnstrecken durch ganz Europa und bis in den Orient sowie die Unterstützung großer Bauvorhaben wie dem Suezkanal. Im Inland ging es um den Zusammenschluss des Eisenbahnnetzes, neue Häfen, das Trockenlegen von Sumpfgebieten und Ähnliches. Vor allem beinhaltete das Programm jedoch die Umgestaltung der städtischen Infrastruktur von Paris. 1853 holte Napoleon III. den Politiker und Stadtplaner Georges-Eugène Haussmann nach Paris, um ihm die Leitung der Bauvorhaben anzuvertrauen.
Haussmann verstand sofort, dass seine Aufgabe darin bestand, das Problem der Arbeitslosigkeit und das der Kapitalüberschüsse durch Urbanisierung zu lösen. Der Umbau von Paris absorbierte nach damaligem Maßstab dann auch ungeheure Mengen an Arbeitskraft und Kapital und war, neben der autoritären Unterdrückung der Pariser Arbeiterschaft, eines der wichtigsten Instrumente der sozialen Stabilisierung. Haussmann stützte sich auf die Pläne zur Umgestaltung von Paris, über welche die Anhänger utopischer Sozialisten wie Charles Fourier und Henri de Saint-Simon bereits in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts diskutiert hatten – allerdings mit einem großen Unterschied: Er dachte in ganz anderen Dimensionen. Als der Architekt Jakob Ignaz Hittorff Haussmann seine Entwürfe für einen neuen Boulevard zeigte, warf dieser ihm die Skizzen mit den Worten vor die Füße: »Das ist nicht groß genug … Bei Ihnen ist er 40 Meter breit, aber ich will 120!« Haussmann stellte sich die Metropole in einem größeren Maßstab vor, er gemeindete Vororte ein und gestaltete ganze Viertel neu (etwa Les Halles), statt nur hier und dort Veränderungen in der Struktur der Stadt vorzunehmen. Er transformierte die Stadt umfassend, nicht stückchenweise. Dafür benötigte er neue Finanzinstitutionen und Finanzierungsinstrumente, die nach den Plänen der Saint-Simonisten entworfen wurden (Crédit mobilier und immobilier). Faktisch trug er dazu bei, das Problem des Kapitalüberschusses zu lösen, indem er ein keynesianisches Programm der schuldenfinanzierten Stadterneuerung auflegte.
Dieses System funktionierte etwa 15 Jahre lang und führte nicht nur zu einer Transformation der urbanen Infrastruktur, sondern auch zur Entstehung einer völlig neuen urbanen Lebensart und völlig neuer urbaner Typen. Paris wurde zur »Stadt der Lichter«, zum wichtigsten Zentrum für Konsum, Tourismus und Vergnügen – die Cafés, die Kaufhäuser, die Modeindustrie und die großen Messen veränderten das städtische Leben derart, dass im Zuge eines geradezu haarsträubenden Konsumismus (der die Traditionalisten erzürnte und die Arbeiter ausschloss) gigantische Überschüsse absorbiert wurden. 1868 brachen dann jedoch das überforderte und zunehmend spekulative Bankensystem und die Finanzierungsstrukturen zusammen, auf denen all das zuvor basiert hatte. Haussmann wurde die Macht entzogen. In seiner Verzweiflung zog Napoleon III. gegen Bismarcks Deutschland in den Krieg – und verlor. In dem darauffolgenden Vakuum erhob sich die Pariser Kommune, eine der bedeutendsten revolutionären Episoden in der kapitalistischen Stadtgeschichte. Die Kommune speiste sich einerseits aus der Sehnsucht nach der urbanen Welt, die Haussmann zerstört hatte (die langen Schatten der Revolution von 1848), andererseits wollten jene Bewohner, die Haussmanns Projekten hatten Platz machen müssen, ihre Stadt zurückerobern. Gleichzeitig kamen in den Ereignissen aber auch konkurrierende Visionen einer sozialistischen (im Gegensatz zur monopolkapitalistischen) Moderne zum Ausdruck; man stritt darüber, ob man den Weg der zentralisierten hierarchischen (die jakobinische Position) oder jenen der dezentralisierten Kontrolle durch das Volk einschlagen sollte, der von den Anarchisten (angeführt von den Proudhonisten) propagiert wurde. In den hitzigen Auseinandersetzungen beschuldigten sich die Parteien gegenseitig, für die Niederlage der Kommune verantwortlich zu sein, und so kam es 1872 zu jenem radikalen politischen Bruch zwischen Marxisten und Anarchisten, der große Teile der linken Opposition gegen den Kapitalismus bedauerlicherweise bis heute spaltet.5