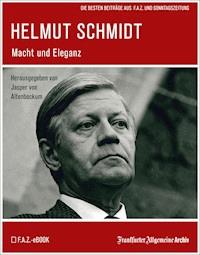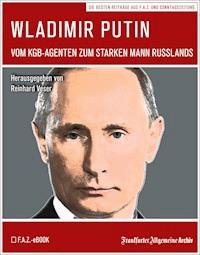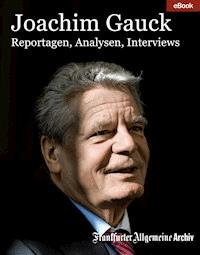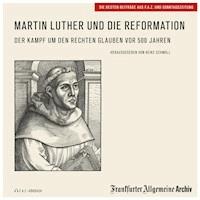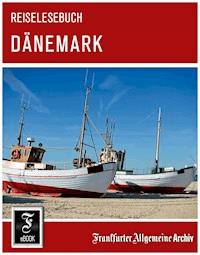
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Deutschlands nördlicher Nachbar erfreut sich -vor allem als Familien-Urlaubsziel- zunehmender Beliebtheit. Makellose Strände, wunderschöne Küstenstädtchen, und eine schier überbordende Vielfalt an gut ausgestatteten Ferienhäusern machen diesen Trend nachvollziehbar. Das F.A.Z.-Reiselesebuch "Dänemark" beginnt mit einer halb wehmütigen, halb spöttischen Reminiszenz an die Dänemark-Urlaube vergangener Jahre. Von Fanø, wo in jedem Jahr ein beeindruckendes Drachenfestival stattfindet, über Südjütland bis Fünen erkunden die Autoren dieses Hörbuchs anschließend zunächst das westliche Dänemark und die Inselwelt in Belt und Sund, bevor sich der Schauplatz der Reportagen auf die Hauptinsel Seeland verlagert. Ein Abstecher führt nach Rungstedlund, wo Karen Blixen residierte. Anschließend widmen wir uns Kopenhagen und ergründen, warum es als eine der schönsten Hauptstädte der Welt gilt. "Ferien" ist für viele Dänen ein Synonym für Bornholm. Daher steht auch die östlichste Insel Dänemarks im Besuchsprogramm der F.A.Z.-Autoren. Zu guter Letzt geht es zu den entfernteren dänischen Territorien, auf die Färöer und nach Grönland. Die unglaubliche Inselwelt mit Ihren sympathischen Bewohnern finden wir in mehreren packenden Porträts trefflich beschrieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reiselesebuch
Dänemark
F.A.Z.-eBook 30
Frankfurter Allgemeine Archiv
Projektleitung: Franz-Josef Gasterich
Produktionssteuerung: Christine Pfeiffer-Piechotta
Redaktion und Gestaltung: Hans Peter Trötscher
eBook-Produktion: rombach digitale manufaktur, Freiburg
Titelbild: Fischkutter bei Løkken (Jütland) © istockphoto.com
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb: [email protected]
© 2014 F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main.
ISBN ePub 978-3-89843- 298-6
Eine kleine Einführung in die Kunst des Dänemark-Urlaubs
Im Land der Lebensmittelfarben
Der Geist der Mittagsruhe oder Frühe Selbsterfahrung in Dänemark
Von Jens Jessen
Dänemark ist kalt, regnerisch und gesund. Als ich noch ein Kind war, fuhren meine Eltern mit mir und meinen Schwestern (erst einer, dann zweien) immer nach Dänemark; und zwar, wie ich eine Zeitlang vermutete, aus pädagogischen Gründen. Dänemark ist weit von der kontinentalen Hitze Berliner Sommer entfernt und erst recht von dem lasterhaften Sonnenüberfluss südlicher Strände, deren Wasser meine Mutter warnend und sehnsüchtig als »badewannenwarm« bezeichnete. Die dänische Nordsee dagegen ist zu jeder Jahreszeit eine Mutprobe; und die dänische Ostsee auch. Die dänische Ostsee, die ich als erste von beiden kennenlernte, ähnelte einem großen kalten Karpfenteich, der träge vor sich hinschwappt und an einem Überangebot von Nahrung in Form von Algen und einem Mangel an Essern in Form von Fischen zu leiden scheint. Wenn ich ins Wasser wollte, musste ich nicht nur den Kälteschock, sondern auch den Ekel vor dem verfilzten Algenteppich überwinden; und wenn ich beides überwunden hatte, gab es die Fische noch immer nicht zu sehen, auf die ich mich so gefreut hatte.
Noch heute glaube ich heimlich, dass es in den nördlichen Meeren gar keine Fische gibt, sondern nur Taschenkrebse (Nordsee) und Quallen (Ostsee). Die Taschenkrebse konnte man immerhin, wenn sie glücklich tot waren und nicht mehr zwickten, am Strand trocknen und nach Hause mitnehmen, wo sie zu beträchtlichem Gestank und bald auch gewaltigem Ärger mit den Eltern führten. Die Quallen aber, die am Strand trockneten, verschwanden dabei und bildeten nur vorübergehend ein Fetzchen regenbogenfarbener Folie, die von den Eltern, wenn man sie ihnen an den Liegestuhl brachte, auch nicht geliebt, aber ihrer transitorischen Natur halber auch nicht gehasst wurden. Wirkliche Genugtuung fand ich nur bei Ebbe in den Prielen (also an der Nordsee), die sich unter dem seltenen Sonnenschein durchaus erwärmten und die Jagd auf Garnelen erlaubten, die darin unwahrscheinlich geschickt, mit ihrem Schwanz schnappend, vor meinen Händen flohen; aber vergeblich, was ich sympathisch fand.
Solche Übungen gehörten zu dem Training, mit dem ich den pädagogischen Nutzen des Dänemark-Urlaubs zu unterlaufen trachtete; ihre Ernst-Jünger-Haftigkeit entsprang sozusagen dem Geist der Mittagsruhe, der über dem ganzen Land liegt und es zu einer Quelle kindlicher Langeweile, aber auch gefährlicher kindlicher Inspiration macht. Jene unheilbrütende Stille, von der alle Eltern zu Recht aus dem Mittagschlaf geschreckt werden, weil sie in ihr den Urgrund der verhängnisvollsten Kinderstreiche wissen, beherrscht auch Dänemarks Sommer. Denn im Sommer passiert in Dänemark dasselbe wie im Winter: nämlich nichts, weswegen die vornehmen Engländer, die dieses Nichts traditionshalber besonders würdigen können, nach Dänemark, jedenfalls auf seine eleganteren Inseln wie Fanø, gerne kommen, dort aber auch gerne für eine gewisse undänische Aufregung sorgen. Denn die Engländer sind sehr unbefangen in der Nutzung der Ressourcen eines Ferienorts und versuchen deshalb zum Beispiel auch, mit dem Auto dahin zu fahren, wo man selbst in Dänemark besser zu Fuß hingeht, also etwa mit einem schweren Bentley an die Südspitze Fanø.
Dieser Bentley mahlte sich an einem nasskalten Vormittag des August 1967 durch die sandigen Spuren eines Feldweges, bis er auf dem bewachsenen Mittelstreifen aufsaß; sogleich sprangen zwei Engländer in tatsächlich karierten Anzügen heraus und warfen sich ohne weitere Ziererei in den feuchten Sand, um einen besorgten Blick auf den Auspuff zu richten, dann mit fruchtloser Schaukelei den Wagen zu befreien. Er musste erst von einem Bauern mit dem Trecker auf härteren Untergrund gezogen werden. Mir machte jedoch die Unbekümmertheit der Engländer um ihre Anzüge großen Eindruck; so lernte ich, dass wahre Vornehmheit nicht im Besitz schöner Sachen, sondern im achtlosen Umgang mit ihnen besteht.
Überhaupt ist Dänemark, gerade in der Ereignisarmut, die man wohl als nationalen Zug ansehen darf, eine Schule der Erkenntnis; man starrt so lange in die Dünen, auf einen Parkplatz, in die Auslagen eines Supermarkts, bis die Wüste zu leben beginnt. Später merkte ich allerdings, dass soviel eigene Anstrengung gar nicht nötig ist, um die Umrisse eines existentiellen Abgrunds im Wohlfahrtsstaat zu bemerken, sondern Dänemark selber genügend sündige Schwachheiten ausstellt, zu denen der öffentliche und private Kraftverkehr am Strand gehört oder die exzessive Verwendung von Lebensmittelfarben oder – eine echte Zügellosigkeit – die Herstellung von Speiseeis mit Lakritzgeschmack. Die Dänen, die sich wie alle nordprotestantischen Völker viel verbieten, erlauben sich andererseits manches, zum Beispiel Würste schreiend rot zu färben, Aprikosenmarmelade giftig gelb und Limonaden überhaupt in allen Farben des Regenbogens, nur leuchtender. Der Besuch eines dänischen Supermarkts war für mich wie eine Safari durch ein Reservat der ausgestorbenen und verbotenen Nahrungsgenüsse, die augenscheinlich in der Vergangenheit, in der Dänemark damals (vor seinem EU-Beitritt) noch lebte, zuallererst optischer Natur waren.
In Dänemark, so schien es, isst das Auge nicht mit, sondern ganz allein. Das ist bei Kindern ähnlich; aber möglicherweise nicht nur aus der blöden Freude am Bunten, die ihnen vielleicht nur unterstellt wird, sondern aus einer Freude am Exzess, am Unbeherrschten, Vernunftwidrigen. Dänemarks Vitalität, überall sonst durch süße Sahne und Sozialgesetzgebung ruhiggestellt, explodiert auf dem Ladenregal. Dort ist sozusagen ein ewiges Brillantfeuerwerk oder war es wenigstens vor dem EU-Beitritt des Landes, der zu einigen Nörgeleien und Eingriffen in die nationale Nahrungsmittelindustrie geführt haben soll. Der Safaripark wurde, wenn ich richtig unterrichtet bin, seither von einigen der giftigsten Arten (den rötesten Würsten) gesäubert, was wiederum die Befürchtungen der dänischen Europa-Gegner bestätigte. Zu meiner Kinderzeit aber war in Dänemark Europa noch fern, es lebte in einer anderen Warenwelt; mit deutlich anderen Preishierarchien übrigens auch.
Eisenwaren waren unglaublich teuer; und zwar sowohl Nägel wie Automobile (falls man diese zu den Eisenwaren rechnen darf). Für Autos musste die ganze Steuer im voraus beim Kauf entrichtet werden; hatte man also einmal eines, versuchte man es so lange wie möglich zu erhalten, denn es wurde gleichsam von Jahr zu Jahr billiger. Ich sah also nicht nur wegen ihrer Buntheit andernorts längst verschwundene Süßigkeiten, sondern auch Autos, die in Deutschland für ausgestorben galten, riesige schwarze Opel, bei denen Kotflügel und Motorhaube noch imposant getrennt waren und auf dem abfallenden Heck das Reserverad sichtbar unter einer großen Napfkuchenform untergebracht war. Es gab auch englische Kombis, deren hinterer Teil in Fachwerk ausgeführt war, und zwar mit wirklichem Holz und nicht nur mit aufgemaltem wie bei den amerikanischen Straßenkreuzerkombis, die von der Besatzungsmacht (der sogenannten Schutzmacht) in Berlin bewegt wurden. Die herrlichen Saabs allerdings, die damals wirklich noch wie aus dem vorderen Teil eines Sportflugzeuges herausgeschnitten wirkten, interessierten mich nicht, weil sie von Zweitaktern angetrieben wurden, die ich verachtete.
Zweitakter schienen mir eine einfältige, gebrechliche Motorenart zu sein, die in ihrer Harmlosigkeit das Mittagsschläfrige des Landes verstärkten. Das Abenteuerliche aber, das es in Dänemark auch gibt, liegt mehr im Politischen, das für Kinder unsichtbar bleibt. In meine Nähe kam es, ohne dass ich es würdigen konnte, in Gestalt eines dänischen Ministerpräsidenten, der über dunkle Skandale gestürzt war und nun in einem benachbarten Ferienhaus auf Fanø lebte. Er pflegte uns zum Frühstück im Garten zu besuchen und schwang große Reden, während sein Dackel auf den Tisch sprang und eines der pappigen dänischen Brötchen verschlang, das ihm prompt im Rachen steckenblieb, aber von dem Ministerpräsidenten sogleich mit gekrümmtem Finger wieder herausgeholt wurde. Ich erinnere mich mit filmischer Genauigkeit an diesen Griff; er war so schnell, dass einem das Unappetitliche erst später, ich möchte sagen: nach Tagen aufging, nämlich wenn man davon erzählte. In einem Gedicht von Morgenstern heißt es: »Korf erfindet eine neue Art von Witzen, die erst viele Stunden später wirken. Jeder hört sie an mit Langeweile. Aber dann, als hätt' ein Zunder still geglommen . . .«
So war es auch mit dem dänischen Ministerpräsidenten und seinem Dackelrachengriff; und so geht es vielleicht mit vielen frühen und sogar den später eindrücklichsten Ferienerlebnissen. Man erlebt sie achtlos; während das, was man mit allen Fasern und angespannter Bewusstheit im Augenblick auskostet, also ich damals zum Beispiel das Lakritzeis, später vollkommen versinkt und nicht zu rekonstruieren ist. Niemals ist es mir gelungen, mich an den Geschmack von Lakritze als Eis zu erinnern, obwohl er mir damals als kostbare Perversion, als die in Dänemark überhaupt höchste erreichbare Perversion erschien. Ich bin vor einem Jahr noch einmal in Fanø gewesen, ich habe ein Dutzend Wege und Orte mit Rührung wiedergesehen, aber das Lakritzeis, das es wunderbarerweise noch gibt, habe ich ohne jede innere Bewegung, mit einer schrecklichen Nüchternheit sozusagen einfach weggeleckt. Es schmeckte schwach, ziemlich entfernt nach Lakritze; und weiter war gar nichts.
Für den Exzess darin (die Verschränkung zweier sonst getrennter Süßigkeiten) bin ich offenbar über die Zeiten hinweg unempfindlich geworden; mir fehlen heute, in der Sprache der Medizin gesprochen, die Rezeptoren für das Verbotene im Lakritzeis. Ganz anders ergeht es mir mit meiner allerersten Dänemark-Reise. Von ihr habe ich noch immer ein Bild, das für mich so etwas wie die Essenz aller späteren Dänemark-Reisen enthält, auch wenn es nur ein einziges ist, nämlich von der Fährfahrt über die Ostsee zurück nach Hause. In die Fähre muss unser Auto als eines der ersten am Abend oder in der Nacht hineingefahren sein, denn das Bild, an das ich mich erinnere, ist nach dem Aufwachen entstanden und zeigt einen Blick auf den Bug des Schiffes und über ihn hinaus. In dieses Auto waren meine Schwester und ich und zwei in Dänemark gekaufte Cocktailsessel, denen man die Beine abgeschraubt hatte, solchermaßen untergebracht worden, dass meine Schwester auf der Rückbank lag, ich auf dem Boden ihr zu Füßen und die beiden Sessel (sie hatten die avantgardistische Form eines Bikini-Körbchens) über uns. Ich lag also im Dunkeln und kroch, als ich erwachte, wie ein Kind, das geboren wird, ans Licht.
Die Helligkeit blendete mich. Statt des Meeres oder des Himmels sah ich jedoch, haushoch über mir und lackweiß glänzend, die Bugklappe des Schiffes. Aus den Schließfugen am Boden, also mehr in meiner Höhe, sickerte und sprühte Wasser, was ich mit einer gewissen technischen Sorge beobachtete (die Schiffsteile hielten offenbar genauso schlecht wie alte Legosteine), andererseits aber auch als erfreulichen Vorschein möglicher Katastrophen nahm, die in große, ganz undänische Abenteuer führen könnten. Meine Mutter hatte diese Ahnung offenbar auch, denn sie sah schwach und elend und etwas grünlich aus. Einen Moment später hatte sich die Lage jedoch vollkommen verändert. Der Bug verlor mit zunehmender Geschwindigkeit an Höhe, schrumpfte vor unseren Füßen und wurde zu seinem Gegenteil, einer schiefen Ebene nach unten, die den wahren Grund des mütterlichen Zustandes erkennen ließ: nämlich das Meer, das sich als gurgelnder Abgrund unter uns öffnete. Mit anderen Worten: Es stürmte, und meine Mutter war seekrank.
Ich aber hatte eines der ersten Selbsterfahrungserlebnisse, die man dem Reisen im allgemeinen zuschreibt: ich war nicht seekrank. Mit großer Kälte betrachtete ich die Achterbahnfahrten des Schiffes und hatte dabei sogleich noch ein zweites Reiseerlebnis, nämlich eine Relativitätserfahrung. Das Schiff, riesengroß, verglichen mit unserem Auto oder unserer Mutter, war im Verhältnis zu den Wellen ziemlich klein. Man kann es auch, um den kindlichen Gefühlswert richtig wiederzugeben, so sagen: Das Schiff, das sich mir gegenüber als Erwachsener von beträchtlicher Kraft und Autorität aufgespielt hatte, war vor dem Meer Fortsetzung auf der folgenden Seite auch nur ein Kind, und zwar ein recht verlorenes, offenbar unklug von zu Hause Ausgerissenes.
Mir gefiel dieses Meer. Es tat, was ich auch gerne getan hätte, nämlich alles umzudrehen und in sein Gegenteil zu verkehren. Kinder sind Surrealisten. Ihr Möglichkeitssinn übersteigt ihren Wirklichkeitssinn bei weitem, und sie leiden darunter, dass sich die Wirklichkeit den Möglichkeiten gegenüber so sperrig zeigt, obwohl sie doch gleichsam nur eine privilegierte Möglichkeit ist, die zufällig zu festerer und dauerhafter Gestalt gefunden hat. Dieses kindliche Leiden kann freilich recht offensive Formen annehmen, vor denen die härteste Wirklichkeit an Härte verliert und zumindest vorübergehend dem Aggregatzustand der Möglichkeiten wieder näherkommt. So geschah es zum Beispiel, dass sich Luftmatratzen, dreieckig zusammengelegt, in Raketen, Schränke in Abschussrampen und Kinder, die sich in das Luftmatratzengehäuse zwängten, in Astronauten verwandelten, die ihren Start, ihren Flug und ihre Landung auch in einem dänischen Ferienhauswohnzimmer mit beachtlicher Realitätsnähe zu simulieren vermochten.
Aus der gelandeten, vulgo vom Schrank auf den Teppich gestürzten Luftmatratze stiegen nämlich meine Schwester und ich genauso benommen und mit blauen Flecken übersät wie die Astronauten aus ihrer Weltraumkapsel. Wir waren jedoch auch genauso glücklich wie die Nasa, dass es gelungen war, ein ziemlich überflüssiges Produkt einer halbwegs plausiblen Verwendung zugeführt zu haben. Das überflüssige Produkt war in unserem Falle die Luftmatratze, die bei sechzehn Grad Lufttemperatur und vierzehn Grad Wassertemperatur in der Wirklichkeit des dänischen Sommers zu nichts taugte. Regen und Kälte dauerten in jenem Jahr die vollen sechs Wochen unseres Aufenthaltes, und man kann sagen, dass er den Möglichkeitssinn von meiner Schwester und mir mit bleibendem Erfolg trainierte. Während meine Eltern über Land fuhren und Gegenstände kauften, die von Mal zu Mal sperriger wurden, während also auch ihr Wirklichkeitssinn einer Erosion ausgesetzt war, insofern sie an den Transport der Sachen mit dem Auto zurück nach Berlin nicht denken wollten, ruderten meine Schwester und ich auf der Luftmatratze, die damit einem bestimmungsgemäßen Gebrauch schon näherkam, über die Nordsee, die der Ferienhausteppich darstellte.
Der Teppich tat dies in gewisser Hinsicht sogar besser als die wirkliche Nordsee, weil er nämlich weder Quallen noch Algen, aber in seinen geschwungenen Mustern allerhand Fische, sogar Walfische vorführte. Wir Kinder entwickelten uns in diesem Sommer zu wahren Meistern der maritimen Exegese von Orientteppichen, und wir Erwachsenen können daraus lernen, dass eine jede Dänemark-Reise, schon allein des Wetters wegen, zu einer Reise nach innen werden muss, ja dass es mutmaßlich vollkommen sinnlos ist, nach Dänemark zu reisen, wenn man nicht bereit ist, gleichzeitig nach innen zu reisen. Das Wissen darum, dass nämlich an der Oberfläche, in der sogenannten Wirklichkeit dieses Landes nur schwache Zeichen zu finden sind, die erst der innere Möglichkeitssinn entziffert, ließ sich übrigens auch bei den eingesessenen Verwandten studieren. Mein Großonkel erklärte mir die Fuchsjagd zum Beispiel anhand der Gewehre, die im Schrank standen; und auch die Hähnchen, die meine Tante zubereitete, waren in ihrer chiffrenhaften Blässe nur eine Andeutung der wirklichen Brathähnchen, die man gewissermaßen hinter ihnen zu suchen hatte, als Idee.
Dänemark war insofern phantasiebeflügelnd und enttäuschend zugleich, und dass wir Kinder am Ende doch immer gerne hingefahren waren, lag im Kontrast zu der robusten, sozusagen phantasiefeindlichen Berliner Wirklichkeit, die sich im Hochsommer von ihrer robustesten, starrsinnigsten Seite zeigte. Wenn wir, meist früh am Morgen, in die Ferien aufbrachen, stand schon brütende Hitze über der Stadt; wenn wir nach anderthalb Monaten zurückkamen, meist gegen Abend, stießen wir noch immer auf dieselbe Hitze, und während wir die ersten Berliner Straßen hinabfuhren, unter staubigen Straßenbäumen, die in äußerster Erschöpfung schon Laub abgeworfen hatten, begannen meine Eltern zu ahnen, dass auch das Sprengen des Gartens, das sie für unsere Abwesenheit organisiert hatten, nichts geholfen haben mochte. Dazwischen aber hatte es für uns sechs erfrischende Wochen Regen in Dänemark gegeben. Wir begrüßten die staubig im abendlichen Neonglanz liegende Stadt wie Nomaden, die von einer Oase in die heimatliche Wüste zurückgekehrt waren.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.08.1995
Im Westen viel Neues: In Jütland lernt man Dänemark richtig kennen
Eine windige Geschichte
Das Drachenfestival ist einer der Höhepunkte auf der dänischen Nordseeinsel Fanø. Doch Wind gibt es dort das ganze Jahr über.
Von Elke Sturmhoebel
Ein Lied zu singen nützt nur bei ablandigem Wind. Doch jetzt weht der Wind aus Südwest, und die Robben können uns nicht hören. Wir stehen vor dem Galgenriff, eine sechs Meter tiefe Gezeitenrinne, und schauen zur Sandbank hinüber, auf der sich etwa hundert Seehunde und Kegelrobben räkeln. Bis zu 740 Tiere seien dort schon gezählt worden, erzählt Jesper, der Wattführer. Streitigkeiten zwischen den Arten gebe es nicht. Manchmal, vor allem zu Beginn der Touristensaison, ließen sich die Tiere von dem Gesang dazu verleiten, die Sandbank zu verlassen, und kämen über das Galgenriff geschwommen, um die Besucher in Augenschein zu nehmen. Robben sind neugierig. Aber jetzt kommt der Wind aus der falschen Richtung, und Singen nützt nichts.
Der Wind wirft Wellen im Galgenriff, bürstet das Watt und fegt über Wasserlachen, die die Ebbe übriggelassen hat. Hinter uns liegt Fanø, weiter im Süden das Inselchen Mandø, das bei Ebbe vom Festland mit dem Auto zu erreichen ist. Im Dunst ist sogar der trutzige Dom im 23 Kilometer entfernten Ribe auszumachen.
In Ribe kam Fanø im Jahr 1741 unter den Hammer. Der dänische König Christian VI. war aufgrund einer Wirtschaftskrise knapp bei Kasse und entschloss sich, das wenig einträgliche Fanø zu verkaufen. Um bei der Versteigerung nicht von reichen Investoren überboten zu werden, griffen die Insulaner zu einer List. Sie spendierten dem Ratsdiener ein paar Schnäpschen, bis ihm vor Müdigkeit die Augen zufielen. Dann stellten sie den kleinen Zeiger der Wanduhr eine Stunde vor. Zwar wunderte sich der Beamte zu Beginn der Auktion, dass nur Inselvertreter erschienen waren. Doch mangels weiterer Interessenten ging der Zuschlag an sie. So erzählt man es sich jedenfalls auf der Insel – ist ja auch eine nette Geschichte.
So oder so, der Deal hat sich gelohnt. Mit dem Kauf durften nun auch Seetransporte auf eigene Rechnung ausgeführt werden. Der Handel florierte. Im Jahr 1896 blieb Fanø an Tonnage nur hinter Kopenhagen zurück. Aber das sind alte Kamellen. Wichtig heutzutage: Auch an Volumen legt Fanø zu. Ohne etwas dafür zu tun, wird die kleine Insel immer größer. Allerdings kommt der Sand, der am Weststrand anlandet, zum Teil aus Sylt, wo man sich mit jährlichen Aufschüttungen für viel Geld bemüht, die Insel beziehungsweise den Strand zu halten. Fanø hat das Glück, im Schutz des Hornriffs zu liegen, und Strömungs- und Windverhältnisse sorgen für stetigen Landgewinn. Da fällt es den knapp dreitausend Bewohnern leicht, großzügig zu sein. Zwischen den Orten Fanø Bad und Sønderho darf der Strand bei Tempo 30 befahren werden. Und auch die Buslinie führt über den Strand. Es hat schon etwas Entspanntes, an einer Haltestelle vor den Dünen auf den Bus zu warten und dabei den Blick über das Meer schweifen zu lassen.
»Hygge« mit Fahrrad auf Fanø bei ruhigen Windverhältnissen. Foto: Visitdenmark.dk
Die Fanøer sind pragmatisch. Eine Asphaltstraße parallel zum Strand und große Parkplätze zu bauen mache ja auch keinen Sinn, sagt Tourismuschef Poul Therkelsen. Der Flächenverbrauch sei ja ganz unnötig und ginge nur auf Kosten der Natur. Auf dem festen Sand rollen zudem auch andere Gefährte wie Fahrräder, Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren. Strandsegler und Kitebuggys finden auf einem ausgewiesenen drei Kilometer langen Strandabschnitt ebenfalls Platz für ihr Hobby. Wer die absolute Einsamkeit sucht, geht besser an den feinpudrigen Søren-Jessen-Strand, eine autofreie Zone im Norden der Insel. Die einstige Sandbank dockte vor etwa hundert Jahren an, nachdem die Gezeitenrinne mit Sand verfüllt war. Wie in einer Wüste könnte man sich dort fühlen, würden nicht laufend die großen Fähren nach England am Horizont vorbeiziehen.
Die bislang 55 Quadratkilometer große Insel wächst und wächst, der zwölf Kilometer lange Strand wird immer breiter. Eine nächste Dünenreihe ist schon im Entstehen, und die Autopiste wird weiter ans Ufer verlegt werden müssen. Die hohen Dünen zu betreten – auf deutschen Inseln aus Küstenschutzgründen nicht gestattet – findet man auf Fanø eigentlich nicht so schlimm. »Ein einziger Sturm macht mehr kaputt als Touristen in zehn Jahren«, bekräftigt Jesper Voss, der auch Naturführer ist. Allerdings beträgt der Tidenhub hier nur 1,60 Meter, und von Sturmfluten geht keine wirkliche Gefahr aus.
Nur zwölf Minuten dauert die Überfahrt von Esbjerg zur nördlichsten Insel im Wattenmeer. Sobald man von der Fähre runtergefahren ist, passiert man als Erstes die Hundesäule – vermutlich das einzige Denkmal, das den leichten Mädchen gewidmet wurde. Als Fanø noch eine Seefahrerinsel war, suchten viele Fahrensleute in englischen Häfen ein Freudenhaus auf. Dort war es Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts den Damen verboten, für ihre Dienste Geld zu nehmen. Also verkauften sie ihren Freiern noch ein Souvenir. Zum Beispiel die Porzellanhündchen auf der Fensterbank, die anzeigten, ob sie gerade zur Verfügung stehen. Schauten die Hunde hinaus, warteten sie auf Männerbesuch. Schauten sie ins Zimmer, war schon besetzt. Auffallend viele Porzellanhunde zieren heute noch die Fensterbänke auf Fanø. Mancher Liebhaber könne nun erkennen, ob die Luft rein ist, wird mit einem Augenzwinkern kolportiert. Auch eine schöne Geschichte.
Nach Ankunft der Fähre verteilen sich die Urlauber auf Rindby Strand, Fanø Bad und Sønderho. Von den insgesamt dreitausend Ferienhäusern werden etwa die Hälfte vermietet. 700.000 Übernachtungen im Jahr zählt Fanø. Die meisten der etwa 125.000 Touristen kommen aus Deutschland. Im Juni aber wird die Insel bunt. Aus aller Welt reisen die Leute dann an, aus Japan, Tasmanien, Südamerika und von überall her. Und kurz darauf hängt der Himmel über Fanø voller Drachen. Fünftausend Teilnehmer werden zum weltgrößten Drachenfest regelmäßig erwartet, und im Durchschnitt hat jeder vier Drachen im Gepäck. Das International Kitefliers Meeting, das im Jahr 2014 schon zum 30. Mal stattfindet, ist vor allem ein Happening. Da treffen sich Gleichgesinnte, werden Workshops veranstaltet, Drachen und Zubehör versteigert, und zwar zu Gunsten der Kinderhilfe Kolumbien e.V. Was diese Open-Air-Veranstaltung so sympathisch macht: Es ist ein ganz und gar unkommerzielles Festival. Es geht dort einzig um die Lust, Freunde zu treffen, sich auszutauschen und gemeinsam Drachen steigen zu lassen. Tatsächlich hat Fanø mit dem breiten Strand, der unendlichen Weite sowie dem stetigen Wind die dafür perfekten Bedingungen.
Der Wind ist auf Fanø das treibende Element. Wind, der Drachen in die Luft schwingt, in die Segel der dreirädrigen Blokarts streicht, die Kitebuggys und Windsurfer antreibt. Geplant wurde schon der Bau eines Windsportcenters mit einem Windkanal, um zu testen, wie sich neue Freizeitgeräte im Wind verhalten. Der Wind treibt auch Sand vor sich her und türmt ihn zu hohen Dünen auf. Manches wird dabei zugedeckt und manches freigelegt. So sind bis jetzt 330 Bunker mit Geschützvorrichtungen zutage getreten, Reste des Atlantikwalls, der von der deutschen Wehrmacht zum Schutz gegen eine Invasion der Alliierten errichtet wurde. Von Fanø aus sollte der Hafen von Esbjerg verteidigt werden. Der Bunker, über den sich in jüngster Zeit ein Graffiti-Künstler mit Sprühdosen hermachte, hat es zum Kultobjekt gebracht. Ist ja auch cool, sich mit Kitebuggy oder Drachen vor dem bunten Schriftzug »Be free« fotografieren zu lassen.
Während Drachenflieger in die Luft schauen, gucken Bernsteinsucher nach unten. Sobald sich das Wasser zurückzieht, suchen Einheimische und Urlauber im Fanø-Gang den Spülsaum ab, stochern in gebückter Haltung zwischen Muscheln und Tang herum. Bernstein mit normalen Steinen zu verwechseln, sei auf Fanø nahezu ausgeschlossen, erklärt Jens Peter Jensen. Schließlich ist die Insel eine Sandbank, und daher gibt es auch keine Steine, die der Sturm loslösen und anspülen könnte. Der Bernsteinschleifer aus Sønderho begutachtet aber gern die Fundstücke. Auf Wunsch verarbeitet er sie auch, schleift und poliert den Schatz und fasst ihn zu einem Schmuckstein. Etwa dreißig Kilo Bernstein pro Jahr verarbeitet er in seiner »Ravsmeden«, seiner Bernsteinschmiede. Wohl an die zweihundert Kilo habe er am Weststrand schon geborgen, schätzt der 61 Jahre alte Jensen, der in seinem Laden gern ein Schwätzchen hält. Bernstein sei nach einem Sturm leicht zu finden, erklärt er. Und fügt hinzu: »Ich nehme aber nur die großen Stücke. Die kleinen lasse ich liegen für die Touristen.«
Das etwa dreihundert Einwohner zählende Sønderho im Inselsüden mit seinen schmucken alten Häusern ist das schönste Inseldorf. Besonders schön sind auch die reetgedeckten Ferienhäuser in den Dünen. Wie überall in Dänemark flattert auch hier vor den Feriendomizilen der Danebrog am Fahnenmast, der über Nacht eingeholt werden muss. Im ganzen Königreich ist es verboten, eine andere Fahne zu hissen. Auch keine HSV-, Totenkopffahnen und andere Fanwimpel. Da sind die Dänen eigen.
Der Tourismus begann Ende des 19. Jahrhunderts aber in Fanø Bad, nachdem die Insel die Umstellung auf Dampfschiffe verschlafen hatte. Dort wurden 1891 auf Initiative des Königs die ersten Hotels gebaut, 1901 der erste Golfplatz Dänemarks angelegt. Christian IX. quartierte sich ein, der Adel und die gut Betuchten folgten. Man vergnügte sich am Strand bei Veteranenrennen, ließ sich in rumpelnden Badekarren ins Meer geleiten, und die ersten selbstgebastelten Strandsegler kamen zum Einsatz. Im Café Victoria's Palace – an der Stelle stand einst das Nobelhotel, in dem der König abstieg – kann man bei Kaffee und Kuchen die Lichtbilder von alten Ansichten anschauen, die an die Wand geworfen werden.
Die besten Zeiten in Fanø Bad sind vorbei. Zwar stehen noch einige Strandvillen aus der Jahrhundertwende verloren herum. Doch die meisten Gründerzeitvillen wurden in den siebziger Jahren abgerissen, stattdessen sterile Apartmenthäuser aus Beton hingeklotzt. Wundersamerweise blieb das zauberhafte Sønderho im Windschatten der südlichen Dünenreihe und der Wattenmeerdeiche von dieser Entwicklung verschont.