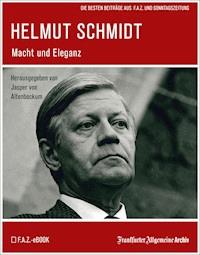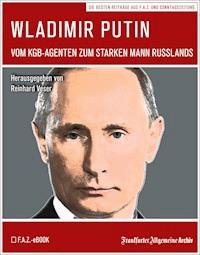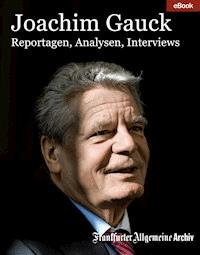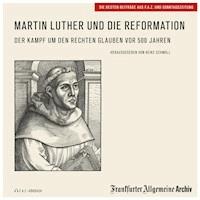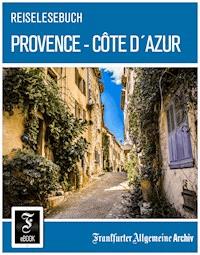
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei südliche Sehnsuchtsziele in einem eBook: Die Provence und der Mittelmeerabschnitt der Côte d'Azur bezaubern gleichermaßen durch ihre Landschaften, Dörfer und Städte wie durch das mediterrane Klima mit all seinen Düften, Farben und Lichtern. Dieses reich bebilderte F.A.Z.- eBook führt dem Leser die Schönheit und Vielseitigkeit der Landschaften dieser Region, die Mentalität ihrer Bewohner und die kulturellen und kulinarischen Besonderheiten vor Augen. Die 49 schönsten Reiseberichte aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung wurden hierfür ausgewählt und neu zusammengestellt. Sie sind fundiert recherchiert und lebhaft geschrieben. So erfährt der Leser hier so manches, was in keinem Reiseführer steht, aus einer Region, in der sowohl die Künstlerbohème als auch der internationale Jet Set sich zuhause fühlen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reiselesebuch
Provence und Côte d’Azur
F.A.Z.-eBook 29
Frankfurter Allgemeine Archiv
Projektleitung: Franz-Josef Gasterich
Produktionssteuerung: Christine Pfeiffer-Piechotta
Redaktion und Gestaltung: Birgitta Fella, Hans Peter Trötscher
eBook-Produktion: readbox publishing gmbh
Titelbild: Gasse im mittelalterlichen Saint-Paul-de-Vence © Fotolia.com
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb: [email protected]
© 2014 F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
ePub-ISBN 978-3-89843-294-8
Rückblick statt Vorwort
Vor uns wölbt sich das Meer
In den frühen Fünfzigern mit Vaters Auto an die Côte d’Azur – Ein Nachmittag mit Südwörtern
Von Ludwig Harig
Wie oft sind wir bei dem Städtchen Serves im Rhônetal an der hohen Bruchsteinmauer vorbeigebraust, haben mit Zeigefingern die romanischen Arkaden in die Luft gezeichnet und laut ausgerufen: „Hier fängt der Süden an!“ Als wir zum ersten Mal hinkamen und von weitem schon diese zyklopische Wand aufragen sahen, verschlug es uns die Stimme: auf der Mauerkrone blühende Agaven im Maulbeergestrüpp, stinkender Goldregen vor dem Bahndamm und zwischen den Zähnen feiner, von den Reifen der Autos aufgewirbelter Sandstaub, der nach Salzwasser schmeckte.
So ist es geblieben, mehr als vierzig Jahre danach. Immer noch blüht die Agave, stinkt der Goldregen, immer noch schnarren Zikaden, krabbeln Schnurfüßler, dampft die mythische Erde: Pans Weinhumpen hängt mit abgegriffenem Henkel am Lorbeerstrauch, wo ihn Vergil schon hingehängt hat, und im Nymphengarten sitzt Aristophanes und speist Erdbeeren und Myrrhen, Mädchennaschwerk. „Nur sehe ich weit und breit keine Nymphe mehr“, sagt Brigitte, „und der dicke Pan hat sich sicher auch verdrückt. Nicht einmal die Mauer hat gehalten, was sie damals versprach. Sie ist gar kein schönes altes Bauwerk aus roten und braunen und gelben Natursteinen, wie wir es in Erinnerung haben, sondern eine graue Betonwand, durch Rundbögen verstärkt. Und was mir noch auffällt: Stand die Mauer früher nicht viel näher an der Straße?“
Schon mit zwanzig wollten wir den Süden sehen und es den Idolen aus Mode, Film und illustrierten Blättern gleichtun, in Nizza auf der Promenade des Anglais unter Palmen spazieren gehen, in Cannes an der Croisette einen Pernod trinken, Eis schlecken im Eispalast, Austern essen an der Austernbude, baden in der Badebucht. Bizarre Geschichten aus der Boulevardpresse hatten Staub aufgewirbelt: Ein amerikanischer Millionär bewundert dreißig Jahre lang von seiner Yacht aus das Bergmassiv des Estérel und stirbt an einer Halsstarre, die ihm den Hauptnervenstrang abdrückt; eine schwedische Filmschauspielerin lehnt in ihrem Garten mit Vorliebe am Stamm eines Trompetenbaums, wird von einer Kreuzotter gebissen und stirbt am Schlangengift.
Das war noch vor der Zeit, als Brigitte Bardot ihre Sommertage in St. Tropez zubrachte und Françoise Sagan im offenen Sportwagen durch die Gegend kutschierte und barfuß das Gaspedal bediente – doch es kitzelte uns in der Fußsohle schon ein paar Jahre zuvor, und so waren wir nicht mehr zu halten und brachen im Sommer 1953 zum ersten Mal in den Süden auf.
Wir reisten zu dritt: Brigitte, mein Bruder Hermann und ich. Wenn ich mir das ganze Drum und Dran dieser Reise heute ins Gedächtnis zurückrufe, kommt es mir vor, als seien damals drei arglose bunte Vögel unterwegs gewesen, auf gut Glück ins Eldorado auszuziehen. Nur wer Tollheit mit Abenteuerlust verwechselt, hätte in uns Nachäffer der drei Musketiere vermuten können, die seinerzeit hoch zu Ross das halbe Europa unsicher gemacht haben. Wir hatten es nicht darauf abgesehen, unser Leben aufs Spiel zu setzen, an Halsstarre zu sterben wie der Millionär oder am Schlangenbiss zugrunde zu gehen wie die Filmschauspielerin – uns stach der Hafer, mit imposantem Automobil und forschem Auftreten ein bisschen Staub aufzuwirbeln.
Kaum in Lothringen angekommen, liefen uns die Kinder nach. Der Mercedes nämlich, den Vater gekauft hatte – Kabriolimousine, Typ 170V, Vorkriegsmodell – war kein gewöhnliches Auto: Die Trittbretter schwangen sich ausladend an den beiden Seitenfronten des Wagens entlang, die Türgriffe, chromblitzend und solide gefertigt, lagen handlich zwischen Daumen und Fingern, der Kühlergrill glitzerte wie das Gitter eines mondänen Kachelofens, und wir dahinter, auf breiten Lederpolstern, lehnten uns bei heruntergedrehten Scheiben lässig aus dem Fenster, lauschten dem Rauschen der Reifen und dem behaglichen Brummen des Motors. Hermann hatte das Auto neu lackiert, das frische Grün aus Vaters Firmenfarbe hellte nun das vornehme Mercedesschwarz auf, die Farbenkombination war ungebräuchlich und so augenfällig, dass die lothringischen Kinder dem Wagen oft bis ans Ende der Ortschaft hinterherliefen. Unterwegs wollten wir uns nirgends länger aufhalten als nötig. Nur in Seurre machten wir Station, dort blieben wir für einen Abend und eine Nacht bei Roland Cazet, meinem Freund aus der Lyoner Zeit.
Die Landschaft der Provence und der Küstenabschnitt der Côte d’Azur gehören zur südostfranzösischen Region Provence-Alpes-Côte d’Azur mit den Départements Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var und Vaucluse. F.A.Z.-Karte Levinger
Am nächsten Morgen brachen wir beizeiten auf: Es lockte der Süden, Nur ein paar Kilometer hinter Seurre bogen wir rechts auf die schnurgerade Straße nach Chalon ab. Zwischen den Ortschaften erhöhten wir das Tempo, fuhren mit größerer Geschwindigkeit über die weit geschwungenen Bodenwellen, rollten durch die Burgundische Pforte die Saône entlang bis vor die Hügel der Monts d’Or. Am Flussufer schlugen wir unser Zelt auf, wie der junge Jean-Jacques Rousseau, der einst flussabwärts in der Stadt Lyon eine Nacht an der Saône verbracht hatte: verzaubert vom rosigen Abendgewölk, verzückt vom Gesang der Nachtigallen.
Heute wie vor vierzig Jahren führt die alte N 7 durch hinziehende Straßendörfer die Rhône entlang. Das verwaschene Bleu und Gelb und Rosa der Häuserfronten ist noch blasser geworden und erinnert an die Charmeusefarben der Damenunterwäsche aus den Fünfzigern. In Montélimar schwenkt der Verkehr um die Altstadt herum, durchquert die breite Platanenallee, in der Kunstmaler und Souvenirhändler ihre Stände aufgeschlagen haben. Den weltberühmten Nougat von Montélimar gibt es immer noch in Pappschachteln, die den rotweißen Kilometersteinen der Nationalstraße nachgebildet sind, klein- und großformatig, mit pfiffigen Werbeaufschriften. Damals fuhren wir in jede Stadt hinein, bestiegen das antike Theater von Orange, tanzten über die Brücke von Avignon, tranken vom warmen Brunnenwasser der Cours Mirabeau in Aix-en-Provence und brachten den halben Nachmittag an einem winzigen Caféhaustischchen zu.
Aix-en-Provence besuchten wir diesmal nicht, wechselten von der Autoroute du Soleil zur Provençale und entdeckten von weitem das Gebirge Sainte-Victoire, das Cézanne in vielen Abwandlungen immer wieder gemalt hat: ein mit bizarrer Spitze gezacktes ungleichschenkliges Dreieck, das beim Vorüberfahren wie ein umgedrehter Tanzknopf einen Halbkreis um die eigene Achse schlägt. Nach und nach gibt es den langgestreckten Gebirgsrücken hinter sich frei, Buckel und Schultern scheinen mit Panzerstahl überzogen, der wie poliert in der Sonne glänzt. An den Böschungen der neuen Trasse, wo die Haut der Erde noch nicht wieder nachgewachsen ist, bündeln sich schräg liegende Gesteinsmassen zu einem gelbroten Adergeflecht. Im Kalkstein schimmern Ginsterkissen und üppige Bukette der Spornblume, hingehauchte Tupfer von Altrosa, gemischt aus Weiß und Karmesinrot. „Vor uns im Schein der virgilischen Sonne das Gebirge Sainte-Victoire, ungeheuer groß, zart und blau, die Täler des Montaignet, der Viadukt des Pont de l’Arc, die Häuser, das Rauschen der Bäume, die viereckigen Feldstreifen“, schreibt Joachim Gasquet, der vor hundert Jahren noch näher als wir heute bis zum Standort des Malers herangegangen war.
Vor vierzig Jahren fanden wir den rechten Weg wie im Traum. Zwischen runden, schwarzen Schieferkuppen, tief ins Dunkel getrieben vom Hartlaub dichter Kastanien- und Korkeichenwälder und nur selten erhellt von gelbweißen Kalkwänden, durchquerten wir schlafwandlerisch das Massif des Maures, stiegen von Passhöhe zu Passhöhe empor, wechselten in kurvenreiche Talfahrten über, und ich genoss, wenn ich am Steuer saß, das Zurückschalten in den scharfen Kehren.
„Rasche Wendung des Weges: Vor uns wölbt sich das Meer. Grün des Olivengeheges rennt jetzt neben uns her, brennende Fahnen aus Halmen, Drahtverhau der Kakteen. Weiße Villen mit Palmen steigen, fallen, vergehn. Weggeschmolzen die Linien, feurig flirrt der Asphalt.Nur noch die schwankenden Pinien haben Stand und Gestalt.“
Es war der 5. August 1953, ein sonnendurchglühter Mittwoch-nachmittag. Ich saß auf einem Stein, mein Notizbuch auf den Knien, und kam mir vor wie Gottfried Benn beim Dichten, von Kopf bis Fuß wie ein Pantoffeltierchen mit Flimmerhaaren bedeckt. Es sind aber keine Sporen und Algen, die das Wimperhaar heranwedelt, sondern Wörter – es sind Wörter mit Rausch- und Wallungswert, Südwörter, Schamanenwörter, die den Himmel von Sansibar und das Meer der Syrten herbeizaubern können. Aber aufgepasst: „Nicht immer sind diese Flimmerhaare tätig“, verrät Gottfried Benn in seinem Marburger Vortrag, „sie haben ihre Stunde.“ Und genau diese Stunde der unermüdlichen Flimmerhaare war an jenem Mittwochnachmittag hinter Roquebrussanne im Maurengebirge herangekommen: Ich sitze auf einem Felsbrocken und betrachte zum ersten Mal in meinem Leben das Meer. Was für eine Aufregung, was für ein Glück! Mein Herz klopft, mein Schädel raucht, die geheimnisvollen Flimmerhaare zucken und zittern und tasten Südwörter herbei. Obwohl von diesem sagenumwobenen Mittelmeer nur ein matter Schimmer hinter Felsnasen zu sehen ist, fliegen Namen von legendären Buchten und Stränden durch die Gegend, liegt mythisches Gewese in der Luft. Unternehmungslustig, wie ihnen nachgesagt wird, sind diese Südwörter in Aktion, durchstoßen Zusammenhänge, zertrümmern Wirklichkeit und schicken sich an, die Welt neu zu erschaffen. „Sie brauchen nur die Schwingen zu öffnen, und Jahrtausende entfallen ihrem Flug“, ruft Gottfried Benn, und so wirbelt mein Stift die Südwörter über das Papier, drängt sie in neue Zusammenhänge, verschmelzt sie zu neuen Wirklichkeiten. Wie die Wörter glänzen! Die Sonne streichelt sie und reibt sie immer wieder blank. Die alten sind in den Schatten gewichen. Heute kann ich’s ja zugeben: An diesem ominösen 5. August, hoch oben im Kalkgeröll des Massif des Maures, fühlte ich mich als dichtender Halbgott, der sogar Gottfried Benn in den Schatten stellt.
Als wir jetzt wieder hinkamen, fanden wir die Stelle nicht mehr. Wir irrten durchs Gebirge, vergebens. Hinter keiner Felsnase blinzelte das Meer hervor. Am Spätnachmittag erreichten wir Hyères, durchquerten die Palmenallee, fuhren zwischen Flughafen und Salinen über die Halbinsel nach Giens. Damals wehte ein frischer Wind, und es roch nach Salz. Heute steigt aus dem verschilften Becken der Pestgestank von faulem Fisch und Vogelkadaver. In den Salzlachen verrotten Pflanzen, über den Salzhügeln kreisen Schwalbenschwärme auf der Jagd nach Insekten. In Giens ist Jahrmarkt mit Trachtenfest: Ein Reiter, zu Pferd auf dem Weg in den Friseursalon, stößt mit dem Kopf gegen den Türbalken. Wir sind in ein Tollhaus geraten, entrinnen ihm nur mit allerletzter Mühe. Gibt es am Strand von Hyères noch den geruhsamen Blick auf die Reede? Gibt es auf der Insel Porquerolles noch den begehrten Nacktbadestrand? Wir fahren immerzu, es gibt kein Halten, kein Rasten, kein Bleiben, die Parkplätze sind besetzt, die Straßen verstopft, wir quälen uns unentwegt voran in der Illusion, immerwährendes Fahren müsste ein lohnendes Ziel in Sicht bringen.
Auch Le Lavandou, einst Fischerdörfchen, ist jetzt ein Touristenzentrum. Zwischen Residence de la Plage und Domaine des Mandariniers dämmert das alte L’llot Fleuris im Halbschlaf vergessener Sommerpaläste hin. Tauch- und Segelschulen, in schäbiger Leichtbauweise konstruiert, verstellen den Blick auf die Mole. Über den Bootsmasten flattern blauweißrote Wimpelchen, winden und verdrehen sich, als müssten sie sich inmitten trostlosen Cabanen- und Budengewirrs vor Lachen krümmen. Ein alter Fischer mit Ringelhemd und Schirmmütze sitzt zwischen Fischladen und Crêperie vor einem Knäuel salzgebeizter Netze, schaut auf, nimmt seine Pfeife aus dem Mund und grüßt kopfnickend. Er lächelt, sein dicker Zeh hat sich in den Maschen verfangen und zwingt ihn, auf dem Pflaster zu verharren. Gestenreich winkt er einen jüngeren Fischer zum Plausch herbei. Zuerst schreien und lachen sie, dann werden sie leiser und ernster und haben schließlich keine Worte mehr. „Unter ihrem Ringelhemd spüren / sie den kalten Haifischzahn“, schrieb ich damals in einem Gedicht.
Das war der Süden! Das waren die Strände, die wir suchten! Wir steuerten den Mercedes über eine Bodenwelle, ließen ihn an der ausgestreckten Hand des Patrons entlang bergab unter eine Pinie rollen und schlugen im feingemahlenen Sand unser Zelt auf. Fast vergessene Tage an der Bucht von Le Lavandou! Wir schwammen, spielten Ringtennis, spielten Wasserball, spielten Fußball, einmal trat ich mit nacktem Fuß in einen Agavenstrunk. Eine tiefe Wunde klaffte, Blut lief über den Fuß, die Narbe ist heute noch zu sehen. Bei jedem Wetterumschlag rötet sie sich und ruft mit sanftem Kitzeln den Südseestrand von Cap Bénat in Erinnerung zurück.
Ein Zelt ist kein Hotelzimmer, der blaue Himmel kein Ziegeldach. Eine Trainingshose ersetzt kein Beinkleid aus Gabardine, eine Gummisandale keinen Lederschuh. Wir liefen herum wie die Landstreicher, hausten wie die Pfadfinder, lebten von der Hand in den Mund. Wir hatten nicht gelernt, den feinen Pinkel hervorzukehren, und hinter unserer Kabriolimousine liefen dort unten in den mondänen Alleen keine kleinen Kinder mehr her.
Wem waren wir eigentlich gefolgt in diesem Sommer 1953 beim Aufbruch in den Süden, der uns den Duft der großen weiten Welt in die Nase blies: irgendeiner zauberkräftigen Pansmusik oder dem aufputschenden Trommeln der Zigarettenindustrie? Wollten wir tatsächlich forsch auftreten, ein bisschen Staub aufwirbeln, ein bisschen Wellen machen? Geschmack am eleganten Leben finden? Wir stürzten uns kopfüber in die herzhaften Sommerlüste, schwammen im Meer, bräunten in der Sonne, fuhren ziellos mit dem Auto an der Küste entlang und ließen den lieben Gott einen guten Mann sein. Wir kurvten durch Croix-Valmer und Ramatuelle, kutschierten durch St-Tropez und Ste-Maxime, schauten nur mit halbem Auge nach den Häusern, mieden Kirchen und Kapellen, übergingen die bronzenen Standbilder auf den alten Stadtplätzchen mit Naserümpfen. Sogar ein paar Jahre danach noch ließen wir Kirchen und Klöster und Museen trotz ihrer vielgepriesenen Schätze links liegen, stürzten uns lieber ins Wellenbrausen des Meers als in den Redestrom eines Reiseführers, lauschten lieber dem Zikadenschnarren als dem Tönen einer Orgel. Zweimal hintereinander verbrachten wir die Ferien in Ste-Maxime im Hotel Mirador, badeten tagsüber in der Bucht, ließen uns bräunen in der Sonne. Spätnachmittags, wenn die Gluthitze nachgelassen hatte, fuhren wir nach Ramatuelle ans Grab von Gérard Philipe, dessen Filme mit Martine Carol und Gina Lollobrigida uns von den wöchentlichen Kinobesuchen in Erinnerung waren, spielten Boule im Hotelgarten, tranken Gin-Fizz zum Apéritif, schlüpften in unsere schicksten Sommerkleider, kutschierten nach dem Abendessen nach St-Tropez und saßen bis spät nachts in der Tropicana-Bar. Dort tranken wir wieder Gin-Fizz, wechselten zum Pernod über und hörten Don Byas auf dem Tenorsaxophon.
Jetzt, beim Wiederkommen, graust es uns. Was hat St-Tropez ein schäbiges Flair angenommen! Vom Parkplatz am Frachthafen, zwischen Lagerschuppen und Einkaufsbaracken, strömt die Menge an den Staffeleien der Kitschmaler vorbei zu den Anlegestellen der Yachten. Ein Tanklaster pumpt Öl in ein haushohes Motorboot, ein verdreckter Container steht quer zum Fußgängersteig. Von den alten Häuserfronten blättert die Farbe, vor den legendären Bars der fünfziger Jahre gammeln Markisen und Jalousielamellen in der scharfen Salzluft. Ein Serviermädchen, Typ Brigitte Bardot, X-Beine, Schmollmund, runde Brüste, mit quergestreiftem Ringelhemd und enger weißer Hose, balanciert mit Crêpes und Cidreflaschen durch die Holzschemelreihen. Die Berge der Maures sind hinter tief gestaffelten Metallkulissen in weite Ferne gerückt. Was uns früher anzog, stößt uns heute ab: Knalliges Gelb mischt sich mit schreiendem Rot der Reklameschilder, auf blankem Falschsilber des Blechs spiegelt sich das Geglitzer der Boote. Hinter Barrieren, Holzblöcken und Palettenstößen steht Pierre André de Suffren, Landeshauptmann und Träger des Großkreuzes von Jerusalem, in Bronze gegossen vor dem Hotel Sube, Johnny Hallyday auf seiner Harley Davidson ziert ein farbenprächtiges Plakat.
Ärger mit dem Getriebe
Wie freundlich uns im Sommer 1953 die Landschaft entgegenkam! Sie stand nicht einfach da, sie spreizte sich mit Zypressenreihen, zierte sich mit Oleander- und Kakteengewinden wie die Bühne für ein bukolisches Theaterstück. Sie hob und senkte sich, dreht sich in den Kehren und kam uns, in verschiedenerlei Gestalt verwandelt, bis vor die Räder gerollt: Bestickte Paradeteppiche der Küstenhügel wallten über die Häuser hinweg und schütteten Blüten auf den Asphalt, klobige Steinriesen des Estérel in goldbraune Panzer gehüllt, schritten über die Straße und setzten ihre Füße ins Meer.
Wohlbehütet in kühlen Ledersesseln, uns fest verlassend auf die reibungslosen Abläufe des Wellen- und Räderspiels, rollten wir durch Cannes und Nizza. Und doch, das Auto war nicht unverwüstlich. Schon in der Calanques des Issambres, wo Hermann in den engen Kehren ständig runter- und raufschalten musste, drang aus dem Innern des Getriebes ein feines Sirren an mein Ohr. Zuerst knisterte es nur hin und wieder, zischelte und rieselte, schien mir aber nicht erwähnenswert. Doch beim Hinauffahren nach Villefranche-sur-Mer krachte es in einer Kurve derart schrill und abscheulich, dass Hermann und Brigitte das Spektakel in meinem Ohr auf einmal nicht mehr für eine Einbildung meiner hypochondrischen Natur halten konnten.
Am steilen Hang, im Garten einer Villa, bezogen wir einen Campingplatz. Unter einem Feigenbaum schlugen wir unser Zelt auf, stellten den Wagen in der Einfahrt ab und gingen in den darauffolgenden Tagen nur noch zu Fuß. „Das Getriebe muss sich von den Strapazen erholen“, meinte Hermann, „ihr werdet’s erleben, in ein paar Tagen ist von dem Geräusch nix mehr zu hören.“
Anderntags in aller Herrgottsfrühe schlugen wir das Zelt ab, packten unsere Sachen zusammen und traten die Rückreise an. Adieu denn, schöner, krummer Feigenbaum von Villefranche! Immer, wenn ich seitdem eine frische Feige esse, denke ich an ihn; immer, wenn unser Auto lauter brummt als gewöhnlich, kommt er mir in den Sinn! Irgendwo in Cannes, mitten im dichtesten Stadtverkehr, zerbarst das Gehäuse. Auf dem Weg zu einer Reparaturwerkstatt, nachdem das Mahlen und Stampfen die Ausmaße einer modernen kakophonischen Musik angenommen, holte Hermann mit einem letzten Fußdruck auf Gaspedal zu einer schwelgerischen Kadenz aus. Nur das Räderwerk der künstlichen Nachtigall im Märchen von Andersen hat sein Leben in einem so dramatischen Todeskampf ausgehaucht wie das Getriebe von Vaters Mercedes.
Nach einer Schrecksekunde fiel das Wort Differential, dem ein paar andere hartklingende Wörter folgten: brisé, cassé, éclaté. Der kalte Schauer lief uns über den Rücken. O nein, meinte der Patron der Reparaturwerkstatt, es bestehe überhaupt kein Grund zur Sorge. Die zerbrochenen Teile seien leicht zu beschaffen, in zwei, drei Tagen habe er sie aus Nizza oder Toulon herbeigeholt, und der Schaden sei im Nu behoben. Wir räumten den Kofferraum aus, und mit Sack und Pack zogen wir auf den Campingplatz von La Napoule.
Hier, im schönsten Pinienhain des Südens, schlugen wir unser Zelt auf und lebten mit französischen und holländischen und schweizerischen Campern wie die Faune und Nymphen, sprangen im Wald umher, schwammen im Meer und kamen uns vor wie die unsterblichen Halbgötter. In diesem Hain hätten wir ausgeharrt, bis die Pinienzapfen gefallen wären! Und zu unserem Glück dauerte es nicht zwei, drei Tage, es dauerte zwei, drei Wochen, bis das zersprungene Differential wieder repariert war. So vergnügten wir uns an Ort und Stelle, und endlich hatten wir, was wir suchten, tummelten uns den ganzen Tag am Strand, schwammen im Meer, bräunten in der Sonne – und kein mondänes Getue! Kein Chateaubriand konnte so schmackhaft sein wie Steaks und Pommes frites vom Budengrill, kein Mouton-Rothschild so süffig wie ein algerischer Mascara aus der Literflasche!
Tagsüber in den Schwimmpausen und spätnachmittags vor dem Abendimbiss lag ich im Sand und schmökerte: Ich las Hans Falladas Roman „Wolf unter Wölfen“. In irgendeiner Pappschachtel gibt es ein Foto, darauf liege ich bäuchlings im Sand neben dem Zelt, das Buch in beiden Händen vor dem Gesicht, dass man den Titel lesen kann. Noch heute erinnere ich mich an die Geschichte vom verzweifelten Deutschen der Inflationszeit. Vielleicht die anderen, dachte ich, ja die anderen sind die Wölfe, räkelte mich im Sand und genoss das schöne Leben in der Sonne.
Abschied von Pan
Ende August kam Bescheid aus der Werkstatt: „Das Differential ist repariert, der Mercedes wieder fahrbereit und kann abgeholt werden.“ Mit dem Bus fuhren wir hin, gingen schnurstracks an die Kasse und nahmen die Rechnung in Empfang. Die Höhe der Summe habe ich vergessen, doch erinnere ich mich an unser jähes Erschrecken. Nicht einmal unsere Armbanduhren und Brigittes Halskettchen mit dem vielgeliebten Aquamarin als Pfand samt aller zusammengekratzten Francstücke hätte ausgereicht, sie zu begleichen. Keine Bange, wir sollten die Rechnung getrost einstecken und von zu Hause aus die Summe per Banküberweisung herschicken, sagte der Patron, er habe sich die Autopapiere und die Nummernschilder genau angeschaut und schließe daraus, dass wir so gut wie keine Ausländer seien. Und auf unserem Führerschein, fügte er aufgeräumt hinzu, sei jeder Vordruck auch in französischer Sprache zu lesen, vom moteur über den cachet bis zur signature. Seine schlitzohrige Miene verriet uns: Er war alles haargenau durchgegangen: Zulassung, Führerscheine, Versicherungspapiere, vielleicht hatte er sich sogar die eingestanzte Motornummer notiert.
Als wir dann, schon auf dem Nachhauseweg, noch einmal am Camp de la Pinède vorüberfuhren, grüßten wir mit lautem Hallo und wilden Gebärden. Bocksfüßiger, ziegenbärtiger Pan, so sanft hingeschmiegt zwischen den beiden Flüsschen haben wir deinen lieblichen Hain nie wiedergesehen! Vierzig Jahre danach, zum Golfplatz arriviert, liegt er eingezwängt zwischen vierspuriger Fahrstraße, ausbetoniertem Flussbett und frisch geschotterter Bahntrasse, mit Hügelchen und Bodenwellen, Flachbahnen und Sandkuhlen, kurz geschoren bis zum letzten Grün hinter einem Maschendrahtzaun versperrt. An der Meerseite gegenüber protzen das Strandhotel und der Bootshafen, jenseits der Flussbrücke die Restaurants, Agenturen, Tankstellen und eine Reihe mehrstöckiger Hochhäuser mit Park und Tennisplätzen dahinter.
Hinter Cannes biegen wir landeinwärts ab nach Vallauris. Ein Dörfchen mit schmaler, aufsteigender Straße ist uns in Erinnerung geblieben, am Ende, hoch oben links von der Kirche, ein Plätzchen mit dem Standbild eines Schafhirten. Hier arbeitete Picasso seinerzeit, zeichnete, malte, töpferte, modellierte die Hirtenplastik für das Plätzchen. Damals haben wir Ausschau nach ihm gehalten, wir haben ihn nirgendwo entdeckt. Heute ist die Straße vollgestopft mit Töpferwaren: Teller und Tassen, Vasen, Kännchen, Schüsseln, aber auch Hühner und Tauben, Stiere und Fische. Jedes Haus ist eine Galerie, jeder Keller ein Ausstellungsraum für Villen-und Brunnenanlagen aus Keramik. Obwohl es so aussieht, als hätte Picasso jeder Suppenterrine, jedem Eierbecher, jedem Sparschwein seinen Fingerabdruck hinterlassen: Die Töpfererde von Vallauris, der er ihre Körperlichkeit, ihre Schwere genommen und die er ins Stofflose der Kunst gewendet hat, ist unter den Fingern schlechter Keramiker wieder Material geworden: Essgeschirr, Tafelzubehör, Gebrauchsgegenstand. In Picassos Bronzefigur L’homme au mouton auf dem Marktplätzchen neben der Kirche hat der alte Pan die Züge eines Menschen angenommen. Ein kahlköpfiger Hirt, den Blick nach innen gekehrt, mit breiten, schweren Händen, trägt das Lamm gegen seine Brust gepresst: Tier und Mensch gehören untrennbar zusammen, drei Beine des Lamms und drei Finger des Hirten sind eng ineinander geknotet.
Gesättigt von den Farben und Klängen treten wir auf die Terrasse des Herrenhauses, hoch über klobiger Bruchsteinmauer. Vor uns wölbt sich das Meer. Wir sind aber in einen anderen Süden zurückgekehrt. Hier, wo er mit unstofflichen Instrumenten über Menschenlärm und Autogetöse hinwegtönt, ist er eine schöne Idee.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3.8.1995
Durch die Provence: Dörfer und Berge
Der Koch, der Alchimist und der Karpfendompteur
Ein Dorfreigen aus der Provence
Von Klaus Simon
Rooobiiie, ah ouiii“, seufzt die Kellnerin im Café du Cours und weist mit der Hand nach draußen. Hier auf der Terrasse habe er gesessen, hier in Cotignac, wo Freunde des britischen Popstars Robbie Williams ein Landhaus besitzen sollen. Wo es ist, weiß Mademoiselle nicht. Oder will sie ihr Geheimnis nicht teilen? Der Blick in den französischen Reiseführer „Guide du Routard“ bringt auch nicht weiter. Die Bibel für geläuterte Alternativreisende orakelt nebulös, dass der Sänger und Schwarm aller Demoiselles diesseits und jenseits des Ärmelkanals im Sommer „regelmäßig in den Ferien zu Freunden nach Cotignac fährt“.
Ob mit oder ohne Freunde unter den Ferienhausbesitzern von Cotignac, man verirrt sich nicht einfach so in das Dorf tief im Hinterland des Departements Var. St-Tropez ist viele, zu viele Haarnadelkurven entfernt, und Cotignac ist leicht zu übersehen. Fast alle Dörfer der Provence liegen auf einem Hügel. Man fährt von weitem auf eine Silhouette mit Burg und Belfried zu, immer höher, bis der Motor heult. Nicht so Cotignac, das nach endloser Schunkelei in einer Mulde auftaucht. Ein gestriger Charme liegt über den Krimskramsläden am Cours Gambetta. Hinter der Theke stehen Paulette oder Antoine. So sagt es das verblichene Türschild. Schick ist die Provence woanders, aber auch selten so unberührt wie in Cotignac.
Eine poröse Felswand mit zwei abgenagten Türmen obendrauf nimmt das Dorf von Norden in die Zange. Steile Treppen führen vom Cours Gambetta an den Fuß der Wand. Beim Näherkommen erkennt man Höhlen, dann vermauerte Nischen und Scharten im achtzig Meter hohen Tuffstein. Es wird immer enger, bis an einem Kassenhäuschen zwei Euro fällig sind. Dafür erhält man Zutritt in ein Höhlenlabyrinth, aus dem die letzten Bewohner 1902 nach einem verhängnisvollen Erdrutsch ausgezogen sind. Das verlassene Höhlenviertel ist kein Ort für Klaustrophobe. Über mehrere Stockwerke winden sich Gänge, die man nur gebückt passieren kann. Die Schultern reiben sich am feuchten Fels. Durch spärliche Öffnungen fällt etwas Licht auf den rotgelben Tuffstein. Bald will man nur noch heraus aus der Enge, herunter ins Dorf, zurück ins Leben, so wie einst Cotignacs Einwohner.
Schon lange vor dem endgültigen Aus für das Höhlenviertel flohen die ersten Bewohner aus der Enge. Die, die zuvor ein Fledermausleben zwischen Stalaktiten und Stalagmiten geführt hatten, setzten in die Mulde unter dem Fels ein prachtvolles Palais ans nächste. So entstand im Spätmittelalter das heutige Cotignac. Renaissance-Fratzen schauen auf das Pflaster der Grande Rue. Das Rathaus gluckt in respektheischendem Barock zwischen abricot- und zitronengelben Fassaden. Gegenüber setzt die Tour de l’Horloge mit einem der schönsten schmiedeeisernen Campanile der Provence der Dächerlandschaft die Krone auf. Es mag sein, dass sich die Sucht nach Licht und Luft aus der Erinnerung an die Jahrhunderte in den Höhlen speist. Jedenfalls war Cotignac Frankreichs erstes, vollelektrifiziertes Dorf.
Keine heimelige Place, sondern ein Cours, so gewaltig wie ein Fußballfeld, weitet sich in der Mitte des Ortes. Es ist die Bühne, auf der das Dorf große Stadt probt. Quer über den Cours Gambetta sitzt man erstens im Café. Und bleibt zweitens im Café sitzen. Dann wird flaniert. Von rechts nach links und auf der anderen Seite zurück von links nach rechts. Man zeigt den neuen Freund oder das neue Fähnchen. Platanen stülpen ein schummeriggrünes Dach über das Treiben. Die Comédie humaine darunter wird nach festen Regeln gespielt. Punkt ein Uhr nachmittags knallt der Metallrolladen des Bar-Tabac herunter. Die Touristen fallen auf die aufgetakelten Terrassen direkt am Brunnen rein. Die Einheimischen wissen es besser und gehen im bodenständigen Restaurant du Cours zu Tisch. Der Metzger hat Mittwoch geschlossen. Dann gibt es im Café des Sports keine „pieds-paquets“ – mit Fleisch und Gewürzen gefüllte Kaldaunen. Am Dienstag strömen alle durcheinander zum Markt auf dem Cours.
Nur einer bleibt daheim: Gabriel-Henri Blanc. Seit mehr als dreißig Jahren porträtiert der alte Herr mit der ergrauten Künstlermähne die Welt, soll heißen Cotignac. Das kühle Atelier in einer Seitenstraße des Cours hat sich im Lauf der Jahre zu einer Art Dorfarchiv gewandelt. Monsieur Blanc hält die Geschicke von Cotignac in dicken Büchern fest. Dazu benutzt er Tinte und Federkiel sowie sein Gedächtnis. Der Dorfchronist ist ein geduldiger Mensch. Eines kann er freilich nicht leiden: dass man ihn nach britischen Popstars fragt, die er sowieso nicht kennt. Prompt wird er grantelig.
Der Tanz der Fische
In Cucuron, viele Berge und das breite Tal der Durance weiter westlich, heißt der Star Alain. Einmal am Tag lässt Alain die Karpfen tanzen. Dazu sammelt der Patron der Bar de l’Etang in der Küche ein, was seine Gäste im Laufe des Tages an Brot verschmäht haben. In aller Seelenruhe schreitet er nun zum Dorfteich. Ahnungslos trinken Cucuron-Besucher auf der Terrasse ihren Kaffee. Schaut keiner herüber, werfen sich die Stammgäste einen komplizenhaften Blick zu. Denn Alains Stunde ist gekommen: Die ersten Brotkrumen landen auf dem Wasser. In Sekundenschnelle wird aus dem stillen Teich ein wildes Wasser. Kiloschwere Karpfen springen leicht wie eine Bachforelle empor. Laut klatschend plumpsen die fetten Leiber ins Wasser zurück, jede Bauchlandung ein Wellenschlag. Die Nummer reißt alle vom Caféstuhl. So als ob nichts gewesen wäre, kehrt der Karpfendompteur dann zurück an die Theke.
Der Etang ist genaugenommen ein rechteckiges Bassin mit dicken Mauern, ungefähr so groß wie ein Schwimmbad in Olympiaformat. Ganz am Ende dösen die roten Löschfahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr in einer offenen Garage. Ganz vorn sitzt man in der Bar de l’Etang, an Tischen, die unter den gigantischen Platanen wie Puppenstubenmöbel wirken. Unter den zweihundert Jahre alten Kronen verharrt das Leben im Schummerlicht. Soweit ähneln sich der Etang von Cucuron und der Cours von Cotignac. Cucuron ist ein ebenso gesundes Dorf wie Cotignac. Es gibt einen Metzger, einen Bäcker, eine Epicerie, dazu ein Kurzwaren- und Bekleidungsgeschäft mit dem madamigem Chic der Provinz.
Geradezu sensationell jedoch ist, dass Cucuron nur eine Immobilienagentur hat, was rekordverdächtiger Tiefststand im Luberon sein dürfte. Schilder mit der Aufschrift „à vendre“ sind entsprechend selten. In einer Gasse verkauft eine schlohweiße Alte Feigen und Tomaten aus dem eigenen Garten, einen Euro zwanzig Cents der Pappkarton, abgewogen wird nicht. Der Asphalt sieht aus wie ein Flickenteppich in Grau-Schwarz-Grau. Das war das Dorf, das Jean-Paul Rappeneau Mitte der neunziger Jahre für die Verfilmung des „Husaren auf dem Dach“ nach einer Novelle von Giono gesucht hatte. In Cucuron ließ er Juliette Binoche nach dem Husaren schmachten. Das tut die bleiche Schöne noch immer, freilich nur vom Kinoplakat an einer Wand der Bar de l’Etang.
Unbeeindruckt vom Filmerfolg geht alles weiter seinen gewohnten Gang. Die Besitzerin des kleinen Hotels am Teich pflegt ihre Launen. Alain probt sich als bester aller möglichen Karpfendompteure. Für Aufregung sorgen indes auch in Cucuron die Briten, in diesem Fall eine Multimillionärin. Lady Hamlyn heißt die Dame, die ihrem Lieblingskoch Michel Mehdi vor fünf Sommern ein kleines, sehr feines Restaurant in bester Lage am Etang eingerichtet hat. Für einen Augenblick glaubte „tout Cucuron“, der Dorffrieden sei für immer dahin. Die Wogen haben sich wieder geglättet. Einem Küchengenie wie Lady Hamlyns „Mister Michel“ verzeiht man in Frankreich alles. Nur als ein von der flittrigen Côte d’Azur nach Cucuron geeilter Gast lauthals nach dem „voiturier“ schrie, verstand man in Cucuron die Welt nicht mehr. „Ein Wagenmeister, um sein Auto parken zu lassen! Rund um den Teich findet man immer einen Platz“, grummelt der Patron der Bar de l’Etang.
Vielleicht war es eine Dummheit, Cucuron wieder zu verlassen. Zu spät. Als der Gedanke durch den Kopf schießt, tauchen schon die Alpilles am Horizont auf.
So still ruht der Löschteich, wenn keine Karpfen darin tanzen. Unter Schatten spendenden Platanen des Cafés lässt sich in Cucuron trefflich der Sommer genießen. Foto: Alain Hocquel / Coll. CDT Vaucluse
Merci, Monsieur le Maire
Olivenhaine schimmern silbrig aus der gelb verbrannten Ebene. Im Süden bäumt sich der Drachenzackenkamm eines knochenbleichen Gebirgszugs auf. Die Provence ist plötzlich eine steinige Sierra. Keine Wolke nirgends. Vom stahlblauen Himmel brennt eine unbarmherzige Sonne. Zwei kerzengerade Zypressen bewachen ein schlichtes Kapellchen, dessen Mauern sich am nackten Fels festkrallen. Laut Karte heißt das nächste Dorf Eygalières. „Eigalier“ steht auf dem Ortsschild. So heißt das Dorf auf provenzalisch. So will es der Bürgermeister.
„Eygalières ist ein rätselhaftes Dorf, voller Magie“ poltert es aus Florence Jullion hervor. Ihr Akzent weist unüberhörbar nach Québec. Die Botanikerin stammt aus Montréal. Besser gefällt es ihr allerdings in Eygalières, wo die Frankokanadierin den Jardin de l’Alchimiste leitet. Durch ein Labyrinth, dessen Gänge aus der Luft betrachtet das hebräische Wort „berechit“ ergeben, fädelt man sich in den Garten hinein. Das Wort bedeutet „am Anfang“. So beginnt die Bibel. Drei Etappen führen zum Stein des Philosophen, dem Ziel aller alchimistischer Erkenntnis. Das „schwarze Werk“ mit Schieferplatten und düsterem Heckentunnel, das „weiße Werk“ mit weißadrigem Schilf und blassen Iceberg-Rosen, schließlich das „rote Werk“, in dem die Granatäpfel mit den blutroten Bellegarde-Rosen um die Wette leuchten. Hinter einem Wall aus Heckenrosen schreitet ein Grüppchen Freizeitalchimisten mit dem Pendel in der Hand durch die Beete. „Besser man sagt nichts, sonst endet man als verzauberter Kürbis“, warnt Florence. Und lacht schallend los.
Beim Bürgermeister von Eygalières hat Florence nichts zu lachen. Der ist ein streitbarer Mann, stolz auf sein Dorf wie ein Landesfürst. Der Bürgermeister will keinen Tourismus. Deshalb gibt es kein Office de Tourisme. Deshalb musste Florence zwei Jahre kämpfen, bis ein Hinweisschild zum Alchimistengarten aufgestellt wurde. Womit wir erstens bei den Dorfquerelen gelandet wären und zweitens klar ist, dass Eygalières ein provenzalisches Dorf wie viele andere ist, mit Bar-Tabac, Boule-Spielern, Immobilienagenturen, Sterne-Koch und einem streitbaren Bürgermeister, der keine Touristen mag, dafür aber steuergewichtige Prominente.
Charles Aznavour, Amanda Lear, Showmaster Michel Drucker und die Familie von Premierminister Jospin besitzen ein Haus in der Nähe. Die Prominenten verirren sich selten aus ihren Villen à la campagne in das Dorf. Wenn, dann höchstens ins Restaurant des Flamen Wout Bru, in dem für teures Geld himmlisch getafelt wird. Wie in Cucuron erregen die Reichen und Schönen in Eygalières keinen Neid. Ein paar Schritte vom Luxusrestaurant entfernt zechen Eygalières’ Winzer und Olivenbauern im Café Le Progrès. Nach getaner Arbeit. Und davor. Und zwischendurch. Dabei leisten ihnen Radfahrer und Wanderer Unterstützung, die durstig auf der Terrasse eintrudeln.
Hinauf ins „vieux village“ bemüht sich kaum jemand, außer den Touristen natürlich. Man kennt das schon aus Cotignac: Vor hundert Jahren, als es nichts mehr abzuwehren galt, ist Eygalières hinunter in die Ebene gerutscht. Zurück auf dem Hügel blieb das alte Dorf, ein Trümmerfeld, das kaum vom hellen Kalkfels zu unterscheiden ist. Ein Barockgiebel zeichnet sich messerscharf ins Blau des Horizonts. Dahinter gähnt ein Abgrund. Der Blick fällt im Sturzflug in die Ebene, durchpflügt einen Weinberg und schnellt an der steilen Nordflanke der Alpilles wieder hoch. So abrupt erheben sich die Alpilles aus der Ebene, dass man meint, auf eine Dreitausenderkette zu schauen. Nichts und niemand stört die Aussicht. Denn es gibt ja kein Office de Tourisme in Eygalières, das Fremde zum einsamen Aussichtspunkt hochschicken könnte. Man sollte dem Bürgermeister dankbar dafür sein.
Résistes!
In Simiane-la-Rotonde gibt es kein Hotel. Die Bar hat nur im Sommer auf. Ohnehin packen die meisten Bewohner im Herbst ihre Koffer und kehren erst im Frühjahr zurück. So hält es auch Martine Cazin, die immer etwas scheu aufschaut, wenn sich Besucher in ihr Töpferatelier verirren. Warum die damals frischgebackene Absolventin der Kunsthochschule vor einer halben Ewigkeit nach Simiane-la-Rotonde an den Südrand des Plateau d’Albion zog? Die Liebe, was sonst, hat sie vor langer Zeit aus Paris in die Hochprovence verschlagen. Martine war gerade angekommen, als die Strategen im Pariser Verteidigungsministerium eine Raketenabschussbasis auf dem Plateau planten. Achthundert Quadratkilometer wurden eingezäunt, die Armee stellte Atomraketen auf. In Simiane-la-Rotonde regte sich der Widerstand. Der Rest ist Geschichte. Fünfundzwanzig Jahre lang währte der Kampf von Martine und Weggenossen gegen die Atomraketenbasis. Es war ein Kampf wie der von David gegen Goliath. David hat gewonnen: Die Armee zog 1996 mit ihren zweitausend Soldaten und Zivilangestellten ab. In einigen Dörfern am Rand des Plateaus gingen fast die Lichter aus, und es wurde noch einsamer in diesem ohnehin fast menschenleeren Landstrich der Hochprovence. Auch in Simiane-la-Rotonde wurde es stiller.
Im Oberdorf sind die Gassen zu eng für Autos. Jeder Einkauf muss vom Parkplatz am Rathaus hochgeschleppt werden. Es geht bergauf, immer den Drehungen der Gassen nach, die sich wie das Innere eines Schneckenhauses den Kalkhügel hochschrauben. Wie Bauklötzchen stehen die Häuser am Hang, eines aufrechter als das andere. Kein graziler Campanile krönt die Dächer. Kein Cours, kein Etang weitet sich zur schattigen Bühne. Statt dessen thront ein runder Koloss über dem Dorf: la Rotonde, so einmalig, so unverwechselbar, dass der behäbige Turm dem Dorfnamen angehängt wurde – Simiane-la-Rotonde. Generationen von Kunsthistorikern und Archäologen haben sich die Zähne am ungeschlachten Turm ausgebissen. Für die einen ist die Rotonde ein Wehrturm der längst zerstörten Burg. Ihre Gegner weisen auf die Steinfratzen im Kuppelsaal hin und sehen im Turm eine mittelalterliche Kultstätte. Der Magie der Rotonde entzieht sich niemand, auch den kahlgeschorenen Rekruten der Fremdenlegion gelingt das nicht, die einen Teil der freigewordenen Militärbasis auf dem Plateau d’Albion übernommen hat. Am Wochenende kommen die Soldaten manchmal ins Dorf, schauen sich die Rotonde an und ziehen dann schnell weiter nach Apt, wo die Bars das ganze Jahr über geöffnet sind.
Sozialer Wohnungsbau
Ganze hundertundzweiundfünfzig Seelen hat Bernard Clap, der sich offiziell Monsieur le Maire nennen darf, zu verwalten oder auch zu verköstigen. „Dreißig mehr als zu Beginn meiner Amtszeit“, darauf ist er stolz. Im Winter macht der Bürgermeister von Trigance dennoch sein Restaurant Le Vieil Amandier dicht. Auch einhundertundzweiundfünfzig Mäuler sind nicht genug, um den Betrieb rentabel zu machen. Wie Simiane-la-Rotonde hat Trigance mit der Landflucht in der Hochprovence zu kämpfen. Achthundert Meter hoch liegt das Dorf. Im Winter ist es oft eingeschneit. Die steinigen Böden der Garrigue ringsherum sind mager. Selbst im Sommer bleibt der Ansturm, der die Haarnadelkurven links und rechts der Gorges du Verdon verstopft, dem Dorf erspart. Kein Reisebus wuchtet sich nach Trigance hoch. „Für das große Geschäft sind wir zu klein“, sagt Bernard ohne die Spur eines Bedauerns.
Für die meisten im Dorf bleibt der Bürgermeister ganz einfach Bernard. Bernard, der Koch, der am Herd kleine Wunder vollbringt. Die Mairie liegt nur ein paar Schritte von seinem Restaurant entfernt. Und auf dem Weg schaut Bernard öfter kurz bei der Frau Mama vorbei, um en passant den einen oder anderen Ratschlag zu bekommen. Nein, nicht für die Küche, sondern für das Amt. Schließlich hat Madame Clap senior selbst ein paar Jahrzehnte im Gemeinderat gesessen. Kochen kann Bernard freilich besser als die Mama, worauf Madame Clap senior wiederum sehr stolz ist.
Ein botanischer Lehrpfad kringelt sich von der Kirche ins Tal hinunter, in dem der Jabron eine Geröllwüste im Wiesengrund freigelegt hat. Jede Wegkehre beschert eine neue Duftwolke. Lavendel, Minze, Salbei. Rosmarin, Ginster, Thymian. Uralte Mandelbäume stemmen sich gegen den Wind. Zwei Esel blöken herzzerreißend aus dem Hang. Der Hals geht steil nach oben. Aus dem Tal betrachtet scheint Trigance vor seinen Besuchern zu fliehen. Bis auf den höchsten Punkt des Felsriffs streben die Häuser. Doch da thront bereits die Burg, kühn und uneinnehmbar. Viel Platz auf den schmalen Felsvorsprüngen darunter bleibt für das Dorf nicht. Jetzt versteht man, warum Trigance sich auf dem Ortschild als „Wächterin des Verdon“ preist: Wer von Süden auf kürzestem Weg zum berühmten Point Sublime will, dem Aussichtspunkt schlechthin in die Verdon-Schlucht, muss unterhalb der Burg vorbei. Wer von Norden an die Côte d’Azur will, ebenfalls.
Monsieur le Maire will, dass Trigance Taille hält. Seit Paris im Zuge der Dezentralisierung den zweiunddreißigtausend Dörfern im Land mehr Autonomie zugestanden hat, besitzt der Bürgermeister auch die Macht dazu. Früher musste selbst der Bau eines neuen Gemeindehauses von Paris abgesegnet werden. Heute darf jeder Bürgermeister sein eigenes Betonsüppchen kochen. Die Folgen sind oft schwer zu verdauen. Wohnblöcke und Einkaufszentren ersticken historische Dörfer. Nicht so in Trigance, darüber ist sich Bernard mit dem gesamten Dorf einig. Auf dem Dorfplatz, der nicht einmal einen Namen hat, sondern einfach „la place“ heißt, kann man jeden dazu befragen: In Trigance soll alles so bleiben, wie es ist. Das sagt der Imker, der eine Gasse tiefer in einer anrührend unaufgeräumten Rumpelkammer Lavendelhonig verkauft. Das sagen die jungen Familien, für die Monsieur le Maire ein paar baufällige Häuser instand setzen ließ. Die Häuser gehören der Gemeinde und werden als „Habitation à loyer modéré“, kurz HLM, zu deutsch Sozialwohnung, günstig vermietet. So bleibt das Dorfleben trotz einiger Ferienhausbesitzer aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden im Lot.
Die Wölfe
In Venasque tragen die Wölfe Kittelkleider und haben eine Dauerwelle. Neugierig belauern sie jeden Fremden, der aus der Unendlichkeit der Wälder in ihr Dorf findet. Sollte man nicht gleich sagen: in ihren Bau? Vor den beiden schlupflochgroßen Portalen, durch die es ins Dorf geht, sitzen die Wölfe auf einer Parkbank. Keine Miene verzieht sich. Ein artig dahingeworfenes „Mesdames, Bonjour“ ändert daran nichts.
Wölfe haben „die anderen“, die aus der Ebene von Carpentras, die Einwohner von Venasque getauft. Die Alten hier nennen sich noch heute so, voller Stolz. Jahrhundertelang verschloss man sich allen Fremden. Erst 1802 verband eine für Kutschen geeignete Straße das Dorf auf dem Plateau du Vaucluse mit der Außenwelt. Viel löchriger als die Rumpelpisten, auf denen man sich heute aus den Nachbardörfern Le Beaucet oder La Roque-sur-Pernes Venasque nähert, kann die Straße kaum gewesen sein. Ringsherum sind die Wälder so dicht, die scharf in den weißen Kalksockel geschnittenen Bachtäler so unzugänglich, dass das Plateau de Vaucluse bis heute ein fast menschenleerer Gebirgszug geblieben ist.
Nach langer Fahrt durch das Halbdunkel von Kermeseichen und Buchen gleißt ein gewaltiges Steinschiff in der Sonne, das auf einem Felssattel festgelaufen zu sein scheint: Venasque. Eine Häuserfront riegelt den Abgrund ab. Unten weicht der Wald uralten Kirschbäumen. An den knorrigen Ästen glänzt die Rinde so, als ob die Bäume unter der Last der Früchte schwitzten. „Taubenherz“ heißt die lokale Sorte, eine echte Bergkirsche, feuerrot und fest im Fruchtfleisch.
Zwischen Rhône und den Seealpen liegen die schönsten provenzalischen Dörfer. F.A.Z.-Karte Levinger
Die Auberge de la Fontaine liegt in der Dorfmitte, am Brunnen. „Man bleibt ein Fremder in Venasque“, sagt Christian Soehlke auch nach knapp dreißig Jahren. Solange lebt der Mann, der in einem früheren Leben die Welt für den Nähmaschinenhersteller Dürkopp-Adler bereist hat, unter Wölfen. In seinem heutigen Leben ist Christian Soehlke Koch und Hotelier. Soehlke kennt jeden im Dorf, geht überall ein und aus und bleibt einer, der „nicht von hier ist“. Dafür weiß der gebürtige Züricher, wo die besten Trüffel auf dem Plateau de Vaucluse wachsen und bei welchem Bauern man den cremigsten Ziegenkäse bekommt. Von den oberen Etagen des Hauses schaut er auf den Mont Ventoux, bei klarer Sicht sogar bis auf die Cevennen. Das allein entschädigt für ein Leben unter Wölfen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.5.2005
Jeder zieht seine eigene Lehre
Ein Tag auf der Montagne Sainte-Victoire
Von Michael Bengel
Wer sich dem Berg von Aix aus nähert, sieht ihn so, wie ihn Cézanne ein halbes Leben lang gemalt hat, immer wieder neu und doch auch immer wieder ähnlich, unverwechselbar noch in der Meisterschaft des einzelnen Tableaus: als schroffes weißes Dreieck, wie den Querschnitt einer Pyramide der Natur, jäh nach rechts gestürzt, nach Süden hin, und mählich fallend auf der Gegenseite. Wie eine weiße Fläche hebt die Form sich aus dem Grün der Ebene, und ein Steilstück unterhalb der Kuppe, die man auf den Bildern wiederfindet, sichtlich in den Farben abgestuft, wirkt wie ein Siegel auf die Echtheit: Das ist die Montagne Sainte-Victoire, wie sie uns von Cézanne überliefert ist.
Wer so von Westen kommt, dem erscheint das Kreuz darauf als Gipfelkreuz, geschaffen für die Menschen in der Ebene, für sie als Blickfang und als neue Spitze auf den Berg gestellt als „Croix de Provence“, eine Pointe also, die den Berg zum Sockel degradiert. Anfangs scheint es unerreichbar hoch. Erst wenn man mit der Straße aufsteigt, bei Le Tholonet und dann bei St.-Antonin-sur-Bayon, wirkt der Abstand in die Höhe überbrückbar. Von hier aus, und mit jedem Kilometer mehr, enttarnt sich die Montagne Sainte-Victoire als jener langgestreckte Höhenkamm. Sie ist eben keine irgendwie geformte Pyramide, sondern eine kilometerlange Kalksteinscholle, ein weißes, zerklüftetes Riff, in Schichten aufgefaltet und geborsten, sieben Kilometer lang, mit Klippen von vierhundert Metern Höhe. Ein überraschend schönes Bild.
Wie oft Cézanne den Berg gemalt hat, in Öl, als Aquarell, als bloße Skizze mit dem Stift: darüber gehen die Zahlen auseinander. Vierundvierzig Ölgemälde und dreiundvierzig Aquarelle zählt eine offiziöse Farbbroschüre des Verkehrsamts von Aix-en-Provence; von einem Konvolut von sechzig Werken spricht Gottfried Boehm in seiner Kunst-Monographie über den Maler und seinen Berg im Insel Verlag. Erst jüngst, im Mai 2001, ist eines davon, ein Bild von 1888, in New York für mehr als 76 Millionen Mark versteigert worden.
Schon als der Maler seine ersten dieser Bilder malte, war das Kreuz auf der Gipfelerhebung im Westen den Nachbarn ein lang vertrauter Anblick gut achtzehn Meter hochgereckten patriotisch-bürgerlichen Imponiergehabes nach einem vaterländischen Krieg. Doch man findet es auf keinem der bekannten Bilder. Sechzigmal, vielleicht auch neunzigmal, je nachdem, wen man fragt, hat sich der Künstler, wie es scheint, geweigert, dieses Kreuz zu malen. „Parallel zur Natur“: das war die Richtung seines Schaffens nach dem eigenen Programm, nicht „nach“ ihr.
„Die Lehre der Sainte-Victoire“ hat Peter Handke sein Annäherungsbuch an den magischen Berg der Provence und seinen Porträtisten genannt. Auch ihm war das Kreuz keiner Erwähnung wert, obwohl er den „Dreispitz“, wie er den westlichen Gipfel, den Bildern folgend, nennt, zweimal erklommen hat. Er suchte nach dem Wesen, das Cézanne gefunden hatte, und fand es in der „Schattenbahn“ der Bilder unter dem Kamm. Dort weist der Berg am Pas de l’Escalette eine geologische Bruchstelle auf, wie Handke schreibt, „mit dem freien Auge“ nicht zu sehen, nur auf den Bildern von Cézanne.
Mein Ziel an diesem Morgen, da ich von Puyloubier aus den Aufstieg unternehme, allein mit einem Rucksack, einer Karte, etwas Literatur und zwei Wasserflaschen, ist nicht das Kreuz, nicht einmal das Prinzip der Kunst, mein Ziel ist einfach der Berg. Unter den Platanen der „Place de la République“ schnüre ich die Schuhe, 376 Meter hoch, und steige der kleinen Straße nach, die ungeachtet ihrer Enge „Grand Rue“ heißt. Doch schon das nächste Gässchen trägt sein verbum proprium als Namen: „Rue qui monte“. Nur über Treppen geht es hier hinauf. Von der „Rue Notre-Dame“ sind es nur ein paar Schritte über einen kleinen Platz, dann hat man das Ziel im Blick: „Rue Sainte Victoire“ mit dem weiß-roten Doppelbalken des GR 9. Der Wanderweg führt auf den wahren Höhepunkt des langgezogenen Massivs, den Pic des Mouches, und über die gesamte Höhe bis zum Pas du Moine und erst von dort hinab nach Vauvenargues. Am Ortsrand folgt eine letzte Hinweistafel, zweifach die Botschaft: Willkommen und Warnung – „Danger“.
Der Wanderweg, nur eine gut markierte Spur von grauem Schotter, führt quer durch eine grüne Felsenkerbe mit Stechginster, Zistrosen und kleinwüchsigen Kermeseichen und steigt auf einem flachen Buckel weiter. Als der Pfad sich wieder dem Massiv zuwendet, liegt das Dorf schon dreihundert Meter tiefer, ockerfarben unter schwach geneigten roten Dächern, von der „Barbarotte“, dem Glockenkäfig, überragt. Im Dunst der Ebene dahinter wächst der Wein, schon das nächste Örtchen, Pourrières, liegt wie eine Insel inmitten der Reben. Dort war es, wo sich im Jahre 102 vor Christus das Geschick der Provence endgültig für eine römische Zukunft entschied: In dieser Ebene am Fuß des Bergs schlug Gajus Marius entscheidend die Barbaren: Teutonen, Ambronen, Haruden und Tougener. Die Überlebenden, Kinder und Frauen, wurden in die Sklaverei verkauft, die Toten, ein-, zweihunderttausend, faulten in der Sonne des Midi. Nach einer düsteren Legende gaben sie dem Boden seine Fruchtbarkeit, zumindest gaben sie dem Ort den Namen: „Felder der Modernden“, campi putriti, Pourrières.
So wäre es denn leicht, den Namen des Massivs von dieser Schlacht und diesem Sieg her zu verstehen. Doch den Namen hatte er nicht vor dem siebzehnten Jahrhundert. Vorher hieß der Berg im Provenzalischen „Lou Mount Ventouri“ wie der Mont Ventoux, der zweite Riese der Provence. Und ob der Name nun den Wind oder den ligurischen Gott Vintour meint, der für die kahlen Höhen steht, ist einerlei: An einen Sieg war bei dem Namen keinesfalls gedacht. Im dreizehnten Jahrhundert gab es auf dem Gipfel eine „Sainte Venture“ gewidmete Kapelle, Signal der Christianisierung auch der letzten heidnischen Refugien. Nach ihr hieß auch der Berg bald „Sainte Venture“, bisweilen unverstanden ins Lateinische gebracht als „Sainte Adventure“. Soll man wirklich glauben, dass der Sieg des Marius so spät, erst im siebzehnten Jahrhundert, mit einem Denkmal aufgewertet werden sollte? Weit eher ließe sich an eine rein lokale Tradition des Namens denken – wenn nicht überhaupt der provenzalische Begriff französisch werden sollte, „venture“, „adventure“ zu „victoire“, weil es die Provence als Land geworden war: französische Provinz seit 1660.
Das erste Steinmännchen am Schottersteig wirkt noch ein wenig übertrieben, die Trittspur zieht sich ockerfarben durch den grauen Kalk, jederzeit gut sichtbar, und als Herold der Zivilisation spannt sich noch eine Hochspannungsleitung über den Weg. Nach einer knappen Stunde in der Wüstenei aus Schotter und Garrigue, auf der Höhe überraschend aufgeputzt von Lilien in Gelb und Blau, erreicht man das Oratoire de Malivert am Ende eines Karrenwegs, der sich von Osten auf dem langen Kamm heraufzieht, einen grau gefügten Bildstock mit Muttergottes und Kind hinter dickem, verrostetem Draht.
Später dann, am Felsensteig, übermannshohes Gesträuch der Macchie. So ist der Blick für eine Zeit versperrt, erst auf dem Grat, wo die Bäume spärlich werden und der Berg nach beiden Seiten abfällt, reicht die Sicht weit in den Dunst der gescheckten Ebene. Die erste Höhe, Baou Nègre, kommt auch auf der Karte ohne Zahlen aus, am Handgelenk der Höhenmesser zeigt 995, immerhin ein Anhaltspunkt. Sonst nichts hier oben als ein Steinmännchen, ein wenig größer nun. Dahinter fällt die Crète leicht ab, schwingt sich abermals hinauf, von Steinhaufen nun dicht gesäumt, nur um wiederum auf eine Höhe zuzulaufen, die nicht die eigentliche ist.
Dann das erste Ziel: An der Seite eines Steinmännchens der Hinweis „Pic des Mouches 5 Min“. Und: „Puyloubier – 2 h 10“. Länger also als der Aufstieg bis hierher. Von seiner kahlen Höhe aus erscheint das Massiv wie eine gewaltige Welle aus Kalk, erstarrt im Augenblick des Überschlags von Nord nach Süd, als die Auffaltung der Alpen vor fünf Millionen Jahren die gewaltigen, längst aufgetürmten Kalkstöcke der Kreidezeit noch einmal anhob. Ein tonnenförmiger Sockel aus Stein trägt eine emaillierte Panoramatafel, in kleinen Gruppen sitzen Wanderer daneben auf dem Scheitelpunkt der Welle wie Surfer auf solidem Grund. Auf einer kleinen Felserhebung nahebei tanzt ein nervöser Wetterhahn, an Stahlseilen im Wind verspannt, ein Relais im Dienst des Landfunks und der „agriculture de précision“, wie zu lesen ist. Auch dort nicht der Gipfel. Die junge Dame im „Maison Sainte-Victoire“ am Fuß des Bergs bei Saint-Antonin-sur-Bayon hatte noch am Morgen die Frage nach dem „sommet“, dem Gipfel, mit Nachsicht überhört und stillschweigend von „point culminant“ gesprochen. Der unspektakuläre Ehrentitel ist dem Pic des Mouches zumindest nicht zu nehmen. Er ist fünfundsechzig Meter höher als die Pointe des Massivs mit dem gutgemeinten Kreuz, das man fern im Westen sieht, fünfeinhalb Kilometer entfernt – „en ligne droite“.
Das bedeutet auch: Beim Weiterwandern geht es erst einmal hinab, anfangs auf einer festen Grasnarbe mit flachen Disteln dazwischen, dann auf Felsensteige, mal im scharfen Wind, mal in der Wärme des Mittags. In Felsennischen steht dürrer Lavendel, der echte, nicht das fotogene landwirtschaftliche Gewächs, das in Reih und Glied das Plateau von Valensole beherrscht. An einem Steilstück auf der kalten Schattenseite des Baou de l’Aigle, wo es nicht weiterzugehen scheint, kommt ein junger Mann entgegen, und schnell sind wir uns einig, dass wir den Weg verloren haben. Spuren einer Markierung gibt es noch, wo sie mit dem spitzen Meißel, dicht an dicht punktiert, aus dem Fels entfernt worden ist. Immerhin: Das war einmal der Weg. Dennoch: Jetzt ist er es nicht mehr. These, Antithese, Fazit: Wir trennen uns.
Er hinab, ich hinauf – wo irgendwann die Doppelbalken in Rot-Weiß wieder auftauchen. Diese Lehre der Sainte-Victoire gilt beiden: Nicht der Aufstieg ist die eigentliche Mühe, nicht die zum Pic, erst recht nicht die zum Kreuz: Am schwersten ist das Stück dazwischen, drei Stunden immerhin, was zu diesem Zeitpunkt freilich noch keiner von uns ahnt. Zur Rechten im Tal und noch deutlich vor uns liegt inmitten weiter Wälder Vauvenargues, das Dörfchen und Picassos Schloss, in dem er für drei Jahre lebte und in dessen Park er nun mit seiner zweiten Frau Jacqueline für immer liegt.
Die nächsten ein, zwei Kilometer verlaufen auf der schroffen Abrisskante der Klippe, die hier gut zweihundert Meter in die Tiefe stürzt, manchmal überwölbt, ehe sie den Büschen unten Halt gibt, steil gewölbtes Kalkgestein in dichten Schichten, in deren Rissen, Nischen, Ecken Buchsgesträuch sich festgesetzt hat. Ein Blick wie dieser folgt auf den nächsten, jede flache Kuppe bietet sie als Belohnung. Vor einer solchen Wand, im Vordergrund von beiden Seiten schräg eingerahmt wie auf einer Landschaft Caspar David Friedrichs, liegt als eine seiner Perspektivfiguren mein Geselle von vorhin, den Blick wie stets auf das Tableau gewandt, zu dem er selbst gehört. Er scheint über die nächste Begegnung nicht überrascht und unser kurzes Abenteuer am Scheideweg schon vergessen, nickt nur und weist mit dem Kinn nach vorne: „C’est beau!“
Es passt zu der Ödnis, dass sich wenig später die Sonne in ein Gespinst von Wolken verhüllt, der Himmel weiß, dann grau, ich tappe Schritt um Schritt voran durch die Leere der Sainte-Victoire, sacht hinan auf einer flachen Höhe, die wie das Skelett dieser Felsensteppe wirkt, löchrig, wie zerfressen, ausgewaschen in bizarren Formen. Kein Schritt wie der andere, kein Tritt findet wirklich Grund. Irgendwann dann eine Höhe, trotz 1010 Metern eine Spitze ohne Namen, ohne Kreuz und ohne jedes Renommee – wenngleich nur einen Meter tiefer als der Pic des Mouches. Aber wiederum der Blick aufs Kreuz, noch immer knapp drei Kilometer weit entfernt. Dort mag dies elende Gestolpere ein Ende haben – und prompt, als Landmarke verstanden und nicht als „Croix de Provence“, will mir das Kreuz sogar gefallen.
Der Karte nach zu urteilen stehen noch zwei identifizierbare Höhen bevor, doch es sind mehr. Im Buchsgestrüpp, nicht fern, versucht eine Gruppe junger Leute, steifbeinig wie Jacques Tati, ihren Turnschuhen von innen Halt zu geben. Auch sie werden eine Lehre finden. Allmählich werden die Felspartien flächiger, die Graspartien größer. Der Wind lässt nach, so scheint es. Doch es ist nur eine Finte der Natur, billige Dramaturgie, um sich nur um so mehr zur Geltung zu bringen. Denn als das Kreuz schon wie zum Greifen nahe scheint, führten die Markierungen in eine letzte Wand, die nur auf allen Vieren zu schaffen ist, den Friedhofsgeruch des Buchsbaums immer in der Nase. Das Kreuz gerät sogar aus dem Blick – für einen letzten großen Auftritt: Dann steht es da auf blankem Fels wie ein grotesk vergrößertes Friedhofskreuz, Beton und altes Eisen, in der Ferne eingerahmt von Kühltürmen zur Linken und der gewölbten Staumauer des Sees zur Rechten, in der Nähe von Besuchern.