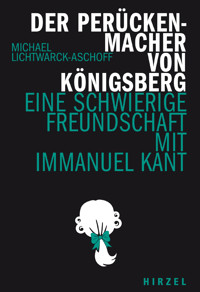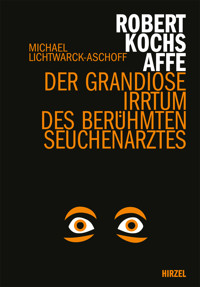
21,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: S. Hirzel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Seine Wissenschaft von den Bakterien hat Robert Koch als totalen Krieg gegen das Unsaubere erfunden. Unsauber ist alles, was fremd ist. Und das unsaubere Fremde ist ansteckend. Ansteckung produziert angesteckte Massen. Die verseuchte Masse macht Aufstand. So sind Seuche und Aufstand vom selben schrecklichen Fleisch. In drei Episoden wird erzählt, wie eine solche Haltung zu Beginn des 20. Jahrhunderts im sauberen Berlin entsteht, und zu welch unmenschlichen Folgen sie zwangsläufig führt. Das kranke, aufsässige Afrika, für Koch das Unsaubere schlechthin, muss mit Menschenversuchen in concentration camps gesäubert werden. In New York dann erweist sich die Seuchenbekämpfung nach seinen Prinzipien als Zuchtinstrument gegen all jene, die unbelehrbar an der Hoffnung auf ein besseres Leben festhalten. Nun kommen Koch selber Zweifel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michael Lichtwarck-Aschoff
Robert Kochs Affe
Der grandiose Irrtum des berühmten Seuchenarztes
»Sehr interessant und einer besonderen Betrachtung wert sind die Versuche, Ansteckung – und zwar im doppelten Sinn des Wortes – zu verhindern. Das Weitergegebene, das Menschen so zusammenbringt, dass Massen aus ihnen entstehen könnten, gilt als Krankheit und gefährlich, und muss auf jede Weise verhindert werden.«
Elias Canetti
Das Sommerhaus
Berlin im Sommer und Herbst 1903
Der Affe, der ihm die Tür öffnete, besaß eine gewisse dünnfingrige Manierlichkeit. Ein Klavierschüler, der eben noch an Czernys Schule der Geläufigkeit gesessen hatte. In der Art.
Walther Hesse würde sich später fragen, wie um Himmels willen er in diesem Augenblick auf einen Klavierschüler kommen konnte. Das Samtjackett des Affen, wahrscheinlich war es das. Ausgewaschenes Grün, die Seitentaschen mit drei Knöpfen akkurat geschlossen.
Der Affe legte den Kopf schräg und studierte einen Punkt oberhalb Hesses rechter Schulter, auf dem Rand der Thujahecke. Ganz bei der Sache war er wohl nicht, trotzdem wirkte seine Haltung liebenswürdig. Hesse sagte sich, seine Klingelei mochte den armen Kerl aufgeschreckt haben. Wahrscheinlich hatte er sich das Jackett nur rasch übergeworfen, um an der Tür nachzusehen.
»Ich möchte zu Herrn Professor Koch, bitte«, sagte Hesse, »der Herr Professor hat mich herbestellt, respektive ist es so, dass man mich im Hygienischen Institut, also man hat mich wohl avisiert. Die Einstellung, wenn es recht ist, sozusagen.«
Plötzlich empfand Hesse, wie kühl der hauptstädtische Nachmittag geworden war. Überhaupt: War das nicht alles ein bisschen unernst? Nachlässig gekämmt war der Affe jedenfalls. Dünnes Haar klebte am platten Hinterkopf. Wie bei einem Säugling, der in der Milch geschlafen hat, die ihm aus dem Mund geronnen ist. So reinlich, wie man sich den Hausdiener des weltberühmten Hygienikers vorstellen muss, war das Tier nicht. Ist Hygiene nicht die Wissenschaft vom Sauberhalten, von der Reinheit an sich?
Später würde gefragt werden, ob Hesse tatsächlich angenommen hatte, der Affe verstünde ihn. Schwer zu sagen. Sicher ist nur, dass diese ironischen Augen ihn gerade jetzt beunruhigten. Zärtlich wanderten sie über Hesses steifen Kragen und dann, als sei noch längst nicht alles gesehen, an seinem schwarzen Anzug hinunter. Der wurde nur zu Beerdigungen aus dem Schrank geholt.
Der Affe hatte keinerlei Eile. Gelassen schweifte sein Blick von Hesses Händen zu dessen Knien. Dann wieder zurück. Als gäbe der Abstand zwischen, sagen wir, Daumenendglied und Kniescheibe Auskunft darüber, wie schwerwiegend das Anliegen eines Fremden überhaupt sein kann, der klingelt, wenn man gerade Klavier übt.
Mittlerweile war Doktor Hesse überzeugt: Das Tier will mich gar nicht verstehen. Natürlich kann man Affen abrichten. Sie spielen zum Beispiel Czerny auf dem Klavier. Aber bestellen sie dem Hausherren auch, welches Anliegen Walther Hesse hat? Kann man sich in diesem Punkt auf einen Affen verlassen?
Hesse begann zu schwitzen. Sah sich nach einem Weg um, auf dem er sich zurückziehen konnte.
Dabei müsste ihm eigentlich, ein paar Schritte neben dem Gartentor, ja dort, wo die Thujahecke beginnt, ein Mann unbestimmbaren Alters mit einer langen Schürze aufgefallen sein. Er stützte sich auf eine Harke. Das war Witold Krol, Professor Kochs Mädchen für alles, Faktotum, Kräuterkundiger, Konservierer, Labordiener, was weiß ich, jedenfalls unter anderem auch: Gärtner. Hesse hätte ihn sehen können, durchaus.
Witold seinerseits beobachtete ihn scharf. Obwohl der Doktor wenig Ungewöhnliches an sich hatte. Sauber gestutzter Vollbart, über der Oberlippe vielleicht etwas ausladend, die grauen Augen schielten unmerklich, hohe Stirn, das Haar hatte früh begonnen zurückzuweichen. Seine erste Freundin hatte behauptet, er sehe Dostojewski geradezu lächerlich ähnlich, besitze überhaupt so etwas Russisches. Leider konnte Fanny, die Frau, die Hesse dann geheiratet hatte, das nie feststellen.
Witold besaß die Angewohnheit, sich auch Kleinigkeiten gut einzuprägen. Gelegenheit gab es genug, denn selber war Witold für die meisten unsichtbar. Wem fällt schon ein älterer Gärtner vor einer Thujahecke auf? Außerdem die Judasohren. Sind praktisch unverzichtbar für eine gute Beobachtungsgabe. Wachsen auf Holunderrinde, wissen Sie. Wenn man das Knorpelige mag, schmecken sie gar nicht mal so schlecht. Und diese Wülste. Jedes Mal überraschen sie mich, weil sie so fest daherkommen in dem samtigen Rot der Judasohren. Nach dem Verzehr bekommt die Welt eine scharfe Kantenlinie. Judasohren empfehle ich auch bei Schwachsichtigkeit.
Hesses Verwirrung vor der Haustür war begreiflich. Er war zum ersten Mal in der Hauptstadt Berlin. Und dann gleich beim großen Koch klingeln. Wohl war er ein bisschen herumgekommen in der Welt. Der Krieg hatte ihn 1871, als Feldarzt, bis knapp vor Paris geführt, der Friedensschluss hatte eine Besichtigung der schönen Stadt verhindert. Später als Schiffsarzt bis nach New York, von dort aus die Ostküste beider Amerika hinunter. Dabei hatte er erst die Seekrankheit studiert, und dann seine Frau Fanny kennengelernt. Oder war es umgekehrt? Gegenwärtig bekleidete er den Posten eines Bezirksarztes im erzgebirgischen Schwarzenberg. Bergbau, Staublunge, Blasenkrebs, unheilbares Zittern nach Verschüttungen, Gasvergiftungen, abgerissene Beine, Bergsucht. Interessantes Material, würde er später zu Witold sagen, aber man hat doch wenig Ansprache ansonsten.
Da also stand entmutigt vor Kochs Haustür der Doktor Walther Hesse. Und trotz einer gewissen, sagen wir: Welterfahrenheit, war dies hier der erste Affe seines Lebens, der ihm die Tür öffnete.
Das Schweigen zwischen den beiden zog sich in die Länge. Hesse hatte das Gefühl, es könnte zur Klärung beitragen, wenn er sein Anliegen wiederholte.
Noch einmal langsam und deutlich: Um seine Einstellung ginge es. Der Herr Professor sei im Bilde.
Den durchdringenden Blick unverwandt auf den Fremden gerichtet, begann der Affe jetzt, die Türe in Hesses Gesicht hinein zu schließen. Lehnte sie behutsam an. Drehte sich um. Durch den Türspalt sah Hesse, wie die Jackenärmel über die Fingerspitzen fielen, und wie tief die Taille hing.
Ein kleiner Mönch. Als Einziger lebt er noch in einem japanischen Kloster, so verschwand das Tier in die Stille. Das Samtjackett war eine Nummer zu groß.
»Storm«, hörte Hesse kurze Zeit später eine Frauenstimme, »Storm! Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht an die Tür gehen, wenn es klingelt. Das gehört nun wirklich nicht zu deinen Aufgaben, du neugieriger Mensch.«
Die Tür ging wieder auf. Eine feingliedrige Frau, das erhitzte Gesicht umrahmt von einem Schwall schwarzer Locken, schaute Hesse ärgerlich an. Ihre Oberlippe war eine Winzigkeit zu kurz. Neben ihr stand der Affe. Storm hieß er also. Sie hatte den Arm um seine Schulter gelegt. Diese entrückte Belustigung im Blick des Tieres. Vorher war Hesse sich nicht ganz sicher gewesen, jetzt war das unverkennbar. Man kann es Hesse nachfühlen – ein Affe im taillierten Jackett mit zugeknöpften Taschen, öffnet einem die Tür. Würde man da nicht glauben, die ganze Welt lache gerade über einen?
»Guten Tag!«, sagte Hesse, »mein Name ist Walther Hesse, Doktor Walther Hesse. Ich sollte mich bei Herrn Professor Koch zur Stelle melden, ich meine also, auf eine freie Stelle wollte ich, bewerbungshalber …«, er verstummte. Wusste nicht mehr weiter.
»Bewerbungshalber? Schön, Herr Doktor Hesse«, sagte die Frau, ihre Stimme war überraschend tief und rauh, Halsschmerzen vielleicht, »dann bin ich eben Frau Koch. Meinen Storm hier haben Sie ja schon kennengelernt. Kommen Sie herein, ich schaue nach, ob mein Mann Zeit für sie hat. Ich will wirklich nicht ungastlich sein, aber ich werde nie begreifen, warum er seine Bewerber immer in unser Haus bestellen muss statt ins Institut.«
Jahre danach, Walther Hesse und seine Frau hatten Berlin längst wieder verlassen, würde Hesse noch immer gerne von seiner Einführung in die Familie Koch erzählen. Mit jedem Mal wurde der Affe Storm mönchischer, sah Frau Koch feingliedriger aus, war das Haus stiller, und Witold Krol verschwand tiefer in der Thuja.
Frau Koch und Storm gingen Hesse voran ins Haus. Frau Koch hatte den Arm über die Schulter des Affen gelegt. Die beiden führten Hesse durch eine geräumige Diele, einen Gang entlang, in dem es nach überbackenem Blumenkohl roch, über eine Treppe hinauf, bis vor eine mit Schnitzereien überladene Tür.
»Robert, da ist schon wieder einer dieser jungen Männer für dich, die du beharrlich hierher bestellst anstatt in dein Institut«, sagte Frau Koch, während sie die schwere Tür aufdrückte.
Ausgerechnet jetzt nahm der Gedanke, die zarte Frau des Professors sei bestimmt nicht älter, eher sogar jünger als er selbst, Hesse ganz in Anspruch.
»Meinst du, es wäre möglich unser häusliches Leben und deinen Institutsbetrieb etwas säuberlicher auseinanderzuhalten? Du überschätzt mein Interesse an den Personalangelegenheiten der Hygiene.«
Ihr Unmut schien sich nicht auf Hesse zu beziehen. Im Gegenteil: Sie lächelte ihn an, fast als gäbe es seit der Haustür ein winziges Geheimnis zwischen ihnen.
Auch der Affe fand diese Art der Vorstellung offensichtlich angemessen. Sein Blick hatte jetzt definitiv etwas Versonnenes, was Hesses Unruhe aber nur verstärkte.
»Gehen Sie nur hinein, Herr …, Herr ..., na wie auch immer, gehen Sie ruhig hinein, Sie können ja nichts dafür, dass mein Mann so wenig Erfolg damit hat, den Unterschied zwischen unserem bescheidenen Haushalt und seinem kaiserlichen Labor zu erkennen. Jetzt gehen Sie schon.«
Sie konnte unmöglich älter sein als er.
Zögernd trat Hesse über die Schwelle.
Hinter seinem Schreibtisch saß Professor Robert Koch. Den stellt man sich nun immer als einen großen Menschen vor. Weil ein umfangreicher Schädel, der sich in eine fleischige Hand stützt, ungenierter denkt? Er war ja nicht größer als andere Männer seiner Zeit, im Gegenteil. Er passte in diese Zeit nur besser hinein als andere, größere. Vielleicht war es auch, weil Robert Koch so ganz in sich zusammengesunken da saß. Im Sitzen, jedenfalls, schien er kaum größer als dieser Storm. Wenn man die beiden aufforderte, sich nebeneinanderzustellen, würde man es sehen.
Koch wies auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch.
»Ich lasse die Herren dann besser allein«, sagte Frau Koch. »Robert, du vergisst nicht, dass wir gleich zu Abend essen.«
»Tu mir die Liebe und nimm den Affen mit«, sagte Koch, »und Sie, junger Mann, setzen Sie sich endlich hin, Sie machen mich ganz nervös mit Ihrer Herumsteherei.« Koch nahm die Brille ab und rieb sich die entzündeten Augen. »Wie war der Name gleich?«
»Hesse, Herr Professor, Walther Hesse, Bezirksarzt aus Schwarzenberg. Also im Hygieneinstitut hatte man mich wissen lassen, dass in Ihrem Labor eine Vakanz bestünde. Man hat mir gesagt, ich solle mich bei Ihnen zu Hause melden. Ich hätte es sonst nicht gewagt, Sie hier zu stören. Ich habe allergrößtes Interesse an der Hygiene, doch, das habe ich unbedingt. Vielleicht kann ich mir das eine oder andere bei Ihnen abschauen.«
»Ach nein, ein Interesse haben Sie demnach? Und abschauen wollen Sie?«
Koch hatte den Kopf schief gelegt, das machte man im Hause Koch wohl so. Daumen und Zeigefinger der linken Hand zwirbelten an der Haut unter dem Ohrläppchen herum, als müsse er Worte und Töne, die es bis hierhin geschafft hatten, behutsam mit einer Häkelnadel aufspießen, in den Gehörgang hineinschieben, und von dort aus, nach eingehender Prüfung, eventuell ins Hirn.
»Gedient?«
»Jawohl, Herr Professor, Feldarzt im siebten Artillerieregiment, Spichern.«
Koch beschäftigte sich weiter mit seinem linken Gehörgang.
Hesse wusste nicht, wie er seine Sache weiter voranbringen sollte. Zwar hatte er Zeugnisse und Diplome dabei, seine Doktorarbeit bei Leberecht Wagner über Erkrankungen des weichen Gaumens, dazu seine Abhandlung über die Seekrankheit. Aber irgendetwas sagte ihm, dass Koch daran nicht speziell interessiert war.
Sollte er vielleicht das Bidet zur Sprache bringen?
Mit dem Bidet verhielt es sich ja so: Es lag Walther Hesse wirklich am Herzen. Verkörperte es doch den hygienischen Fortschritt schlechthin. Seine Bekannten sagten ihm, sie wunderten sich, dass ein Anhänger der romantischen Medizin so begeistert sein könne vom profanen Bidet. Worauf er meistens mit einem Lächeln antwortete, Romantik und Bidet seien kein Widerspruch, außerdem sei er eben ein widersprüchlicher Mensch. Und sei es gerne. Ein bisschen Russe, viel Deutsches, dazu ein Schuss angelsächsische Nüchternheit, so sehe er sich.
Hesse hätte nicht sagen können, was ihn eigentlich hierher nach Berlin getrieben hatte. Vielleicht, dass er die Medizin besser verstehen wollte, die er in Schwarzenberg betrieb? Dass er bei Koch moderne wissenschaftliche Methodik lernte? Könnte er mit einer Ausbildung beim großen Robert Koch renommieren und seine Karriere voranbringen? Oder suchte er einfach ein bisschen Abwechslung, das muss ja erlaubt sein? Fürchtete er, das Schwarzenberger Provinzleben würde seiner amerikanischen Frau Fanny langweilig?
»Haben Sie schon mal etwas entdeckt, Herr Bezirksarzt, irgendetwas X-beliebiges, vielleicht war es ja nur Ihnen wichtig, aber vor Ihnen hat es noch keiner gesehen?«, fragte Koch jetzt müde.
»In Schwarzenberg, Herr Professor, gibt es außer Unrat nichts zu entdecken. Deswegen möchte ich ja gerne nach Berlin.«
»Junger Mann, Sie tauschen Bequemlichkeit und Beständigkeit gegen ewige Unruhe. Haben Sie eine Ahnung, wie schwer das Neue es hat? Nicht nur da draußen, wo die Herde grast, die am liebsten jeden Tag auf dieselbe Weide rennt, sondern …«, der Professor klopfte sich auf die Brust, »hier drinnen, auch und vor allem im eigenen Herzen. Man fürchtet das Neue selbst ja am meisten, man ernährt sich praktisch vom Zweifel, und ich kann Ihnen sagen: Man lebt dabei nicht angenehm. Wiederum braucht man natürlich überhaupt erst einmal einen Schatten, damit man über ihn springen kann.«
Koch verstummte. Hesse sah sich im Arbeitszimmer um. Mehr aus den Augenwinkeln, Koch sollte nicht den Eindruck bekommen, er höre ihm nicht genau zu. Vielleicht hing ja ein Gesprächsthema an der Wand.
Die bis zum Boden reichenden Fenster führten auf einen Garten hinaus, von dem aber, wegen der halb zugezogenen Vorhänge, wenig zu sehen war.
Auf zwei schmalen Marmortischen standen Mikroskope und samtgefütterte Kästen, darin aufgereiht daumenlange Glasplatten. Auf diesen Glasplatten wurden die Bakterien ausgestrichen, getrocknet und gefärbt, sodass sie sich unter dem Mikroskop untersuchen ließen, so viel wusste Hesse natürlich. Sogar in der Gartenlaube wurden Professor Kochs Arbeitsmethoden detailliert geschildert.
Zwischen überquellenden Bücherregalen hingen afrikanische Masken. Einige waren aus eisenfarbenem Holz geschnitzt, andere aus Wurzeln, Rinde oder Speckstein, in Bronze gegossen, auf straff gespannte Tierhaut gemalt. Alle Farben des verlorenen Kontinents. Manche pflaumenblau, andere maisgelb. Es gab Ebenholzmasken, die zinnoberfarbene Zähne bleckten, und aschefarbene Rauten, in die sich die wulstigen Augenbrauen und das Kinn, das ebenso lang und spitz zulief wie die Stirn, einfügen mussten. Die Masken glänzten, als würden sie täglich mit Öl abgerieben. Manche waren nach innen gewölbt wie eine Schale, die Klänge aufbewahrt oder Hirsebier.
Hesse sah, dass das Wilde gezähmt wurde durch rot-weiße Bänder, an denen die Masken hingen. Im Inneren der Hirnschale befestigt, hielt das Band sie davon ab, sich von der Wand loszureißen, und aus dem abgedunkelten Zimmer hinaus in das Gemüsebeet zu stürzen.
»Die meisten meiner Geschwister sind ausgewandert, Uruguay, Mexiko, Amerika natürlich. Manchmal weiß ich wirklich nicht, was mich in diesem zugigen Berlin hält«, sagte Koch, der bemerkt hatte, dass Hesse die Masken anstarrte. »Ja, reisen. Sich auf und davon machen, sich nicht umdrehen nach dem, was man hinter sich lässt, nie mehr. Wo, sagten Sie, haben Sie studiert, junger Mann?«
»Leipzig, Herr Professor, bei Professor Leberecht Wagner. Und bei Professor Pettenkofer in München habe ich mich auch umsehen dürfen.«
»Bei Pettenkofer, diesem romantischen Fossil? Mein Gott, auch das noch. Dieser Mensch erkennt einen Tuberkulosebazillus nicht einmal dann, wenn ich ihm einen roten Kringel darum herum male. Was täte ich bloß ohne meine wissenschaftlichen Gegner und ihre grenzenlose Kurzsichtigkeit. Wahrscheinlich in Ruhe durchs Mikroskop schauen und die Welt der Bazillen beschreiben, eine Abteilung nach der anderen. Sterben würde ich vor Langeweile ohne all die Pettenkofers und Pasteurs. Aber trotz meiner Dankbarkeit für meine Feinde – Sie werden hoffentlich nicht annehmen, dass Sie der Gottesdienst beim alten Pettenkofer für eine Stelle an meinem Institut empfiehlt?«
Die afrikanischen Masken rissen ihre geschnitzten Münder auf und brachen in brüllendes Lachen aus.
Belebt richtete Koch sich auf. Einen Schüler Pettenkofers zu schurigeln, das war einmal eine Erfrischung. Noch dazu, wo dieser Schüler gezwungen war, ihm zuzuhören. Schließlich bewarb er sich um eine Stelle. In seinem Institut.
»Ach, Hesse, bis München hat es sich wohl noch nicht herumgesprochen, dass Krankheiten nicht von üblen Gerüchen hervorgerufen werden, von Miasmen, wie Ihre griechisch gebildete Lederhose das nennt, sondern von genau benennbaren Erregern, jede Erkrankung von einem anderen Erreger. Der Milzbrand vom Milzbranderreger, die Wundinfektion von Erregern, die sich von Tierart zu Tierart und von Wunde zu Wunde unterscheiden, die Tuberkulose vom Tuberkulosebazillus. Es ist mein bescheidenes Verdienst, diese Erreger entdeckt, und ihre Lebensweise beschrieben zu haben. Und es ist mein unbescheidener Wunsch, dass es uns gelingen möge, ihnen allen einen Namen und ein Gesicht zu geben. Sobald wir sie einmal benannt haben, können wir gezielt auf sie losschlagen, auf jede Bazille mit einem speziellen Mittel. Von meinem Tuberkulin wird man auch in Schwarzenberg gehört haben? Na sehen Sie. Wer, wie Pettenkofer, an üble Gerüche glaubt, der glaubt auch, für den Kranken sei alles Menschenmögliche getan, wenn man nur das Fenster öffnet und tüchtig durchlüftet. Was um Gottes willen wollen Sie an meinem Institut?«
Walther Hesse verwünschte sich, dass er Pettenkofer überhaupt erwähnt hatte. Es war ja nicht einmal ein richtiges Studium gewesen. Nur ein paar Monate, die er an Pettenkofers Institut irgendwie herumgebracht hatte. Hatte ein bisschen etwas von städtischen Abwassersystemen aufgeschnappt. Den Alten ein paar Mal gesehen, der war ständig mit tausend Dingen beschäftigt. Hesse erinnerte sich, dass er von einer Feindschaft zwischen Pettenkofer und Koch gehört hatte. Warum musste er sich immer mit Namen wichtigmachen. Wiederum: Ganz so daneben lag der alte Pettenkofer doch nicht damit, dass er Abwässer in Kanäle ableiten und das Trinkwasser filtern wollte. Die Leute waren ja nicht schuld an ihren Krankheiten.
Koch saß jetzt kerzengerade hinter seinem Schreibtisch. Hesse fragte sich, warum es ihm so vorkam, als starre ihn ein furchtsamer Hirschkäfer durch die runden Brillengläser an.
»Ich bin ja selber jahrelang so was wie Bezirksarzt gewesen, einfacher Landdoktor in Posen. Sie sehen mir nicht aus wie einer, dem ich eine Stelle an meinem Institut gebe, Sie bleiben nicht bei mir. Ihnen kann ich es deshalb auch sagen: Ich sehne mich immer öfter zurück in mein stilles, unaufgeregtes Wollstein.«
»Sie mögen Kalbsherz?«, fragte Frau Koch, schon vorhin war Hesse ihre heisere Stimme aufgefallen. »Mit breiten Nudeln?«
Sie war hereingekommen und hatte den Professor, der sich allmählich in eine begeisterte Feindschaft gegen Pasteur und gegen die Franzosen überhaupt hineinredete, unterbrochen.
»Selbstverständlich, gnädige Frau, Kalbsherz. Sehr!« Es konnte schließlich nicht schaden, Kalbsherz zu mögen. Hesse war aufgestanden. In Schwarzenberg wusste man auch, was sich gehört.
»Na dann kommen Sie und essen Sie mit uns zu Abend. Manchmal glaube ich, Robert, du bestellst deine Kandidaten nur deswegen zu uns ins Haus, damit diese schrecklichen Masken sie anglotzen und du beobachten kannst, wie sie die Mutprobe bestehen. Dann sollen sie wenigstens etwas Ordentliches zum Essen bekommen. Ist Ihnen aufgefallen, Herr …, Herr Kandidat, dass all diese Fratzen hübsch gesittet an einen Nagel gebunden sind und Ihnen gar nichts tun können? Sie sind sehr fremd und sehr harmlos. Und jetzt kommen Sie bitte.«
Wie die anderen Räume war auch das Esszimmer abgedunkelt. Vielleicht tat das Tageslicht Kochs Augen weh, wenn er stundenlang durchs Mikroskop gestarrt hatte. Seine Lidränder waren entzündet.
Als Erstes gab es Kerbelsuppe.
»Witold baut den Kerbel hinten im Garten an. Eigentlich wollte Robert mit dem Kerbel-Grün seine Bazillen färben, aber die sind kapriziös genug, den Kerbel nicht anzunehmen. So hat der Kerbel es zwar nicht unter Roberts Mikroskop geschafft, aber immerhin in unsere Suppenteller. Ich gebe ein paar Blättchen Bärlauch daran, hoffentlich schmeckt Ihnen das. Den Bärlauch kultiviert Witold auch selber. Witold, unser Gärtner, Witold Krol, Sie werden ihn beim Hereinkommen gesehen haben.«
Hesse schüttelte den Kopf.
»Keine Sorge, Sie lernen ihn noch kennen. Er ist praktisch derjenige, der entscheidet, ob ein Kandidat eingestellt wird. Jedenfalls haben Robert und Witold immer eine Menge zu besprechen, wenn hier ein Kandidat auftaucht. Nach meiner Meinung wird nicht gefragt. Es wird angenommen, ich betrachte die Bewerber, typisch Weib, sowieso nur unter dem Blickwinkel des Manntieres.«
Hesse errötete.
Die Kerbelsuppe war vorzüglich. Er aß sie langsam, um den Augenblick hinauszuzögern, an dem er sich mit dem Kalbsherz würde befassen müssen.
Doch noch vor dem Kalbsherz erschien Storm. Er hatte das Samtjackett gegen eine Uniformjacke vertauscht, irgendetwas Tannengrünes mit befransten Schulterstücken und zahllosen Bordüren und Schnallen, schräg über der Brust einen Ledergurt. An dem hing eine leere Säbelscheide, sie reichte bis auf den Boden. Ein merkwürdiger Kontrast zwischen dem gelassenen Blick des Affen und dieser schreiend bunten Uniformjacke.
»Mein Gott, Emmi, wo hat er denn diese Jacke wieder her?«, stöhnte Koch, während Storm auf den Stuhl neben der Hausfrau kletterte. Das Tier nahm Frau Kochs halbvolle Suppentasse und trank sie leer. Setzte die Tasse mit einer zierlichen Bewegung wieder vor sie hin.
»Witold hat sie ihm besorgt. Er macht sich Sorgen, weil Storm in letzter Zeit so antriebslos, geradezu trübsinnig ist. Eine neue Ulanenjacke anstelle der langweiligen alten Husarenuniform könnte ihm Spaß machen, denkt Witold.«
»So, denkt er das. Und Witold glaubt tatsächlich, die Begeisterung für wechselnde Uniformen sei besonders affengemäß?«
»Ach Robert, und das sagst ausgerechnet du, der beim Anblick von einem Paar Epauletten schon feuchte Augen bekommt. Lass Storm seinen Spaß, siehst doch, wie stolz er ist. Fragen wir lieber unseren Gast ein bisschen aus.
Was treiben Sie denn so, wenn Sie nicht gerade in Berlin sind und mit den Merkwürdigkeiten des Koch’schen Haushalts zurechtkommen müssen, Herr …, ich weiß wirklich nicht, warum ich Ihren Nachnamen ständig vergesse. Vielleicht versuche ich es mal mit dem Vornamen? Wie heißen Sie mit Vornamen?«
»Walther, gnädige Frau.«
»Dann werde ich Sie Walther nennen, das kann sogar ich mir merken.«
Sie schöpfte großzügig Kalbsherz auf Hesses Teller. Der fragte sich, warum es nicht den überbackenen Blumenkohl geben konnte, nach dem es in der Diele so nachdrücklich gerochen hatte.
»Nun, gnädige Frau, ich bin ein einfacher Bezirksarzt in Schwarzenberg. Bergsucht, Staublunge und mangelnde Sauberkeit in den Wohnungen meiner Bergarbeiter, das sind so die Aufregungen meines beruflichen Alltags.«
»Und die wollen Sie natürlich gegen die mondänen Aufregungen Berlins vertauschen?«
»Das würde ich gerne, gnädige Frau, in der Tat sehr gerne. Obwohl es natürlich nicht ums Mondäne geht. Geht es ja nie. Aber das werden Sie selbstverständlich nicht gemeint haben.«
Ein Schweigen entstand.
Zog sich in die Länge. Nur die Essgeräusche Storms. Hesse war sich sicher, dass er, der Provinzler, an diesem Schweigen schuld war.
Er zögerte, stürzte sich dann kopfüber in eine Darstellung seines Lieblingsprojekts: die Ausstattung städtischer Wohnungen mit Bidets. Einen Augenblick war er unsicher, ob es wirklich passend war, ausgerechnet ein Bidet in den Mittelpunkt des Tischgesprächs zu stellen. Aber dann fand er es reizvoll, vor einer Zuhörerin darüber zu sprechen. Die Gelegenheit dazu hatte er viel zu selten.
Dabei, und diesen Gedanken entwickelte er jetzt, konnte gerade das Bidet ungeheuer viel zur Gleichberechtigung beitragen. Während Urinale nur das männliche Bedürfnis befriedigen. Die ganze Hygienekultur war nach Hesses Meinung im Grunde eine Kultur des Stehens. Dagegen könnten Bidets, wegen ihrer speziellen ausgeklügelten Bauweise, endlich einer Komponente des Sitzens und damit einer weiblichen Hygienekultur, Kultur ganz generell, den Weg bereiten.
Hesse drang ein in die Geschichte des Bidets, ja, ein fremd klingender Name, kommt eben, nicht wahr, aus dem Französischen und bedeutet ursprünglich ein kleines Packpferd; er sprach über die Details der Wasserversorgung, die Stärke und Richtung des Spülstrahls, über Mehrfachnutzung, zum Beispiel die Möglichkeit, sich darin auch die Füße zu waschen, was ansonsten gerne vernachlässigt wurde. Das Thema ging ihn wirklich etwas an.
Er war, je weiter er in den Einzelheiten vordrang, immer deutlicher der Auffassung, dass es nicht nur der Gleichberechtigung, sondern der Hygiene überhaupt, guttäte, wenn solche Dinge von falscher Scham befreit, rückhaltlos offen, in moderner Sachlichkeit, durchaus auch bei Kalbsherz mit breiten Nudeln besprochen wurden.
Frau Koch allerdings, das merkte Hesse rasch, war nicht bei der Sache. Storm lenkte sie ab. Der versuchte, aus den Nudeln ein Halsband zu flechten, das er ihr umlegen wollte. Sie ließ es zu, zeigte Storm, wie er die Nudeln zusammenflechten musste, pustete auf die Nudeln, damit Storm nicht die zarte Haut des Halses verbrannte.
Während Robert Koch am Bidet merkwürdig uninteressiert war, also für den Leiter eines Hygieneinstituts. Ihn bewegte anderes. Sein Feldzug gegen den Typhus, über den musste er unbedingt sprechen.
»Aus dem Hochwalder Land rings um Trier schickt man mir Stuhlproben, die von Typhusbazillen nur so wimmeln.«
Hesse verstand kein Wort, fühlte sich aber geehrt, dass Koch mit ihm redete, als sei er mit Stuhlproben, Typhusbazillen und dem Feldzug im Hochwalder Land bestens vertraut.
»Gesunde Bazillenträger, ich bitte Sie recht herzlich!«, raunzte Koch. »Eine einzige Schweinerei sind diese gesunden Bazillenträger.«
»Verzeihung, Herr Professor: Demnach wäre Gesundsein also ein Problem?«, fragte Hesse. Er fand selbst, die Frage klang genau so geistreich, wie die Hauptstadt es von einem Bezirksarzt aus dem Erzgebirge erwarten würde.
Aber Koch hatte ihn gar nicht gehört. In steigender Wut fuhr er fort:
»In den Begleitschreiben zu dem Material will man mir weismachen, die Leute, von denen man diese Stuhlproben gewonnen hat, seien völlig gesund. Ausgeschlossen! Gesunde, deren Enddarm von Typhusbazillen überquillt! Wer weiß, von wem die Stuhlproben in Wirklichkeit stammen. Wenn man es wissenschaftlich wasserdicht machen will, muss eine Stuhlprobe öffentlich durchgeführt werden, mindestens unter Beobachtung. Nur so können wir sicher sein, dass uns kein falscher Stuhl untergeschoben wird.«
Hesse schob seine Bandnudeln hin und her, verstand kein Wort.
»Mein Gott, Herr Hesse, lassen Sie doch die Nudeln in Frieden. Sie werden gehört haben, dass ich herausgefunden habe: Ansteckende Krankheiten werden von Lebewesen hervorgerufen, die ich färben, vergrößern und unter meinem Mikroskop sehen kann, und die deswegen Mikroben heißen. Das ist Punkt eins: Die Mikrobe, die Bazille, macht krank, sie ist der Erreger, sie ist der Feind. Wird sich mittlerweile auch in Schwarzenberg herumgesprochen haben.«
Hesse nickte eifrig.
»Na also. Daraus Punkt zwei: Wo wir eine Bazille finden, müssen wir auch eine Krankheit finden, unweigerlich. Wie stehe ich denn da, wenn jetzt im Hochwalder Land Leute mit massenhaft Typhusbazillen im Stuhl herumlaufen, und diese Unglücksmenschen merken nichts davon, sind kerngesund! Was ist das noch für ein Feind, der einen gesund lässt? Wenn wir den Menschen die Krankheit nicht mehr an den fiebrigen Augen und den hohlen Wangen ansehen, wenn auch ein völlig Gesunder, ein ganz Unverdächtiger Bazillen beherbergt, dann, ja dann müssen wir jeden untersuchen. Denn dann kann jeder das Schwein sein, das die Bazillen in deiner Küche, deinem Klosett hinterlässt.«
Hesse fand, so pikant war sein Bidet als Thema für ein Tischgespräch gar nicht gewesen.
»Die Generalität drängt mich, endlich die Maßnahmen für den Feldzug gegen den Typhus festzuzurren. Gerade im Westen! Schlieffen-Plan, Sie haben ja gedient. Aber bevor ich nicht weiß, was es mit diesen angeblich Gesunden auf sich hat, kann ich dem Minister nichts Gesichertes an die Hand geben. Also Schritt eins, Klärung der administrativen Abläufe. Sodann, Schritt zwei, noch einmal genaueste Untersuchung dieser Typhusbazillen. Ich brauche ein noch besseres Anzuchtverfahren für diese Biester, um ganz sicher zu sein. Bei der Heimtücke der Bazillen weiß man nicht, ob sie sich nicht maskieren.«
Mittlerweile stand der Affe auf Frau Kochs Schultern, seine Zehen drückten sich in den Seidenstoff der Bluse. Er versuchte, ihr das Nudelband umzulegen. Sie lachte, als kitzelte er sie mit seinen fingerfertigen Zehen, schaute Hesse an, ihre Wangen waren gerötet.
»Wissen Sie, Storm kann mit Männern nichts anfangen, und mich hat er jetzt nach all der Zeit auch über. Was meinen Sie, wie Storm die uniformierten Herren, die mein Mann zu Tisch bittet, verlacht? Schrecklich, aber ich kann es ihm auch nicht verwehren, ich bin ihm gegenüber so hilflos. Schauen Sie ihn an, könnten Sie ihm etwas abschlagen? Und dann haben wir ja auch Verpflichtungen. Sein Zwillingsbruder ist damals gestorben, wir sind, also wir sind ihm viel schuldig geblieben. Ich glaube manchmal, es könnte ihm helfen, wenn er andere Menschen um sich hat, emotionale Herausforderungen, anregende Beziehungen, eine neue Zuneigung.«
Hesse zupfte seinen Oberlippenbart. Die Kultur des Sitzens traf bei Frau Professor Koch nicht auf das Interesse, das er vorausgesetzt hatte.
Ohne große Hoffnung wechselte er das Thema.
»Meine Frau erzählt mir hin und wieder von Affen«, sagte er und versuchte vergeblich Storm zu streicheln. »Sie stammt ja aus einer holländisch-französischen Familie, ein Zweig ihrer Familie lebt auf Java. Dort gibt es viele Affen. Sie werden auch gerne gegessen. Manche Holländer halten sie in ihrem Haushalt, das hat Fanny selbst erlebt.«
»Ihre Frau hat Erfahrung mit Affen?«, fragte Koch, urplötzlich aus dem Hochwalder Land zurückgekehrt, beinah schon drängend.
»Ja, Herr Professor. So viel Erfahrung jedenfalls, dass sie keine Angst vor diesen Tieren hat. Ich denke, sie kann auch ganz gut mit ihnen umgehen, sie hat einfach so eine Art.«
Es blieb ungesagt, welche Art Frau Fanny Hesse einfach hatte, denn das Ehepaar Koch begann über die ihnen eigentlich unbekannte Fanny einen Streit. Hesse begriff nur, dass Storms verstorbener Zwillingsbruder dabei eine Rolle spielte. Frau Koch schien zu glauben, ihr Mann habe Storms Zwillingsbruder mit seinen medizinischen Versuchen umgebracht. Während der Professor den Affen Storm offensichtlich aus dem Haus haben wollte. Eigentlich sollte sich Witold, der Gärtner, um Storm kümmern, aber aus irgendwelchen Gründen ging das nicht. Und seltsamerweise schien das alles irgendetwas mit Fanny Hesse zu tun zu haben.
»Storm mit seinem Fimmel für Uniformen. Wie soll ich denn Vertreter der Generalität zu uns einladen, wenn der Affe hier in Husarenmänteln herumläuft? Man wird doch annehmen, ich mache mich lustig über das Vaterland. Und auch sonst kann man ja niemanden zu Tisch bitten, wenn du es zulässt, dass das Tier beim Essen auf dir herumturnt. Unsauber ist das, eine hygienische und namentlich eine gesellschaftliche Unmöglichkeit. Dabei muss ich die Herren einfach einladen, das verlangt die Höflichkeit. Es wundert mich immer wieder, wie wenig dir an meinem gesellschaftlichen Fortkommen liegt.«
Das Abendessen war dann ziemlich ungeordnet zu Ende gegangen. Koch hatte Hesse ständig nach Java und Fannys Erfahrungen gefragt. Dabei war Hesse sich gar nicht mehr sicher, wie lange Fanny überhaupt dort gelebt hatte. Vielleicht waren es ja nur Erzählungen über die Erlebnisse von Cousins und Cousinen gewesen, die er im Kopf hatte. Während Fanny selbst höchstens ein- oder zweimal Ferien auf Java verbracht hatte.
Storm zerrte an der Hausfrau.
»Er will, dass ich im Schlafzimmerspiegel sein Nudelhalsband bewundere«, erklärte sie lachend, dabei fiel die Schüssel mit dem restlichen Kalbsherz vom Tisch. Hesse versuchte, sich für das Abendessen zu bedanken, versicherte, er fände die Haustür auch allein, der Professor folgte ihm durch die Diele und bat ihn, morgen wiederzukommen und seine javanesische Gattin mitzubringen, unbedingt.
Im Hotel saßen Hesse und seine Frau noch lange auf dem Bett und beratschlagten. Fanny würde morgen zu den Kochs mitkommen. Hatte der Professor sie nicht ausdrücklich eingeladen? Eben. Diesen merkwürdigen Affen, der bei den Kochs eine Hauptrolle zu spielen schien, wollte sie kennenlernen.
Dieses Mal, dachte Witold, muss ich mich nicht in die Thuja drücken, damit ich die Gäste des Professors in Ruhe anschauen kann. Diesem Doktor, der sich gestern wunderte, als Storm ihm die Tür aufmachte, dem wird man inzwischen ja gesagt haben, hier gibt es einen Gärtner. Ich werde ihm nicht auffallen.
Witold trug einen schweren Anzug, auch sommers wollten seine Knochen nicht warm werden. An Knien und Ellbogen war der Anzug ausgebeult, dort glänzte der Stoff. Ursprünglich war es ein grauer Fischgrätanzug gewesen. Witold hatte daran seine ersten Versuche mit dem Blau des Färberwaid gemacht. Zuerst war das Grau regelmäßig wieder durchgekommen. Inzwischen verstand er die Färberei viel besser. Und so war, nach vielen Neujahrsmorgen, die er stets damit verbrachte, seinen Anzug frisch zu färben, der Stoff endlich satt getrunken vom Färberwaid. Das Blau summte in einem tiefen Ton, die Fischgrätmusterung gab dem Blau zusätzlich Körper. Wenn Witold etwas anderes tragen musste, weil der Anzug, schwer von blauer Lauge, in den ersten Januartagen zum Trocknen hing, fühlte er sich unbehaglich.
Aber um das zu sehen, musste man Witold erst einmal herausschälen aus der blühenden Selbstverständlichkeit dieses Gartens.
Frau Hesse jedenfalls entdeckte ihn sofort, zog ihren Mann von der Haustürklingel zu den Beeten hin, wollte Witold begrüßen, als seien die beiden nur seinetwegen zum zweiten Mal hier herausgekommen, gar nicht Robert Kochs und der Vakanz im Institut wegen.
Hesse blieb unsicher auf der Veranda stehen. Es war ihm peinlich, einfach in den Professorengarten einzudringen, das sah Witold. Ein Garten ist ja trotz allem etwas Intimes, gibt viel preis über seinen Besitzer. Auch Kochs Garten sagte einiges über den Professor, obwohl oder weil er selbst die Pflanzen gar nicht anrührte.
Der Frau war das wohl gleichgültig. Sie ging auf Witold zu, drückte ihm kräftig die Hand. Ganz sauber war sie nicht, seine Hand. Witold fand, die Erde, in der seine Pflanzen zu Hause waren, das war kein Dreck. An seinen breiten Händen klebte immer warmer Boden. Er achtete nicht darauf.
Witold Krol war mit den Kochs aus Wolsztyn gekommen, wo der Professor noch keiner, sondern Kreisphysikus, Mikroskopiker und Privatgelehrter gewesen war. Koch sagte gerne: Meinen Garten habe ich samt Gärtner aus der kalten Heimat nach Berlin mitgebracht. Witold widersprach nie.
In Wolsztyn hatte Witold sich um die Versuchstiere gekümmert, um den Garten und was sonst so anfiel. Das tat er auch hier in Berlin. Er war geschickt im Färben, ein geborener Farbenmensch. Genauso mit den Mikroskopen, mit allem war er geschickt. Wie aus dem Boden gewachsen stand er da, wenn wieder einmal etwas nicht voranging bei einem Experiment, beim Marmelade-Einkochen, bei der Reparatur einer zerbrochenen Maske. Er schaute eine Weile zu und brachte dann mit ein paar Griffen, die ihm ganz selbstverständlich aus den Händen wuchsen, das Stockende wieder ins Laufen. Selber wusste er nicht, woher ihm diese Geschicklichkeit zuflog. Oft schaute er den Wolken im Himmel nach, während seine Finger, ohne Aufsicht, schraubten schliffen, rüttelten und die Dinge behutsam so lange drückten, bis sie an ihrem Platz einrasteten.
Über seine Zeit vor den Kochs redete er nicht. Ich bin einmal Lehrer gewesen, aber das ist lange her. Mehr sagte er nicht.
In Wolsztyn behaupteten sie, Witold habe zwar Lehrer gelernt, das ja, habe aber nie eine Schule von innen gesehen, und das Geldverdienen habe er der Frau überlassen, mit der er jahrlang verlobt gewesen war.
Verlobt. Er fand, als Verlobter hatte er alles, was er brauchte. Und was die Kinder anging, so hatte er einfach keine Lust, kleine Kinder abzurichten, darauf lief seiner Meinung nach das Schulwesen am Ende hinaus. Andere vermuteten, er könne Kinder nicht leiden, oder habe Angst vor ihnen.
Witold kümmerte es nicht. Solange er nur seine Farben ausziehen, eindampfen, mischen, fixieren konnte, mehr wollte er ja nicht. Er sammelte Blätter, Blüten, Stengel und Wurzeln, Nüsse, Rinden, die jungen Spitzentriebe, er sammelte Pilze und totes Holz. Er war glücklich, wenn aus dem Sud des braunen Habichtspilzes ein Blau entstand, tief wie der Himmel, oder wenn die Schamblume ihr helles Violett herausgab.
Nachdem er eines Morgens feststellte, dass er gar nicht mehr verlobt war, musste er nun doch ans Geldverdienen denken und hatte die Stelle als Faktotum beim Professor angenommen. Der saß in seinem Dachzimmer, das er sich mit der Mitgift seiner Frau als Labor eingerichtet hatte, und schaute durchs Mikroskop. Um seine Patienten kümmerte er sich nur widerwillig, es sollten schon Privatpatienten sein.
Einmal hatte Witold ihn gefragt, ob man die Bazillen nicht mit Hilfe von Pflanzenfarben sichtbar machen könnte. Seither steckten die beiden tagelang zusammen im Labor, versuchten mit den Blättern des Walnussbaums, mit Blutweiderich oder den Wurzeln des Japanischen Indigo die Bazillen in ihrem unsichtbaren Treiben zu ertappen.
Nach Berlin war Witold ohne besonderen Grund mitgekommen, es hielt ihn ja nichts im friedlichen Wolsztyn.
Der Garten, der zu der Villa gehörte, die die Kochs in Berlin gemietet hatten, war riesig. Witold hatte erreicht, dass sogar noch die Hälfte des Nachbargartens dazu gepachtet wurde. Das war unerhört im städtischen Berlin. Aber die Generalswitwe nebenan konnte mit ihrem vielen Grün ohnehin nichts anfangen. Koch zahlte ihr jährlich eine kleine Summe, die sie lächelnd Pacht nannte. Dazu hatte sie sich ausbedungen, dass ihr Witold im Spätsommer und Herbst von den neuen Kartoffeln bringen musste und das ganze Jahr über Salat, Grünkohl, Zwiebeln, Lauch, Kürbisse, Gurken. Was er eben gerade zog. Ihre Abgaben nannte die Generalswitwe das. Sie fand, es stehe ihr zu.
Und so wuchs unter Witolds Händen aus dem sandigen Boden Berlins in vielfach unterteilten Beeten, Spalieren und Gewächshäusern, neben und über sie hinaus, ein weites Land, leuchtete, jubilierte und hatte einen offenbaren oder einen verschwiegenen Nutzen, manchmal beides.
Früher hatte Witold Pflanzen, die lediglich schön waren und keinen Ertrag brachten, nicht geduldet. Tulpen, zum Beispiel, nahmen nur Platz weg. Inzwischen glaubte er, auch die Schönheit selber sei schon ein kleiner Nutzen. So wuchsen jetzt, wenn es ihre Zeit war, die duftlosen Tulpen neben den unzähligen Färberpflanzen.
Zwischen die Beete häufelte Witold kleine Wälle aus Erde, er schlug niedrige Pfähle aus weißem Holz hinein, um die er frische Weidenruten flocht. Manchmal wuchsen die ihm in den Boden, wo sie im nächsten Frühjahr austrieben. Koch beschwerte sich, welches Durcheinander Witold im Garten anstellte. Witold fragte, ob er bitteschön den Pflanzen Vorschriften machen sollte, wo sie den besten Boden finden dürften. Er jedenfalls zwang sie nicht dazu, ewig am selben Platz zu bleiben. Sie wussten es eh besser als er, und er riss keine aus, nur weil sie ihre Wurzeln in ein anderes Beet hinüberstreckte.
Gerade war er dabei gewesen, die Erde um den Ginster zu lockern.
Frau Hesse wollte wissen, wie er die Ruten, die sich doch sonst nur schwer zähmen ließen, dazu brachte, in der Nachbarschaft von Kohl und Rüben zu gedeihen, und aus welchen Teilen der Pflanze er das Gelb gewann.
Gleich geriet Witold ins Erzählen. Sonst interessierten sich die Besucher für Koch und seine unsichtbaren Bazillen, den Garten sahen sie nicht einmal. Während Fanny Hesse, geborene Eilshemius, von Niederländern, Franzosen und vielleicht Javanesinnen abstammend, eine Empfindlichkeit für Pflanzen geerbt hatte, ein unaussprechliches Verständnis dafür, was sie fühlten, wovor sie sich fürchteten. In dem, was dieser Gärtner in seinem blauen Anzug sagte, fand sie viel Kluges.
Jetzt öffnete sich die Verandatür. Frau Koch erschien mit Storm an der Hand, begrüßte Hesse freundlich. Storm riss sich los und rannte zum Ginsterbeet, umfasste Witolds Knie und schaute Fanny Hesse so nachdrücklich ins Gesicht, als verlangten Witolds Darlegungen eine weitere Erklärung, die er auch sofort geben würde.
Heute trug er keine Uniformjacke, dafür eine Reithose. Jodhpur-Hose hieß das Kleidungsstück. Frau Hesse hatte so etwas bisher nur in illustrierten Zeitschriften gesehen. Am Oberschenkel albern ausgebeult, mit Lederbesatz vom Gesäß die Innenseite der Oberschenkel hinunter bis zum Knie, galt die Hose in Berlin derzeit auch abseits des Reitplatzes als enorm elegant. Gehalten wurden sie von gelben Hosenträgern, die sich über Storms nackten Oberkörper spannten. Auf seinem Kopf ein Helm mit einem Paradebusch aus weißen und schwarzen Federn, die Schuppenkette hing ihm im Nacken.
»Witold, du zeigst der Dame schon meinen Garten? Das ist gut!«, sagte die Frau des Professors, die langsam hinter Storm hergegangen war. »Guten Tag Frau, mh … Hesse, ich bin Emmi Koch. Wie schön, dass Sie den Weg zu uns heraus gefunden haben. Mir scheint, Storm bewundert Sie auch schon. Kommen Sie, Witold veranstaltet eine Führung für uns.«
Dann fragte sie noch, wie Frau Hesse mit Vornamen heiße, Fanny, wie ungewöhnlich, so wienerisch, und dass sie sich den besser merken könne, hakte sich bei Fanny Hesse ein, und die beiden folgten Witold, der sie zu den Gewächshäusern führte.
Versteckt hinter Maulbeerbäumen weitete sich der Garten hier zu üppigen Beeten. Am Ende stand ein Sommerhaus. In den Ritzen der Holztreppe wuchsen Malven. Im Spätsommer zerstampfte und kochte Witold sie, um Blaurot und Grau daraus zu ziehen.
»Ah, der an Hygiene interessierte Herr Bezirksarzt, guten Tag«, sagte Koch, der jetzt auf die Veranda heraustrat. Er hatte einen Packen Papiere unter den Arm geklemmt. »Ich sehe, Sie haben Ihre javanesische Gattin mitgebracht?«
Fanny Hesses roter Schopf leuchtete zwischen den Maulbeerbäumen.
»Guten Tag, Herr Professor, jawohl, und Ihre Frau Gemahlin ist so liebenswürdig, meiner Frau Ihren wunderbaren Garten zu zeigen.«
»Na ja, mein Garten, in erster Linie ist es Witolds Garten, der tut hier, was er will, oder was die Pflanzen wollen. Manchmal glaube ich, es ist so, dass die Pflanzen Witold ziehen, anstatt, dass umgekehrt er die Pflanzen zieht. Aber solange alle so fröhlich gedeihen und ich frisches Gemüse auf den Tisch und neue Farben ins Labor bekomme, lasse ich ihn natürlich gewähren. Und Storm tut sich wichtig, selbstverständlich.«
Tatsächlich schlug der Affe wie an der Schnur gezogen Purzelbäume, so unangestrengt, als sei dieses Vorwärtsrollen seine eigentliche Art sich fortzubewegen. Den Helm mit dem Paradebusch hatte er Frau Hesse zum Halten gegeben.
»Ich möchte Ihre Gattin kennenlernen, bitte stellen Sie mich ihr vor«, sagte Koch und ging hinter der kleinen Gruppe her.
Derweil hatte Witold die beiden Frauen und Storm schon in das Sommerhaus geführt. Das Erdgeschoss bestand aus einer Küche, oder vielleicht war es ein Labor. Ein gewaltiger Ofen, Tische unterschiedlicher Größe, Werkzeuge, deren Zweck nicht erkennbar war, riesige Töpfe und Wannen aus Zink, Reagenzgläser und Destillierkolben. Daneben ein dämmriger Raum mit geschlossenen Läden. An den Wänden zogen sich Regale mit Einmachgläsern, Steinguttöpfen, Flaschen und bauchigen Krügen. Schließlich ein sonnenhelles Zimmer, in dem kreuz und quer Schnüre gespannt waren, auf denen Witold Blätter und Stängel trocknete. Sie dufteten scharf und belebend.
Im ersten Stock eine Wohnung, die seit Jahren nicht mehr bewohnt zu sein schien. Irgendjemand hatte Spinnweben und Mäusekot nachlässig zusammengekehrt. Die Zimmer waren groß und voll staubiger Sonnenstrahlen. Durch die Fenster, für die es keine Vorhänge gab, sah man Witolds Gewächshäuser, Schuppen und Beete. Von hier oben aus ordneten sich die Beete zu einem Muster. Darüber noch ein ausgebautes Dachgeschoss.
»Wollen wir draußen auf der Veranda einen Schluck trinken? Es ist so staubig, wir benutzen das Sommerhaus eigentlich nie,« sagte Frau Koch.