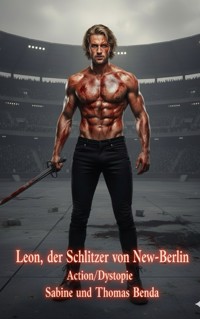5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bitte sagt es mit Blut klebt an seinen Händen. Bangkok, 1976. Ein Toter in einer schäbigen Bar – und der Fotograf Konrad Fischer flieht. Nicht nur vor der Polizei, sondern auch vor der Leere in sich. Er tauscht die grellen Neonlichter der Stadt gegen die undurchdringliche, grüne Finsternis des Dschungels. Doch die Wildnis hat ihre eigenen Regeln. Sie ist atemberaubend schön und unvorstellbar grausam. Konrad entdeckt eine neue Welt – und sich selbst. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf Im undurchdringlichen Dschungel von Papua-Neuguinea stößt eine spanische Spezialeinheit auf einen furchterregenden und brutalen Gegner, den sich keiner von ihnen hätte ausmalen können. Ein entsetzliches Grauen, das keine Gnade kennt, sondern nur seinem unstillbaren Hunger folgt. Doch … was die Einheit bald feststellen muss: Die Wahrheit, die sich hinter dem blutigen Albtraum verbirgt, ist noch viel entsetzlicher ... für uns alle. Fleisch 1974. Westpapua. Professor Joachim Fredemann entkommt verstümmelt einem unbekannten Kannibalenstamm. Traumatisiert kehrt er nach Hamburg zurück. Dort ist er nur von einem einzigen Gedanken besessen: Er muss seine Tochter Monika aus den Händen der Wilden befreien. Für Joachim beginnt eine Odyssee, die ihn an seine persönlichen Grenzen bringt. Wird er Monika lebendig wiedersehen? Und ... welche brutalen Regeln gelten für einen deutschen Akademiker in den Tiefen des undurchdringlichen Dschungels?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sabine und Thomas Benda
Sammelband Dschungel - Drei Romane in einem Band
Bitte sagt es mir / Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf / Fleisch
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Sammelband Dschungel
Bitte sagt es mir
1. Ich brauche euch … ja, euch!
2. Mein Name ist Konrad
3. Die erdrückende Last
4. Im Dschungel
5. Gefangen
6. Ein Lichtblick im Schatten
7. Das Unvermeidliche
8. Als ich ein anderer Mann wurde
9. Ein neues Leben
10. Das dunkle Gesicht des Dschungels
11. Der Sturm bricht los
12. Requiem
13. Die Entscheidung am Scheideweg
Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf
1. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf
2. Cocktails der Verachtung
3. SENSATION IN MADRID! SPANIENS TOP-HELDEN STÜRZEN TERROR-HÖLLE!
4. DER TERROR-GRIFF UM MADRID – UND UNSERE ANTWORT AUS STAHL! (Die realen Namen der Spezialeinheit wurden geändert.)
5. So bin ich
6. Ankunft im Inferno
7. Begegnung im Schattenwald
8. Der Kampf im strömenden Regen
9. Das Herz der Finsternis
10. So bin ich jetzt
11. 24 Stunden zuvor: Ich, die Hoffnung
12. Die Jagd nach dem Leben
13. Das Festmahl
Fleisch
1. Ein blutiger Anfang
2. Alles tun, um zu überleben
3. Die Narben der Zivilisation
4. Ein Kampf gegen Windmühlen
5. Wenn sich das Grauen wiederholt
6. Ich, der Besondere
7. Die Feier
8. Die Göttin und der Besondere
9. Gedanken an uns, die Zivilisierten
Über die Autoren:
Impressum neobooks
Sammelband Dschungel
Drei Romane in einem Band
Bitte sagt es mir
Abenteuer/Drama
Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf
Action/Horror
Fleisch
Abenteuer/Drama
Sabine & Thomas Benda
IMPRESSUM
© 2025 Sabine Benda, Thomas Benda
Korrektorat und Lektorat: Sabine Benda
Coverdesign: Sabine Benda
Sabine und Thomas Benda
Josef-Schemmerl-Gasse 16
A-2353 Guntramsdorf
E-Mail: [email protected]
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Hinweis der Autoren: Unsere Bücher sind nur für Erwachsene geeignet!
22.10.2025
Bitte sagt es mir
Abenteuer/Drama
Sabine & Thomas Benda
IMPRESSUM
© 2025 Sabine Benda, Thomas Benda
Korrektorat und Lektorat: Sabine Benda
Coverdesign: Sabine Benda
Sabine und Thomas Benda
Josef-Schemmerl-Gasse 16
A-2353 Guntramsdorf
E-Mail: [email protected]
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Hinweis der Autoren: Unsere Bücher sind nur für Erwachsene geeignet!
22.10.2025
1. Ich brauche euch … ja, euch!
Es ist eine seltsame Sache, über das eigene Leben zu berichten, denn man muss sich selbst mit der gleichen unbarmherzigen Ehrlichkeit betrachten, die man auch von anderen erwartet.
Vielleicht sucht ihr nach einer Geschichte über Heldentum und glorreiche Taten, nach einer Romanze, die euer Herz höherschlagen lässt, oder nach der Aufregung, die ein Thriller bietet. Ich kann euch nichts davon garantieren, aber ich verspreche euch, dass ihr eine ehrliche Geschichte bekommen werdet.
Ich stehe hier und schaue auf diese Welt, die wir die Moderne nennen. Alles ist schnell, alles ist laut, und die meisten von uns jagen einem Ideal nach, das wir gar nicht mehr erkennen können. Es scheint, als hätten wir die Orientierung verloren. Werte, die einst als unerschütterlich galten, scheinen im Nebel verschwunden zu sein. Was bleibt uns noch? Wofür kämpfen wir? Ich stelle mir oft diese Fragen, und ich weiß, dass es im Grunde dieselben Fragen sind, die die Menschen schon immer beschäftigt haben. Und doch fühlen sie sich in unserer Zeit drängender an als je zuvor.
Die Antwort, so scheint es, liegt nicht im Äußeren, in der Jagd nach Erfolg oder Anerkennung, sondern im Inneren. Es geht darum, sich selbst zu finden, über den eigenen Tellerrand zu blicken und zu erkennen, dass die Welt mehr ist als das, was wir sehen. Manchmal entdecken wir uns selbst erst, wenn wir uns in den Geschichten anderer wiederfinden. Manchmal ist es ein winziges Detail in einem fremden Leben, das uns plötzlich einen Lichtstrahl auf unser eigenes wirft.
In den folgenden Kapiteln werdet ihr mich kennenlernen, den Mann, der ich war, und den Mann, der ich geworden bin. Ihr werdet von meinen Fehlern lesen und von den Taten, die ich bedauere. Ihr werdet meine Schuld erkennen, die mich beinahe erdrückt hätte. Doch ihr werdet auch meine Freuden teilen, die kleinen Momente des Glücks, die mich gerettet haben. Es ist eine Reise, die mich von der Dunkelheit ins Licht geführt hat, und ich lade euch ein, mich zu begleiten.
Doch diese Reise ist noch nicht zu Ende, und genau deshalb brauche ich euch, meine lieben Leserinnen und Leser. Am Ende dieser Erzählung wartet eine Entscheidung auf mich, die ich nicht alleine treffen kann. Ich brauche eure Hilfe, um zu verstehen, was wirklich zählt. Ich brauche eure Perspektive, um den nächsten Schritt zu wagen. Ich vertraue euch meine Geschichte an, weil ich hoffe, dass ihr mir am Ende auch euer Vertrauen schenkt. Ich zähle auf euch, ja! Ich brauche euch … ja, euch!
Bitte sagt es mir …
2. Mein Name ist Konrad
1976.
Die feuchte, schwüle Hitze Bangkoks klebte an meiner Haut wie ein feuchtes Leichentuch und raubte mir den Atem. Es war eine Hitze, die nicht nur die Luft zum Flimmern brachte, sondern auch die Seele zum Kochen. Ich war Konrad Fischer aus Bayern, ein Fotojournalist, dessen beste Zeiten wohl hinter ihm lagen. Die Kamera, meine ständige Begleiterin, hing schwer um meinen Hals, doch ihr Gewicht schien mir heute eher eine Last als eine vertraute Freundin zu sein. Sie war nur noch eine stumme Zeugin meiner gescheiterten Existenz, eine Linse, die das Chaos in mir nicht mehr einfangen konnte. Die Straße stank nach Abgasen, gebratenem Essen und den 1.000 unerfüllten Träumen der Menschen, die wie Ameisen durch die Gassen krochen.
Ich stolperte durch die labyrinthartigen Gassen, das pochende Geräusch meines eigenen Herzens dröhnte lauter als der ohrenbetäubende Verkehr um mich herum. Jede Ecke, die ich umrundete, jeder Schatten, in dem ich mich versteckte, fühlte sich an wie eine Falle, die sich langsam zuzog. Die Panik war ein hungriges Tier, das mich an den Fersen hatte, und ich wusste, dass es mich früher oder später einholen würde.
Vor wenigen Stunden noch hatte ich in einer schäbigen Bar gesessen, deren flackernde Neonlichter die Verzweiflung der Gäste gnädig verschleierten. Das billige Bier spülte die Bitterkeit der letzten Monate hinunter, die wie eine zähe, dunkle Masse in meiner Seele klebte. Bangkok war für mich nicht mehr das verheißungsvolle Tor zu Asien, das ich mir einst erhofft hatte. Es war ein Gefängnis, dessen Mauern aus Schulden, verpassten Chancen und geplatzten Träumen bestanden.
Meine Karriere, einst so vielversprechend, war in den letzten Jahren nur noch eine Aneinanderreihung von Absagen. Die großen Geschichten, die ich einst jagen wollte, gab es nicht mehr für mich. Stattdessen verdiente ich mein Geld mit drittklassigen Aufträgen, die kaum die Miete deckten. Der Alkohol – mein ständiger Fluch und meine manchmal einzige Zuflucht – war der einzige Weg, die endlose Leere zu füllen, die sich in mir ausgebreitet hatte. Er hatte mir die klare Sicht genommen, die ich als Fotograf so dringend gebraucht hätte. Er hatte mein Urteilsvermögen vernebelt und meine Emotionen in einem undurchdringlichen Nebel aus Wut, Angst und Schmerz gefangen.
In dieser Bar, in dieser schäbigen Ecke des Elends, trafen Welten aufeinander. Es waren nicht nur die leeren Bierflaschen und die rauchgeschwängerten Gesichter, die die Atmosphäre bestimmten. Es war das kollektive Scheitern, das in der Luft lag. Meine eigenen Dämonen spiegelten sich in den Augen der anderen Trinker wider. Ein thailändischer Trunkenbold, dessen Gesicht ich nie wirklich erkennen konnte – vielleicht, weil ich es nicht wollte, vielleicht, weil der Alkohol es mir unmöglich machte – saß mir gegenüber. Er war ein stummer Ankläger, ein Spiegelbild meines eigenen Versagens.
Wir saßen uns gegenüber, zwei gestrandete Seelen, gefangen in unseren jeweiligen Albträumen. Ein Wort zu viel, ein unbedachter Blick, eine Hand, die sich erhob – die Details verschwimmen zu einem nebligen Schleier. Ich weiß nicht mehr, wer angefangen hat, wer den ersten beleidigenden Satz aussprach. Vielleicht war es der Blick in seinen Augen, der die leere Hülle meiner eigenen Seele zu durchbohren schien. Es war ein Blick voller Verachtung, der mich auf eine Weise traf, die schmerzhafter war als jeder Schlag.
In diesem Moment brach etwas in mir. Die monatelange Anspannung, die Bitterkeit, die Selbstverachtung – all das entlud sich in einer einzigen, brutalen Welle. Meine Hand, die einst so sanft eine Kamera führte, um die Schönheit der Welt einzufangen, wurde zu einer Waffe. Es war ein Moment der Raserei, nicht von mir gewollt, doch von mir ausgelöst. Ich sah nicht den Mann vor mir, ich sah nur noch das Monster in mir. Die Faust traf sein Kinn mit einem dumpfen, grausamen Geräusch. Er taumelte, doch es reichte mir nicht. Ich wollte, dass er aufhört, mich so anzusehen. Ich wollte, dass er aufhört, mein eigenes Versagen so gnadenlos in seinen Augen zu spiegeln.
In diesem Sekundenbruchteil, der mir wie eine Ewigkeit vorkam, hatte ich keine Kontrolle mehr über mich selbst. Es war, als würde eine fremde Macht meinen Körper steuern. Ich holte aus, ein weiteres Mal. Er fiel, ein roter Fleck breitete sich auf seinem Hemd aus. Ein Riss in der dünnen Maske der Zivilisation, die wir uns alle aufgesetzt hatten. Und dann die Stille. Eine Stille, die lauter war als jeder Lärm, jeder Schrei.
Ich sah den Mann am Boden liegen, ein Bild, das sich in mein Gedächtnis brannte, schärfer als jedes Foto, das ich je geschossen hatte. Der dunkelrote Fleck auf seinem Hemd war die Farbe meines eigenen Scheiterns. Es war die Farbe des Blutes, das ich in meiner Verzweiflung vergossen hatte. Die Panik packte mich wie ein hungriges Tier. Mein einziger Gedanke: weg. Ich stolperte aus der Bar, die Welt um mich herum verschwamm zu einem unscharfen Gemälde aus Angst und Schuld. Die Lichter Bangkoks, die einst so verlockend geschienen hatten, waren nun die strahlenden Augen eines Monsters, das mich zu jagen schien. Ich war kein Fotojournalist mehr. Ich war ein Mörder. Und ich wusste, dass ich niemals wieder frei sein würde.
Die Panik war nun mein einziger Begleiter. Ich rannte durch die Gassen, vorbei an den Essensständen, den blinkenden Neonreklamen, den lächelnden Gesichtern, die nun in meinen Augen zu anklagenden Schatten wurden. Mein Herz hämmerte so laut gegen meine Rippen, dass ich befürchtete, es würde jeden Moment aus meiner Brust springen. Ich war ein Mörder. Der Gedanke war ein eiskalter Stich, der mich bis ins Mark traf. Ich, Konrad Fischer, der Mann, der einst Geschichten mit seiner Kamera einfing, hatte nun selbst eine geschrieben – eine Geschichte von Gewalt und Tod.
Ich wusste, dass ich jetzt ein Leben als Flüchtling führen würde. Immer auf der Hut, immer in der Angst. Gejagt von der Vergangenheit, von der Polizei, von mir selbst. Bangkok, die Stadt, die einst mein Zuhause war, war nun mein Gefängnis.
3. Die erdrückende Last
Meine Hände zitterten, nicht vor Kälte, sondern vor einem Schock, der jede Faser meines Seins durchdrang. Ich starrte auf meine Handflächen, als wären sie mir fremd. Es waren dieselben Hände, die in meiner Kindheit Baumhäuser gebaut hatten, die im Fußballverein den Ball hielten, die später im Studium unzählige Seiten mit Gleichungen und Notizen füllten. Hände, die geliebt, gelebt und erschaffen hatten. Nun waren es Hände, die getötet hatten.
Die Erinnerungen an mein früheres Leben zogen wie ein Film vor meinem inneren Auge vorbei, ein Film, der so unwirklich wirkte wie eine Erzählung aus einem fernen Universum. Ich sah mich als kleinen Junge in einem beschaulichen Dorf in Süddeutschland. Der Duft von frisch gemähtem Gras an den heißen Sommertagen, das laute Lachen beim Versteckspiel im Wald, die Abende, an denen meine Mutter Märchen vorlas. Es war eine unbeschwerte Kindheit, geprägt von der Sicherheit einer intakten Familie, von Freunden, mit denen ich bis zur Erschöpfung die Welt erkundete.
In der Jugendzeit wurde die Welt größer, aber die Grundfeste blieben dieselben. Erste Liebe, erste Enttäuschungen, die Planung der Zukunft. Ich war ein guter Schüler, fleißig, neugierig. Ich ging auf Partys, trank mein erstes Bier, verbrachte endlose Stunden mit meinen Freunden an einem kleinen See, philosophierte über das Leben und die Welt. Das Leben war eine lange, gerade Straße mit klaren Schildern. Ich würde studieren, einen guten Job finden, eine Familie gründen. Ein ganz normales Leben, so wie es Tausende andere in Deutschland führten.
Doch in mir wuchs eine leise, aber stetige Unruhe. Die Bilder aus fernen Ländern, die ich in Büchern und Dokumentationen sah, faszinierten mich mehr als die Aussicht auf ein Reihenhaus und einen Firmenwagen. Die Abenteuerlust, die Neugier auf das Unbekannte wurden zu einem inneren Motor. Die geradlinige Straße des Lebens schien plötzlich zu eng, zu vorhersehbar. Ich wollte mehr sehen, mehr fühlen, mehr erleben.
Nach dem Studium packte ich meinen Rucksack. Es war eine Entscheidung, die meine Eltern nur mit Mühe nachvollziehen konnten. »Du hast doch so gute Aussichten, warum willst du das alles aufgeben?« Die Frage spiegelte ihre Sorge, aber auch ihr Unverständnis wider. Ich aber hatte meinen Entschluss gefasst. Ich wollte die Welt sehen, nicht als Tourist, sondern als Teil von ihr. Meine Reise begann als Auszeit, als ein Jahr, um mich selbst zu finden. Doch die Faszination der Fremde, die Schönheit und die Härte der Welt ließen mich nie wieder los. Ich tauchte in fremde Kulturen ein, lernte Sprachen, überlebte in der Wildnis, fand Freunde, die mir näherstanden als meine Familie. Ich wurde zu einem Weltbürger, einem Abenteurer, der in den Ecken der Erde Zuhause war, in denen andere nur Urlaub machten.
Ich liebte dieses Leben. Die Herausforderung, der Nervenkitzel, das Gefühl der Freiheit. Dieses Leben schien mich zu definieren. Ich war nicht mehr nur der Junge aus dem Dorf, ich war der, der in den Dschungeln Südamerikas überlebte, der die Wüste Gobi durchquerte, der die höchsten Berge bestieg. Ich war ein Held meiner eigenen Geschichte.
Doch Helden fallen. Und jetzt, in dieser heißen Nacht, fühlte ich mich alles andere als heroisch. Ich fühlte mich leer, kaputt, entstellt. Die Tat, der Tod, den ich verursacht hatte, war kein Moment des heldenhaften Überlebenskampfes, sondern ein brutaler, hässlicher Akt. Ein Moment, der die geradlinige, wenn auch abenteuerliche, Bahn meines Lebens mit einem Schlag zerstörte.
Ich dachte an den Mann, den ich getötet hatte. War er ein guter Mensch? Hatte er eine Familie, Kinder, die auf ihn warteten? Das Gesicht des Mannes war jetzt nur noch eine verschwommene Erinnerung, aber seine Augen, diese Augen voller Panik und Entschlossenheit, brannten sich in meine Netzhaut. Ich hatte ihn nicht getötet, weil ich es wollte, sondern weil ich musste. Es war ein verzweifelter Akt der Selbstverteidigung, in einer Situation, in der es nur eine Wahl gab: töten oder getötet werden.
Ich war ein Mörder. Der Begriff brannte in meinem Kopf, eine unveränderliche Wahrheit, die ich nie wieder loswerden würde.
Ich hatte getötet, um zu überleben. Doch das Leben, das ich jetzt hatte, schien mir fremd. Es war nicht mehr meines. Die unbeschwerte Abenteuerlust, die mich angetrieben hatte, war verschwunden, ersetzt durch eine endlose, erdrückende Last. Ich war jetzt nicht mehr der Held meiner Geschichte, sondern ein Fremder in meinem eigenen Körper. Ein Mann mit leeren Händen, die einst so viel gebaut und erschaffen hatten und nun nur noch die Erinnerung an das Ende eines Lebens hielten.
Die Welt um mich herum schien sich zu verändern. Der Wind schien kälter zu pfeifen, die Sterne am Himmel heller zu brennen, als wollten sie meine Tat beleuchten und anklagen. Ich fühlte mich isoliert, alleine, getrennt von allem, was mir einst vertraut war. Mein altes Leben, meine unbeschwerte Kindheit, die Abenteuer, die ich so sehr liebte – all das war jetzt nur noch ein schöner Traum, aus dem ich brutal erwacht war.
Jetzt galt es, zu überleben, nicht im Sinne von Atmen und Essen, sondern im Sinne der psychischen Bewältigung. Ich musste einen Weg finden, mit der Tat zu leben, ohne dass sie mich vollständig zerstörte. Ich musste diese neue, kalte Dunkelheit in mir akzeptieren. Und ich musste lernen, der Fremde zu sein, der ich jetzt war. Ein Mann, der getötet hatte, um zu überleben, aber der dabei einen Teil seiner eigenen Menschlichkeit verloren hatte. Und diese Erkenntnis schmerzte mehr als jede Wunde, die ein Gegner mir hätte zufügen können.
Die Dunkelheit hatte sich nicht verändert, aber die Art und Weise, wie sie mich jetzt umgab, war neu und unbarmherzig. Sie war nicht mehr die vertraute Schwärze der Nacht, in der ich mich so oft geborgen fühlte, sondern ein kaltes, feuchtes Tuch, das sich um meine Seele legte und langsam, genüsslich jede Hoffnung aus mir herauspresste. Die Zeit hatte ihre Bedeutung verloren, war zu einem wirren Strom von Fragmenten geworden, in dem Sekunden zu Ewigkeiten wurden. Vor einem Atemzug lag noch ein Mensch vor mir – ein Mensch, der atmete, sprach, existierte. Jetzt lag dort nur noch ein stiller Körper. Ein Körper, dem ich selbst die Stille gebracht hatte. Ich hatte eine Grenze überschritten, die keine Landkarte verzeichnete, eine, von der ich nie gedacht hätte, sie zu überqueren. Die Tat war kein Akt der Wut oder des Hasses gewesen, sondern ein verzweifelter, instinktiver Schlag, um mein eigenes Ende abzuwenden. Doch die Rationalität der Selbstverteidigung konnte die emotionale Verheerung nicht aufhalten. Ich war ein Mörder. Der Begriff brannte sich in mein Gehirn wie ein Brandzeichen.
Der Dschungel, mein eigentliches Ziel im Norden Thailands, wurde plötzlich zur ersehnten Rettung. Ich musste verschwinden, bevor die thailändische Polizei mich fand. Dies war kein geplanter Rückzug, sondern eine kopflose Flucht vor den Konsequenzen eines Augenblicks, der mein Leben für immer verändert hatte. Die Bilder dieser Nacht brannten sich in mein Gedächtnis, eine ständige Erinnerung an den Punkt, an dem mein altes Leben endete und dieses neue, ungewisse begann. Jeder Blick über meine Schulter war von der Paranoia gezeichnet, entdeckt zu werden. Jeder Schatten ein potenzieller Verfolger, jedes ferne Geräusch das Echo von Sirenen, die nur in meinem Kopf existierten. Der Herzschlag war ein ständiges, dumpfes Dröhnen in meinen Ohren, eine Trommel, die den Takt meiner Angst schlug. Die Luft, einst so erfüllt von den exotischen Gerüchen Asiens, schien jetzt nach Verwesung und Schuld zu stinken.
Ich brauchte jemanden, der die Wege kannte, die unsichtbaren Pfade, die tief in das grüne Herz des Landes führten. Mein Glück war Somchai, ein kleiner, drahtiger Mann mit Augen, die die Weisheit vieler Generationen zu tragen schienen. Ihn zu finden, war die erste Hürde, ein Wettlauf gegen die Zeit in einem Labyrinth aus Gassen, Märkten und undurchsichtigen Kontakten. Ich hatte von ihm in einer Bar am Rande der Stadt gehört, einem Ort, der sich anfühlte wie die letzte Station vor der Welt, in der die Regeln keine Rolle mehr spielten. Der Barkeeper, ein alter Mann mit einem zerfurchten Gesicht, der mich mit einem Blick erkannte, verstand sofort, was ich brauchte, und schrieb mir eine Adresse auf einen zerknüllten Zettel.
Die Adresse führte mich in eine Gasse, die so schmal war, dass ich meine Schultern einziehen musste, um hindurchzukommen. Hinter einer rostigen Eisentür, die mehr quietschte als die Stimmen der Händler am Markt, fand ich Somchai in einem winzigen Raum, der von Räucherstäbchen und dem Geruch von getrockneten Kräutern erfüllt war. Er saß auf dem Boden, eine Teetasse in den Händen, und musterte mich, ohne ein Wort zu sagen. Das Verhandeln mit ihm war anfangs eine Qual. Er sprach kaum Englisch, und mein Thai war miserabel. Die Sprachbarriere wurde zu einer unüberwindbaren Mauer der Missverständnisse und der Paranoia. Ich versuchte, meine Dringlichkeit zu verbergen, aber meine Hände, die noch immer leicht zitterten, und meine weit aufgerissenen Augen verrieten mich. Er sah es, er verstand es, aber er zögerte. Der Preis, den er nannte, war astronomisch, ein Vielfaches von dem, was ich erwartet hatte. Er wusste, dass ich verzweifelt war, und er spielte das Spiel mit einer stoischen Ruhe, die mich fast in den Wahnsinn trieb. Ich bot mehr, er lehnte ab. Ich flehte, er musterte mich schweigend. Es war ein Tanz der Verzweiflung und der Macht, bei dem er alle Trümpfe in der Hand hielt. Schließlich, als ich fast bereit war, aufzugeben, nickte er langsam und forderte eine letzte, unverschämt hohe Summe. Ich zögerte nicht. Ich zog das gesamte Bargeld, das ich bei mir hatte, aus der Tasche und drückte es ihm in die Hand. Sein Gesicht blieb unbewegt, doch in seinen Augen, die wie dunkle, tiefe Seen wirkten, erkannte ich einen Funken der Anerkennung. Geld wechselte schnell den Besitzer, und bald saßen wir in einem klapprigen Pickup, der uns nordwärts rumpelte, immer tiefer hinein in die scheinbar endlose Wildnis.
Der Geruch von feuchter Erde und unbekannten Pflanzen hing in der Luft, eine Mischung, die gleichermaßen beruhigend und beängstigend war. Ich klammerte mich an die Hoffnung, die Somchai verkörperte – die Hoffnung auf einen Ausweg, eine unsichtbare Tür in die Anonymität. Doch die Last der Tat saß mit mir im Beifahrersitz, ein stiller, unheilvoller Passagier, der mich auf diesem Weg begleiten würde, bis ans Ende meiner Tage. Ich hatte mein Leben verloren, um es zu retten. Und jetzt, in diesem klapprigen Pickup, wurde mir schmerzlich bewusst, dass das gerettete Leben nur noch ein Schatten des alten war. Ein Schatten, der in der Dunkelheit des Dschungels nach Erlösung suchen würde.
Die Fahrt war eine Qual, eine endlose Tortur aus Hitze, Staub und der ständigen, lähmenden Angst, angehalten zu werden. Ich schlief kaum, mein Magen krampfte sich zusammen. Meine Gedanken kreisten unaufhörlich um die Tat, um das Gesicht des Mannes, um die Frage nach dem »Was wäre, wenn ...«. Ich sah mein altes Leben in Deutschland an mir vorbeiziehen: die unbeschwerte Kindheit, die Abenteuerlust, die mich auf die Reise geschickt hatte. War ich jetzt noch derselbe Mann? Würde ich jemals wieder ein normales Leben führen können? Oder war das, was mich einst ausmachte, für immer verloren?