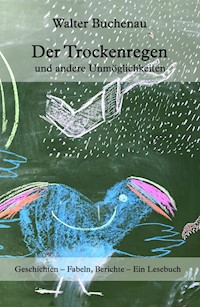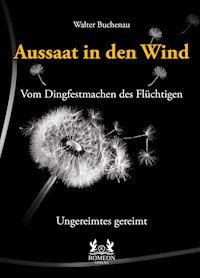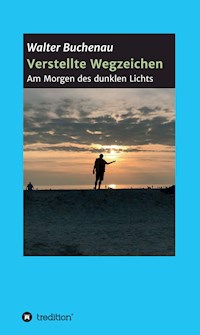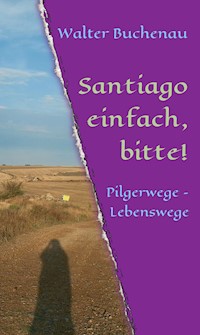
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Landschaften Nordspaniens, von den Höhen der Pyrenäen, über die Meseta in Leon/Kastilien, das Bierzo, über die Berge und Almen Galiziens, bis zur Atlatikküste - der Jakobsweg führt durch all diese Regionen, und auf ihm begegnet der Wanderer den unterschiedlichsten Menschen aus aller Herren Länder, die sich wie durch ein geheimes Band verbunden fühlen und ihre Geheimnisse miteinander teilen. Auch die eigenen, verschütteten Erinnerungen entstehen vor den Augen auf den einsamen Strecken, allein mit sich und seinen Gedanken. Daraus entstanden zusätzlich Gedichte über besondere Orte oder Emotionen und fiktive Dialoge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
© 2017 Walter Buchenau
Korrektur und Satz: Angelika Fleckenstein, Spotsrock
Bilder Titel- und Rückseite: © Walter Buchenau
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44,
22359 Hamburg
ISBN:
978-3-7439-7737-2 (Paperback)
978-3-7439-7738-9 (Hardcover)
978-3-7439-7739-6 (eBook)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Walter Buchenau
Santiago einfach, bitte!
Pilgerwege – Lebenswege
Wen oder was man so alles findetauf dem Camino oder in sichoder auch zurücklässt
Für Anne, Michael und Janund für Christel
Inhaltsverzeichnis
I. Noch’n Buch vom Camino! 30.7.2015
Plötzlich in der frühen Nachmittagsglut: oben!
II. Roncevalles – Zubiri, 11.8.2015
Ponte Rabia, Zubiri, 11.8.2015
III Zubiri – Pamplona, 12.8.2015
Neubeginn
Pamplona – Cirauqui
Wegzeichen – Cirauqui, 13.8.2015
Cirauqui – Estella – Los Arcos, 14.8.2015
San Juan de Ortega –Burgos
Viana – Navarete – Santo Domingo de la Calzada
Über die Ehrlichkeit
Die andere Seite des Schattens, 16.8.2015
Die Sonne wirft schräg
Irgendwann aus einem Spaß
Belorado, Gedenkstätte
Ort der Massenmörder, 19.8.2015
Verführt, gedungen, gezwungen, war es so?
Was hat die Seelen euch verbogen?
Ihr habt euch ins Gedächtnis der Zeit gegraben
San Juan de Ortega
Ich stehe vor meinem Spiegel und sehe mich an
Burgos, 20.8.2015
Meseta, 24.8.2015
Burgos – Castrojeriz – Fromista, 24.8.2015
Fromista – Carrion – Terradillos des los Templarios
Terradillos – El Burgo Ranero
Wind von vorne
Gedenken
Dialog ‚Demut‘
Auf halber Strecke
Villarente – León
León – Villar de Mazarife
Mittagsstille
Astorga – Rabanal, 30.8.–1.9.2016
Erkenntnisse
Astorga – Rabanal
Herberge Rabanal, 31.8.2015
Wo der HERR dich birgt
Könnten wir nicht alle
Rabanal – Molinaseca
Um die Fünfzig
Molinaseca, Ponferrada
Bestimmung, Villafranca, 2.9.2015
Ich habe geliebt und habe gegeben
Geschichte vom ‚Talisman‘
Vor O’Cebreiro
Ein Nichts. Laguna de Castilla, 3.9.2015
Ebenen der Logik
Triacastela-Sarria, 5.9.2015
Der Weg – Sarria, 5.9.2015
Dialog über Kirchen
Sarria–Portomarin, 6.9.2015
Portomarin – Palas de Rei, 7.9.2015
Dialog Freiheit, 8.9.2015
Die Wand mit dem einzigen Tor
Palas de Rei – Ribadiso, 8.9.2015
Trennung
Ribadiso – O Pedrouzo, 9.9.2015
O Pedrouzo – Santiago, 10.9.2015
Dialog Mystik, 10.9.2015
Endspurt
Santiago, 10.–11.9.2015
Hinter St. Jakobs Hochaltar
Deine Schultern sollten golden sein
Santiago – Muxia – Finisterre, 12.9.2015
Von der Ehrlichkeit
Epilog
Vielleicht, dass ich wieder wandern muss!
Denn ich war einmal bereits
Vielleicht hat die Schwerkraft hier
Vom Mut
I. Noch’n Buch vom Camino! 30.7.2015
Irgendwann, so ca. zwei bis drei Wochen vor der Abreise – der Flug und die erste Unterkunft waren längst gebucht – wurde es ruchbar, was ich vorhatte. Einige waren beeindruckt, fanden es gut und wünschten mir Glück. „Das wollte ich auch immer schon einmal“, meinten sie. Aber die anderen hatten sofort eine Latte von Einwendungen parat – reflexartig auf alles Neue, schien mir. Oder empfanden sie mein Vorhaben als Anspruch an sie selbst, es mir gleich tun zu müssen? Und dem galt es rasch einen Riegel vorzuschieben? „Hast du dir das auch genau überlegt? Wer weiß, was da alles auf dich zukommt? In deinem Alter! Und die Hitze! Wo willst du denn schlafen?“ So oder so Ähnliches bekam ich zu hören. – „Hast du wirklich nichts Besseres zu tun?“
Nein, hatte ich nicht. Oder vielleicht doch? Ich liebte schließlich meinen Beruf. Aber ich fand, dass ich mit dreiundsiebzig auch einmal an mich selbst denken durfte! Und das Projekt vom Jakobsweg, dem Camino, spukte mir schon seit den frühen 2000er Jahren durch den Kopf, ziemlich genau ab dem Zeitpunkt, als ich das Buch von Paolo Cuelho gelesen hatte.
Nur: damals besaß ich eine Familie und Kinder und alles, was damit zusammenhing. Auch wenn Jan, mein Großer, bei seiner Mutter in Hamburg aufgewachsen und schon lange Jahre aus dem Hause war, so drückten meine Tochter Anne und der „Kleine“, mein Micha, aus meiner zweiten Ehe noch die Schulbank, und ich musste für sie da sein. Ich wollte es auch und auf keinen Fall ihr Heranwachsen verpassen wie bei Jan, denn schließlich hatte ich mir Kinder immer so sehr gewünscht. Nun waren sie da und die Verantwortung und ich glücklich. Und die Lotto-Glücksfee hatte mich beim Küssen auch immer wieder ausgelassen: Also an so etwas wie den Jakobsweg war lange nicht zu denken gewesen. Darüber hinaus schauten meine Patienten schon schräg, wenn ich nur einmal mehr als eine Woche Urlaub machte; ich fühlte mich für sie ebenso verantwortlich. Mir stand immer das Beispiel unseres alten Dr. Christ vor Augen: Landarzt in dem Dorf bei Limburg, in das unsere Familie im Krieg aus Frankfurt evakuiert worden war: der einzige in der nicht kleinen Gemeinde und trotzdem immer parat, wenn Not am Manne war. Einer, auf den man sich verlassen konnte und dessen Meinung (und Diagnosen) bei den Dorfbewohnern Gewicht hatte. Das will schon etwas heißen bei eigenwilligen Bauern.
Nun aber sagte ich mir: Wenn nicht jetzt, wann dann? Worauf sollte ich noch Rücksicht nehmen? Anne, mein kleines Blond-Engelchen von damals war nun 25 und schickte mir Whats Apps aus Australien, wo sie gerade um den heiligen Uluru tigerte oder am Great Barrier Reef mit den Haien tauchte! Mein „Kleiner“ überragte mich längst um fast einen ganzen Kopf und begeisterte sich – nach heavy metal und all den düsteren, schwarz kostümierten Gitarrenschwingern – plötzlich für Hans Albers und ‚La Paloma‘. Und vierzehn Tage nach seiner Abifeier – nach neun Jahren, die wir seit dem Weggang seiner Mutter gemeinsam durchlebt, gebangt, genossen hatten, – verabschiedete er sich von mir in Hamburg, (nicht ohne dass es uns beiden einen gehörigen Stich gegeben hätte) und bestieg ein riesiges Containerschiff um Seemann zu werden. Irgendwo zwischen San Francisco und Shanghai schipperte er nun herum, schickte mir gelegentlich Nachrichten, wenn es ihm auf der ‚Hundswache‘, dem Dienst zwischen Null und Vier Uhr, zu langweilig wurde, und ich saß abends nach der Praxis alleine zu Hause und hätte ihn gerne einmal in den Arm genommen.
Zugegeben – ich habe wieder eine liebe Partnerin gefunden, Christel, mit der ich meine Freizeit am Wochenende teilen darf, die sich um mich kümmert und sorgt – mehr, als ich manchmal vertragen kann – und die ich für diese Unternehmung jetzt alleine lassen musste, weil sie wegen der zu erwartenden Strapazen nicht mitkommen konnte. Aber sie verstand mich und stand mir zur Seite, nicht im Weg. Auch das ist Glück.
Jedenfalls wollte ich mich jetzt nicht mehr von meinem Plan abbringen lassen, lief vier Wochen lang täglich samt Rucksack und Stöcken zum Stadtpark und fünf bis sechsmal den Müllberg rauf und runter – jenes zugewucherte Relikt aus unseligen Nachkriegstagen, als die Trümmer aus der Stadt dort abgelagert wurden – und diente dabei verwunderten Spaziergängern und angestrengt trainierenden Jungsportlern als kurioses Anschauungsobjekt.
Und dann, an einem Sonntagmorgen hockten wir tatsächlich, mein Wanderfreund Jens und ich, im Flieger nach Spanien.
Wir schwebten mittags in Madrid ein, saßen uns vier Stunden lang den Hintern platt in der endlos langen Abfertigungshalle, ehe uns mit Verspätung schließlich der kleine Regional-Flieger nach Pamplona schaukelte.
Pamplona – ich kannte bestenfalls den Namen, er klang verheißungsvoll, sehr spanisch, ich dachte an die Stiere, die zu Ehren des Stadtpatrons San Fermines Anfang Juli durch die Stadt getrieben werden, aber hier am Flughafen kein Hauch von Exotik, es war alles recht klein und unspektakulär und ziemlich leer.
Wir sammelten unser Gepäck vom Band, ich entfernte den grünen Überzug von meinem Rucksack, den Christel mir extra genäht hatte und fand mich dann zum ersten Mal marschfertig mit aufgebuckeltem Backpack und den Wanderstöcken in der Hand inmitten der Abflughalle wieder, dachte, dass nun jeder sehen könne, was ich vorhatte und mir entsprechend Respekt zollen müsste. – War aber nicht.
Stattdessen suchten wir, mittlerweile fast schon die Letzten in dem Gebäude, nach irgendeinem Hinweis, einem Fahrplan oder einer Beschilderung, die Auskunft gäbe, wie wir in die Stadt gelangen könnten. Mühsam auf englisch, da mein Spanisch nur rudimentär ausgebildet ist versuchte ich einem durch die Halle schlendernden Angestellten klarzumachen, dass wir mit dem Bus zur Fern-Busstation in die City wollten. Als ich mit meinem Anliegen endlich zu ihm durchgedrungen war, zeigte er durch das Fenster irgendwo in die Landschaft, wo man in einem halben Kilometer Entfernung eine Straße ahnen konnte, und dort, sagt er – und seine Hand machte einen großzügigen Bogen – dort sei die Bushaltestelle. Wo dort genau? Und wie hinkommen? Über den Zaun, der das Gelände umgab? Über den Acker, denn von einem Weg war nichts zu sehen! Achselzucken, eine spanische Worttirade, womit er sich umdrehte und ging. – Da wir also offensichtlich keine „pilgergerechte“ Lösung finden konnten, bestiegen wir am Ausgang leicht entnervt ein Taxi, das uns nach zwanzig Minuten Fahrt durch Gewerbegebiete und wenig ansprechende Vorstadtstraßen in einem unterirdischen Labyrinth von Bussteigen, Fahrbahnen und Schaltern ablieferte. Und wieder hielten wir – genau so nass wie am Flughafen – Ausschau, von wo und wann wohl welcher von den zahlreichen Bussen uns nach St. Jean-Pied-de-Port bringen könnte.
Da erschien wie ein rettender Engel ein Mann neben uns und sprach uns an: er hatte wohl unsere Rucksäcke und ratlosen Gesichter erspäht: „Camino? St. Jean?“, fragte er. Es war der Busfahrer, wie sich herausstellte. Und keine Minute später konnten wir uns inmitten eines angeregt schwatzenden Völkchens von anderen Pilgern in die Sitze des Überlandbusses plumpsen lassen und aufatmen. Soweit hatten wir es also geschafft.
Die Fahrt über die Landstraße mit vielen Kurven zog sich; später beschlich mich beim Anblick der steilen Steigungen schon ein leicht mulmiges Gefühl, denn schließlich waren das die Pyrenäen, über die wir morgen marschieren würden. Nach einer dreiviertel Stunde rollte der Bus über einen Platz und hielt an, alle Passagiere krabbelten hektisch aus dem Gefährt, zogen ihre Rucksäcke aus dem Gepäckabteil und verteilten sich rasch über die Straße in Richtung Innenstadt. Diese bestand mehr oder minder aus einer einzigen, recht steil ansteigenden engen Gasse. Wir hielten mit so gut es ging; Jens hatte die Adresse parat; in dieser Hauptstraße sollte sie sein, aber schon ein Stück bergauf, ich merkte es am Schnaufen; schließlich erreichten wir sie: unsere erste Herberge.
„Schuhe hier unten, Dusche und Toilette links, schlafen oben Raum eins!“ Das erste Nachtlager! „Frühstück von halb sieben bis halb acht.“ – Das schien mir doch etwas früh, aber diese Ansicht änderte sich rasch im Laufe des Camino. Jedenfalls waren wir hier angekommen.
Wir ließen oben in einem Raum mit knarzendem Holzboden und Holzvertäfelung – ein früherer Wohnraum – unsere Rucksäcke vom Rücken gleiten, breiteten die Schlafsäcke auf einem der vier Doppelbetten im Raum aus, suchten so etwas wie Ordnung in das Sammelsurium aus dem Gepäck zu bringen und eine Steckdose zu finden für das Handy: unserer Nahtstelle zur Außenwelt. Man fühlte sich schon jetzt ein beträchtliches Stück weit weg von dem, was sonst den Alltag ausmachte, wenn auch gerade erst zwölf Stunden seit dem Start in Düsseldorf verstrichen waren.
Der Hunger trieb uns nochmals auf die Straße, erst bergauf, am geschlossenen Pilgerbüro vorbei zum oberen Stadttor, wo erste Fotos fällig waren, aber kein Restaurant sichtbar, und wieder zurück – nun war das Büro geöffnet, und wir empfingen von einem Deutschen, der dort ehrenamtlich seinen Dienst machte, Informationblätter über die morgige Etappe und den ersten Stempel im Credential, dem Pilgerausweis. Jeder führt einen solchen mit sich; unserer war schon lange vorher bei der Düsseldorfer Jakobusbruderschaft bestellt und zugeschickt worden. Nun mit dem Stempel war es offiziell und ich heimlich ein bisschen stolz auf den blauen Abdruck.
Der nächste Morgen kündigte sich mit bemüht leisem Rascheln, räumen, halblauten Worten und Schritten an, manchmal fiel jemandem bei aller Vorsicht auch etwas aus der Hand, gefolgt von einem unterdrückten Unmutslaut – jedenfalls: an Schlafen war nicht mehr zu denken, eine Vorübung für den Rest des Camino. Das Aufstehen und Packen erfolgte noch etwas plan- und routinelos, und es erfüllte mit Verwunderung, dass all die ausgebreiteten Sachen tatsächlich wieder in den Backpack passten. Als wir schließlich unten ankamen, waren wir bereits die letzten und der Herbergswirt machte uns darauf aufmerksam, dass er gerade das Frühstück abzuräumen gedachte, es ging auf halb acht. Also schütteten wir rasch den Milchkaffee hinunter, steckten das Marmeladenbrot in den Hals, dann noch das Ves-perbrot in die Seitentasche (im Übernachtungspreis inbegriffen), wuchteten den Rucksack auf den Rücken und traten aus dem Haus: acht Uhr – wir waren auf dem Weg.
Wir liefen die lange Hauptgasse zuerst hinunter, dann durch das berühmte Tor hindurch mit der Maria oben in der Nische und über den Fluss, und von da ab ging es nur noch bergauf – aber wie! Ich hatte bei der anfänglich extremen Steigung wirklich Mühe hinaufzukommen und dachte an mein erstes Mini-Autochen aus meiner Seminar-Zeit in Wien: damit wäre ich hier nicht hinaufgekommen! Zehn Minuten nach dem Start in St. Jean stand mein Rücken bereits unter Wasser.
Alsbald enteilte Jens am Berg. Er hatte seinen Bundeswehr- Gepäckmarsch-Gang eingelegt und wurde den Berg hinauf nicht etwa langsamer als ich, sondern schneller. Der Spieß hätte ihnen früher ein freies Wochenende versprochen, wenn die Truppe innerhalb einer bestimmten Zeit ihr Ziel erreichen würde, erzählte Jens, worauf diese alle Kräfte mobilisierte um die in Aussicht gestellte zusätzliche Freizeit zu ergattern! Jens konnte das heute noch.
Ich ungedientes, BW-unerfahrenes Individuum wuchtete langsam Schritt für Schritt mich und meinen Rucksack die Straße hinauf, dankbar für jede kleine Strecke mit sanfterer Steigung – ab und zu – und das blieb erst einmal so für die nächsten zwanzig Kilometer.
Und es kämen noch siebenhundert und soundso-viele weitere dazu, ging mir durch den Kopf. Ich verglich den Weg mit meinen Lebensjahren. Wie viele Kilometer wohl einem von meinen fast vierundsiebzig entsprechen würden, dachte ich. Diese ersten 20 km, so rechnete ich aus, ungefähr den ersten zwei Lebensjahren. Ob die für ein Kind auch so mühsam sind? So vieles ist neu und zu entdecken. So fühlte ich mich jetzt auch: In einer fremden Umgebung, in der die Sinne geschärft waren, konzentriert auf die körperliche Herausforderung, gefangengenommen von atemberaubenden Ausblicken, je höher ich kam: rundum Täler voll geheimnisvoller Nebel und hinten, bereits tief unten, St. Jean, während es vorne immer weiter bergan ging.
Kleine Besonderheiten am Weg fielen auf, die ich wahrscheinlich sonst nie beachtet hätte: besonders marmorierte Gesteinsformationen, die nackt durch den Pfad herausragten, Erikakissen, an den lehmigen Hang geklammert völlig unerwartet für mich in dieser Gegend; kleine blaue Falter, welche mich wie zu meiner Begrüßung umgaukelten und Eidechsen, die reglos an einer Bruchsteinmauer klebten.
Orrison kam in Sicht, die erste Herberge und Bar unterwegs, bevölkert von den vielen früher Gestarteten, die ihren Café con leche tranken und in die Sonne blinzelten. Jens hatte auf mich gewartet, aber auch noch keine Lust auf Pause und trabte bald wieder los, ich hinterher.
Der Tag hätte nicht schöner sein können: Strahlendes Blau nach dem Dunst in der Niederung, ein leichter Wind, der weiter oben sogar recht kräftig und kühl war, als ich mich nach drei Stunden erstmals auf einem Rasenbuckel am Weg niederließ, um mein Hasenbrot zu vertilgen. Oben kreisten elegant und majestätisch die Pyrenäen-Geier im Aufwind – (die man laut EU-Verordnung nicht mehr füttern darf – schon erstaunlich, worum sich Bürokraten kümmern). Seitlich fiel das Terrain in tiefe Taleinschnitte hinab, und dahinter wieder grüne Berge, so weit das Auge reichte. Beim Blick zurück konnte ich lange das schmale Band des Wegs verfolgen, den ich heraufgestiegen war. Und irgendwo weit hinten vor dem Horizont hatte eine Senke längst das Städtchen verschluckt, von wo aus wir aufgebrochen waren. Ziemlich viel Landschaft, die wir bereits durchwandert hatten.
Frankreich verabschiedete sich mit einem Lieferwagen, der am Straßenrand Erfrischungen und einen Stempeleintrag ins Credential anbot, der erste auf dem Weg: Wir nahmen ihn natürlich mit.
Dann kam noch eine Steigerung des Aufstiegs: die Muschel auf dem Wegweiser zeigte, dass man nach rechts abbiegen musste von der kleinen Straße, auf der wir bislang gelaufen waren. Über Gras, Geröll und Lehmboden stapften wir nun steil aufwärts und mussten genau nach Absätzen und Stufen im Boden Ausschau halten, um nicht abzurutschen – als ob der Rücken nicht schon nass genug gewesen wäre.
Weiter oben wurde es endlich flacher; Jens tröstete mich: Es seien nur noch 4–5 km bis zum Scheitelpunkt, die lt. Pilgerführer mehr oder minder eben verliefen – eher minder wie sich zeigte; wir kamen an einer eingefassten Quelle vorbei zum Füllen der Trinkflaschen, links oben am Berg entsprang sie; auf der anderen Seite konnte man tief ins Tal hinunter schauen, wo wahrscheinlich die Autostraße von gestern verlief. Noch ein paar kleinere Anstiege, und dann Warnas geschafft.
Auf knapp 1500 m Höhe am Scheitelpunkt kreuzte die Passstraße unseren Pfad, und an ihrem Rand erhob sich ein kleines futuristisches Monument, von wo aus sich auf der anderen Seite ein weiter Ausblick in die Runde eröffnete. Hier pfiff der Wind kräftig. Dafür waren aber alle Dunstschleier verflogen, und unten zwischen einem Meer von grünen Wipfeln konnte man entfernt die Türme von Roncevalles erahnen.
Zur Belohnung gönnte ich mir ein zweites Picknick, etwas unterhalb der zugigen
Aussichtsstelle und Straße, die man übrigens bei schlechtem Wetter als Alternative zum Pilgerpfad nehmen sollte – zur Vorsicht, so wurde empfohlen.
Jens hatte wohl keinen Hunger, ihn hielt nun nichts mehr, er stürmte voraus, den Berg hinunter, dem Ziel entgegen, in der Herberge würden wir uns wieder treffen.
Der Abstieg hatte es wirklich in sich, nicht umsonst die Empfehlung, ihn bei Regen zu meiden, denn zwischen den schlanken Eukalyptus-Bäumen, die wie riesige Grashalme astlos in den Himmel ragten, und gewaltigen alten Buchenstämmen mussten schon viele Sturzbäche von Wasser hinunter gerauscht sein und hatten im Laufe der Zeit nur loses Geröll und blanken Fels übrig gelassen – wie heftig würde es hier wohl bei einem Gewitter zugehen?
So wild blieb es auf diesem Abschnitt fast eineinhalb Stunden lang, immer weiter steil bergab, immer auf der Hut hier nicht auszurutschen.
Als sich der Wald endlich unten öffnete, gab er vor mir den Blick frei auf eine idyllische, kleine, von Pilgern belagerte Wiese mit einen Bachlauf, in dem schon zahlreich Füße gekühlt wurden. Auf der anderen Seite ein Stück aufwärts die mächtigen Mauern des Klosters Roncevalles, unseres ersten Etappenziels.
St. Jean-Pied-de-Port – Roncevalles, 10.8.2015
Nicht spektakuläre Berge,
die kleinen Dinge am Wege sind es:
Die rostrote Raupe,
eilig über den Lehmboden buckelnd;
ob sie noch jung war?
Nur Kinder können so verstrubbelt aussehen!
Oder die gefleckte Eidechse,
sonnenbadend an der Mauer vor Orrison.
Und ich,- ohne Zwischenhalt,
zwei Stunden bergauf in den Beinen –
sehe sie so leicht die Steine hinauf huschen,
als könne sie die Schwerkraft ausknipsen!
Oben schlürfte man Café con leche.
Dann diese Schafe:
von der Weide wohl extra herabgekommen,
und dicht gedrängt am Gatter in der Kurve,
die Köpfe auf den Rücken der Nachbarn,
wie sie mit verständnis-entleerten Augen
den Pilger-Erscheinungen bergwärts folgen!
Natürlich auch die großen Dinge:
Täler vollgegossen mit Dunst,
die Kirchen-Stille zwischen den Buchensäulen.
Und rund geschliffene Brocken in den Regenfurchen,
die von ihrer gegenläufigen Pilgerreise erzählen.
Schließlich nur noch die Schritte;
die zählen, einer vor den anderen,
den nächsthöheren Absatz erkämpfend,
oben voraus schimmert es schon verheißend blau,
ehe der Weg sich wieder verbiegt,
den nächsten Aufstieg enthüllend,
und weiter so Schritt um Schritt um Schritt.
Plötzlich in der frühen Nachmittagsglut: oben!
Als ob das Gepäck mit einem Mal leichter wäre
und vor den Augen eine Schimäre
tief unten über wolkigem Baumgrün
zitternd in der Ferne:
Dächer und Türme, das Ziel.
II. Roncevalles – Zubiri, 11.8.2015
Jens erwartete mich schon, nachdem ich die letzten Stufen zum Eingang hinauf gekrochen war. Für heute reichte es! Rucksack ab, Stiefel aus, Anstehen an der hufeisenförmigen Theke, hinter der wieder ein Deutscher Dienst tat, uns den obligatorischen Stempel verpasste und in den 2. Stock schickte.
Roncevalles war für einen größeren Pilgerandrang gebaut, den die Augustiner dort schon seit Jahrhunderten betreuten: es gab hier nur diese Herberge. Und so fanden wir uns in einem der riesigen Schlafsäle wieder mit Gängen vor den Fenstern und zur Mitte hin, Rücken an Rücken, ca. zwei Dutzend Nischen mit je zwei Stockbetten. Nach einer heißen Dusche und frisch eingekleidet lagen wir dort erst einmal für ein Stündchen flach und verpassten prompt die Führung durch das Kloster, die eine junge Studentin angeboten hatte. Aber zum Wäschewaschen rafften wir uns auf –- von nun an das abendliche Pflichtprogramm, denn alles, was ich auf dem Leib getragen hatte, war schweißnass und musste dringend ins Wasser.
Auf der Suche nach einer Bar oder einem Restaurant durchquerten wir einen großen gepflasterten Innenhof und gelangten seitlich durch eine Torbogen zur dunklen, romanischen Stiftskirche mit der – laut Pilgerführer – sehenswerten Statue „Unserer lieben Frau von Roncevalles“. Unsere Bewunderung hielt sich allerdings in Grenzen, denn der Magen knurrte vernehmlich. – „Erst kommt das Fressen, dann die Moral beziehungsweise Kultur.“ (Ob Berthold Brecht auch einmal gepilgert ist?)
Wir trösteten uns mit einem angebotenen ‚Pilgermenü‘, dem ersten der Wanderschaft in einem Restaurant/einer Bar gleich gegenüber der Kirche, dessen Räume eher an hiesige Luxus-Etablissements erinnerten: in weiß fein eingedeckte Tische zwischen dem rustikalen Klostergemäuer des Speisesaals. Und Ruhe! Denn der größere Teil des Pilger-Trecks hatte ein anderes Angebot gleich am Empfang gebucht und war in einem entfern-teren Trakt verschwunden. Wir ‚speisten‘ mit Vor-, Haupt- und Nachspeise: Suppe, Gebratenes mit Pommes und etwas Pudding ähnlichem, dazu gehörig eine Karaffe Wein und Brot, und das alles kostete ganze 10 €. Nach so einem Tag schmeckte es hervorragend und es war ja auch noch ganz neu für uns. Wie sich im Laufe der Zeit allerdings herausstellte, muss es wohl eine geheime Absprache unter den Wirten geben, denn der Hauptgang mit Gebratenem – ob Huhn oder Fisch oder Fleisch plus Pommes fand sich so ziemlich überall auf der Speisekarte, davor Gemüse- oder Linsensuppe, danach Süßes, wobei zur Ehre der Restaurantbetreiber gesagt werden muss, dass die Portionen in der Regel in angemessener Proportion zur Anstrengung unterwegs standen.
Ebenso neu wie das Menü gestaltete sich auch die Nachtruhe heute: ab 22 Uhr war Schlafenszeit, aber irgendjemand schlurfte in der Nacht ständig den Gang entlang zu den Toiletten, leuchtete mit der Taschenlampe umher, klappte mit der Toilettentür, und wenn ich mich gerade zum Weiterschlafen auf die andere Seite gerollt hatte, dann kam er auf dem Rückweg wieder mit seiner Taschenfunzel vorbei. Am Morgen herrschte ab 6 Uhr Aufbruch in allen Kojen – wie schon gehabt! Das Einpacken ging bereits deutlich besser als gestern; wir holten die Wäsche rein, die wir am Abend noch draußen aufgehängt hatten; die feuchten Socken wurden zum Nachtrocknen am Rucksack befestigt, die Stiefel unten aus dem besonderen Schuh-Raum geangelt (dort abgestellt, damit sich in den Schlafsälen nicht die Decke vom „Duft“ anhebt) und erst einmal hinaus in die Morgenfrische. Trotz Hochsommer konnte ich mein Sweatshirt und den Anorak gut gebrauchen. Meine Stimmung schwankte ein bisschen zwischen: noch müde von der gestrigen Strapaze, der Neugier darauf, was heute kommen würde und dem Unmut wegen des Morgenkaffees kurz zuvor. In einer Gaststätte außerhalb des Klosters sollte es für die eigens an der Rezeption gekauften Bons das Frühstück geben. Das Chaos dort war allerdings beträchtlich, die Damen hinter dem Thresen völlig überfordert und davor ungeduldiges Gedränge von all den Wanderern im Aufbruch; es dauerte ewig bis für jeden der Kaffee ein-zeln in der Maschine zubereitet, alle Sonderwünsche berücksichtigt waren – ob viel oder wenig oder gar kein Zucker ob Mich oder nicht, oder mehr Milch als Kaffee etc. … und bis man dann auch noch einen Toast aus einem der zwei(!) kleinen Toaster ergattert hatte! Ich stellte mir vor, dass sich dies Gerangel hier an jedem Tag in der Saison genauso wiederholte. (Und versuchte meine deutschen Organisations-Fantasien zu zügeln.) An einem der Tische draußen, wo es für ein gemütliches Frühstück noch zu kalt war, tranken wir den Kaffee, aßen dazu das Marmeladenbrot, und dann nichts wie weg. (Von da ab hielt sich unser Bedarf an spanischem Frühstück sehr in Grenzen.)
Der Weg versprach Schönes: eben, zwischen Bäumen und an Feldern vorbei, durch sehr aufgeräumt wirkende navarrische Dörfer mit schmucken, weiß verputzten Häusern, deren Hausecken typischerweise aus großen Natursteinquadern gemauert waren, und weite Flussniederungen. Viele starteten ihren Camino erst von Roncevalles aus und ersparten sich die Pyrenäen, aber das war nicht unser Ding: wenn schon, denn schon. Zwei Anhöhen galt es zu überwinden aber kein Vergleich mit gestern und den Pyrenäen. Dazwischen wieder Misch- oder Kiefernwald, und Ausblicke auf bewaldete Täler; eine Senke, in der sich nicht nur das Wasser eines Flüsschens sammelte, sondern am Steinmäuerchen der Brücke darüber auch die Pilger, denn die Sonne meinte es schon gut mit uns. Ein Imbisswagen stand auf der letzten Anhöhe vor unserem Tagesziel, wo wir zur Mittagszeit etwas ‚abdampften‘, dann ein längerer, steiniger Abstieg, und Zubiri kam in Sicht sowie die erste, romanische Brücke auf dem Camino; viele in der Art und lt. Reiseführer berühmtere sollten noch folgen. Diese hier war kaum eine Fahrspur breit und stieg zur Mitte hin kräftig an, unten floss eine seichtes Gewässer, und die Legende erzählte, dass Tollwut-kranke Tiere geheilt würden, wenn man sie unter den Steinbögen des Viadukts hindurch triebe.
Ponte Rabia, Zubiri, 11.8.2015
Der Steig zur anderen Seite,
der fremden, der getrennten,
Auszeit vom gewöhnlichen Weg.
Steinern alt sind ihre Bögen,
Mythen schlingen sich
um die grauen Quader:
von Heilung für die Tiere
wenn sie darunter dreimal
– natürlich – wie auch sonst im Märchen?-
hindurch gelaufen wären.
Ob es die Brücke wohl ebenso
mit Menschen könnte? Heilte?
Und das Getrennte,
Fremd-Gewordene wieder verbände?
Wie viele Steine müssten für mich
– und wo überall? – aufgeschichtet sein,
und wie oft wäre darunter
hindurch zu kriechen,
um eins zu werden und zu gesunden,
und anzunehmen, was auf der anderen,
der vergessenen Seite lauert,
um die entfremdeten Ufer
in mir wieder urbar zu machen?
III Zubiri – Pamplona, 12.8.2015
El Palo de Arellano – schon der Name der Herberge klang vielversprechend! Und so war sie auch: mit großem Aufenthaltsraum zum Garten hin und einem kleinen Speisesaal samt Balkendecke und mittelalterlich anmutenden Wandmalereien, in dem sich am Abend eine bunte Gesellschaft zu Essen einfand: Eine Deutsche aus Mainz, um die 60 und ganz alleine unterwegs, – sie war wohl zu Hause auch alleine und es tat ihr sichtlich gut, mit anderen reden zu können! Ein jüngeres polnisches Paar, das jetzt in Heilbronn lebte und perfekt deutsch sprach; eine junge Russin aus Nowosibirsk(!), attraktiv und charmant – ich fragte mich, was sie wohl in Sibirien bewegt hatte hier zu pilgern? Drei Spanier noch und wir zwei, Jens und ich, und alle redeten auf Englisch und Spanisch und Deutsch kunterbunt durcheinander von den ersten Eindrücken und Gefühlen auf der noch jungen Wanderschaft.! Dazu das Pilgermahl und der Wein, der sein Übriges tat – ich fühlte mich geborgen und frei von allen Alltagsgedanken.
Die nächste Etappe am folgenden Tag nach Pamplona sollte nur ein einfacher Spaziergang werden, hieß es, war allerdings doch mit einer ganzen Reihe unumgänglicher Steigungen und Abstiegen gewürzt, während unten im Tal parallel dazu die Straße bretteben zur navarrischen Hauptstadt führte. Pilgern heißt wohl, nicht nur seinem Ziel entgegen zu streben, sondern dabei alle auffindbaren Schwierigkeiten mitzunehmen. Doch wenn sie überwunden sind, hinterlassen sie das Gefühl etwas geleistet zu haben, nicht bloß ein Stück schnöder Straße entlang gelaufen zu sein.
Die Sonne schien, die Aufstiege belohnten oben mit hübschen Ausblicken ins Tal, wo unten Spielzeug-Autos an den Modellhäuschen vorbei krochen und nebenan in einer Sandgrube Miniatur-Laster wie in einem Sandkasten von Minibaggern beladen wurden.
Und dann war sie plötzlich wieder da – am dritten Tag unterwegs auf dem Camino: diese klammheimliche, innere, diebische Freude, die mich schüttelte, dass ich nicht wusste, ob ich lachen oder weinen sollte. Wie lange hatte ich sie nicht mehr gefühlt. Hier war ich richtig, auf meinem Weg.
Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als sie mich mit vierzehn oder fünfzehn Jahren gepackt hatte: Da stand ich in Frankfurt-Höchst, wo ich zur Schule ging, hinter dem geschlossenen Vorhang auf der Bühne einer großen Turnhalle; Herr Korell, unser Klassenlehrer, hatte eine Schüleraufführung inszeniert: den ‚Revisor‘ von Gogol, und extra für mich einen Einführungstext geschrieben, denn ich war noch zu jung um mit den Älteren mitspielen zu dürfen. Ich stand dort hinter dem „Lappen“ – wie die alten Hasen im Schauspielgewerbe zu sagen pflegten –, gleich würde das Licht im Saal gelöscht werden und auf ein Zeichen von Herrn Korell würde ich alleine und als erster hinaustreten ins Scheinwerferlicht vor all die erwartungsvollen Eltern und Verwandten der Protagonisten und würde meine Passage sprechen. Da war es zum ersten Mal: dieses einzigartige Gefühl, das mir durch die Adern rieselte. „Das ist mein Augenblick, so fühlt sich Leben an.“ Ich hätte mich und die ganze Welt umarmen mögen.
Wie kindisch und eitel es auch gewesen sein mochte, dieser Impuls blieb schon sehr prägend für meine spätere Berufsentscheidung als Schauspieler. Natürlich hatte ich bereits früher einmal an Theater oder vielmehr an den Film gedacht. Meine Schulzeit fiel in die große Zeit des Kinos – lange vor TV, DVD und Internet. Als einmal für die Verfilmung von Erich Kästners ‚ Pünktchen und Anton‘ zwei Kinderdarsteller gesucht wurden, träumten nicht nur kleine Mädchen davon Filmstar zu werden, kleine Jungs konnten das auch. Mit Hilfe meiner immer alles verstehenden Mutter schickte ich sogar ein eigens dafür aufgenommenes Bild von mir irgendwohin. Aber ich wurde natürlich nicht genommen, war zu pummelig oder unbedarft oder sonst irgend etwas, ohne dass es allerdings meine Schwärmerei nachhaltig beeinträchtigt hätte.
Und dann gab es da noch den Sohn eines Marinekameraden meines Vaters: Hans. Ich erinnere mich, wie wir anlässlich einer Geburtstagsfeier alle dicht gedrängt in unserem kleinen Wohnzimmer Kaffee tranken. Der Krieg lag gerade mal 11 Jahre hinter uns, und Wohnraum war absolute Mangelware, sodass meine Eltern die sehr beengten Wohnverhältnisse in einem Frankfurter Vorort in Kauf genommen hatten, nur um meinem Vater täglich vier Stunden Bahnfahrt zu ersparen: im Bummelzug mit einer altersschwachen Dampflok davor über den Taunus, so gemächlich, dass man am Zuganfang hätte aussteigen, auf der Wiese Blümchen pflücken und am Zugende wieder aufspringen können. Und abends wieder das Gleiche zurück in unser Evakuierungsdorf bei Limburg.
Trotz der räumlichen Enge wurden Geburtstage bei uns zu Hause immer aufwendig und mit Freunden gefeiert. Und so saßen also einmal Mitte der fünfziger Jahre Vaters Kriegskamerad Jonny Schmid und seine Frau Jenny mit uns in der Feier-Runde, und ihr Sohn Hans war ebenfalls mitgekommen, damals schon ein richtiger Schauspieler. Er hatte gerade seinen ersten Film gedreht: einen Märchenfilm: ‚Zwerg Nase‘ – das war schon was. Und um meinen und seinen Eltern eine Freude zu machen, lehnte er bald – scheinbar angetrunken – im Rahmen der Wohnzimmertür und gab einen zum Besten von der ‚Dinkelscherbener Feuerwehr‘ – dem Ort in Bayern, an den es Jonny und Jenny nach den Frankfurter Bombennächten verschlagen hatte. Der Erfolg seiner Darbietung war durchschlagend, alle kugelten sich vor Lachen. – Und meine Theater-Begeisterung wuchs immens.
Später wurde er noch richtig berühmt als Hans Clarin, ganz besonders durch seine krächzenden Stimme, die er in der populären Fernsehe-Serie dem Pumuckel, dem Zeichentrick-Kobold vom Meister Eder geliehen hatte.
Circa fünf Jahre nach dem Erlebnis im Wohnzimmer kam wieder so ein besonderer Moment. Ich hatte das Abitur in der Tasche, sechs Monate Arbeit auf dem Bau hinter mir, um die Zeit bis zu den angepeilten Aufnahmeprüfungen an zwei Schauspielschulen auszufüllen, und stand dann eines Herbsttages alleine in der Traumstadt Wien, noch ganz benommen von den vorangegangenen Ereignissen: Ich war soeben in das Max Reinhard Seminar aufgenommen worden. Das war immerhin die Drama-Abteilung der berühmten Wiener Musikhochschule. Ich wusste selbst nicht, wie ich das geschafft hatte.
Hätte ich vor dem Vorsprechen auf der Bühne des Barocktheaters am Schloss Schönbrunn, auf der bereits die Kinder von Kaiserin Maria Theresia herum gepurzelt waren – hätte ich gewusst, dass zum Herbsttermin gerade einmal drei Jungen und drei Mädchen noch aufgenommen werden konnten – von den mehr als einhundert, die im Foyer auf ihren Auftritt warteten, (und dort schon wie Jung-Stars posierten und gestikulierten) – ich hätte mich auf dem Absatz umgedreht und wäre auf den drei Rädern meines Mini-Autos (1 Zylinder, neuneinhalb PS – mit dem ich vorgestern in Saint Jean nicht die Steigung hinauf gekommen wäre) sofort nach Frankfurt zurückgerollt. Etwa 23 Stunden Fahrzeit, wie ich später einmal gestoppt habe. Die erste Steigung übrigens vorgestern in St. Jean-Pied-de-Port hätte ich mit dem neuneinhalb PS Motorradmotor meines ersten Vehikels nicht geschafft.
Aber ich wusste es nicht, ging also tapfer hinein, als ich an der Reihe war, stellte in dem prächtigen Zuschauerraum voll rotem Plüsch und Goldornamenten meinen Beutel vor der Bühne ab, erklomm die ‚Bretter, die die Welt bedeuteten‘, sagte meine Rolle auf, stieg wieder hinab, nahm meinen Beutel und ging. Drei Stunden später erfuhr ich, dass ich in die engere Auswahl gekommen war, daher morgen nochmals antreten durfte! Am nächsten Tag der gleiche Ablauf wie gehabt: hinein, Beutel abstellen, auf die Bühne, zweite Rolle vorsprechen, hinunter, den Beutel nehmen und ... als ich gerade die Klinke in der Hand hatte, um hinauszugehen, hörte ich hinter mir die Stimme eines meiner späteren Lehrer: „Sagen Sie mal, … was haben Sie denn da eigentlich in dem Beutel drin?“
„Was zu essen“, antwortete ich wahrheitsgemäß – und war aufgenommen. Vielleicht deswegen?
Aber diese bewusste Freude, dieses ‚Hier bin ich richtig!’, empfand ich erst später am ersten Tag im neuen Klassenraum – besser gesagt: in dem Gemach mit hohen Fenstern, Stuckdecken und Parkettboden statt lumpiger Bretter – im Palais Cumberland, wo einst noble Abgesandte fremder Mächte residierten hatten! Es besaß eine überdachten Kutschen-auffahrt zur Straße hin, unten im Eingang einen ovalen, mit Fresken bemalten Empfangs-Saal und dahinter einen richtigen Park- das Ganze einen Steinwurf von Schloss Schönbrunn entfernt. In dieser Kutschen auffahrt hatte ich später einmal mein laubgrünes Autochen vergeblich gesucht und schon befürchtet, jemand könnte sich daran vergriffen haben, als ich in einem Winkel einen verdächtig großen Laubhaufen entdeckte, aus dem es an einigen Stellen grün hervor leuchtete. Einige Mitschüler hatten das Leichtgewicht (wegen der Alu-Karosserie) kurzerhand vom Parkplatz getragen und in der Ecke unter Laub begraben.
Die neuen Mitschüler hatten nun im neuen Klassenzimmer Platz genommen, harrten in der herrschaftlichen Umgebung noch etwas zurückhaltend der Dinge, die da kommen sollten, und dann trat Fred Liewehr ein: unser Lehrer – nein falsch: „Professor“, (denn wir waren ja in Österreich), ein Burgschauspieler, Musicalsänger und Filmdarsteller mit kraftvoller Stimme und von einer wunderbaren Präsenz. Da fühlte ich es wieder, dieses Kribbeln: Jetzt begann es, das richtige Leben. So wie er wollte ich auch sein beziehungsweise werden.
Diese Begeisterung lag dann lange verschüttet irgendwo tief drinnen in mir. Jahre waren seitdem vergangen, der Schauspielberuf längst Alltag, mit den Unfreiheiten und Einschränkungen, nie richtig zu Hause zu sein, der Zimmersuche bei jedem Engagementswechsel, immer aufs Neue, den schwierigen Arbeitszeiten, dem Ausgeliefert-Sein an Intendanten, die je nach Belieben wie die letzten Barockfürsten heuerten und feuerten, – ‚aus künstlerischen Erwägungen‘ – wie es dann hieß, denn ein neuer Fürst brachte stets seinen eigenen Tross mit sich in sein neues Reich – und Urlaub einmal zwischendurch oder gar krank sein ging gar nicht(!) – dies alles wogen die Höhepunkte auf der Bühne bei weitem nicht mehr auf.
Onkel Heinrich, ein Vetter meiner Mutter, der nach dem Tode meines Vaters als väterlicher Freund ein Auge auf mich hielt, gab mir eines Tages die Warnung mit: „Pass auf, dass du nicht verbitterst!“ – einen Satz, den ich damals nicht verstand. Ich war noch an einer Landesbühne engagiert, in Detmold an der Lippe, spielte dort mehr Vorstellungen, als die ganze Spielzeit an Tage zählte, inszeniert nebenbei noch vier Stücke und hatte nicht einmal die Zeit heimzufahren nach Bonn, als meine Frau Gisela im Kreißsaal lag und unseren Sohn Jan zur Welt brachte! Ich wäre so gerne dabei gewesen. Erst drei Wochen später konnte ich nach Bonn fahren. Und dann, als ich in unsere kleine Dachgeschoss-Wohnung hochgestiegen war und im Schlafzimmer in das Bettchen schaute, wo mein Söhnchen schlief, da fühlte ich sie endlich einmal wieder: diese Freude!
Die Warnung von Onkel Heinrich tat nach zwei weiteren Jahren doch noch ihre Wirkung! Mitten im andauernden Kampf um das Geld für ein bisschen Einkauf und die nächste Miete, etc., erhielt ich den Brief einer Kollegin aus dem letzten Engagement: Sie schrieb, dass sie Schluss gemacht hätte mit der Schauspielerei, nun bei einem Heilpraktiker zu arbeiten anfinge und auch die Ausbildung zu diesem Beruf machen wolle! Kurz darauf las ich die Skripten der ersten Probe-Vorlesung, zu der ich mich kurzerhand entschlossen hatte und war fasziniert: von dem Wunderwerk Körper, von uralt bewährten und oft verkannten Heilsystemen, von neuen Entwicklungen, die weit über Blutdruckmessen und das bloße Verschreiben von Pillen hinaus gingen, von denen viele der offiziellen Medizinmänner nichts wussten, oder wissen wollten. (Sie waren und sind ja mit ihren eingefahrenen Methoden in der Gesellschaft gut angesehen und verdienen im Schnitt einhundertzwanzigtausend Euro im Jahr – so die jüngsten Zahlen der Statistiker – wozu also sich um Neues bemühen?) Die Neugier und der Rebell in mir waren gekitzelt und die Naturheilkunde hatte mich gepackt. Also ging ich es an.
Fast ein Jahrzehnt nach der Warnung meines Onkels lagen dann Ausbildung, Prüfung und Anfangsschwierigkeiten im neuen Beruf hinter mir, Umzüge, in eine unbekannte Stadt und nochmals nach einem Jahr in andere Praxisräume. Und ich erinnere mich, wie ich dann eines Morgens aus meiner Wohnung in die neue Praxis hinunter stieg, die Sonne schien ins Labor, alles roch noch frisch und neu, ich hatte etwas Zeit, ehe die ersten Patienten kamen und schaut mich um: Patientenliegen, Ampullenregale, ein neu erstandenes, sündteures Therapiegerät neben allerlei anderen, alles stand bereit und wartete darauf, dass ich es benutzen würde – da verspürte ich sie endlich wieder, diese Freude. Ich konnte jetzt etwas Sinnvolles tun, das anderen nützte, das mich herausforderte und vielleicht gerade deswegen zufrieden stellte, hier war ich an meinem Platz.
Neubeginn
Christine schrieb mir also, dass sie den Schauspielberuf an den Nagel gehängt habe, nun als Sprechstundenhilfe bei einem Heilpraktiker angestellt sei und berichtete auch wie sehr sie die Methoden der alternativen Medizin begeisterten. Damit erziele ihr neuer Chef tolle Heilerfolge, z. B. bei der sonst so schwer zu behandelnden Schuppenflechte oder im Anschluss an überstandene Herzinfarkte. Davon kannte ich nun erst einmal gar nichts. Von dem Beruf eines Heilpraktikers wusste ich bestenfalls den Namen. – Und, so fügte sie hinzu, sie habe sich erkundigt, es gäbe eine bezahlbare Möglichkeit sich in diesem Beruf ausbilden zu lassen: Das werde sie tun.
Da bekam ich plötzlich spitze Ohren, denn kurz vor dem Abitur war mir der Gedanke an die Medizin auch einmal durch den Kopf gegangen, und ich hatte sogar die Praxis unseres Hausarztes inspiziert. Ich wollte zwar immer in meinem künftigen Beruf mehr mit Menschen als mit Technik oder Bürokram zu tun haben, doch die ganze Zeit nur in einer Praxis zu stehen, immer mit Kranken zu tun zu haben und die Klagen über die diversen Wehwehchen zu hören – nein, das konnte ich mir damals beim besten Willen nicht vorstellen – dafür lockte das Theater viel zu sehr.
Jetzt aber schrieb Christine, dass der hessische Heilpraktikerverband eine interessante Variante zu der Ausbildung an einer Tagesschule anbot. Die damals größte Berufsvereinigung DH in Deutschland veranstaltete an Wochenenden berufsbegleitende Seminare und Vorlesungen, die dann zu Hause selbständig bearbeitet und vertieft werden mussten. Das passte. Denn ich hatte ja Frau und seit kurzem auch einen Sohn, für die ich sorgen wollte. Und außerdem sagte ich mir, dass ich schon viel Geld auch für viel unnützere Dinge als Wissen ausgegeben hätte. Also forderte ich die Unterlagen an.
Die Vertragsbedingungen waren mehr als fair, die Kosten mäßig: Ich würde jederzeit ohne Nachteil aufhören können, sollte ich es nicht schaffen oder mir sonst etwas nicht zusagen, daher unterschrieb ich den Vertrag. Das erste Wochenende kam. Ich erhielt die ersten Skripte, hörte die ersten Vorlesungen und wusste sofort: Das war’s! Ich war auf Anhieb gefesselt von der Naturheilkunde und bin es bis heute noch immer – nach so vielen Jahren.
Sicher spielte bei der Entscheidung für diesen Beruf auch der frühe Tod meines Vaters eine Rolle, der schon 1965 mit einundsechzig Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben war. Zu dieser Zeit arbeitet ich sommers bei den Bregenzer Festspielen als Regieassistent, und meine Eltern besuchten mich dort auf der Rückreise von ihrem Urlaub im Allgäu. Wir probten gerade das Ballett ‚Dornröschen‘, und ich führte zum Takt der Musik einige kleine Ballettmädchen an der Hand über die riesige Seebühne um mit ihnen ihre Gänge und Schritte einzuüben, wie sie der Choreograph festgelegt hatte. Meine Eltern saßen dabei auf der Tribüne und sahen zum ersten Mal, was ihr „Kleiner“ in dem für sie so fremden Metier eigentlich machte. Auch mein sonst sehr zurückhaltender Vater war ausgesprochen angetan und wohl endgültig mit meinem Beruf und überhaupt meiner Existenz versöhnt, denn er hatte sich eigentlich immer ein Mädchen gewünscht, aber drei Jungen bekommen. Meine Mutter erzählte gerne eine Episode aus dem Krankenhaus, als mein zweiter Bruder zur Welt kam: Auf dem Flur vor dem Kreißsaal wanderten mein Vater und ein anderer Mann ungeduldig hin und her und warteten auf die erlösende Nachricht von der Geburt; mein Vater erhoffte sich diesmal also ein Mädchen, der zweite Mann dagegen einen Jungen, denn er hatte schon ein Mädchen zu Hause. Als es dann so weit war und die Schwester die Nachricht verkündete: Buchenaus hätten wieder einen Jungen(!) und der zweite Vater Zwillinge und zwar gleich z w e i Mädchen, da rannte der andere Vater den Gang auf und ab, griff sich mit beiden Händen an den Kopf und jammerte „Aach noch zwaa von dene Weibsleut’ – aach noch zwaa von dene Weibsleut’!“ –