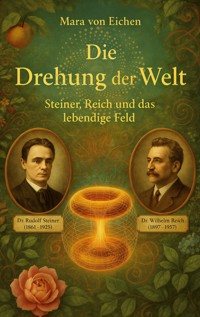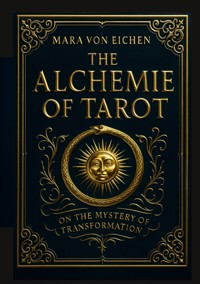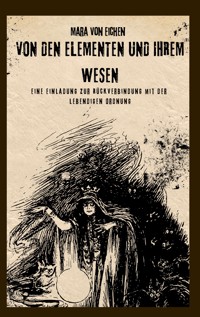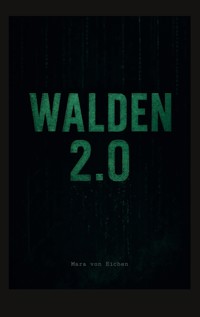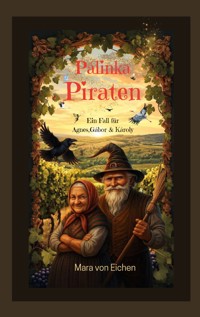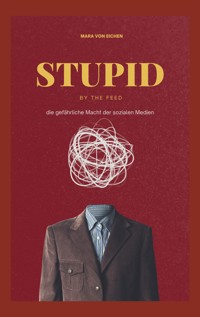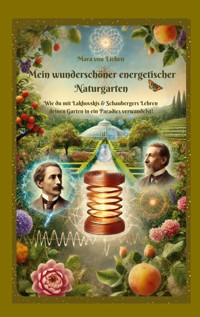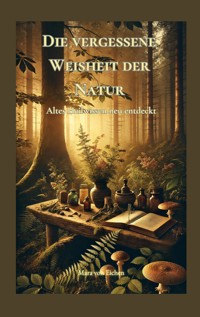Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Schachteln im Fluss“ erzählt die Geschichte der Donauschwaben nicht mit Zahlen, sondern mit Herz. Nicht mit Fakten, sondern mit Gefühl. Im Mittelpunkt steht Lisl, ein junges Mädchen, das gemeinsam mit ihrer Familie aufbricht, um in einem neuen Land ein neues Leben zu beginnen. Mit ihr erleben wir die große Auswanderung, die Hoffnung, die Mühen, das Staunen und die leise Kraft der Gemeinschaft. Die Reise auf der Donau, auf hölzernen Ulmer Schachteln, ist mehr als ein Weg nach Süden. Sie ist ein Symbol für das, was viele durchlebt haben: Abschied, Aufbruch, Ankommen. Verlust und Neubeginn. Dieses Buch ist eine Hommage an die Donauschwaben an ihre Lieder, ihren Zusammenhalt, ihren Mut. Es erzählt, wie aus Fremde Heimat wurde. Und wie Erinnerung lebendig bleibt, wenn sie weitergegeben wird von Herz zu Herz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von derselben Autorin oder demselben Autor
KEINE PANIK! Der ultimative Survival Guide durch das Midlife Universum
KEINE PANIK!Der ultmative Hitzewelle Surf-ival Guide durch das Menopause Universum
KEINE PANIK! Der ultimative Survival Guide durch das Chaos Universum der Pubertät
STUPID by the Feed-die gefährliche Macht der sozialen Medien
Die Kunst sich selbst zu leben-vom Mut den eigenen Weg zu gehen
Psychotricks-Manipulation in Beziehungen und im Alltag erkennen und sich davor schützen
Energievampire unsichtbare Feinde der Seele-wie Du deine Lebensenergie zurückeroberst
Mensch 2.0 wie du mit Technologie in Einklang kommst ,ohne dich selbst zu verlieren
Workflow 2.0-effizienter arbeiten,smarter leben
Das kreative Chaos- wie ADHS dein größtes Talent sein kann
Mein wunderschöner energetischer Naturgarten-wie du mit Lakhovskis und Schaubergers Lehren deinen Garten in ein Paradies verwandelst
Pannonische Perspektiven- Geschichten aus Pannonia
Donaugeschichten-Ein Tag an der Donau vor 500 Jahren
Die vergessene Weisheit der Natur-Altes Heilwissen neu entdeckt
Mara von Eichen
Mara von Eichen lebt mit ihrer Familie in Südungarn und verbindet in ihren Werken Natur,Psychologie,Bewusstsein und kreative Ausdrucksformen. Als Autorin und Künstlerin betrachtet sie die Welt mit besonderer Sensibilität und Tiefgang. Ihre Romane, Geschichten und Sachbücher laden dazu ein, neue Perspektiven zu entdecken und die Verbindung zwischen Mensch und Natur bewusster wahrzunehmen. In der Ruhe der unberührten Landschaft findet sie Inspiration für ihre Arbeiten, die Verstand und Seele gleichermaßen ansprechen.
Für alle, die Heimat nicht als Ort begreifen – sondern als Menschlichkeit.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Bevor es richtig losgeht...
Teil 1 – Die Reise beginnt...
Kapitel 1 – Der Aufbruch
Kapitel 2 – Der zweite Morgen
Kapitel 3 – Die Enge von Weltenburg
Kapitel 4 – Ein Fluss wie ein Versprechen
Kapitel 5 – Der Anfang vom Miteinander
Kapitel 6 – Der Verband wächst
Kapitel 7 – Stimmen auf dem Wasser
Kapitel 8 – Straubing
Kapitel 9 – Wenn’s kracht, kracht’s leise
Kapitel 10 – Vorfreude auf neues Land
Kapitel 11 – Weite Wasser, fremde Länder
Kapitel 12 – Wien in Sicht
Kapitel 13 – Wien
Kapitel 14 – Die Stadt auf dem Thron
Kapitel 15 – Auf dem Weg nach Győr
Kapitel 16 – Strömung, Streit und Sternschnuppen
Kapitel 17 – Das Mädchen mit den roten Haaren
Kapitel 18 – Das goldene Donauknie
Kapitel 19 – Die Hügel von Esztergom
Kapitel 20 – Ein Abend voller Töne
Kapitel 21 – Am Feuer
Kapitel 22 – Die letzte Strecke
Kapitel 23-Geburtstag
Kapitel 24 – Ankunft in Mohács
Teil II – Leben in Ungarn
Kapitel 1 – Das erste Jahr in Ungarn
Kapitel 2 – Der zweite Frühling
Kapitel 3 – Die Hochzeit
Kapitel 4 – Hagel, Hoffnung, Handwerk
Kapitel 5 – Der Besuch aus Véménd
Kapitel 6 – Das Fest der Felder
Teil III – Erinnerungen
Harte Jahre, helle Stunden
Wenn das Herz spricht
Ein neues Band
Der große Schatten
Abschied vom Hof
Epilog – Und nun seid ihr dran
Vorwort
Nach dem Großen Türkenkrieg im 17. Jahrhundert lagen weite Teile des heutigen Südungarn – besonders die Regionen Baranya, Tolna und die Batschka – verwüstet und menschenleer da. Die jahrzehntelangen Kämpfe hatten Dörfer zerstört, Felder verwildern lassen, ganze Landschaften entvölkert. Um dieses Land wieder urbar zu machen, riefen die Habsburger zur Besiedelung auf.
Sie versprachen den Siedlern Ackerland, Steuererleichterungen und Glaubensfreiheit. Besonders im deutschsprachigen Süden des Reiches – in Schwaben, in Hessen, im Elsass, in Bayern – folgten viele diesem Ruf. Zwischen 1722 und 1787 kamen zehntausende Familien in mehreren großen Wellen ins Land. Sie reisten mit wenigen Habseligkeiten, oft auf hölzernen Flößen – den sogenannten Ulmer Schachteln – die Donau hinunter. Ihre Reise dauerte Wochen. Und nicht alle kamen an.
Viele starben unterwegs. Kinder. Alte. An Fieber, an Seuchen, an Erschöpfung. Und selbst wer ankam, fand oft kein vorbereitetes Haus vor, sondern nur Rohbauten, Wildnis oder verlassenes Land. Die ersten Jahre waren geprägt von Rückschlägen, Krankheiten, bitteren Wintern und harter Arbeit. Doch sie blieben. Und sie bauten auf. Mit ihrer Sprache, ihren Liedern, ihrem Glauben und ihrer unerschütterlichen Gemeinschaft.
Sie wurden zu dem, was man heute die Donauschwaben nennt.
Sie waren die ersten Auswanderer, die dem Ruf des Habsburgerreiches folgten und in den südlichen Gebieten an der Donau siedelten. In den Jahren nach der Ansiedlung entwickelten sie sich zu einer eigenen Gemeinschaft, die in der Region tief verwurzelt war. Doch auch das war nicht von Dauer.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Zuge der politischen Umwälzungen und dem Ende des Habsburgerreiches, wurden viele ihrer Nachkommen – vollkommen schuldlos – enteignet, vertrieben oder deportiert. Sie wurden für Verbrechen verantwortlich gemacht, die sie nie begangen hatten. Ihre jahrhundertelange Heimat wurde ihnen genommen. Wieder mussten sie gehen, die Wurzeln, die ihre Vorfahren im Land geschlagen hatten, wurden zerrissen. Und ihre Leistungen – der Fleiß, das Handwerk, die Siedlungsarbeit – gerieten vielfach in Vergessenheit.
Umso wichtiger ist es, ihre Geschichten zu erzählen. Nicht nur die großen, die man in Archiven findet. Sondern die kleinen. Die echten.
Die, die in den Küchen begannen, auf den Feldern gesungen wurden und am Feuer von Generation zu Generation weitergegeben wurden.
Manchmal beginnt eine Reise nicht mit dem ersten Schritt – sondern mit einem Gedanken.
Mit einer Sehnsucht, die leise wächst.
Mit einem Satz, der in einer Küche fällt, während draußen der Wind durchs Gebälk streicht:
„Sie sagen, es gibt Land dort unten. Fruchtbar. Bereit. Und man sucht uns.“
So begann sie, die große Reise der Donauschwaben. Nicht als Abenteuer – sondern als Hoffnung. Nicht aus Übermut – sondern aus Mut.
Sie kamen aus kleinen Dörfern im Süden des Reiches, aus Tälern, in denen die Winter lang und die Felder steinig waren.
Bauern, Handwerker, einfache Menschen – keine Eroberer, keine Entdecker.
Sondern Väter, Mütter, Großeltern, Kinder.
Mit Händen, die arbeiten konnten. Mit Herzen, die tragen wollten.
Sie kamen nicht, um zu nehmen – sie kamen, um Wurzeln zu schlagen.
Und das Land empfing sie.
Nicht immer freundlich. Nicht immer leicht.
Aber es war da.
Verteilt in langen Listen, vergeben von Ämtern, und doch voller Geschichten, bevor ein einziger Spaten die Erde rührte.
Dieses Buch erzählt nicht die Geschichte.
Es erzählt eine.
Und vielleicht spürst du beim Lesen, wie sich aus vielen kleinen Leben ein großes Gewebe spinnt.
Vielleicht erkennst du in den Stimmen der Kinder, im Lachen der Frauen, im Schweigen der Männer etwas von deinen eigenen Wurzeln.
Vielleicht spürst du den Fluss unter den Brettern der Ulmer Schachtel.
Siehst das Licht auf den Wellen.
Hörst das erste Lied, als Ungarn am Horizont auftaucht.
Dies ist ein Buch über das Gehen.
Und über das Ankommen.
Ein Buch über Gemeinschaft, über Abschied und Anfang.
Und über ein Lied, das leise beginnt – aber nie wieder verklingt.
Einleitung
Dieses Buch ist in mir gewachsen – langsam, aber stetig. Seit wir in ein altes Schwabenhaus in der Baranya gezogen sind, gebaut im Jahr 1910, habe ich das Gefühl, als würden die Seelen, die einst darin lebten, mit mir atmen.
Als würden sie flüstern: „Schreib. Erzähl. Vergiss uns nicht.“
Es war kein Plan, kein Vorsatz. Eher ein inneres Drängen. Ein stilles Wissen, dass da etwas ist, das bewahrt werden muss.
Je mehr ich mich hineinfühlte in das, was war – je mehr ich Lisl auf ihrer Reise begleitete – desto tiefer wurde mein eigenes Erleben. Ich habe beim Schreiben oft geweint. Nicht aus Trauer – sondern aus Ergriffenheit. Aus Rührung. Aus einer Seele, die plötzlich ahnte, wie viel mehr sie mitträgt, als sie je vermutet hätte.
Mein Vater war ein Vertriebener aus Schlesien. Seine Geschichten klangen in meiner Kindheit oft wie ferne Trommelschläge – traurig, aber stark. Und je länger ich an diesem Buch arbeitete, desto mehr wurde mir bewusst:
Fast jeder von uns trägt irgendwo in der Familie Spuren von Aufbruch, Verlust, Heimatsuche.
Dieses Buch ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Es ist auch kein Roman im klassischen Sinn. Es ist ein Erinnerungsstück. Eine Verneigung vor jenen, die gegangen sind – und nie ganz angekommen sind. Oder doch. Auf ihre Weise.
Ich habe lange und gründlich recherchiert, mit Respekt, mit Sorgfalt – aber dies ist kein Geschichtsbuch. Es ist eine Erzählung. Ein Erinnerungsgewebe, das sich aus Fakten, Gefühl, überlieferten Stimmen und leisen Lücken zusammensetzt.
Vielleicht wird sich der eine oder andere Leser über ein Detail wundern – ein Ort, ein Datum, ein Umstand. Ich bitte, darüber hinwegzusehen.
Denn die Wahrheit der Geschichte liegt nicht nur in Jahreszahlen. Sondern in dem, was Menschen empfanden, dachten, hofften.
Und genau das wollte ich festhalten.
In Dankbarkeit,
Mara von EichenFrühjahr 2025
Prolog
Prolog
Der Wind ging scharf über die Hügel, als Gábor die Tür der alten Scheune öffnete. Der Geruch von Heu und getrockneten Äpfeln mischte sich mit dem Quietschen der alten Scharniere.
Es war sein fünfzigster Geburtstag – und das ganze Dorf und Freunde von überallher waren gekommen. Die Tische standen im Hof, geschmückt mit Sonnenblumen und alten Spitzen-Decken. Es gab Wein, Pálinka ,Krautstrudel, Kuchen und Musik. Die Nachkommen all jener, die einst gemeinsam auf der Donau gereist waren, saßen nebeneinander, lachten, sangen, erzählten. Eine große Feier – wie es bei uns Donauschwaben Brauch ist.
Doch bevor die Musik begann, noch bevor der erste Becher erhoben wurde, reichte seine Mutter ihm ein Geschenk. Wortlos. Nur mit einem Blick, der mehr sagte als jedes Lied.
Ein Heft.
In Leinen gebunden, der Umschlag verblasst, die Ecken rund und weich von Jahren in Händen, Schubladen, Kisten. Der Geruch von Lavendel stieg ihm in die Nase.
„Von Großmutter Lisl“, sagte seine Mutter leise. Mehr nicht.
Er schlug es auf. Die Tinte war bräunlich geworden, die Schrift ordentlich, altmodisch, voller Schwung. Auf der ersten Seite stand nur ein Name:
Lisl Gerhard, geborene Schmidt
Und darunter, kleiner:
Für die, die nach uns kommen.
Maria, seine jüngste Tochter, kam neugierig näher. Vierzehn war sie geworden, schmal, wild, mit Zöpfen und der Art zu lachen, wie es nur jemand kann, der das Leben noch vor sich sieht.
Sie trug an diesem Tag die alte Schürze, die schon ihre Großmutter zu Festen getragen hatte. Die mit den gestickten Blumenranken und den kleinen Herzen am Saum.
Die Schürze, die Großmutter Lisl selbst einst getragen hatte – und auf der Schachtel, an ihrem vierzehnten Geburtstag, von den anderen Frauen geschenkt bekam. Ein Heiligtum.
Die Schürze war weitergegeben worden, wie das Heft. Von Frau zu Frau. Von Herz zu Herz.
„Was steht drin, Papa?“, fragte Maria.
Gábor setzte sich. Blätterte vorsichtig.
„Ihre Geschichte“, murmelte er. „Die ganze.“
Und dann – begann er zu lesen.
Bevor es richtig losgeht...
Ah jo... jetz’ kommt her, Kinderle. Ganz nah. I red net laut, aber ihr sollt's trotzdem alles versteh. Und was i eich jetz’ verzähl – des steht in koinem Buch. Des kimmt aus’m Herz. Und wenn ihr ganz genau zuhörts... vielleicht spürt ihr's aa.
I bin d’ Lisl. Oder besser g’sagt – i war’s. Damals. A Mädle mit Zöpf und viel zu große Träum. Jetzt bin i alt. Sehr alt. Mei Rücken will nimmer so recht, und d’ Händ zittert, wenn i schreib. Aber mei Herz? Des weiß no alles. Jeden Schritt, jede Trän, jeden Duft von frischem Brot, wenn's aus’m Ofen kimmt und draußen der Winter lang und zäh is.
Ihr habt mei Heft g’fundn, gell? In der alte Truh, unterm Leintuch mit de g’stickte Hirsch. I hab’s versteckt – net weil i’s vergess wollt, na! Sondern weil i wollt, dass ihr’s erst dann lest, wenn euer Herz off’n is.
I hab eich ebbes zu verzähle. Von früher. Von unsrer Reis. Von Ulm bis in d’ Baranya. Von der Donau, die uns trogn hat. Und von allem, was dann kumme is.
Damals war i vierzehn. Und mir sind fort – mit nix als Hoffnung, a paar Truhen und große Aug. Mir hat Angst. Aber mir hat aa uns. Und was mir unterwegs erlebt ham, des hat uns zammg’schweißt – fester wie jeder Balken, den mir später verhaut ham.
I will eich verzähle, wie mir aufbrochn und wie mir a’kumme sind. Wie’s war im erste Johr. Wie mir g’lernt ham, des neue Land zu versteh – und wie’s uns versteht hot. I will eich vom Martin verzähle. Und von der Anna. Und von meim große Bruder, der wie a Bam war: still, stark – und nie richtig weit weg.
Und dann verzähl i eich, wie’s weiterganga is. Mit uns. Mit mir.
Aber oins müsst ihr mir versprech: Dass ihr des, was ihr do liest, net nur mit de Aug liest – sondern mit’m Herz.
Weil Erinnerunge... die leb’n nur, wenn mer se weiterträgt.
Und jetz’ seid ihr dra.
Teil 1 – Die Reise beginnt...
Teil 1 – Die Reise beginnt...
Kapitel 1 – Der Aufbruch
März 1761
Noch war es dunkel, als wir uns am Dorfrand sammelten. Die Luft war feucht und roch nach Erde und altem Rauch. Kein Wind, kein Vogel, kein Laut. Nur das Knarren der Wagenräder auf dem gefrorenen Boden und das leise Fluchen der Männer, wenn ein Rad wieder sperrte, begleitete uns. Es war, als hielte die Welt den Atem an. So wie wir.
Drei Familien waren wir. Alle aus demselben Dorf, demselben Tal, denselben schweren Jahren. Unsere Väter hatten gemeinsam Heu eingebracht, unsere Mütter nebeneinander gewaschen, wir Kinder uns auf denselben Wiesen die Knie aufgeschlagen. Wer einmal zusammen durch einen langen Winter gekommen ist, lässt sich im Frühling nicht mehr los.
Der Weg zum Fluss war vertraut, doch heute war er anders. Jeder Schritt hatte Gewicht. Ich ging zwischen meiner Mutter und meinem älteren Bruder, der den Sack mit Werkzeug trug – dem, was Vater für wichtiger hielt als fast alles andere. Ich trug nur meinen kleinen Weidenkorb. Darin ein Stück Brot, ein Tuch mit zwei Äpfeln, und das alte geschnitzte Kästchen meiner Großmutter. Es roch nach Lavendel und Vergangenheit.
Die Männer gingen voraus, schweigend. Vater trug sein langes Bündel auf der Schulter. Herr Lang hatte seinen jüngsten Sohn an der Hand, Herr Reinhardt schob den Karren mit Vorräten. Ihre Gesichter waren angespannt, aber nicht ängstlich. Eher so, als wollten sie sich nichts anmerken lassen – weder uns noch einander.
Als wir den Fluss erreichten, begann der Nebel sich zu heben. Ein feuchter, fahler Schleier lag noch über dem Wasser, aber die Umrisse der Ulmer Schachtel waren schon zu erkennen. Sie lag ruhig am Ufer, lang gezogen wie ein schlafendes Tier, aus hellem, noch jungem Holz gebaut. Die Männer hatten sie in den vergangenen Wochen selbst hergerichtet, jeden Balken geprüft, jede Kiste geladen, jeden Strick kontrolliert.
In der Mitte der Schachtel stand ein fester Aufbau, kaum höher als ein Mann, mit einer schmalen Tür und kleinen, zu verschließenden Luken. Das war unser Haus für die nächsten Wochen. Kein Dach über der Welt, aber ein Dach über dem Kopf. Drinnen lagen Strohballen, Leinenrollen, Decken, unsere Kisten mit Kleidung und Mehl, Salz, Werkzeugen, Heilkräutern. Alles, was wir mitnehmen konnten, hatte seinen Platz gefunden. Alles, was wir zurückließen, passte in kein Gepäck.
Die Großeltern saßen bereits an Bord – fest eingemummt in ihre wollenen Tücher, die Blicke wach, nicht verklärt. Mein Großvater – ein schmaler, wettergegerbter Mann mit ruhigen Augen – nickte mir nur zu. Er hatte nicht diskutiert, als Vater den Entschluss fasste, zu gehen. Er hatte nur gesagt: „Wenn ihr geht, geh i mit. I hab lang gnua an einem Ort g’sesse.“
Auch die anderen Großeltern waren dabei. Bei Familie Lang saß die alte Ursel auf dem Wagen und hielt ein hölzernes Rosenkranzkreuz in der Hand. Sie murmelte kaum hörbare Gebete. Bei Familie Reinhardt hatte der Großvater sogar beim Bau der Schachtel geholfen, mit zittrigen Händen, aber stur wie immer. Keinen von ihnen hätte man zurückgelassen. Das hätte niemand übers Herz gebracht.
Die Schachtel hatte zwei schwere Steuerbalken – einen vorn, einen hinten. Sie dienten nicht zum Vorwärtskommen, sondern zum Lenken, zum Gegenhalten gegen die Strömung, zum Korrigieren. Ein Mann pro Balken war Pflicht, zwei weitere hielten sich stets bereit, um regelmäßig zu wechseln. Niemand konnte stundenlang am Steuer stehen, ohne auszuruhen. Auch das war geplant, durchdacht, besprochen worden – wie alles.
Vater übernahm das hintere Steuerholz, Herr Lang das vordere. Mein Bruder Jakob sollte später mit Herrn Reinhardt rotieren. Die beiden jüngeren Männer waren kräftig genug, wach genug, jung genug, um sich als Ablösung zu bewähren. Und sie wussten es.
Die Frauen führten uns Kinder an Bord. Wir gingen leise, fast andächtig. Kein Gedrängel, kein Gejammer. Jeder wusste instinktiv, dass heute nicht der Moment für Kindereien war. Ich suchte mir meinen Platz nahe der Tür des Aufbaus, wo ich hinaussehen konnte. Leni, die Tochter von Familie Lang, setzte sich neben mich, ohne etwas zu sagen. Wir hatten früher oft gestritten. Heute nicht.
Dann legte Vater die Hand auf das hintere Steuerholz, sah nach vorn zu Herrn Lang – und gab das Zeichen.
Ein kurzer, tiefer Ton aus seiner Kehle. Kein Wort, kein Ruf. Nur dieser Laut, den wir alle kannten. Wie beim Viehtrieb, beim gemeinsamen Einfahren des Heus – ein Laut, der sagte: „Jetzt.“
Langsam, mit kräftigen Bewegungen, stießen die Männer die Schachtel vom Ufer ab. Der Fluss nahm sie auf, zuerst zögerlich, dann mit wachsender Strömung. Das Wasser gluckste unter dem Kiel, der Nebel öffnete sich vor uns wie ein Vorhang.
Ich wagte einen Blick zurück. Die Uferkante, das vertraute Weidengehölz, die steinerne Bank am Rand der Wiese – alles wurde kleiner, unschärfer, verschwamm. Niemand hatte gewunken. Niemand hatte gerufen. Wir hatten uns in der Nacht verabschiedet – heimlich, still, ohne Zeremonie. So wie es sich gehörte.
Der Aufbau in der Mitte war eng, aber gut organisiert. Die Frauen hatten mit Leinen Vorhänge gespannt, Vorräte in Kisten sortiert, das wenige Geschirr in Körben verkeilt. In einer Eisenschale, sorgfältig mit Lehm ausgekleidet, glomm ein kleines Feuer. Darüber ein Dreibein mit Haken – für den Wasserkessel, für Suppe, für Tee. Der Rauch zog durch einen Spalt im Dach ab, so gut es eben ging. Es roch nach Talg, nach Ruß, nach Heimat.
Die Männer wechselten sich bald ab. Vater rief Jakob nach hinten, Herr Lang gab das vordere Steuer an Thomas ab, den ältesten Sohn seiner Familie. Jeder hatte seine Schicht. Jeder bekam seine Pause. Nur so würde es funktionieren.
Drinnen hockten wir auf den Strohballen, die Knie angezogen, das Kinn auf den Knien. Leni starrte hinaus, sagte nichts. Frieda Reinhardt spielte leise mit einem Holzpferd. Die Großeltern schlummerten, die Mütter bereiteten das erste Brotmahl. Kein Festessen, aber warm, sättigend, vertraut.
Der Fluss war ruhig. Aber er hatte Kraft. Und wir wussten –
sie würde noch gebraucht werden.
Ich sah hinaus auf das Wasser, das uns trug, und wusste nicht, wohin genau wir fahren. Nur dass wir fahren mussten. Und dass wir nicht allein waren.
Kapitel 2 – Der zweite Morgen
Ich wurde vom Schaukeln geweckt. Nicht abrupt, nicht beängstigend – eher wie ein müdes Wiegenlied, das weitersummte, auch nachdem der Gesang verklungen war. Draußen war es noch dämmrig. Der Aufbau lag still, nur unterbrochen vom leisen Rascheln von Stoff und dem gelegentlichen Knacken des Holzes. Irgendwo atmete jemand ruhig. Vielleicht Leni. Vielleicht meine Mutter.