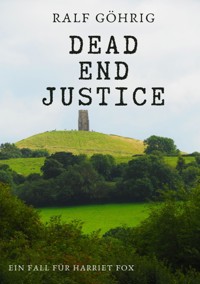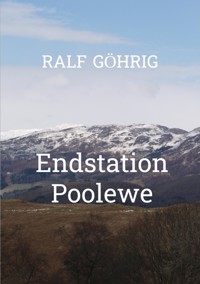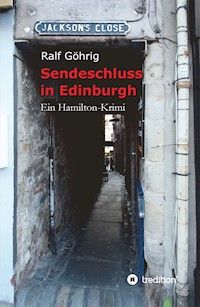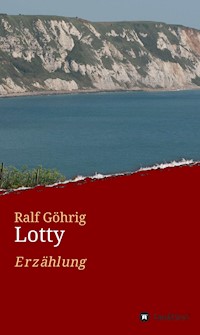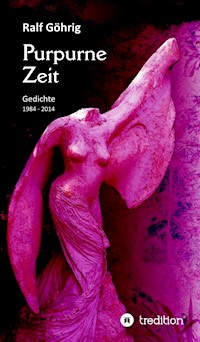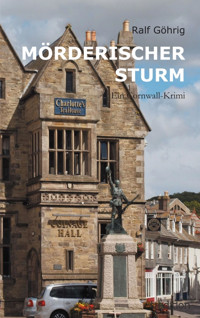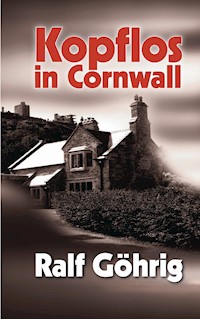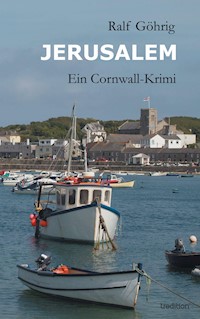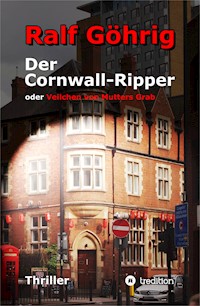9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Naturschutzgebiet Marsland Valley, an der Grenze zwischen Cornwall und Devon, findet ein Landwirt ein ausgebranntes Auto, in dem eine Person mit verbrannt ist. Besteht eine Verbindung zu dem toten Mann, der in Bodmin an einen Baum genagelt war? Und wieso beginnt DCS Hamilton, Leiter der Kriminalpolizei von Devon und Cornwall mit Ermittlungen während seines Urlaubs am Rheinfall?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
www.tredition.de
Foto: B. Danner
Ralf Göhrig
Erneut ermittelt Chief Superintendent Bob Hamilton in Englands Südwesten, einer Landschaft, die der Autor kennt und liebt. Ralf Göhrig, Jahrgang 1967 begann schon früh seine literarischen Ideen zu Papier zu bringen. Die ersten Gedichte und Kurzgeschichten des Kurpfälzers entstanden schon in den frühen 80er Jahren. Doch mit dem Erscheinen seines Bob Hamiltons und dem Entschluss die „Cornwall-Krimis“ zu veröffentlichen, fand Göhrig Leser im gesamten deutschsprachigen Raum. Durch den Erfolg von „Kopflos in Cornwall“ angestoßen, erschienen nacheinander „Mörderischer Sturm“, „Jerusalem“ und jetzt „Schatten folgen dem Licht.
Daneben hat der Autor, als besonders persönliches Projekt, den Gedichtband „Purpurne Zeit veröffentlicht mit Gedichten aus den Jahren 1984 bis 2014.
Ralf Göhrig lebt seit mehr als 20 Jahren in Jestetten am Hochrhein.
Ralf Göhrig
Schatten folgen dem Licht
Ein Cornwall-Krimi
www.tredition.de
1. Auflage September 2014 © 2014 Ralf Göhrig
Satz und Layout: Carla Gromann, Ralf Göhrig Lektorat: Vita Funke
Verlag: tredition GmbH, Hamburg Paperback ISBN: 978-3-8495-9595-1 Hardcover ISBN: 978-3-8495-9596-8 e-Book ISBN: 978-3-8495-9597-5
Inhaltsverzeichnis
Ralf Göhrig,
Ein Cornwall-Krimi
Inhaltsverzeichnis
Die ermittelnden Personen
Prolog
Sonntag, 15. Juni 2014
Montag, 16. Juni 2014
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Dienstag 17. Juni 2014
Kapitel 11
Kapitel 12
Mittwoch, 18. Juni 2014
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Donnerstag; 19. Juni 2014
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Freitag, 20. Juni 2014
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Samstag 21. Juni 2014
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Sonntag, 22. Juni 2014
Kapitel 41
Montag, 23. Juni 2014
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Dienstag, 24. Juni 2014
Kapitel 50
Kapitel 51
Mittwoch, 25. Juni 2014
Kapitel 52
Schlusswort
Die ermittelnden Personen
Detective Chief Superintendent (DCS) Robert Hamilton
Leiter der Kriminalpolizei (Criminal Investigation Department - CID) von Devon und Cornwall
Der gebürtige Schotte ist Fan der Glasgow Rangers, liebt Single Malt Whisky, seine Pfeife, seinen Hund Duke und mischt selbst im Urlaub bei den Ermittlungen mit
Police Chief Inspector (PCI) Rebecca Hamilton
Pressesprecherin der Polizei von Devon und Cornwall
Die Tochter eines anglikanischen Pfarrers und Frau Hamiltons, liebt Musik und kann ihren Mann auch nicht im Urlaub von seinem Ermittlungsdrang abhalten
Detective Superintendent (DSupt.) Steve Parker
Leiter des Abteilung für Schwerverbrechen in Polizeihauptquartier Middlemoor in Exeter
Langjähriger Freund Hamiltons und am liebsten hinter seinem Schreibtisch … oder auf Fortbildungen
Detective Chief Inspector (DCI) Debbie Steer
Leiterin des CID-Ermittlungsteams in Middlemoor
Beste Freundin der Pressesprecherin Rebecca Hamilton
Detective Chief Inspector (DCI) Rachel Ward
Leiterin des CID-Ermittlungsteams in Newquay mit dem Ehrgeiz irgendwann Polizeichefin (Chief Constable) einer englischen Polizeiverwaltung zu werden, wenn nicht gar Commissioner bei Scotland Yard
Detective Inspector (DI) Heather Greenslade
Neu beim CID Middlemoor, sorgt mit ihrer unkonventionellen Art für einige Irritationen
Detective Sergeant (DS) Susan McCoy
Mitglied des Ermittlungsteams und dabei hauptsächlich für die Arbeit mit den elektronischen Fahndungshelfern verantwortlich
Detective Sergeant (DS) Brian Turner
Hochbegabter Polizist mit einem Alkoholproblem, das seine Karriere auf ein Abstellgleis geführt hat
Hamilton hält ihn für den besten Mann in Debbies Truppe – wenn er nüchtern ist
Detective Sergeant (DS) Emma Cohen
Jüngste Ermittlerin im Team war früher bei einer Hundestaffel und bereitet sich augenblicklich auf ihre Mutterrolle vor
Detective Sergeant (DS) Trevor Norman
Dienstältester Ermittler im Team, seine Stärken sind seine physische Präsenz und die guten Verbindungen zur Unter- und Halbwelt
Detective Constabe (DC) Zoe Weston
Nachwuchsermittlerin mit Startschwierigkeiten
Assistant Chief Constable (ACC) Jessica Jones
Leiterin des Ressorts Kriminalität und Strafjustiz, direkte Vorgesetzte Hamiltons
Detective Inspector (DI) Pauline Miller
Leiterin der Spurensicherungsabteilung in Middlemoor
Dr. Greg, eigentlich Grzegorz Brzezinski
Pathologe in Middlemoor, Sohn polnischer Einwanderer dessen Name niemand richtig aussprechen kann
Prolog
Sonntag, 15. Juni 2014
Jäger Stephan Müller legte die Waffe zur Seite und zündete sich eine Zigarette an. Er wusste, der Bock war tödlich getroffen und lag unweit im Wald. Nach rund fünf Minuten stieg er vom Sitz herunter. Er fand eine große Blutlache, doch der Bock war im Wald verschwunden. Eine Aufgabe für den Hund.
Dieser freute sich, endlich aus dem Auto aussteigen zu dürfen, spürte die Aufregung seines Herrn, rannte los und fand nach kurzer Zeit das verendete Tier. Ein stattlicher Sechser. Und während sich Müller an seinem Bock freute, bellte der Hund plötzlich in rund fünfzig Metern Entfernung, direkt am Rheinufer.
„Was zum Teufel ist dort?“, fragte Müller, als ob sein Hund ihm Antwort geben könnte. Als der nicht aufhörte zu bellen, ging Müller langsam in dessen Richtung. Er stolperte über die dichten Brombeeren und kam mit zerrissener Hose bei seinem vierbeinigen Begleiter an. Müller stockte der Atem und er spürte, wie er gegen einen heftigen Schwindel ankämpfen musste. Neben dem Hund lag, die Füße im Wasser, der Leichnam eines Mannes.
Zwanzig Minuten darauf trafen zwei Polizeibeamte, Schmid und Schulze vom örtlichen Polizeirevier, am Parkplatz ein, wo der verstörte Jäger, das Handy noch in der Hand, sie erwartete.
„Wo ist es?“, fragte der eine.
„Da vorne können Sie den Hochsitz sehen. Von dort rund 80 Meter weiter und dann über die Böschung hinunter zum Rhein.“
„Gut.“
Müller ging voraus und die beiden Polizisten folgten ihm durchs Grün des Laubwaldes. Bald hatten die drei Männer die Böschung erreicht und näherten sich dem Rhein.
„Und, wo liegt die Leiche?“, fragte der Beamte ungeduldig.
„Da vorne“, antwortete Müller, trat aus dem Brombeerdickicht heraus und war sich auf einmal gar nicht mehr so sicher.
Vor allem, weil hier keine Leiche lag.
„Es muss hier sein.“
„Kann er weggeschwemmt worden sein?“
„Es war hier. Er lag nur mit den Füßen im Wasser. Wie hätte er weggeschwemmt werden sollen?“
„Vielleicht von einer Flutwelle, die vom Kraftwerk ausgelöst wurde, so wie vor ein paar Jahren.“
„Blödsinn“, antwortete der ranghöhere Polizist. „Das Kraftwerk liegt unterhalb.“
Die drei Männer blickten sich irritiert um und Stephan Müller begann an seinem Verstand zu zweifeln. Der Mann hatte hier gelegen und war tot gewesen. Zumindest noch vor etwa zwanzig Minuten. Aber jetzt war er weg.
Müller und Schulze bahnten sich ein gutes Stück rheinabwärts den Weg und schauten unter jeden Busch. Dann kehrten sie um und trafen Schmid wieder.
„Ich bin bis zur Landesgrenze gegangen, auf dem Fußweg, der vom Hauptwehr zum Rheinfall führt. In diesem Brombeergestrüpp wird er ja wohl nicht liegen“, berichtete der.
„Du bist absolut sicher, dass da ein toter Mann lag?“, fragte Schulze seinen Kumpel vom Turnverein skeptisch.
„Er hat da gelegen!“ Müller zeigte mit ausgestrecktem Arm noch einmal auf das kiesige Stück Ufer.
„Aber es liegt nun mal keiner da. Und ich sehe auch nicht, dass jemand da gelegen haben könnte. Es müssten Schleifspuren zu sehen sein.“
Schulze kniete sich hin und untersuchte den vermeintlichen Fundort. Mit der Nase knapp über dem Kies suchte er den Boden ab und schüttelte dann den Kopf. „Nein, da ist nichts und da war nichts. Es tut mir leid.“
„Aber …“, Müller wusste nicht, was er noch sagen sollte. Er hatte einen toten Mann gesehen und jetzt war nichts mehr da. Müller spürte, wie ihm schwindlig wurde und sank in ein schwarzes, tiefes Loch.
Montag, 16. Juni 2014
Kapitel 1
DCI Debbie Steer schaute aus dem Fenster ihres Büros im Polizeihauptquartier von Devon und Cornwall und sah einer Gruppe übergewichtiger Kollegen beim Fußballspiel zu. „Polizeisport“ nannte sich die Aktion, doch für Debbie sah es eher aus wie eine vom Betriebsarzt verordnete Bewegungstherapie. Dicke und aus der Form geratene Polizisten trabten einem Ball hinterher und Debbie hatte Sorge, den einen oder anderen würde ein Herzinfarkt ereilen. Ästhetisch war das Gekicke sicherlich nicht, doch einen gewissen Unterhaltungswert konnte dem Ganzen nicht abgesprochen werden und außerdem bot es für die leitende Ermittlungsbeamtin eine willkommene Abwechslung vom Einerlei der alltäglichen Schreibtischarbeit. Mangelnde Schnelligkeit wurde mit lautstarkem Schimpfen und derben Flüchen kompensiert. Die Krone der Absurdität jedoch war der dicke Neal O’Connor im Tor. O’Connor, knapp sechzig und kurz vor der Pensionierung, war 1,65 m groß, wog dafür aber gut 120 Kilogramm, was für zwei Männer seiner Größe gereicht hätte. Debbie befürchtete, dass O’Connor tatsächlich einmal nach einem Ball hechten und dann nicht mehr aufzustehen in der Lage sein würde. Doch in diese Verlegenheit kam der Mann vom Betrugsdezernat nicht, denn seine Vorderleute, Trevor Norman und Roger Convery von Debbies eigenem Laden, räumten in Manier der eigentlich längst ausgestorbenen Spezies des Ausputzers alles ab, was in die Nähe von O’Connors Tor kam. Allerdings waren die Stürmer seiner Mannschaft dermaßen ungefährlich, dass auch auf der anderen Seite noch keine Tore gefallen waren. Daher plätscherte das Geschehen unter dem wolkenverhangenen Himmel Exeters vor sich hin und der Ball blieb kaum länger als fünf Spielzüge im Besitz eines Teams. Und so verlor Debbie auch bald das Interesse und wandte sich wieder ihrem Schreibtisch und den Formularen zu.
Manchmal bedauerte sie ihre Berufswahl. Hätte ihr jemand vorher gesagt, dass die Arbeit bei der Kriminalpolizei derart langweilig und eintönig sein konnte, hätte sie sicher eher eine Laufbahn bei den Uniformierten eingeschlagen. Oder sie wäre etwas ganz anderes geworden.
Der vergangene Winter war, aus kriminalistischer Sicht, eher unspektakulär verlaufen, und auch in diesem Frühling schlief das Verbrechen offenbar. Nicht dass der englische Südwesten plötzlich eine Insel der Seligen geworden wäre. Alltägliche Delikte – Betrug, Erpressung, Einbruch und Raub – wurden in schöner Regelmäßigkeit gemeldet und von den Ermittlern meist routinemäßig aufgeklärt. Aber einen Aufsehen erregenden Fall hatte es zuletzt im vergangenen Herbst gegeben. Damals war ein vierzehnjähriges Mädchen entführt, missbraucht und schließlich ermordet worden. Der ganze Landstrich stand noch unter dem Einfluss der Schockwellen, die dieses Verbrechen ausgelöst hatte, und nachdem die Polizei wochenlang im Dunkeln getappt und die zweifelhafte Sternstunde der Boulevardpresse gekommen war, brach eine wahre Hysterie aus. Schulen und Kindergärten mussten geschlossen werden, weil die Eltern ihre Kinder nicht mehr dorthin schickten. Beendet wurde dieser Spuk vergleichsweise unspektakulär. Der Täter verursachte einen Auffahrunfall an einer Kreuzung und bei der Vernehmung machte er einen seltsamen Eindruck auf die Polizeibeamten. Bald verwickelte er sich in Widersprüche und verweigerte die Aussage ganz, was bei der eindeutigen Faktenlage zu dem kleinen Verkehrsunfall mehr als verdächtig war. Also beantragte die Polizei eine Hausdurchsuchung und stieß auf unzählige Zeitungsausschnitte, die Entführung und Ermordung des Mädchens betreffend. Und nach kurzer Zeit hatten die Beamten genügend Beweise zusammengetragen, den Mann für seine Taten verantwortlich zu machen.
Debbie hoffte zwar nicht, dass bald wieder ein Mädchen missbraucht werden würde, aber etwas mehr Abwechslung im Alltag wäre ihr schon entgegengekommen. Besser als ihre momentane Betätigung, in der sie die Aktenberge abarbeiten musste, die Detective Superintendent Parker nicht liebte und daher an sie delegierte. Sie konnte sich nicht einmal beim Chief Super darüber beschweren, denn Bob Hamilton – Chef der Kriminalpolizei und Mann ihrer besten Freundin, der Polizeipressesprecherin Rebecca Hamilton – weilte für zwei Wochen in Europa – Großbritannien gehörte nach ihrer Ansicht und derjenigen der meisten Briten nicht dazu. Irgendwo in den Bergen, wenn sie es recht verstanden hatte. Es half alles nichts, sie musste Parkers Papiere durcharbeiten und hoffte, dass bald Feierabend werden würde.
Debbie schaute auf die alte Kaminuhr aus Marmor – ein Familienerbstück – auf ihrem Schreibtisch. Es war kurz nach drei Uhr am Nachmittag, also musste sie noch etwa eine Stunde durchhalten. Oder sie konnte über den Flur ins Büro zu Susan gehen, um mit ihr zu tratschen. Susan wäre darüber vermutlich nicht unerfreut, da sie an diesem Montag alleine im Büro saß. DS Brian Turner war in einer Kreditkartengeschichte nach Helston aufgebrochen. Und DS Emma Cohens Schwangerschaft war so weit fortgeschritten, dass sie nur noch stundenweise ins Büro kam. In etwa vier Wochen sollte es so weit sein. Und dann würde die Polizei erst einmal ein paar Monate ohne sie auskommen müssen – mindestens. Falls Emma nicht Gefallen an ihrer Mutterrolle finden und weitere Kinder ihrem Job als Polizistin vorziehen würde.
Doch darüber wollte sich Debbie jetzt keine Gedanken machen. Sie fischte einen Keks aus der alten Blechbüchse, goss sich eine weitere Tasse Tee ein und setzte sich wieder an den Schreibtisch, um die unliebsame Arbeit nun endlich hinter sich zu bringen.
Dazu kam es an diesem Tag aber nicht mehr. Gerade als sie genüsslich in den krümelnden Keks gebissen hatte, klingelte das Telefon auf ihrem Schreibtisch. Debbie beschleunigte die Kaubewegungen, schluckte den Keks hinunter und nahm den Hörer ab.
Kapitel 2
Bob Hamilton stand auf der Spitze des Rheinfallfelsens und sah zu, wie das tosende Rheinwasser links und rechts des Felsens nach unten stürzte. Die Gischt hüllte das halbe Becken ein und der Lärm war ohrenbetäubend. Auf einer Informationstafel hatte der Schotte gelesen, dass der größte Wasserfall Europas eine Breite von 150 Metern und eine Höhe von 23 Metern hatte. Das Becken war an der tiefsten Stelle bis zu 13 Metern ausgekolkt. Im Mittel sollten im Sommer rund 700 Kubikmeter pro Sekunde rheinabwärts fließen, doch durch die heftigen Regenfälle der vergangenen Wochen waren es jetzt deutlich größere Wassermengen. Die kleinen Boote, die die Touristen zum Felsen schipperten, hatten große Mühe anzulegen, und nur selten klappte es auf Anhieb. Meist waren zwei oder drei Anläufe notwendig. Mit Vollgas steuerten die Bootsführer ihre Wasserfahrzeuge auf den Landungssteg zu und hofften, nicht abgetrieben werden.
Auch die Fische hatten ihre liebe Mühe. Hamilton beobachtete, wie zahllose Döbel vergeblich versuchten, den Rheinfall zu überwinden. Sie sprangen wohl bis zu gut einem Meter über das Wasser, doch es gelang ihnen natürlich nicht, dieses Hindernis zu bezwingen. In früheren Zeiten, hatte Hamilton gehört, hatte es am Rheinfall unzählige Lachse gegeben, die im Rheinfallbecken ohne Weiteres gefangen werden konnten. Es waren angeblich so viele Lachse gewesen, dass sich die Bevölkerung beim Abt des Klosters Rheinau beschwerte, weil sie nicht immer nur den rotfleischigen Fisch verzehren wollten.
Hamilton konnte dies gut nachvollziehen. Sein Großvater besaß eine Lachsfarm an der schottischen Westküste und immer, wenn er dort zu Besuch war, stand Lachs auf dem Speiseplan. Am Morgen geräuchert, am Mittag gekocht und am Abend gebacken. Bei einer solchen Inflation wird selbst ein Gourmet dieser Delikatesse irgendwann überdrüssig. Im Moment gab es jedoch keine Lachse mehr im Rheinfallbecken, auch wenn größte Anstrengungen unternommen wurden, den Lachs in der Schweiz wieder heimisch zu machen.
Doch das interessierte Hamilton im Moment weniger. Er genoss die Aussicht über das Naturschauspiel und die Landschaft. Das Schloss Laufen thronte auf Zürcher Seite über dem Fluss und das Schlösschen Wörth auf einer kleinen Rheininsel nur wenige Meter über dem Wasserspiegel auf der Schaffhauser Seite. Dort befand sich auch der Steg, von dem die verschiedenen Bootstouren starteten.
Detective Chief Superintendent Bob Hamilton, Chef der Kriminalpolizei von Devon und Cornwall und seine Frau Rebecca, die im Rang eines Police Chief Inspectors den Job der Polizeipressesprecherin versah und Becks genannt wurde, machten eine Woche Urlaub. Zum ersten Mal seit Langem wieder zu zweit, ohne die drei Plagegeister am Bein zu haben. Kinder zu haben ist etwas unglaublich Schönes, bringt Eltern aber bisweilen an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Vor allem, wenn die Kinder Callum, Gillian und Shirley heißen.
Callum war dreieinhalb Jahre alt und durfte in der Zeit, in der seine Eltern in auf dem Kontinent weilten, zu seinen Großeltern nach Schottland, während die zweijährigen Zwillinge bei Becks Schwester, die ihrerseits drei Kinder im Alter zwischen sieben und vierzehn Jahren hatte, geblieben waren. Und Duke, der stattliche Weimaranerrüde, hatte einen Unterschlupf bei Becks Vater gefunden, dem pensionierten Reverend Wynham in Tavistock.
Becks hatte es zwar fast nicht übers Herz gebracht, die Kinder aus ihrer Obhut zu geben. Hamilton konnte sie jedoch überzeugen, dass genügend erfahrenes Betreuungspersonal zur Verfügung stand. Hamilton selbst vermisste den Hund mehr als die Kinder, was freilich daran lag, dass dieser aufs Wort gehorchte und sich in seinen Korb zurückzog, wenn er es geheißen wurde.
Wieso die beiden in der Schweiz gelandet waren, wussten sie eigentlich gar nicht so genau. Vielleicht, weil sie als kleines unabhängiges Land einige Ähnlichkeiten mit Schottland aufwies und Hamilton magisch anzog? Schon in früheren Jahren war der Schotte mehrfach hier gewesen.
„Dort kann ich mich wenigstens mit den Menschen unterhalten“, hatte Hamilton in einer langwierigen Diskussion über die Urlaubsdestination angeführt.
„Wie meinst du das, mein Lieber?“
„Deutsch ist die einzige Fremdsprache, die ich nahezu perfekt beherrsche.“
Becks hatte ihren Mann mit großen Augen angesehen. „Ich wusste es schon immer, du sprichst kein Englisch.“
Tatsächlich war Hamilton nicht ganz einfach zu verstehen, da er ungehemmt in breitestem Glasgower Dialekt redete, obwohl er in einer ländlichen Gegend in Aberdeenshire aufgewachsen war. Seine Mutter jedoch war eine Großstadtpflanze, die Wert darauf legte, dass ihre Kinder Glaswegian beherrschten. Und bei ihrem Sohn Robert hatte sie damit nachhaltigen Erfolg gehabt. Wenn er sich nicht große Mühe gab, konnte ihn niemand außer den Eingeborenen der großen schottischen Stadt verstehen. Und wie um dies zu beweisen, überschüttete er nun seine Frau mit einem Redeschwall, von dem sie kein Wort auch nur annähernd verstehen konnte.
„Immerhin habe ich es geschafft, mich über die Polizei von Manchester bis hin zum Kripochef im Südwesten durchzuschlagen, auch ohne perfektes BBC-English“, fügte er dann in seinem besten Englisch hinzu, das natürlich einen extrem starken Akzent hatte und außerhalb Großbritanniens vermutlich kaum verstanden wurde.
Der Dialekt war eines der Lieblingsstreitthemen des Ehepaares, wenn es nicht gerade um englisch-schottische Auseinandersetzungen oder die Grundzüge der Kindererziehung ging. Becks parlierte in einem astreinen Oxford-English, was sie in ihrer Funktion als Pressesprecherin noch perfektioniert hatte, und war damit das genaue Gegenteil ihres Mannes.
Ohnehin hatten die beiden scheinbar nur wenig gemein. Während Becks künstlerisch orientiert war, Klavier und Orgel neben weiteren Instrumenten spielte und hin und wieder Konzerte gab, wirkte Hamilton wie das Klischee eines Mannes: Fußball, Jagd und Rinderzucht waren die Interessen des Schotten. Letzteres lag jedoch daran, dass er aus einer Familie stammte, die seit Generationen Aberdeen Angus und Galloway züchtete. Er hatte sich inzwischen selbst eine kleine Herde gekauft, die das ganze Jahr durch die kargen Wiesen des Dartmoors stampfte, heranwuchs und schließlich als Roastbeef auf den Esstischen der Familie und ihrer Bekannten endete.
Becks und Hamilton wirkten wie die englische Rose und die schottische Distel, doch wer die beiden kannte, wusste, dass es die perfekte Verbindung war, wenn es denn so etwas gab. Und jetzt hatten sie ihr Urlaubsziel gefunden, ein kleines Land mit viel Natur und genauso viel Kultur. Nur hatten sie feststellen müssen, dass die Schweiz in den letzten Jahren noch teurer und der Service gleichzeitig eher schlechter geworden war.
Deshalb war ihr Plan für diesen Abend, das Dinner nicht in der Schweiz einzunehmen, sondern ins benachbarte Deutschland zu fahren. Becks hatte von einer Freundin den Tipp bekommen, in dem Dorf Lottstetten das Gasthaus „Zum Bahnhof“ zu besuchen. Dort würde zu einem vernünftigen Preis gutes Essen geboten. Außerdem hätte das Lokal den Vorteil, direkt in Bahnhofsnähe zu liegen, und so könnten sie von Schaffhausen aus gut mit dem Zug dorthin kommen und sich auch das eine oder andere Gläschen Wein gönnen.
Kapitel 3
Das Marsland Valley ist ein Naturschutzgebiet rund zwölf Kilometer nördlich der Kleinstadt Bude im äußersten Nordosten Cornwalls und bildet die Grenze zur Grafschaft Devon. Es befindet sich im gemeinsamen Eigentum des Devon Wildlife Trust und seinem cornischen Pendant, die es vom früheren Besitzer Christopher Cadbury geschenkt bekamen, dem ehemaligen Präsidenten der Royal Society for Nature Conservation. Hier zeigt sich die typische, ursprüngliche Vegetation, feuchtliebende Waldgesellschaften mit subtropischem Flair. Zahlreiche Pfade machen es Touristen und Naturfreunden leicht, dieses Kleinod zu erkunden. Ganz im Westen stößt das Marsland Valley auf den South West Coast Path, der oberhalb der Klippen verläuft und die eindrucksvolle Küstenlandschaft erwandern lässt. Rehe verstecken sich im Dickicht des Waldes und seltene Schmetterlinge wie der Braunfleckige Perlmutterfalter flattern durch die lichten Bestände. Das Salz des nahen Atlantiks ist in der Luft zu schmecken und das Lärmen der ewig sich streitenden Möwen zu hören.
Von all diesen Schönheiten der Natur nahmen die Polizisten, die am nördlichen Waldrand vor ihren Fahrzeugen standen, keine Notiz. Sie hatten ein Gebiet von rund einem Hektar mit dem berüchtigten blauweißen Plastikband abgesperrt, sorgten dafür, dass die Presse und Schaulustige nicht zu nahe kamen und warteten auf das Eintreffen der Spurensicherung und der Beamten aus Middlemoor. Hätte das ausgebrannte Auto ein paar hundert Meter weiter südlich gestanden, wären die Kollegen aus Newquay zuständig gewesen. Da sich der mutmaßliche Tatort eines Verbrechens jedoch in Devon und nicht in Cornwall befand, war das eine Angelegenheit für DCI Debbie Steer und ihr Team.
Und dass hier ein Verbrechen geschehen war, stand außer Frage: Im ausgebrannten Wagen befand sich eine Person, deren Hände mit Handschellen an das Lenkrad oder was davon übrig geblieben war, gefesselt waren.
Entdeckt worden war der Wagen von Peter Wilson, einem Landwirt aus Gooseham, etwa einen Kilometer südlich der Grenze gelegen, als dieser am Morgen nach seinen Rindern sehen wollte. Ihm war ein stechender Geruch aufgefallen und nachdem er der Quelle des Gestanks auf den Grund gegangen war, verständigte er die Polizei in Bude. Die wusste nichts Besseres, als sich für nicht zuständig zu erklären, sicherte allerdings zu, die Angelegenheit an die Kollegen aus Devon weiterzuleiten. Dies geschah jedoch erst am frühen Nachmittag.
Um kurz nach zwei Uhr klingelte Wilsons Handy und ein Polizist aus Bideford meldete sich. Danach ging alles sehr schnell, zahlreiche Polizeiautos standen bald im Marsland Valley und die Beamten sicherten den Tatort.
Debbie Steer war in einem halsbrecherischen Tempo gen Westen gefahren und traf nach gut neunzig Minuten Fahrt ein. Zur Unterstützung hatte sie DC Zoe Weston mitgenommen, die ihr im Flur über den Weg gelaufen war und sich sichtlich darüber ärgerte, dass sie nun Überstunden machen musste, anstatt in den Genuss eines frühzeitigen Feierabends zu kommen. Doch Debbie störte sich nicht an der schlechten Laune der jungen Kollegin. Als Chefin war sie gewohnt, unliebsame Entscheidungen zu treffen, und wäre Zoe, die Debbie schon seit deren Kindheit kannte, ein paar Minuten länger in ihrem Büro geblieben, säße sie jetzt sicherlich zu Hause und ein anderer neben Debbie im Auto. Typischer Fall von „zur falschen Zeit am falschen Ort“, dachte Debbie und parkte ihren nagelneuen Ford Kuga, den sie erst seit zwei Wochen fuhr – nachdem sie ihren Insignia zu Schrott gefahren hatte. Allerdings ohne eigenes Verschulden: Ein jugendlicher Rennfahrer hatte ihr auf der A 30 bei Whiddon Down die Vorfahrt genommen.
Offenbar war die Spurensicherung noch nicht eingetroffen, stellte Debbie fest, nahm ihr Handy aus der Jackentasche und wählte die Nummer von DI Pauline Miller, um sich zu erkundigen, wo sie und ihr Team steckten. Der VW-Bus hatte eine Reifenpanne und nun war man gerade dabei, ein Ersatzrad aufzutreiben … es konnte also noch dauern.
In der Zwischenzeit wollte sich Debbie selbst ein Bild von dem ausgebrannten Auto machen und stapfte, die immer noch schlecht gelaunte Zoe im Schlepptau, den Waldweg entlang. Um das Auto hatten die Polizisten bereits einen Sichtschutz errichtet. So sollte verhindert werden, dass die allgegenwärtige Presse und sonstige Neugierige Aufnahmen machen und die Bilder ins Netz stellen konnten. In letzter Zeit war es immer wieder vorgekommen, dass schon Bilder im Internet kursierten und Zeitungen in ihren Onlineausgaben von Straftaten berichteten, noch bevor die Polizei überhaupt Kenntnis davon hatte. Manchmal verwünschte Debbie die modernen Zeiten, in denen nichts mehr sicher und geschützt war. Jedes Telefonat konnte abgehört werden, jedes E-Mail wurde gelesen und wer einigermaßen bekannt war, durfte sich weder in der Öffentlichkeit noch im Freundeskreis eine Unpässlichkeit leisten, ohne Gefahr zu laufen, sich alsbald bei Facebook und Co oder den Titelseiten der berüchtigten Gazetten wiederzufinden.
Das ausgebrannte Auto, es war ein Peugeot gewesen, stand am Ende eines Waldwegs, der dann in einen hangabwärts führenden Pfad mündete. Wenn es in den vergangenen Wochen nicht so ausgiebig geregnet hätte, wäre die Gefahr eines Waldbrandes groß gewesen, dachte Debbie und ging vorsichtig um den Wagen herum. Von dem Mann – wenn es denn einer gewesen war – war nicht mehr viel übrig. Der Leichnam war vollständig verkohlt, der Schädel aufgeplatzt, die Arme abgesprengt und hingen an den Resten des Lenkrades. Debbie spürte, wie sich ihre Eingeweide zusammenzogen. Sie rang nach Luft und war bemüht, das Geschehene nicht zu nahe kommen zu lassen. Die Polizistin schloss die Augen und atmete tief und gleichmäßig und hoffte dabei, dass man ihr den Schock nicht anmerkte. Schließlich war sie die Ermittlungsleiterin.
Für Debbie gab es im Augenblick nicht viel zu tun. Wie das Opfer zu Tode gekommen war, konnte sie nicht feststellen. Sehr viele Brandopfer, das wusste sie aus ihrer langjährigen Erfahrung, waren vorher erschossen, erwürgt oder sonst irgendwie ermordet worden. Bei Verbrechen gingen die Täter selten das Risiko ein, alleine auf das Feuer zu setzen. Meist sollte ein Brand nur zur Vernichtung von Spuren dienen, eine heute jedoch ziemlich aussichtslose Prozedur, da die Forensiker über Methoden verfügten, hinter nahezu alle Geheimnisse eines Verbrechens zu kommen. Allein die fehlenden Finanzmittel waren bisweilen ein Hindernis für die Ermittler.
Debbie wandte sich ihrer Kollegin zu, die jetzt nicht nur schlecht gelaunt, sondern auch noch – verständlicherweise – ziemlich mitgenommen aussah.
„Wenn du kotzen musst, bitte nicht hier“, ermahnte sie die junge Frau, ohne sonderlich viel Empathie zu zeigen.
„Ach, es geht schon“, antwortete Zoe. „Wer tut so was?“
„Das müssen wir herausfinden. Komm mit, wir suchen mal, ob es hier jemanden gibt, der mehr Kompetenzen hat, als kontemplativ aus der Wäsche zu schauen.“
Zoe sah ihre Chefin mit großen Augen an und folgte ihr stumm und missmutig. Bald hatten sie den Leiter des Polizeireviers von Bideford gefunden: PS Ron Alsop, einen kleinen, dürren Polizisten mit einer überdimensionierten Nase im schmalen Gesicht, der den Kriminalpolizisten bereitwillig Auskunft erteilte.
„Guten Tag, Ma’am. So etwas hatten wir schon lange nicht mehr. Eine Leiche in einem ausgebrannten Auto.“ Alsop schüttelte den Kopf. „Heute Morgen erreichte uns ein Anruf von Mr Wilson, der das Auto gefunden hatte. Wir trafen ihn im Dorf und dann führte er uns hierher.“
„Und wo ist der Zeuge, dieser Mr Wilson?“, fragte Debbie nach einer kurzen Pause.
„Zu Hause, denke ich. Wir haben ihn wieder gehen lassen, nachdem er uns den Tatort gezeigt hatte. Was soll er auch hier warten und sich die Füße in den Bauch stehen? Er ist Landwirt und hat im Moment viel zu tun. Landwirte haben eigentlich immer viel zu tun …“
„Den müssen wir uns vornehmen“, unterbrach ihn Debbie, an Zoe gewandt, und drehte sich wieder zu dem redseligen Kollegen: „Und wo wohnt Mr Wilson?“
„In Gooseham, das ist ein kleines Kaff jenseits der Grenze, in Cornwall.“
„Sie wissen schon, dass Cornwall auch zu England gehört, sogar zur gleichen Polizeiverwaltung wie Sie?“
„Ja, ja. Ich meinte nur …“
„Und haben Sie auch eine Adresse?“
„Roseland Farm. Sie finden das schon. Ich habe hier noch die Mobile-Nummer von Wilson.“ Alsop reichte Debbie einen zerknitterten Zettel.
„Dann machen wir uns mal auf den Weg, Zoe.“
In der Zwischenzeit war endlich auch Pauline Miller mit ihrem Team angekommen und nahm den Tatort unter die Lupe. Bis es erste Ergebnisse gab, würde sicherlich noch eine ganze Zeit vergehen und so fuhren Debbie und Zoe nach Gooseham zur Farm von Peter Wilson. Doch so einfach, wie sie es sich vorgestellt hatten, war das Unterfangen nicht, denn es führte keine direkte Straße in den Weiler. Debbie musste zurück zur A 39, dann nach Süden und über schmale Sträßchen wieder in westliche Richtung, um schließlich festzustellen, dass sie sich verfahren hatten. Das Navigationsgerät war auch keine große Hilfe, zeigte es doch an, dass sie sich mitten in einer großen Wiese befanden, was nicht stimmen konnte, denn sie standen am Ende eines Weges bei einer alten, baufälligen Scheune. Debbie wählte Wilsons Nummer und schilderte ihm ihre missliche Lage. Der zeigte sich wenig verwundert, denn offenbar verirrten sich hier in der einsamen Gegend regelmäßig Leute. Der Landwirt dirigierte sie zurück zur Hauptstraße und dank seiner guten Wegbeschreibung saßen die beiden Polizistinnen bald mit Peter Wilson in der Küche des Farmhauses und ließen sich von Wilsons Frau Tee und Scones mit Clotted Cream, der unvermeidlichen Kalorienbombe des Südwestens, bringen. Die Farm machte auf Debbie dagegen einen sehr unenglischen Eindruck. Alles wirkte ordentlich, sauber und organisiert und nicht vom allgegenwärtigen Chaos der britischen Improvisation dominiert. Bestimmt hatte Wilson oder seine Frau deutsche Vorfahren. Dies wäre schließlich keine Schande, denn das englische Königshaus ist durch und durch deutsch, auch wenn der royale Nachwuchs einiges daran setzt, ein paar britische Akzente zu setzen: Sowohl Charles als auch sein Sohn William nahmen eine englische Rose zur Frau.
„Nun schießen Sie mal los, Mr Wilson“, forderte Debbie den Farmer auf.
„Na ja, ich war auf dem Weg zu meinen Rindern drüben in Devon, und dabei bin ich über das Auto gestolpert. Es lag direkt auf meinem Weg, einem schmalen Pfad durch das Tal auf die andere Seite.“
„Und wann war das?“
„Heute Morgen in der Frühe.“
Debbie wirkte irritiert. „Wann in der Frühe?“
„So gegen halb sieben.“
„Und wieso erfahren wir erst am Nachmittag davon?“, fragte sie in Richtung Zoe. Diese hob nur die Schultern.
„Sie haben die Polizei in Bude informiert?“
„Ja.“
Diese Penner! Debbie wurde sauer und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Wie konnte es sein, dass eine solche Nachricht erst Stunden später in Middlemoor ankam? War da tatsächlich eine Grenze zwischen Cornwall und Devon?
„Dann mal weiter, Mr Wilson. Haben Sie jemanden gesehen, als Sie auf dem Weg zu Ihren Rindern waren?“
„Im Dorf sah ich Sarah Tillman, die den Hund ausführte … und Tom.“
„Tom, und wie weiter?“
„Nur Tom. Er lebt draußen im Wald. Ist mal da und mal nicht. Heute Morgen war er da. Saß auf einer Bank am Dorfbrunnen und las in einer alten Zeitung.“
„Wo findet man Tom, wenn er im Dorf ist?“
„Mal hier, mal dort. Schwer zu sagen. Sie finden ihn, wenn er es will. Und wenn er nicht gefunden werden will, ist er nicht zu finden.“
Debbie merkte, dass sie so nicht weiterkam, also wechselte sie das Thema und fragte: „Das Auto muss während der Nacht gebrannt haben. War da nichts zu sehen?“
„Wenn jemand darauf geachtet hätte, wäre sicherlich etwas zu erkennen gewesen. Ich habe nichts gesehen und meine Frau auch nicht. Gooseham ist ein kleines Nest und wenn jemand ein Feuer im Wald bemerkt haben würde, hätte es nicht lange gedauert und das ganze Dorf wäre informiert gewesen.“ Wilson nahm ein Stück Gebäck und biss so herzhaft hinein, dass etliche Krümel auf den Fußboden fielen. „Aber wenn das Auto sehr spät in der Nacht gebrannt hat, es also schon dunkel war, wäre die Flamme kaum zu sehen gewesen. Bei einem brennenden Auto gibt es ohnehin kaum eine Flamme, dafür aber jede Menge schwarzen Rauch. Ich kann Ihnen davon ein Lied singen. Mir sind in den letzten Jahren ein Schlepper und ein Mähdrescher abgebrannt. Das qualmt wie Hölle.“
„Zurück zum heutigen Morgen. Ist Ihnen am Auto irgendetwas aufgefallen?“
„Na ja, es war ausgebrannt. Ich habe mir das Wrack näher angesehen und bemerkt, dass da einer drin saß. Armer Kerl.“
„Wie kommen Sie darauf, dass es ein Mann war?“
„Keine Ahnung. Kann natürlich auch eine Frau gewesen sein. War nicht zu erkennen. Gestern Abend um acht Uhr war dort noch nichts. Ich schaue zwei Mal am Tag nach den Rindern, am Morgen und am Abend. Und gestern habe ich noch nichts gesehen. Das muss also später geschehen sein, vermutlich in der Nacht.“
Zoe machte immer noch ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter, obwohl die Sonne herausgekommen war und ein paar Strahlen auf die südwestenglischen Felder gelegt hatte. Immerhin brachte sie sich jetzt ins Gespräch mit ein und stellte folgende Frage: „Sind außer Ihnen weitere Personen regelmäßig in dem Wäldchen unterwegs?“
„Vermutlich schon, aber ich bin der Einzige, der Felder und Weiden drüben in Devon hat und daher wirklich ständig rüber muss. Aber die Gegend ist die Heimat von einigen Menschen, die sich mehr oder weniger oft durchs Tal bewegen. Und dann sind da die ganzen Naturliebhaber und die Ökofreaks, die den lieben langen Tag im Gebüsch rumschleichen und meinen, sie wüssten mehr über das Leben auf dem Land als die Menschen, die hier seit Generationen beheimatet sind.“ Wilson warf Zoe einen verächtlichen Blick zu, als wäre sie selbst eine der Naturschützerinnen.
„Haben Sie Probleme mit dem Umweltschutz?“, fragte Zoe.
„Ich wüsste nicht, was das in diesem Zusammenhang für eine Rolle spielen sollte. Aber wenn Sie es genau wissen wollen, ja! Diese ganzen Typen gehen mir tierisch auf den Sack – bitte entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise –, aber wenn plötzlich jemand aus dem fernen London hierher zieht und sagt, dass die Art, wie wir hier leben, schlecht für die ganze Menschheit ist, dann steigt mein Blutdruck in bedenkliche Höhen.“
Debbie trank in aller Ruhe einen Schluck Tee und fragte den Landwirt dann: „Können Sie uns Namen von Personen nennen, die sich der Natur verpflichtet fühlen und aus diesem Grund ins Naturschutzgebiet kommen?“
„Es gibt viele Menschen, die oft hier sind. Es ist ja auch wirklich schön da draußen. Drei Gestalten sind aber immer da. Da ist Paul Lloyd, der wohnt im letzten Haus an der Straße. Er ist ein Ökofundamentalist und wenn er mal tot sein sollte, würde es mich nicht wundern. Und dann gibt es dieses junge Pärchen aus Bude, Scott und Holly heißen die. Nachnamen weiß ich nicht, aber die finden Sie leicht heraus, die sind bekannt, und im Zweifel weiß es der zuständige Ranger des Naturschutzzentrums. Der ist hier auch ständig unterwegs und damit beschäftigt, Touristen durch das Tal zu schleifen. Harry Moffat heißt der Mensch und wohnt drüben im Naturschutzzentrum. Mit regulären Naturschutzmenschen wie ihm haben wir hier keine Probleme. Es sind nur die privaten Besserwisser, die noch nie eine Kuh aus der Nähe gesehen haben und mit Sicherheit keine melken könnten. Fragen Sie mal einen dieser Ökofuzzis nach den vier wichtigsten Getreidesorten. Die wissen weder die Namen noch könnten sie sie erkennen. Wenn die ihre Vorstellungen umsetzen würden, würde die Menschheit verhungern.“
Wilson redete sich regelrecht in Rage und Debbie ließ ihn gewähren. Sie wusste, dass viele Kriminalfälle alleine durch gutes Zuhören gelöst wurden und schrieb fleißig mit. Vielleicht war etwas Verwertbares unter den vielen Worten, die Wilson durch seine Küche schleuderte.
Mrs Wilson hingegen war ziemlich wortkarg. Eine hagere Frau, Anfang fünfzig mit grauen Haaren und schlichter Kleidung, wie man sich gemeinhin eine Bäuerin vorstellt. Sie konnte die Aussagen ihres Mannes bestätigen, sagte jedoch kein Wort mehr als notwendig und Debbie spürte, dass es keinen Wert hatte, weiter nachzufragen. Sie wollte die Frau zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal befragen. Und dies ohne dass ihr Mann dabei war. Vielleicht war dann mehr aus ihr herauszubekommen. Jedenfalls war das Ganze für Debbie äußerst spannend. Die Klischees über Dörfer waren wieder einmal mehr als nur Klischees. Es gab jetzt schon mehr Verdächtige und Spuren als in manchen Mordfällen erst nach Wochen. Auch wenn es noch nichts Konkretes war, Debbie fühlte, dass irgendwo in Griffweite der Anfang einer Spur lag. Und diesen Anfang galt es zu finden.
Als Nächstes wollte sie Kontakt mit diesem ominösen Tom aufnehmen, und Zoe sollte sich mit dem Naturschützer Paul Lloyd in Verbindung setzen. Danach würden sie weitersehen.
Kapitel 4
Nachdem Hamilton und Becks vom Rheinfallfelsen zurückgekehrt waren, beschlossen sie, eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen und anschließend um den Rheinfall herum zu wandern. Offensichtlich war der Wettergott heute gnädig gestimmt. Obwohl es stark bewölkt war, hielten die Wolken ihre nasse Fracht zurück. Die Luft war kühl und frisch, zum Wandern optimal.
Über die Eisenbahnbrücke konnte man den Rhein oberhalb des Falls überqueren und hatte einen hervorragenden Blick auf die Szenerie. Ein kurzer, steiler Teerweg führte zum Schloss Laufen, dessen Ursprünge schon im frühen Mittelalter lagen. Ein gläserner Lift brachte die Touristen wieder nach unten zu einem Pfad, der am sogenannten Känzeli endete, einer Plattform direkt unterhalb des Wasserfalls, wo die gesamte Wucht des Wassers und die Kräfte der Natur spürbar waren. Die Liftfahrt, die einen grandiosen Ausblick bot, war für Hamilton ein Grenzerlebnis. Von Höhenangst geplagt wagte er kaum den Blick nach draußen.
„Du wirst ganz grün im Gesicht“, lachte Becks.
Nachdem sie den Rheinfall auch auf der Zürcher Seite inspiziert hatten, liefen sie auf einem schmalen Pfad entlang des Rheins bis zu einer Fußbrücke gegenüber dem Dörfchen Nohl. Diese überquerten sie, und anstatt gleich wieder zurück zum Rheinfallparkplatz zu gehen, beschlossen sie, weiter rheinabwärts zu marschieren. Die Touristenströme verebbten und plötzlich waren anstatt des babylonischen Sprachgewirrs wieder die Stimmen der Natur zu vernehmen. In der Luft lag ein leicht brackiger Geruch, der grün schimmernde Rhein floss jetzt ruhig dahin. Der Weg wurde schmaler und führte leicht hangabwärts. Bald hatten die beiden einen unscheinbaren Grenzstein entdeckt.
„Das ist jetzt wohl die Landesgrenze“, mutmaßte Hamilton und Becks nickte gedankenverloren.
„Ich habe mir eine EU-Außengrenze bislang anders vorgestellt, so mit Schlagbaum und Grenzsoldaten“, meinte er scherzhaft. „Aber im Ernst, das ist hier ein normaler Wanderweg und jeder kann ihn problemlos überwinden. Wenn ich etwas zu schmuggeln hätte, wüsste ich, wo ich die Grenze überqueren würde. Jedenfalls nicht an einem der großen Zollämter an den Straßen.“
„Bestimmt ist es dort sicherer zu schmuggeln als hier. Wer weiß, vielleicht sitzt irgendwo in den Bäumen eine Zollstreife, die nur darauf wartet, verdächtige Individuen festzunehmen“, antwortete Becks.
„Dann pass nur mal auf.“
Der Weg wurde noch schmaler und führte mehr oder weniger direkt am Ufer entlang. Plötzlich wurde Hamilton stutzig.
„Was ist denn da vorne los?“
„Wieso?“
„Siehst du nicht die Polizei?“
Becks starrte angestrengt geradeaus. „Was ist dort wohl los?“
„Keine Ahnung, schauen wir mal.“
Sie gingen weiter rheinabwärts und sahen, dass einige Polizisten den Wald absuchten. Dabei waren zwei Schäferhunde, doch das Ganze machte auf den erfahrenen Ermittler einen ziemlich lustlosen Eindruck. Er wollte sich erkundigen, was gesucht würde, wurde aber sofort von einem der Polizisten zum Weitergehen aufgefordert.
„Die sagen nichts“, stellte er enttäuscht fest.
„Ich male mir gerade aus, wie der Chief Super in Middlemoor explodiert, weil einer seiner Polizisten an einem Tatort irgendeinen dahergelaufenen Typen mit Informationen über einen Mordfall versorgt.“
„Vielleicht hätte ich ja helfen können.“
„Wie denn, indem du mit der Nase am Boden nach Schwarzgeld suchst?“
„Du hast ja recht.“
Der schmale Weg führte weiter am Rhein entlang, mal direkt am Ufer, mal stieg er etwas an und verlief einige Meter höher. Teilweise war er so steil, dass Treppen notwendig waren, die Höhendifferenz zu überwinden. Der Rhein hatte sich etwa dreißig Meter tief eingegraben und beide Uferhänge waren mit Eichen, Hainbuchen und Linden bestockt. Becks entdeckte Spuren vom Biber, der, wie sie in einer Broschüre gelesen hatte, seit zwei Jahrzehnten am Hochrhein wieder heimisch war. Etliche Bäume waren angenagt und ein paar lagen gefällt im Wasser. Irgendwann wurde der Weg wieder breiter und ein Grillplatz tauchte im Grün des Waldes auf. Danach teilte sich der Weg, ein steiler Anstieg führte hangaufwärts und ein schmaler Pfad weiter entlang des Ufers.
„Und jetzt?“, fragte Becks.
„Weiter am Ufer entlang. Irgendwann muss das Hauptwehr des Kraftwerks kommen und dann können wir den Fluss überqueren und wieder zurück gehen.“
„Meinst du nicht, dass das saumäßig weit ist? Wir sind jetzt auf der kürzeren Seite. Die gegenüberliegende Seite ist durch die Kurve, die der Fluss macht, deutlich länger. Da kommen wir ja erst am Abend an.“
„Und wenn wir jetzt irgendwo durch den Wald laufen, erst am morgen früh. Ich habe keine Ahnung, wo der Weg hinführt. Außerdem haben wir Zeit und können nach einem langen Marsch am Abend mit Genuss und ohne schlechtes Gewissen ein gutes Essen zu uns nehmen.“
Sie entschieden sich also für den Pfad entlang des Flusses und bereuten dies irgendwann am späten Nachmittag, als der Weg kein Ende zu nehmen schien. Doch zunächst konnten sie die landschaftlichen Reize des Hochrheins in vollen Zügen genießen. Bald hatten sie das Hauptwehr des Wasserkraftwerks Rheinau erreicht. Eine große Infotafel erregte das Interesse Hamiltons. Das Ausleitungskraftwerk war demnach in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts errichtet worden und erzeugte 36,8 Megawatt Strom. Es nutzt dabei den Höhenunterschied des Wasserspiegels der Doppelrheinschleife bei Altenburg und Rheinau. Das Wasser wird beim Hauptwehr gestaut und durch die Halbinsel Rheinau, wo sich zwei Turbinen in einem Stollen befinden, wieder zurück in den Rhein geleitet.
Über das Hauptwehr führte eine Fußgängerbrücke und eine unscheinbare weiße Linie markierte die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Von der schweizerischen Rheinseite hatten die beiden einen wunderbaren Blick auf die Klosterinsel Rheinau mit dem gleichnamigen Kloster.
„Das ist echt schön hier“, stellte Becks fest und Hamilton war erstaunt darüber, dass in seinen Reiseführern zwar der Rheinfall beschrieben war, das wundervolle Tal des Hochrheins mit seinen landschaftlichen und kulturellen Höhepunkten jedoch nicht. Und so wussten die beiden weder von der alten keltischen Siedlung, die hier auf beiden Seiten des Rheins bestanden hatte, noch vom Römerweg, der durch den sogenannten Jestetter Zipfel führte. Sie hatten auch keinerlei Kenntnis von den alten Burgen des Gebietes. Sie wanderten wieder flussaufwärts und wunderten sich darüber, dass sie scheinbar gar nicht ans Ziel kamen. Bis nach Dachsen zog sich der Pfad endlos dahin. Natürlich konnten sie das kleine Dorf nicht passieren, ohne eine Pause im „Cafe Dachs“ zu machen und die verdiente Tasse Tee zu sich zu nehmen.
Nachdem sie das Dorf hinter sich gelassen hatten, war der große Parkplatz schon zu erkennen. Allerdings befanden sie sich auf der Zürcher Seite des Rheinfalls und mussten auf die Schaffhauser Seite wechseln. Also war ein weiterer Fußmarsch angesagt, am Damwildgehege des Schlosses Laufens vorbei zur Eisenbahnbrücke über den Rhein, weiter auf dem schmalen Teergässchen bis zum Haldenweg und dann über die Rheinfallstraße, wo sie endlich auf dem Parkplatz gegenüber dem Kletterpark müde und hungrig ihr abgestelltes Mietauto erreichten.
Sie fuhren zurück in ihr Hotel nach Schaffhausen, duschten, reservierten einen Tisch im „Bahnhof“ in Lottstetten, hatten genügend Zeit für ausgiebigen und befriedigenden Sex und machten sich dann auf den Weg zum Abendessen.
Während Hamilton sich für die klassische Variante mit Jeans und weißem Hemd entschieden hatte, wählte Becks ein pastellblaues Cocktailkleid, dazu passende blaue Schuhe und hatte ihre schulterlangen, rotblonden Haare, die sie normalerweise offen trug, zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.
Kapitel 5
Tom war leichter zu finden, als Debbie sich das vorgestellt hatte: Er wartete in der Hofeinfahrt von Peter Wilsons Farm. Auf die beiden Polizistinnen machte er einen überraschend gepflegten Eindruck. Sein langes, graues Haar und sein dichter Bart waren weder verfilzt noch irgendwie stumpf oder gar fettig.
Tom trug eine leichte Lodenjacke, passende Hosen und altmodische, aber frisch geputzte Wanderschuhe. In tiefen Höhlen ruhten braune, wachsame Augen.