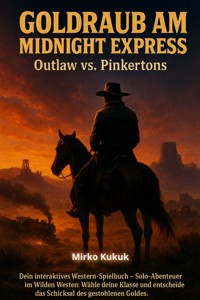Schatten unterm Weihnachtsbaum: Psychothriller für die stille Nacht
24 Kurzgeschichten voller unheimlicher Geheimnisse, übernatürlicher Schrecken und winterlicher Angst
Mirko Kukuk
Impressum © 2025 Mirko Kukuk
Mirko KukukKleinfeld 10221149 HamburgUmschlaggestaltung: © Copyright by Mirko
[email protected] Rechte vorbehaltenHerstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 BerlinKontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
[email protected] Unterstützung bei Text/Bild: ChatGPTDie in diesem Buch dargestellten Figuren und Ereignisse sind fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten realen Personen ist zufällig und nicht vom Autor beabsichtigt.
Inhalt
Titelseite
Impressum
Vorwort
1. Der Wunschzettel
2. Stille Nacht, kalte Angst
3. Die Weihnachtskarte
4. Der Engel im Schnee
5. Unterm Mistelzweig
6. Die letzte Kerze
7. Der verlorene Adventskalender
8. Schneesturm der Erinnerung
9. Der Weihnachtsbaum
10. Das vergessene Geschenk
11. Der Glühwein-Mörder
12. Der Schatten im Kamin
13. Weihnachten ohne Geräusche
14. Das vergessene Fenster
15. Der Schneemann
16. Der letzte Weihnachtsmann
17. Die blinkende Lichterkette
18. Der Heilige Abend-Versager
19. Die Mitternachtsglocke
20. Das leere Wohnzimmer
21. Das Kerzenlicht der Verdammten
22. Die verlassene Puppe
23. Die Gesichter im Schnee
24. Das Rentier ohne Herz
Nachwort
Krimis, Thriller & Horror:
Deutsche Geschichte:
Vorwort
Weihnachten ist die Zeit von Licht, Wärme und festlicher Freude – zumindest an der Oberfläche. Unter dem funkelnden Lametta, zwischen den Kerzen und den Lichtern der Häuser, lauern Geschichten, die niemand gerne erzählt: von dunklen Wünschen, unaufhaltsamen Mächten und Ängsten, die in der stillen Nacht lebendig werden.
In dieser Anthologie habe ich 24 Geschichten zusammengetragen, die Weihnachten aus einer anderen Perspektive zeigen – nicht die glänzende, friedliche, sondern die Schattenseite dieser festlichen Zeit. Jede Geschichte erkundet die Grenze zwischen Realität und Einbildung, zwischen dem, was wir sehen, und dem, was wir fühlen. Manche davon spielen mit der kindlichen Unschuld, manche mit der Schuld, die wir tief in uns vergraben, andere mit den uralten Bräuchen und Ritualen, die längst vergessen scheinen – doch deren Macht niemals vergeht.
Beim Lesen werden Sie feststellen, dass selbst alltägliche Objekte – ein Spielzeug, ein Adventskalender, ein Rentier oder eine Kerze – plötzlich zum Tor in eine Welt werden, in der die Regeln von Raum, Zeit und Leben nicht mehr gelten. Es sind Geschichten über Kontrollverlust, über die subtilen Schrecken des Alltags und über das Grauen, das oft genau dort lauert, wo wir uns am sichersten fühlen.
Wenn Sie diese Seiten aufschlagen, lassen Sie das Licht des Zimmers gedimmt, hören Sie auf den Wind draußen, und achten Sie auf das Flüstern, das zwischen den Zeilen lauert.
Denn in diesen Geschichten ist Weihnachten nicht nur ein Fest der Freude – es ist ein Fest, bei dem die Dunkelheit, still und unaufhaltsam, immer mitschwingt.
1. Der Wunschzettel
Der Schneesturm peitschte gegen die Fenster, rüttelte am alten Rahmen des Hauses, als wollte er einbrechen, und draußen verwandelte der weiße, dichte Schnee die Straßen in ein endloses, klares Nichts. Im Wohnzimmer brannte der Weihnachtsbaum, seine Lichter flackerten in rhythmischen Intervallen und warfen lange Schatten über die abgewetzten Möbel. Ein alter Teppich lag schief, die Polstermöbel hatten Flecken, die schon Generationen alt sein mussten – alles wirkte vertraut und doch irgendwie fremd.
Lukas saß allein am Tisch, zehn Jahre alt, einen Stift in der Hand, das Papier vor ihm wie ein unberührtes Versprechen. Er lehnte sich über das Blatt, die Lippen leicht zusammengepresst, die Stirn in Falten. Seine Finger krallten sich um den Stift, als wäre er das einzige, was ihn von der Welt schützte. Auf dem Papier stand bereits eine einzige Zeile:
„Ich wünsche mir, dass Mama versteht, dass Papa lügt.“
Seine Mutter, die hinter ihm stand und den Wunschzettel überflog, lachte nervös. „Lukas, das ist… ungewöhnlich. Das Christkind kann keine Erwachsenen belehren. Es kann dir Spielzeug bringen, vielleicht ein Fahrrad, aber keine Probleme lösen, die Mama und Papa haben.“
Lukas hob nur den Kopf, die Augen ruhig, beinahe unergründlich. „Doch es kann“, sagte er leise, so als würde er ein Geheimnis teilen, das nur er und das Christkind verstanden.
Seine Mutter zuckte die Schultern und lächelte schwach. Sie konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas in der Art, wie er sie ansah, anders war, merkwürdig. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, aber sie schob ihn beiseite. Schließlich war es nur ein Kind, nur ein Wunschzettel.
Am nächsten Morgen war das Haus stiller als sonst. Zunächst dachte sie, es sei nur die Ruhe des frühen Winters, das Prasseln des Schnees auf das Dach, das die Stille hervorbrachte. Doch dann bemerkte sie den Laptop seines Vaters, offen auf dem Küchentisch. E-Mails blinkten auf dem Bildschirm, Dokumente geöffnet – alles Beweise für eine Affäre, klar und unmissverständlich.
Sie starrte auf den Bildschirm, das Herz raste, die Hände zitterten. „Lukas… hast du das…?“ Sie brach ab, unfähig, das Kind anzuschauen. Lukas saß am Tisch, spielte unbeeindruckt mit seinem Stift und lächelte leicht. Es war ein Lächeln, das keine kindliche Unschuld ausstrahlte – es war das eines Kindes, das genau wusste, welche Macht es hatte.
Die Tage danach wurden merkwürdig. Zuerst war es Kleinigkeiten. Die kleine Schwester, normalerweise laut und lebhaft, verlor plötzlich ihre Stimme, ohne medizinischen Grund. Niemand konnte erklären, warum sie stumm war, und sie schien die Welt um sich herum nur noch mit großen Augen zu beobachten.
Dann passierte es mit dem Nachbarn, Herrn Beck. Er war ein mürrischer Mann, der immer laut schimpfte und kleine Streitereien mit den Kindern suchte. Eines Nachmittags hörten die Eltern Schreie aus dem Garten. Als sie hinausstürmten, fand man Herrn Beck zusammengesunken am Boden, zitternd, unfähig zu sprechen. Ärzte konnten keinen physischen Grund für seinen Zusammenbruch finden.
Immer wieder bemerkten die Eltern, dass nach jedem Wunsch von Lukas Dinge geschahen – nicht sofort, aber genau so, wie er sie niedergeschrieben hatte. Anfangs waren es scheinbar harmlose oder kaum wahrnehmbare Vorfälle. Doch das Muster wurde bald beunruhigend klar: Alles, was Lukas wünschte, wurde Realität.
Am Heiligen Abend fand die Mutter den neuesten Zettel unter dem Christbaum. Ihre Hände zitterten, als sie ihn aufhob. Darauf stand nur ein Satz:
„Ich wünsche mir, dass Papa für immer verschwindet.“
Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Sie rannte ins Schlafzimmer, in dem ihr Mann normalerweise schlief – doch das Bett war leer. Kein Zeichen, kein Hinweis, keine Spur von ihm. Ein leises Lachen hallte durch den Flur, kindlich und doch unheimlich, und Lukas saß am Tisch, sein Gesicht im flackernden Licht des Weihnachtsbaumes erleuchtet, während er leise weiterschrieb.
„Mal sehen, was das Christkind morgen bringt.“
Die Mutter fühlte sich wie in einem Alptraum gefangen. Sie wollte schreien, jemanden rufen, den Polizisten anrufen – doch der Schnee draußen hatte die Straßen verschluckt, und sie selbst konnte sich keinen klaren Gedanken fassen. Überall im Haus lag eine merkwürdige Stille, schwer und drückend, nur unterbrochen vom gelegentlichen Kichern des Jungen.
Sie versuchte, Lukas von dem Papier wegzunehmen, doch er hielt es wie ein Schutzschild zwischen sich und ihr. „Es ist nur ein Wunschzettel“, sagte sie, die Stimme brüchig. „Lukas, du verstehst doch, dass man damit keine Menschen verschwinden lassen kann!“
Er hob den Kopf, die Augen dunkel und tief, fast wie zwei Fenster in eine andere Welt. „Doch, Mama“, flüsterte er, „manchmal macht das Christkind, was man wirklich will.“
Die Mutter starrte ihn an. Etwas in seiner Haltung, in seinem Ausdruck, ließ ihr Blut in den Adern gefrieren. Es war nicht nur kindliche Hartnäckigkeit – es war Absicht. Kalkuliert, präzise, unfehlbar.
Die Stunden vergingen quälend langsam. Die Mutter saß auf dem Boden, starrte auf Lukas, der weiterschrieb. Draußen fiel der Schnee unaufhörlich, wie eine trügerische Decke, die alles verschluckte. Das Haus war still, aber es war eine Stille voller Erwartung, als wartete alles darauf, dass etwas Unerbittliches geschehen würde.
Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages bemerkte sie eine Veränderung in der Luft: eine eigenartige Kälte, die nicht nur von draußen kam. Der Vater war immer noch verschwunden. Kein Anruf, keine Nachricht, keine Spur. Nur Lukas saß am Tisch, das neue Blatt Papier vor sich, und kritzelte ruhig weiter.
Die Mutter wagte einen zitternden Blick auf das Papier. Darauf stand nur eine weitere Zeile:
„Mal sehen, was das Christkind morgen bringt.“
Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Sie sank auf die Knie, ihre Hände zitterten, während das Gewicht der Erkenntnis sie zu erdrücken schien. Dies war kein Zufall. Kein kindlicher Scherz. Lukas’ Wünsche waren zu Gesetzen geworden – brutale, unaufhaltsame Gesetze, die schon begonnen hatten, die Welt der Erwachsenen nach seinem Willen zu formen.
Draußen rieselte der Schnee weiter, lautlos, als würde er die Welt verschlucken. Die Stille war drückend, endlos, und sie wusste, dass sie ihr nicht entkommen konnte. Jeder Atemzug fühlte sich wie ein Eindringen in diese dunkle Ordnung an, die ein kleines Kind erschaffen hatte. Lukas saß am Tisch, seine kleinen Finger umschlossen den Stift, und in seinen Augen lag die Macht eines unsichtbaren Gesetzes: Alles, was er wünschte, würde eintreten.
Das flackernde Licht des Weihnachtsbaumes warf lange Schatten an die Wände, die sich zu bewegen schienen, als lauschten sie den Gedanken des Jungen. Ein leises Kichern begleitete seine Worte, ein Lächeln, das keine Unschuld mehr kannte, nur Kontrolle und Vorfreude.
„Mal sehen, was das Christkind morgen bringt.“
Die Nacht senkte sich wie ein schwarzer Schleier über das Haus. Der Schnee dämpfte jede Bewegung, jedes Geräusch der Außenwelt. Die Mutter presste die Hände auf das Gesicht, spürte die Kälte in ihren Knochen. Und in diesem Moment wusste sie: Die Macht dieses kleinen Jungen war grenzenlos. Was auch immer sie taten, es würde geschehen, weil es sein Wille war – unaufhaltsam, unbarmherzig, unausweichlich.
Die Stille herrschte nun endgültig. Doch in ihr pulsierte eine Gefahr, lebendig, lauernd, bereit, alles zu verschlingen. Und während Lukas weiter schrieb, überkam sie die furchtbare Gewissheit: Dieses Weihnachten würde nie mehr so sein wie zuvor.
2. Stille Nacht, kalte Angst
Der Wind heulte durch die kahlen Bäume, die den einsamen Weg zum Hotel säumten, und trieb den Schnee gegen die Fenster wie scharfkantige Nadeln. Anna zog den Mantel enger um sich, während sie die schwere Holztür des Hotels aufstieß. Die Eingangshalle war still. Kein Feuer prasselte im Kamin, kein Telefon klingelte, kein Mensch war zu sehen. Nur der Geruch von altem Holz und Putz lag in der Luft, und das schwache Echo ihrer eigenen Schritte hallte durch den Raum.
Sie hatte das Hotel gebucht, um Weihnachten allein zu verbringen. Einsamkeit, dachte sie, ein bisschen Ruhe, ein bisschen Abstand vom Chaos ihres Lebens. Die Welt draußen war von einer dichten Schneeschicht bedeckt, alles war still und weiß. Doch sobald sie die Lobby hinter sich ließ, spürte sie eine seltsame Kälte, die nicht nur von den Temperaturen herrührte. Es war, als würde die Stille selbst sie beobachten.
Anna nahm den Schlüssel für Zimmer 312 entgegen, das sich auf dem dritten Stockwerk befand. Der Flur war lang, schmal und spärlich beleuchtet. Die Tapeten waren alt, die Muster verblasst, und jede Ecke schien einen Schatten zu bergen, der sich bewegte, wenn sie den Kopf drehte.
Kaum hatte sie die Tür zu ihrem Zimmer geöffnet, spürte sie die Unruhe. Das Zimmer war einfach möbliert: ein Bett, ein kleiner Tisch, ein Stuhl, ein Schrank. Auf den ersten Blick wirkte alles normal, doch die Atmosphäre war schwer, beinahe drückend. Sie schloss die Tür, schaltete das Licht an und versuchte, sich zu beruhigen.
Die erste Nacht war ruhig, fast zu ruhig. Doch irgendwann erwachte sie durch leises Knarren – Schritte, die sich durch den Flur bewegten. Anna hielt den Atem an, lauschte. Die Schritte verhallten, doch das Geräusch schien sich genau hinter ihr zu bewegen. Sie drehte sich um – nichts. Nur der Schatten des Kleiderschranks.
Am Morgen bemerkte sie, dass einige Gegenstände aus ihrem Zimmer verschwunden waren. Ihr Buch lag nicht auf dem Nachttisch, sondern auf dem Schreibtisch, genau in einer Ecke, an die sie sich nicht erinnert hatte, es gestellt zu haben. Die Kaffeetasse stand plötzlich auf dem Fensterbrett. Sie schüttelte den Kopf. „Ich habe mich bestimmt nur vertan“, murmelte sie.
Doch in den folgenden Nächten wiederholte sich das Muster. Anna hörte Schritte, Türen knarrten, obwohl niemand zu sehen war. Spiegel zeigten nicht ihr Spiegelbild, sondern verzerrte, fremde Gestalten. Eines Nachts stand sie vor dem Badezimmerspiegel und sah nicht sich selbst, sondern eine dunkle Frauengestalt, die in alle Richtungen zu starren schien, ihr Gesicht ein verzerrtes Echo von Angst und Schmerz. Sie schrie, aber ihr eigener Schrei hallte nur wie ein Echo zurück, als hätte das Zimmer alles verschluckt.
Am dritten Tag wagte Anna sich tiefer ins Hotel. Die Gänge waren unendlich, jeder Flur schien sich zu wiederholen, Türen führten ins Leere. Schließlich entdeckte sie eine Tür, die ihr vorher nie aufgefallen war. Sie war klein, unscheinbar, fast wie ein Wartungseingang. Die Klinke war kalt und fest in ihrer Hand. Als sie die Tür öffnete, schlug ihr ein muffiger Geruch entgegen. Dahinter war ein Raum, der aussah wie ein Archiv, vollgestopft mit Ordnern, Stapeln von Papier und Kisten.
Auf dem ersten Tisch lagen Fotografien. Anna erkannte sofort die Szenen: es waren Bilder von ihr – wie sie die Treppe hochstieg, das Frühstück zubereitete, den Schnee draußen beobachtete. Ihre eigenen Augen starrten aus den Fotos, wie eingefroren in Momenten, die sie kaum noch bewusst erinnert hatte. Daneben lagen Tagebuchseiten – sorgfältig abgeschrieben, teilweise mit kleinen Anmerkungen am Rand: „Sie dachte, sie sei allein. Sie lacht leise. Bald wird sie verstehen.“
Anna schauderte. Jeder Gegenstand, jede Bewegung, jedes Lächeln war dokumentiert. Ihr eigenes Gesicht war auf jedem Papier, gezeichnet, fast skizzenhaft, aber erschreckend lebendig. Es war, als hätte jemand ihr Leben minutiös verfolgt, jede Handlung beobachtet und aufgeschrieben.
Plötzlich hörte sie Schritte. Diesmal näher, deutlicher, aber sie waren zu präzise, zu bewusst, als würde sie selbst die Schritte machen. Panik ergriff sie, als sie sich umsah: Die Tür war verschwunden. Die Wände verschoben sich wie Schatten, die sich bewegten. Das Licht flackerte. Sie wollte schreien, rannte, stolperte über Papierstapel, doch alles führte sie zurück in den Raum.
In der Ecke des Raumes stand ein großer Spiegel. Zuerst dachte Anna, es sei ein gewöhnlicher Spiegel, doch als sie hineinsah, erkannte sie die Wahrheit. Hinter ihr stand jemand – oder besser gesagt, etwas – das genau wie sie aussah. Ihr eigenes Gesicht, ihre eigenen Züge, aber mit dunkleren Augen, ohne Bewegung, ohne Leben.
„Wer bist du?“ flüsterte Anna.
Keine Antwort. Nur ein Kichern, das ihr aus der Kehle zu kommen schien, obwohl sie wusste, dass sie selbst zitterte. Der Schatten ihres Selbst bewegte sich langsam, unnatürlich, als wollte es ihr etwas zeigen. Anna wich zurück, stolperte, fiel.
Der Spiegel verzerrte sich, und sie sah Szenen aus ihrem eigenen Leben, aber verzerrt, grausam. Szenen, die niemals passiert waren – oder noch passieren würden. Ein Mann, der sie verfolgt, Türen, die sich schlossen, Stimmen, die sie riefen, während sie stumm war. Die Schatten bewegten sich außerhalb der Reflexion, aber gleichzeitig darin.
„Es ist immer nur ich…“, flüsterte sie, die Stimme brüchig. „Es war immer nur ich…“
Der Schatten bewegte sich näher. Anna erkannte, dass dieses Wesen, diese Präsenz, ihr eigenes Selbst war – eine Version von ihr, die nicht verschwinden wollte. Nicht, solange sie noch existierte. Nicht, solange sie noch lebte.
Sie sprang zurück, stolperte gegen die Wand, die wieder fest war, keine Tür mehr zu sehen. Panik schnürte ihre Kehle zu. Sie wollte rufen, wollte jemanden alarmieren, aber die Worte versiegten in der eisigen Luft. Die Kälte drang in ihre Knochen, der Schnee draußen schien jetzt wie ein unsichtbares Wesen, das alles beobachten konnte.
Dann hörte sie ein leises Rascheln. Die Papierstapel auf dem Boden begannen sich zu bewegen, als würden unsichtbare Hände sie sortieren, neu anordnen. Die Fotografien der jüngeren Versionen von ihr selbst begannen sich zu verändern, die Augen blickten direkt in die ihren, die Züge verzerrten sich zu einem stummen Schrei.
Anna taumelte zurück, der Herzschlag raste wie ein Trommelwirbel in ihrer Brust. Vor ihr spiegelte sich die grausame Realität: Sie war nicht allein. Nie allein gewesen. Das Hotel, die leeren Flure, die Schritte – alles nur ein dünner Vorhang, der die Existenz dieser dunklen Version von ihr selbst verdeckte. Ein Schatten, der in ihr lebte, der jede ihrer Bewegungen, jeden Gedanken kannte – und nun entschlossen war, seine eigene Version von Realität zu beanspruchen.
Der Wind heulte draußen, der Schnee fiel dichter, als wolle die Welt selbst sie verschlingen. Anna spürte die Präsenz hinter sich – ein kalter, unsichtbarer Griff, der sich langsam, unerbittlich um ihre Seele schloss. Sie rannte, doch die Türen führten ins Leere, die Flure wiederholten sich endlos wie in einem Alptraum, der keine Grenze kannte. Jede Ecke, jede Reflexion in den Spiegeln verstärkte nur das Gefühl, dass sie gejagt wurde – von sich selbst.
Schließlich blieb sie wieder vor dem Spiegel stehen. Die Augen weit aufgerissen, die Hände zitternd. Der Schatten lächelte. Ein Lächeln, das ihr selbst gehörte, und doch fremd war. Ein Lächeln, das ihre Angst wie ein Spielzeug hielt, das jederzeit zerbrochen oder verdreht werden konnte.