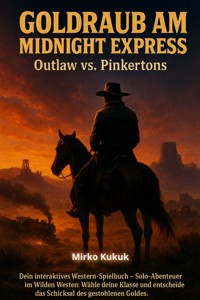Schatten zwischen Zeit und Spiegeln: Horror Kurzgeschichten & Psychothriller Kurzgeschichten
Übernatürliche Erzählungen: Albtraumhafte Geschichten und Geistergeschichten
Mirko Kukuk
Impressum © 2025 Mirko Kukuk
Mirko KukukKleinfeld 10221149 HamburgUmschlaggestaltung: © Copyright by Mirko
[email protected] Rechte vorbehaltenDie in diesem Buch dargestellten Figuren und Ereignisse sind fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten realen Personen ist zufällig und nicht vom Autor beabsichtigt.KI Unterstützung bei Text/Bild: ChatGPT
Inhalt
Titelseite
Impressum
Einleitung:
1. Die Straße, die verschwand
2. Das Zimmer ohne Tür
3. Der verschwundene Zug
4. Der Spiegel im Keller
5. Die Stimmen im Nebel
6. Die Schatten der Bibliothek
7. Die Uhr des Vergessens
8. Die Stadt der Vergessenen Stimmen
9. Das Spiegelhaus
10. Der letzte Zug
11. Das Uhrwerk des Grauens
12. Das Spiegellabyrinth
13. Die Schattenbibliothek
14. Das Spiegelhaus am See
15. Die Uhrmacher-Villa
Nachwort:
Danksagung Autor:
Weitere Krimis/Thriller:
Einleitung:
Schatten zwischen Zeit und Spiegeln
Manche Orte existieren nicht einfach. Sie lauern, beobachten und ernähren sich von der Angst derer, die sie betreten. Ein altes Haus, eine vergessene Villa, eine leere Schule – sie alle sind nichts als Kulissen für etwas Dunkles, das wartet. An solchen Orten verzerren Schatten die Realität, biegen Uhren die Zeit und zerbrechen Spiegel das, was wir für wahr halten.
In den Geschichten, die folgen, triffst du auf Menschen wie Fiete, Michael, Jacek, Milan, Albert, Fabian, Max und Levin. Sie betreten diese scheinbar gewöhnlichen Orte, aber bald erkennen sie, dass die Regeln hier anders sind. Plötzlich zeigen Spiegel nicht nur ihre Reflexion, sondern fremde Versionen ihrer selbst. Uhren manipulieren nicht nur die Stunden, sondern formen Erinnerungen. Die Vergangenheit verfolgt die Gegenwart, Albträume greifen nach der Wirklichkeit.
Jede Geschichte ist ein tieferer Schritt in die dunkle Ungewissheit, ein Test für Mut, Neugier und Verstand. Die Protagonisten versuchen zu entkommen, doch oft bleibt ein Teil von ihnen zurück – gefangen in einem Spiegel, einem Schatten oder der Zeit selbst. Sie werden zu Zeugen einer Welt, in der die Grenzen zwischen Leben und Albtraum verschwimmen.
Diese Geschichten sind mehr als nur Erzählungen über verlassene Orte. Sie sind Spiegel deiner eigenen Neugier und Angst, Mahnungen, dass manche Geheimnisse besser unentdeckt bleiben. Und doch locken sie, die tickenden Uhren und die flüsternden Stimmen. Weil jeder von uns wissen will, was jenseits der Wirklichkeit lauert.
Tritt ein in diese Welten, beobachte genau und hinterfrage alles. Aber vergiss nicht, deine eigenen Schatten im Auge zu behalten. Denn wer zu neugierig ist, könnte selbst zu einem Teil der Geschichte werden.
1. Die Straße, die verschwand
Kapitel 1: Der Nebel
Paul Faber war ein Mann der Gewohnheit. Jeden Morgen fuhr er in seinem alten Wagen die Oakwood Road zur kleinen Bibliothek von Millersville. Er mochte die Verlässlichkeit seiner Routine, das sanfte Klirren der Kaffeetassen, das vertraute Rattern des Motors, das Rascheln der Blätter im Wind. Alles war berechenbar. Bis zu diesem Montag.
Schon als Paul sein Haus verließ, spürte er, dass die Luft anders war. Ein dichter Nebel lag über der Stadt, so schwarz und schwer, dass er die Straßenlaternen verschluckte. Es war nicht einfach nur Nebel. Er kroch wie eine lebendige, kalte Hand die Straße hinunter, umhüllte die vertrauten Umrisse der Häuser und dämpfte jedes Geräusch, als hätte die Stadt selbst den Atem angehalten. Paul fröstelte. Etwas in ihm flüsterte, dass dies nicht einfach nur Wetter war.
Er stieg in seinen Wagen, und für einen Moment beruhigte ihn das vertraute Rattern des Motors. Doch als er die Oakwood Road erreichte, sah er es: Die Straße schien sich zu winden. Die weißen Linien auf dem Asphalt flossen wie geschmolzene Kreide, zogen sich zurück und krümmten sich, als hätten sie ein eigenes, widerwilliges Leben. Pauls Herz hämmerte, und er griff instinktiv nach der Bremse. Der Wagen glitt weiter, langsam, aber unerbittlich, als hätte die Straße ihn in Besitz genommen.
Plötzlich hörte er es: ein Ticken, rhythmisch und unnatürlich laut. Es schien aus dem Armaturenbrett zu kommen, ein Geräusch, das er noch nie zuvor gehört hatte. Und dann kam das Flüstern. Leise, kaum hörbar. „Komm nach Hause… komm nach Hause…“ Es war kein Wind. Die Stimme hatte Gewicht, war direkt und kam von überall und nirgendwo gleichzeitig. Pauls Hände umklammerten das Lenkrad so fest, dass seine Knöchel weiß wurden. Panik stieg in ihm auf, doch er konnte nicht anhalten, nicht entkommen.
Dann sah er die Gestalt. Schwarz und gesichtslos stand sie mitten auf der Straße. Regungslos, still, doch Paul wusste, dass sie ihn sah. Sein Herz setzte einen Schlag aus. Er wollte schreien, wollte zurückfahren, aber kein Laut kam über seine Lippen. Das Blut in seinen Adern schien plötzlich zäh zu werden. Die Luft war schwer, fast greifbar. Und dann bemerkte er, dass auch in den Fenstern der vernebelten Häuser entlang der Straße dunkle Silhouetten standen, die ihn anstarrten.
Die Gestalt hob die Hand, und plötzlich hörte Paul Stimmen. Nicht nur das Flüstern, sondern einen Chor aus Panik und Beklemmung. Er hörte Stimmen von Nachbarn, Kollegen, Kindern – sie alle riefen seinen Namen, schrien aus den Schatten, aus den Bäumen, aus dem Nebel. Die Schreie wurden lauter und schriller, bis Paul die Hände auf die Ohren presste, unfähig zu reagieren. Er sank auf die Knie und schloss die Augen so fest er konnte. Er betete, dass dies nur ein Albtraum sei.
Als er sie wieder öffnete, war die Straße normal. Alles wirkte unverändert – die Häuser standen, die Straßenlinien waren klar, die Bäume regungslos. Doch die Stadt war still. Unnatürlich still. Keine Kinder, keine Autos, keine Vögel. Millersville wirkte ausgestorben.
Paul fuhr nach Hause. Jeder vertraute Anblick, jede vertraute Ecke wirkte jetzt fremd. Als er die Veranda seines Hauses erreichte, sah er es. Im Fenster, das auf seinen Sessel zeigte, stand eine Silhouette. Schwarz, regungslos, unbeweglich. Paul erstarrte. Es war seine eigene Silhouette, aber sie stand verkehrt herum, und in ihrer Hand hielt sie etwas, das einer alten Uhr ähnelte.
Paul spürte einen kalten Schauer, der ihm den Rücken hinablief. Die Straße war nie verschwunden. Sie hatte nur auf ihn gewartet. Und sie würde nicht aufhören zu rufen. Er saß eine lange Zeit auf der Veranda, starrte auf die Nebelschwaden, die die Straßen verschlangen, und fragte sich, ob er noch der Letzte war, der in Millersville bewusst atmete. Er konnte nur noch warten. Und lauschen.
Kapitel 2: Die Nachrichten
Der nächste Morgen brachte keine Erleichterung. Paul wachte mit einem drückenden Gefühl auf, das sich wie Blei auf seine Brust legte. Das Haus war still, unnatürlich still. Sogar das vertraute Rattern der Autos auf der Straße draußen war verschwunden. Paul griff nach seinem Telefon – und erstarrte. Auf dem Display blinkte nur ein einziges, unmissverständliches Wort: BLEIB WEG.
Es war kein Streich. Es gab keine Nummer, keine Absenderkennung. Die Buchstaben waren groß, perfekt und leuchteten mit einem unheimlichen Schein, als hätten sie sich in das Glas gebrannt. Pauls Hände zitterten, und er ließ das Telefon fallen. Es klirrte auf dem Boden, aber das Wort blieb. Es flackerte und pulsierte auf dem Bildschirm, bis Paul die Augen schloss. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken, und sein Herz begann schneller zu schlagen.
Auf dem Weg zur Bibliothek sah er es. Auf dem Bürgersteig, groß und perfekt geschrieben, prangte ein neuer Satz in Kreide: DIE STRASSE WARTET. Paul blieb abrupt stehen. Wer konnte so etwas schreiben? Die Linien waren so akkurat, jede Buchstabenform identisch, als hätte jemand ein Lineal benutzt. Pauls Gedanken rasten. Wer wusste, wo er jeden Morgen war? Das war nicht nur eine Drohung. Es war eine Kenntnis seiner Routine. Ein eiskaltes Gefühl der Verfolgung klammerte sich an seine Wirbelsäule.
Er stieg zurück in den Wagen und fuhr weiter, die Knöchel weiß vor Anspannung. In der Bibliothek angekommen, stapelten sich die Bücher auf seinem Tisch. Paul schlug eines auf – und erstarrte erneut. Sein Name prangte auf dem Cover, darunter der Titel: Ein Mann der Gewohnheit. Die Geschichte erzählte von einem Mann, der von einer lebendigen Straße verfolgt wurde, die Menschen verschlang und in Nebel und Schatten zerriss. Jeder Satz schien speziell für ihn geschrieben zu sein, als hätte jemand seine Angst, seine Routine, sein Leben in Worte gefasst. Paul spürte ein Brennen in den Augen, schluckte, aber die Worte verschwanden nicht. Sie brannten sich in sein Gedächtnis.
“Du gehörst mir, Paul. Du gehörst der Straße.” Das leise Flüstern in seinem Kopf war nicht neu, aber es war lauter geworden. Es klang sanft, beinahe tröstlich, und das machte es noch viel schrecklicher. Es war die Stimme des Bösen, das ihm die Hand reichte.
Auf dem Heimweg hörte er Schritte hinter sich. Er drehte sich schnell um. Niemand war da. Die Straße schien leer, aber die Schritte folgten ihm, ein steter Rhythmus, der ihm die Luft abschnürte. Paul riss die Autotür auf und sprang hinein. Doch er wusste instinktiv: Wer oder was auch immer ihn verfolgte, war schon bei ihm.
Als er die Tür seines Hauses hinter sich schloss, fühlte er für einen kurzen Moment Sicherheit. Dann hörte er es wieder. Das Ticken, das er schon im Auto gehört hatte, aber diesmal kam es nicht von draußen. Es kam aus seinem Haus. Erst aus der Küche, dann aus dem Flur, dann aus dem Bad. Paul setzte sich auf das Sofa, die Hände um die Knie geklammert, und starrte in den Nebel, der durch die Fenster kroch.
Er konnte nicht schlafen. Jede Nacht hörte er die Schritte, die Stimmen, das leise Flüstern, das seinen Namen rief. Manchmal glaubte er, die Silhouette im Fenster zu sehen, die ihn anstarrte, regungslos und unbarmherzig. Seine Gedanken begannen sich zu verheddern. War es real, oder fing sein Verstand an, ihn zu täuschen? War die Straße nur ein Produkt seiner Angst? Doch tief in seinem Inneren wusste Paul, dass sie real war. Sie wollte ihn. Und sie würde nicht aufhören.
Er wusste, dass er nicht entkommen konnte – nicht wirklich. Und er hatte das unheilvolle Gefühl, dass sie auf den perfekten Moment wartete, um ihn endgültig zu holen. Die Straße wartete.
Kapitel 3: Die Nachbarn verschwinden
Die Tage vergingen, doch Millersville fühlte sich leerer an als je zuvor. Paul bemerkte es zuerst an den kleinen Dingen: das unheimliche Fehlen des sanften Klingelns an den Türen, das schrille Lachen der Kinder auf den Gehwegen, das Geräusch von Herrn Watkins, der jeden Morgen seine Zeitung aufschlug. Stattdessen nur die Stille, die so tief war, dass sie beinahe schmerzte. Paul versuchte, die Nachbarn anzurufen. Jedes Mal nur Rauschen, dann ein Klicken, und die Verbindung war tot.
Er fuhr die Oakwood Road entlang, den Wagen langsam durch die nebelverhangenen Straßen schiebend. Jedes verlassene Haus jagte ihm einen kalten Schauer über den Rücken. Die Haustür von Frau Lewis stand einen Spalt weit offen, und Paul spürte eine Mischung aus Angst und Neugier. Er stieg aus, seine Schritte hallten auf dem leeren Gehweg wider. Die Bäckerei roch nach frischem Zimt und warmem Brot. Auf der Theke lag noch ein Laib, warm genug, um die Feuchtigkeit an seiner Hand zu spüren. Frau Lewis war verschwunden, aber ihr Brot war noch da.
Die Isolation krallte sich an sein Herz. Pauls Atem ging schwer. Er war allein, gefangen in einer Stadt, die einfach nicht mehr existierte. Er versuchte die Polizei zu kontaktieren, wählte die Nummer immer und immer wieder. Jedes Mal nur ein Rauschen, ein leises Summen in der Leitung, als wäre niemand dort. Dann die Stille. Pauls Hände zitterten, und ein Gefühl der Ausweglosigkeit überwältigte ihn.
In den Nächten wurde alles schlimmer. Paul hörte Schritte hinter den Wänden seines Hauses, flüsternde Stimmen, die seinen Namen riefen. Manchmal glaubte er, hinter den Vorhängen in den Häusern der Nachbarn Gesichter zu sehen, nur für den Bruchteil einer Sekunde, bevor er blinzelte und sie wieder verschwanden. Seine Träume wurden zu Albträumen, die in die Realität übergriffen. Die Straßen verschoben sich, Häuser bogen sich in unmögliche Winkel, und die Menschen, die er kannte, fielen in Wände aus Nebel, die wie lebendige Wesen pulsierten.
Paul begann, an seinem Verstand zu zweifeln. Was war real und was Einbildung? Hatte der Nebel die Menschen einfach verschluckt, oder hatte die Straße sie wirklich geholt? Die Frage nagte an ihm, während Angst und eine seltsame, fast krankhafte Faszination an ihm zogen. Er fühlte sich wie ein Protagonist in einem Buch, das sich selbst schrieb.
Trotzdem wagte er sich hinaus. Er lief durch die leeren Straßen, spürte förmlich die Präsenz der Straße unter seinen Füßen. Der Nebel kroch zwischen den Bäumen hindurch, wirkte lebendig, pulsierte, und Paul spürte, dass er von ihm beobachtet wurde. Jede Abzweigung, jeder Weg, den er wählte, führte ihn wieder zurück zur Oakwood Road. Es gab keinen Ausweg mehr.
Die Stadt war verschwunden, die Menschen verschwunden, und die Straße… die Straße wartete. Sie hatte ihn in ihr Netz gelockt und würde ihn nicht mehr gehen lassen. Paul fühlte, dass er die Kontrolle verloren hatte. Jeder Atemzug, jeder Schritt brachte ihn tiefer in das unheimliche Netz der Oakwood Road. Er war gefangen zwischen Realität und Wahnsinn, und der Nebel war nicht nur Wetter – er war eine lebendige Präsenz, die ihn langsam, aber unaufhaltsam umschloss. Er konnte nicht entkommen. Und tief in seinem Inneren, so seltsam es auch klang, wollte er das vielleicht auch gar nicht.
Kapitel 4: Die Entscheidung
Der Nebel war dichter als je zuvor. Paul stand an seiner Haustür und starrte hinaus in die weiße, feuchte Wand, die die Oakwood Road verschluckt hatte. Er spürte sie – die Präsenz, die ihn seit Tagen verfolgte. Es war nicht nur der Nebel, nicht nur die verlassene Stadt. Es war die Straße selbst, lebendig, hungrig, aufmerksam. Sie rief seinen Namen. Direkt vor seiner Tür, laut und unmissverständlich: „Komm nach Hause.“ Die Stimme klang freundlich, beinahe tröstend, und das war das Schrecklichste daran.
Paul presste die Hände auf das Türschloss. Sein Herz hämmerte, Schweiß rann über seine Stirn. Er wollte sich zurückziehen, den Schlüssel drehen, die Tür verriegeln. Doch ein seltsamer Sog, eine leise Stimme tief in seinem Inneren, flüsterte: „Vielleicht ist das der einzige Weg, es zu verstehen.“ Die Worte klangen wie seine eigenen Gedanken, aber er wusste, dass sie es nicht waren. Sie stammten von der Straße.
Der Nebel zog sich wie flüssiges Grau durch den Vorgarten, formte sich um die Laternenpfähle und die Bordsteine, als wären sie Schattenwesen, die auf seinen nächsten Schritt warteten. Paul atmete tief ein, spürte die feuchte Kälte, die seine Lungen füllte, den Geruch von feuchtem Asphalt, verrottetem Laub, und etwas anderes – ein subtiler, scharfer Duft nach Metall und Erde, der nach Tod roch. Es war der Duft der Straße, und er war unwiderstehlich.
Er zögerte, warf einen letzten Blick zurück in sein Haus. Auf den vertrauten Kratzer am Türrahmen, den Sessel im Wohnzimmer, das Lichtspiel, das durch das Fenster fiel. Alles so normal, so sicher. Doch die Straße hatte ihn bereits gewählt. Sie formte seine Realität, verzerrte sie, veränderte sie, und jede Bewegung, jeder Atemzug führte ihn tiefer hinein. Pauls Arm hob sich, scheinbar von selbst, und seine Hand legte sich auf den Türknauf. Die Tür schwang auf, bevor er sie überhaupt berühren konnte.
Er trat hinaus. Kälte und Feuchtigkeit umfingen ihn wie ein Lebewesen. Der Nebel schloss sich um ihn, verschluckte die Häuser, die Bäume, die vertrauten Straßen. In der Ferne hörte er das laute, unheimliche Ticken seiner Armbanduhr, die er gar nicht trug. Es wurde schneller, immer schneller, wie ein hämmernder Herzschlag. Stimmen flüsterten, sanft, fast tröstend: „Willkommen zu Hause.“ Für einen Augenblick sah er im Nebel die Schatten seiner verschwundenen Nachbarn, die wie Geisterwesen tanzten und ihm mit leeren Augen zuwinkten, ihre Gesichter waren blass und ohne Ausdruck, als wären sie nur Hüllen.
Mit jedem Schritt fühlte er, dass die Straße ihn einsog, dass seine eigene Realität sich auflöste. Die Häuser, die Autos – sie existierten nur noch als Erinnerung, als flüchtige, schmerzhafte Bilder in seinem Kopf. Die Straße pulsierte, lebte, und Paul konnte spüren, wie sie ihn formte, ihn festhielt. Angst mischte sich mit Faszination, Verzweiflung mit einer unheimlichen Ruhe. Er konnte nicht entkommen. In seinem Inneren begann ein seltsames Einverständnis. Er war nicht mehr Paul Faber, der Mann der Gewohnheit. Er war nun ein Teil der Straße.
Die Straße umschloss ihn wie ein lebendiges Wesen, verschmolz mit seinen Gedanken, mit seinem Atem. Paul spürte die Präsenz hinter seinen Augen, eine dunkle, hungrige Intelligenz, die ihn beobachtete, prüfte, festhielt. Er war nur noch ein Teil des Nebels, ein Teil der Straße, und das Einzige, was blieb, war der leise Gedanke: „Ich bin hier… und ich kann nicht mehr zurück.“ Das Ticken der unsichtbaren Uhr war das letzte Geräusch, das er hörte, bevor die Stille ihn verschluckte.
Kapitel 5: Die Flucht und der Spiegel
Der Nebel hatte Paul vollständig verschlungen. Straßen, Häuser, die vertrauten Bäume – alles war verschwunden, als befände er sich in einer anderen Dimension, geformt aus flüssigem Grau und Schatten. Jeder Atemzug war feucht und schwer, der Geruch von nassem Asphalt und verrotteter Erde brannte in seiner Nase. Paul rannte, so schnell seine Beine ihn tragen konnten, stolperte über Wurzeln, über unsichtbare Hindernisse, aber die Straße führte ihn immer wieder zurück. Jeder Versuch zu entkommen, jede Richtung, die er einschlug, brachte ihn nur tiefer in das unheimliche Gewebe hinein, das sich um ihn legte.
Schließlich stieß er auf ein altes, verlassenes Haus, das zwischen den Nebelwänden stand wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Die Fenster schimmerten dunkel, wie Augen, die ihn fixierten, und Paul wusste instinktiv, dass dies kein normales Gebäude war, sondern ein Herzstück der Straße selbst. Er stieß die knarrende Tür auf und trat ein. Der Boden knarrte unter seinen Füßen, die Luft war stickig und roch nach Schimmel und Verzweiflung. Der Nebel folgte ihm, kroch durch Türrahmen und Spalten, als sei er lebendig und bereit, ihn endgültig zu umschließen.
Im Inneren des Hauses standen unzählige Spiegel, alte, dunkle Glasflächen, die kaum Licht reflektierten. Jeder einzelne von ihnen reflektierte sein Bild, aber nicht, wie er sich kannte. Paul sah sich selbst alt, bleich, verzweifelt, schreiend, gefangen in der Zeit. Manche Spiegel zeigten ihn in Momenten, die er nie erlebt hatte, andere zeigten das, was er am meisten zu fürchten wagte: sein eigenes Verschwinden, sein eigenes Ende. Panik schnürte ihm die Kehle zu. Er rannte von Spiegel zu Spiegel, suchte einen Ausgang, doch jeder Schritt brachte ihn nur tiefer in das Labyrinth aus Reflexionen und Nebel. Die Spiegelbilder lachten, stöhnten und bewegten sich im Takt seiner eigenen Panik.
Die Stimme der Straße flüsterte nun direkt in seinem Kopf, nicht als Echo, sondern als Gedanke: „Du kannst nicht entkommen. Du bist schon hier.“ Paul taumelte, fiel auf die Knie, die Hände über die Augen gepresst. Der Nebel schien ihn zu umschlingen, durchdrang seine Kleidung, seine Haut, als würde er selbst ein Teil der Straße werden. Er spürte das Gewicht der verschwundenen Stadt, die Stimmen der toten Nachbarn, die ihn aus den Wänden riefen – alles zog ihn unaufhaltsam hinein.
Er wusste, dass dies das Ende war. Jeder Versuch, zu entkommen, endete in denselben Spiegeln, denselben Reflexionen seiner eigenen Angst. Das Haus, die Spiegel, die Straße – alles war eins geworden. Paul schrie, doch kein Laut drang über die Nebelwand hinaus. Nur das Echo seiner eigenen Stimme hallte von den Spiegeln zurück, verzerrt und voller Wahnsinn. Er sah sich in jeder Reflexion, wie er fiel, wie er verzweifelte, wie er schließlich selbst zu einem Schatten wurde, der in den Spiegeln gefangen war.
Am nächsten Morgen fand man nur noch sein Auto am Straßenrand der Oakwood Road. Die Türen standen offen, der Motor kalt. Kein Hinweis auf seine Flucht, keine Spur von ihm in der Stadt. Millersville schien wieder normal, doch Paul war nicht zurückgekehrt. Er war gefangen im Nebel, gefangen in den Spiegeln, gefangen in der endlosen Straße, die ihn verschluckt hatte.
Und manchmal, wenn der Nebel besonders dicht ist, berichten Leute, sie hätten einen bleichen Mann gesehen, der stumm zwischen den Spiegeln stand, die im Nebel flackerten. Sein Blick ist leer, verzweifelt, doch wachsam, gefangen für immer – ein Warnzeichen für jeden, der die Oakwood Road entlanggeht. Denn die Straße hört nie auf zu rufen, sie verzeiht niemandem, und Paul Faber ist nur der erste, der vergessen wurde.
2. Das Zimmer ohne Tür
Kapitel 1: Das neue Apartment
Lena Carter liebte Veränderungen – oder dachte zumindest, sie würde sie lieben. Das neue Apartment in der alten Stadtvilla versprach einen Neuanfang, eine Chance, alles hinter sich zu lassen: den alten Job, die gescheiterte Beziehung, das kleine, stickige Zimmer, das sie jahrelang in die Welt der Träume begleitet hatte. Die Wohnung war klein, aber charmant: knarrende Dielen, hohe Decken, Schränke aus dunklem Holz. Sie atmete tief ein und versuchte, die Aufregung über das neue Leben zu genießen.
Doch schon in der ersten Nacht bemerkte sie, dass die Stille hier anders war. Nicht friedlich, sondern voller seltsamer Geräusche, die aus den Wänden selbst zu kommen schienen. Ein leises, rhythmisches Klopfen, dann ein Kratzen, wie ein Fingernagel, der über Stein schabt. Lena dachte zuerst an Ratten oder die alte Heizung, aber das Klopfen hörte nicht auf. Es war unheimlich präzise, fast wie eine Botschaft. Es spiegelte den Rhythmus ihres eigenen Herzschlags wider, der mit jedem Pochen schneller wurde. Sie zitterte, wickelte sich fester in ihre Decke und versuchte, rational zu bleiben.
Dann entdeckte sie etwas Unfassbares: ein Zimmer, das in keiner Bauzeichnung existierte. Hinter einer Wand in der Ecke des Wohnzimmers schien sich ein Raum zu verbergen. Keine Tür, kein Lichtschacht, nur die leise Andeutung einer Vertiefung in der Wand, so subtil, dass sie es beinahe übersehen hätte. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Sie tastete mit der Hand über die Stelle und spürte, dass die Tapete sich anders anfühlte, glatter und kälter als der Rest der Wand. Sie klopfte dagegen und hörte nur ein dumpfes Echo. Doch manchmal schien es, als würde etwas von innen antworten – ein leises Pochen, kaum hörbar, aber unheimlich rhythmisch.
In den folgenden Nächten verstärkten sich die Erscheinungen. Lena träumte von langen, dunklen Fluren, die direkt in das verborgene Zimmer führten. In den Träumen krochen Schatten aus der Wand, und sie hörte Stimmen, die ihren Namen flüsterten, so nah, als stünden sie direkt hinter ihr. Sie wachte schweißgebadet auf, das Herz hämmerte, und der Gedanke ließ sie nicht los: Das Zimmer war mehr als eine Illusion. Es war da, und es beobachtete sie.
Ihre Freunde lachten, als sie davon erzählte. „Ach komm, du bist nervös“, sagten sie, "ein bisschen Übermüdung, das ist alles.“ Doch Lena wusste, dass dies kein normaler Stress war. Sie spürte eine Präsenz, die nicht nur da war, sondern die auf sie wartete. Etwas im Apartment war lebendig, und es war hungrig. Sie konnte es nicht greifen, nicht sehen, aber sie spürte die Anwesenheit wie einen Schatten, der über ihrer Schulter lauerte, selbst wenn sie allein war.
Selbst die alltäglichen Geräusche, die sonst beruhigend waren – das Tropfen des Wasserhahns, das Quietschen der Dielen, das entfernte Rufen eines Kindes – wirkten verfremdet, als seien sie Teil eines größeren, unsichtbaren Plans. Lena begann, die Räume zu untersuchen, die Möbel zu verschieben, jede Ecke zu inspizieren. Doch das Zimmer blieb undurchdringlich, eine klaffende Leere hinter der Wand, die ihr Herz schneller schlagen ließ. Am Ende des ersten Tages saß sie auf dem Boden ihres Wohnzimmers, die Knie an die Brust gezogen, die Ohren gespitzt. Ein schwaches Klopfen, ein Hauch von Bewegung hinter der Wand. Lena wusste, dass dies kein Zufall war. Das Apartment hatte ein Geheimnis – und das Zimmer ohne Tür wartete. Es wartete nur darauf, dass sie einen Weg hinein fand.
Kapitel 2: Die ersten Begegnungen
Die Tage nach ihrem Einzug in das alte Apartment vergingen langsam, aber unerbittlich. Lena spürte die Anwesenheit des geheimnisvollen Zimmers immer stärker. Das Klopfen hinter der Wand war nicht mehr gelegentlich, sondern rhythmisch, konstant, fast wie ein zweiter Herzschlag in der Wohnung. Manchmal schien es sich zu bewegen, näher zu kommen, dann wieder zurückzuweichen, als würde es sie testen. Sie dachte an die Worte ihrer Freunde, "nur Übermüdung", und der Gedanke ließ sie zittern, denn sie wusste, dass es so viel mehr war.
Eines Abends beschloss Lena, mit den anderen Bewohnern des Hauses zu sprechen. Vielleicht wusste jemand etwas über das Apartment, die seltsamen Geräusche, die sie wach hielten. Doch ihre Nachbarn reagierten seltsam. Die alte Frau im Erdgeschoss, die sie sonst freundlich begrüßt hatte, wich zurück, als Lena das Zimmer erwähnte. Ihre Augen flackerten, und ein flüchtiger Ausdruck von panischer Angst huschte über ihr Gesicht. „Es gibt hier nichts“, sagte sie hastig, ihre Stimme beinahe ein Wispern, bevor sie die Tür zuschlug. Ein junger Mann im dritten Stock zuckte nur die Schultern. „Ich höre nichts. Vielleicht bist du zu gestresst“, sagte er, doch seine Augen sahen sie an, als hätte sie ein schreckliches Geheimnis ausgesprochen.
Diese Reaktionen verstärkten Lenas Misstrauen. Jeder schien zu wissen, dass es das Zimmer gab, aber niemand sprach darüber. Ein Knoten aus Angst und Neugier wuchs in ihr. Sie begann, die Wohnung genau zu beobachten. Manchmal glaubte sie, Schatten hinter der Wand zu sehen, die nicht von draußen kommen konnten. Geräusche drangen durch die Tapete – ein Rascheln, ein Seufzen, manchmal ein leises, trockenes Kichern, das sie erschaudern ließ, denn es klang, als käme es von Knochen, die aneinander reiben.
In ihren Träumen wurde das Zimmer lebendig. Lena lief durch endlose Flure, die in das Zimmer führten, aber die Tür, die sie suchte, gab es nicht. Schatten huschten über die Wände, und Hände, bleich und knochig, griffen nach ihr aus dem Nichts. Sie wachte schweißgebadet auf, das Herz raste, der Atem kurz. Doch selbst im wachen Zustand spürte sie die Anwesenheit. Sie war da, immer da, ein lebendiger Schatten hinter der Wand, der ihre Gedanken beobachtete, ihre Angst spürte und sich von ihr nährte.
Mit der Zeit begann Lena, kleine Dinge zu bemerken, die sich veränderten, wenn das Klopfen lauter wurde. Ein Buch, das sie auf den Schreibtisch gelegt hatte, lag plötzlich auf dem Boden. Ein Bild, das sie aufgehängt hatte, hing schief, als hätte es jemand sanft zur Seite geneigt. Es war subtil, fast unmerklich, aber genug, um zu wissen, dass etwas sie beobachtete. Etwas, das auf sie reagierte.
Eines Abends, als sie auf dem Sofa saß und versuchte, ein Buch zu lesen, hörte sie ein Kratzen direkt hinter der Wand, neben ihrem Kopf. Die Deckenlampe flackerte im Takt des Geräuschs. Lena erstarrte. Es klang, als würde jemand von innen kratzen, tief, rhythmisch, als versuchte jemand, sich einen Weg nach draußen zu schaben. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Langsam legte sie die Hand auf die Wand, spürte die glatte Tapete, und in diesem Moment glaubte sie fast, die Wand selbst hätte Puls.
Sie wusste, dass sie das Zimmer ohne Tür nicht ignorieren konnte. Es war mehr als nur ein leerer Raum hinter einer Wand – es war lebendig, aufmerksam, wachsam. Und Lena spürte eine unheilvolle Einladung, ein Verlangen, das sie nicht verstand, das sie aber nicht ignorieren konnte. Etwas im Inneren der Wand wollte Kontakt, wollte, dass sie näher kam.
Als sie schließlich die Augen schloss, um sich zu beruhigen, hörte sie es wieder: das leise Pochen, das Rascheln, das sanfte Kichern. Das Zimmer wartete, und Lena wusste, dass ihre Begegnung mit ihm erst begonnen hatte. Das Gefühl von Beobachtung, von etwas Lebendigem hinter der Wand, ließ sie nicht mehr los. Sie war nicht allein. Und sie war nicht mehr sicher.
Kapitel 3: Die Geschichte des Zimmers
Lena konnte die wachsende Unruhe in sich nicht mehr ignorieren. Das Apartment fühlte sich nicht mehr wie ein Ort des Neuanfangs an, sondern wie ein lebendiger Käfig, der sich langsam um sie schloss. Nach mehreren schlaflosen Nächten, in denen das unheimliche Klopfen sie fast in den Wahnsinn getrieben hatte, beschloss sie, die Geschichte des Hauses zu erforschen. Vielleicht gab es einen rationalen Grund für das Zimmer – ein vergessenes Archiv, ein alter Lagerraum – etwas, das erklären konnte, was sie hörte.
Die Stadtbibliothek lag nur ein paar Blocks entfernt, doch der Weg dorthin fühlte sich unendlich weit an. In der Bibliothek wühlte Lena durch staubige Baupläne und vergilbte Zeitungsarchive. Der Raum war kalt, und die Luft roch nach altem Papier und Feuchtigkeit. Sie spürte, wie eine unsichtbare Kälte von den alten Dokumenten ausging, die sie berührte. In den Unterlagen gab es keine Spur von einem Raum in der Ecke ihres Wohnzimmers. Dennoch fand sie Berichte über Menschen, die in dem Haus verschwanden. Zwei Bewohner wurden zwischen 1937 und 1952 als vermisst gemeldet. Keiner sprach öffentlich darüber, und in den Artikeln klang es, als sei die Erinnerung an sie nach kurzer Zeit aus dem kollektiven Gedächtnis der Stadt gelöscht worden.
Ein alter Zeitungsausschnitt stach besonders hervor. Er war an den Rändern ausgefranst und hatte einen seltsamen, rötlichen Schimmer. Ein Mann hatte das Gebäude betreten und war nie wieder gesehen worden. Die Überschrift lautete: „Das Zimmer, das niemand betritt.“ Lena fröstelte. Das Klopfen, das Kratzen, die Schatten hinter der Wand – alles passte zusammen. Das Zimmer ohne Tür war nicht nur ein leerer Raum. Es war ein lebendiger Ort, der Menschen festhielt – oder sie verschlang. Die Erkenntnis war so kalt wie die Luft im Archiv.
Zurück im Apartment beobachtete Lena die Wände mit einem neuen Gefühl der Angst. Sie klopfte vorsichtig gegen die Stelle, an der sich das Zimmer befand. Kaum hatte ihre Hand die Tapete berührt, spürte sie eine subtile Vibration, als würde etwas von innen reagieren. Dann hörte sie ein leises Flüstern, das sie beinahe glauben ließ, die Wände hätten ihre eigene Stimme. „Komm näher…“, raunte die Stimme sanft, fast freundlich, und doch lag etwas Bedrohliches darunter.
Die Nachbarn verhielten sich weiterhin merkwürdig. Sie sprachen kaum über das Haus und wichen Blicken aus, wenn Lena das Zimmer erwähnte. Es war, als wüssten sie, dass man es besser nicht betreten sollte, und als hätten sie Angst, dass das Zimmer ihre Namen hören könnte. Dieses Schweigen verstärkte Lenas Angst – und zugleich ihre Entschlossenheit. Sie wusste jetzt, dass sie sich dem Zimmer stellen musste, um die Wahrheit zu erfahren.
In der Nacht hörte sie erneut das Kratzen, diesmal intensiver, fast wie das Schaben von Fingernägeln über Holz. Sie setzte sich auf den Boden, das Herz hämmernd, und sprach leise zu der Wand: „Wer bist du? Was willst du?“ Das Pochen hörte abrupt auf. Stille. Dann ein trockenes, hohles Kichern, das aus der Tiefe des Zimmers zu kommen schien und das wie ein Echo der Seufzer und Schreie der Verschwundenen klang. Lena zitterte. Sie hatte das Gefühl, als würde das Zimmer sie beobachten, prüfen, herausfordern.
Die Erkenntnis setzte sich langsam fest: Das Zimmer war nicht nur ein leerer Raum – es war ein lebendiger Organismus, der auf sie reagierte. Es kannte ihre Ängste, ihre Neugier, ihr Verlangen, zu verstehen. Und es würde nicht aufgeben, sie zu rufen, bis sie einen Schritt weiter wagte, bis sie das Unbekannte betrat.
Lena legte sich schließlich auf das Sofa, die Hände an den Kopf gepresst, und starrte zur Wand. Sie wusste, dass sie sich der Wahrheit stellen musste. Das Zimmer ohne Tür war real, und seine Geschichte war nur ein Hinweis auf das, was noch kommen würde. Jeder Atemzug in diesem Apartment fühlte sich nun wie eine Wette auf ihr Leben an. Sie konnte nicht mehr zurück – nur nach vorn, in die Dunkelheit hinter der Wand.
Kapitel 4: Das Eindringen
Lena stand vor der Wand, die seit Wochen der bestimmende Schatten in ihrem Leben war. Jede Nacht hörte sie das Kratzen, die flüsternden Stimmen, die sanft lockenden Geräusche aus dem Zimmer ohne Tür. Sie hatte jede rationale Erklärung abgewogen, jede Möglichkeit ausgeschlossen. Es gab keine normale Lösung – das Zimmer war real, und es wartete auf sie.
---ENDE DER LESEPROBE---