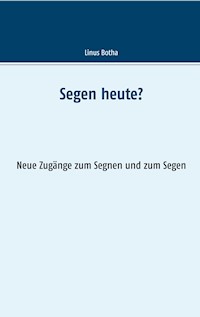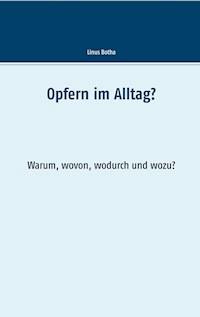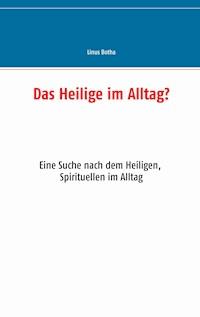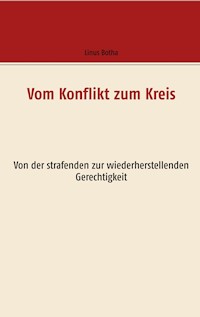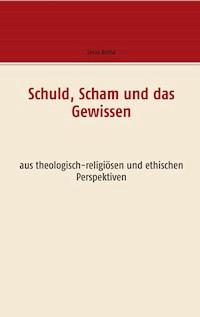
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch möchte aus theologisch-religiösen und ethischen Perspektiven Wege im Umgang mit Sünde, Schuld und Scham beleuchten. Unter Zuhilfenahme von Ethik, christlicher Theologie, eigener Gewissensbildung und einem Begriff von wiedergutmachender Gerechtigkeit werden neue Wege aufgezeichnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1.0 Vorwort
1.1 Religionen und Sünde und Schuld
1.2 Sünde und Schuld im „Vater unser“
1.3 Scham
1.4 Soziologie der Scham
1.5 Psychodynamik der Scham
1.6 Scham in der Seelsorge, Beratung u. Supervision
1.7 Scham in Kirche und kirchlich-beruflichen Kontext
2.0 Schöpfungsmythen
2.1 Die Geschichte von Adam und Eva
2.2 Was kann ich aus dieser Erzählung lernen?
2.3 Das Leben jenseits von Eden
2.4 Ein Fazit
3.0 Das Gewissen
3.1 Das Gewissen im gesellschaftlichen Kontext
3.2 Der religiöse Blick auf das Gewissen
3.3 Gegenwärtige Schuld und das Gewissen
3.4 Der psychoanalytische Blick auf das Gewissen
3.5 Schuldgefühle und Religion
3.6 Wege im Umgang mit dem Gewissen
4.0 Kants Gerechtigkeit und die Freiheit aller
4.1 Kants Trennung von Recht und Moral
4.2 Kants Definition von Recht und Gerechtigkeit
4.3 Kants Theorie des Gesellschaftsvertrags
4.4 Kants Eigentumstheorie
4.5 Kant und das Widerstandsrecht
4.6 Kants Minimal-Sozialstaat
4.7 Kants Idee des ewigen Friedens
5.0 Vom Konflikt zum Kreis
5.1 Der Kreis – ein Urphänomen
5.2 Der Status Quo
5.3 Ein neuer – alter Weg
5.4 Kreisverfahren im Strafvollzug
5.5. Ein Ausblick
1.0 Vorwort
Beim Thema Schuld und Scham wäre es ein Leichtes, wenn ich mich selbst als Kirchenkritiker positioniere und eine „Abrechnung“ mit der schlechten Vergangenheit der christlichen Kirche vornehme.
Die Themen Sünde, Schuld, Scham und Gewissen haben rückblickend in der Betrachtung der Geschichte von Kirche und deren historischen Werdegang zu vielerlei Kirchenkritik geführt. Dies geschah und geschieht, wenn persönliches Schuldempfinden durch kirchliches Handeln und Verkündigen missbraucht wird, um Machtpositionen über Glaubende zu festigen im Gegensatz zur biblischen Botschaft von Vergebung und Annahme. So hat die christliche Kirche in ihrer Geschichte nicht nur heilvoll gewirkt. Gerade im Blick auf Scham, Unterdrückung, "sich schuldig fühlen", haben Kirchenvertreter*innen den Bogen oft in die falsche Richtung gespannt. Sie haben nicht Befreiung von Scham und Schuld gepredigt, sondern dafür gesorgt, dass Menschen sich schuldig fühlen und schamhaft leben. Ich könnte hier Ursachenforschung betreiben, indem ich das geschichtlich-kulturelle Umfeld ansehe, die individuelle Biographie einzelner Theologen, die Theologie in jener Zeit, die Konstellationen von Macht usw. Dies wäre gewiss aufschlussreich und würde dazu beitragen, dass man ein kritisches, hinterfragendes Auge behält. Notwendig ist dies allemal, denke ich.
In diesem Buch möchte ich anhand von Bibelstellen , die in zentraler Weise das Thema Sünde, Schuld und Scham berühren und behandeln, dazu eine Betrachtung erstellen und gewissermaßen den umgekehrten Weg gehen. Es sind bekannte Stellen aus der Bibel, auch für Nicht-Bibel-Leser. Sie sind auch deshalb gekannt, weil sie zum literarischen Kulturgut unserer Gesellschaft zählen. Die Geschichte von Adam und Eva im Paradies und die Textverse aus dem „Vater Unser“ und die dort formulierte Bitte um Vergebung von Schuld. Im Anschluss an einen Deutungsversuch möchte ich im zweiten Teil das Thema Schuld mit dem Gewissen verknüpfen und in den gesellschaftlichen Kontext stellen - von anderen Seiten beleuchten.
1.1 Religionen und Sünde und Schuld
Sünde ist ein religiöser Begriff. Im christlichen Verständnis bezeichnet er den unvollkommenen Zustand des von Gott getrennten Menschen und seine falsche Lebensweise, d. h. das Übertreten von, oder Herausfallen aus der göttlichen Gesetzesordnung. Diese Trennung kam, der biblischen Erzählung (Gen 3) zufolge, durch den Sündenfall zustande, durch das Essen „vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“. Die Sünde besteht nach christlichem Verständnis in einer Abkehr von Gottes Willen, im Misstrauen Gott gegenüber, im Zulassen des Bösen oder im Sich-Verführen-Lassen. Bei Paulus erscheint die Sünde als eine unheimliche Macht, die das Leben und das Zusammenleben bestimmt und die Menschen zu Sklaven ihrer Leidenschaften macht, denen sie entsprechend ausgeliefert sind (Römer 6,12– 14). Der Begriff Sünde bezeichnet des Weiteren die einzelne verwerfliche und daher sündige Tat (Verfehlung), die mit dem bösen Gedanken beginnt (Matthäus15,19). Gedanken- und Tatsünden folgen aus der durch Unglauben verursachten Trennung, d. h. der Grundsünde. Böse Worte, verletzende oder unwahre Äußerungen also, sind nach biblischem Verständnis zu den Tatsünden zu zählen. Sünde kann auch als das Gegenteil von moralischer Verantwortung aufgefasst werden oder die Ursache für psychologisches Fehlverhalten sein. Letztlich führt das In-der-Sünde-Bleiben dem christlichen Glauben zufolge, zur Verurteilung im sogenannten Jüngsten Gericht Gottes, zu zweierlei Schicksal für Glaubende und Ungläubige: die Glaubenden kommen in den Himmel, die Ungläubigen in die Hölle (Daniel 12,2, Matthäus 25,46).
Ein Tatbestand gilt als verwerflich, bzw. schlecht, weil Gott ihn als Sünde kennzeichnet, z. B. durch die Zehn Gebote. Durch Sünden kommen andere Mitmenschen und der Sünder selbst direkt, oder indirekt zu Schaden.
Somit ist der Sünder nicht nur durch die Übertretung selbst, sondern auch durch ihre Folgen mit einer Schuld behaftet. Im Judentum wurde in Jerusalem bis zur Zerstörung des Zweiten Tempels durch die Darbringung von Opfern die Schuld gesühnt, d. h. zugedeckt. Im Islam hingegen hat das Tieropfer seine Sühnebedeutung verloren. Im Christentum ist Jesus Christus das Opferlamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt (Johannes 1,29 , Johannes 1,36, Offenbarung 1,5), deshalb sind keine Tieropfer mehr nötig.
Eng verbunden mit der Vererbung der Sünde sind das Bekennen und Bereuen derselben, sowie die Buße als Abkehr von Fehlhaltungen und Fehlverhalten. Durch diese Reue und aufgrund der Heilstat Jesu Christi am Kreuz, erfahren die Menschen Vergebung. In anderen Religionen wird die Vergebung durch das Gnädigstimmen der Gottheit(en) erreicht, als Verdienst und Selbsterlösung. Im Hinduismus und anderen vedischen Religionen werden unter Sünde Handlungen verstanden, die das Karma, das Schicksal beeinflussen.
Umgangssprachlich wird unter „Sünde“ oft eine als falsch angesehene Handlung verstanden, ohne dass damit eine theologische Aussage impliziert wäre. In trivialisierter Form begegnet der Begriff beim Verstoß gegen Diätvorschriften „gegen die Linie sündigen“, Kleidermode-Ästhetikvorstellungen „Modesünde“ oder gegen Verkehrsregeln „Parksünder“.
Etymologie der Sünde
Der griechische Ausdruck ἁμαρτία (harmatia) des Neuen Testaments und das hebräische Wort chata’a oder chat'at aus dem Tanach bedeuten Verfehlen eines Ziels – konkret und im übertragenen Sinn, also Verfehlung – und werden in deutschen Bibelübersetzungen mit Sünde wiedergegeben. Das deutsche Wort Sünde hat eine gemeinsame Wurzel mit Worten anderer germanischer Sprachen (Englisch sin, Altenglisch synn, Altnorwegisch synd). Der Ursprung ist nicht genau geklärt.
Möglicherweise geht das Wort auf die indogermanische Wurzel *es- zurück, das Partizip des Verbs sein, soviel wie seiend im Sinne von „derjenige, der es war, seiend“ bedeutend. Im Deutschen wurde Sünde erstmals als christlicher Begriff gebraucht. Eine volksetymologische Deutung führt es auf das germanische sund zurück, weil Sund eine Trennung zweier Landmassen durch eine Meerenge bezeichne, aber dem wird entgegengehalten, dass Sund im Gegenteil eine Enge, also eine Verbindung, zum Beispiel eine Meerenge, bezeichnet.
Das Wort lässt sich nach einer anderen Erklärung jedoch vom altordischen Verb sundr herleiten. Es bedeutet „trennen“ oder „aufteilen“, (ab)sondern, heutiges skandinavisch sondre und schwedisch sönder „zerbrochen“. Damit wäre ein Sund eine Landtrennung oder ein Bruchspalt.
Judentum
Im Judentum ist die Übertretung eines Gesetzes Gottes eine Sünde. Die Gesetze sind dabei die Gebote der Tora, andere Vorschriften im Tanach sowie, die im Talmud zusammengestellten Auslegungen. Nach der Auslegung des Tanach werden drei Formen der Sünde unterschieden:
Pesha
oder
Mered
: Absichtlich begangene Sünde, in bewusster Auflehnung gegen Gott.
Avon
: Emotional begangene Sünde, bewusst, aber nicht in Auflehnung gegen Gott.
Chet
: Unbeabsichtigte Sünde
Nach jüdischer Lehre ist kein Mensch perfekt, und alle Menschen sündigen. Diese Handlungen haben allerdings keine andauernde Verdammung zur Folge; nur wenige Sünden sind unvergebbar. Nach dem babylonischen Talmud wird Gottes Gnade in dreizehn Attributen zusammengefasst:
Gott ist gnädig, noch bevor der Mensch sündigt, obwohl er weiß, dass der Mensch zur Sünde fähig ist.
Gott ist dem Sünder gnädig, nachdem jener gesündigt hat.
Gott kann sogar gnädig sein, wo es ein Mensch nicht vermag oder verdient.
Gott ist mitleidsvoll und erleichtert dem Schuldigen die Strafe.
Gott ist sogar denen gegenüber gnädig, die es nicht verdienen.
Gott lässt sich nicht leicht in Zorn bringen.
Gottes Freundlichkeit ist vielfältig.
Gott ist ein Gott der Wahrheit; daher gilt sein Versprechen, dem bekennenden Sünder zu vergeben.
Gott ist den zukünftigen Generationen freundlich, so wie die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs seine Freundlichkeit erfuhren.
Gott vergibt bewusst begangene Sünden, wenn der Sünder bereut.
Gott vergibt das bewusste Verärgern seiner selbst, wenn der Sünder bereut.
Gott vergibt aus Irrtum begangene Sünden
Gott vergisst die Sünden derer, die bereuen.
Nach jüdischem Verständnis begeht jeder Mensch im Laufe seines Lebens Sünden. Gott gleicht dabei die angemessene Strafe durch Gnade aus. Gebet, aufrichtige Reue und Umkehr (Jona 3,5–10), (Daniel 4,27) sowie das Geben von Almosen sind zentrale Elemente der Sühne.
Das allgemeine hebräische Wort für Sünde ist aveira.
Juden sollen die dreizehn Prinzipien im Umgang mit den Mitmenschen anwenden. Nach der Jüdischen Bibel waren die „Stiftshütte“ und später der Jerusalemer Tempel Orte, an denen die Hebräer bzw. die Israeliten Opfer bringen konnten, nachdem sie ihre Sünden vor Gott bereuten (hebr.: kippär). Manche Sünden erforderten zusätzlich noch das Geständnis vor Gott.
Priester führten die in der Tora festgelegten Rituale (Gesang, Gebet, Opfergaben) durch. Der Feiertag Jom Kippur ist ein spezieller Tag, an dem das ganze jüdische Volk zur Vergebung seiner Sünden zusammenkommt. In den späteren Büchern der Propheten werden Rituale ohne echte Reue abgelehnt und die notwendige innere Einstellung der Bittsteller zu Reue und Umkehr erneut angemahnt.
Christentum
Der Begriff der Sünde, insbesondere seine Überwindung, hat im Christentum eine zentrale Bedeutung. Sünde bezeichnet hier den durch den Menschen verschuldeten Zustand des Getrenntseins von Gott, auch einzelne schuldhafte Verfehlungen gegen Gottes Gebote, die aus diesem Zustand resultieren. Die Lehre von der Sünde nennt man Hamartologie. In der Theologie ist die Hamartologie ein Teil der Anthropologie, die wiederum ein Teil der Schöpfungslehre ist. Die Schöpfungslehre ist wiederum ein Teil der Dogmatik. Grundsätzlich ist nach der christlichen Theologie jeder Mensch sündig. Jesus von Nazareth wurde allerdings nicht im Zustand der Sünde geboren und sündigte nicht, so die christliche Auffassung. Die christliche Sichtweise der Sünde bezieht ihre wichtigsten Aussagen aus alt- wie neutestamentlichen Texten und unterscheidet sich teilweise von der jüdischen Theologie. Danach zerstört die Sünde die vertrauensvolle Beziehung des Menschen zu Gott, die von diesem gewollt ist.
Die vielen einzelnen Sünden und sündhaften Handlungen werden als Symptome bzw. Folgen der einen Sünde gesehen, die im Leben ohne Gottesbeziehung besteht.
Sünde im christlichen Sinn ist immer zugleich eine Verfehlung gegen Gott – das Sündig-werden an Mitmenschen als Gottes Geschöpfen ist implizit gegen deren Schöpfer gerichtet.
Ein Beispiel gibt das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Likas15,11–32), in dem der Sohn sich eigentlich nur zwischen-menschlich verfehlt, aber dann zur Erkenntnis kommt: „Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und vor dir“ (Lukas 15,18). Im neutestamentlichen Verständnis ist kein Mensch von Natur aus frei von Sünde: „Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns.“ (1 Johannes 1,8). Sünden haben die Tendenz, weitere Sünden nach sich zu ziehen. Der Mensch hat keine Chance, im Alleingang frei von Sünde zu werden.
Konkrete Sünden, die im Neuen Testament erwähnt werden, sind: Entweihung des Tempels (Markus 11,15– 18), Heuchelei (Matthäus 23,1–36), Habsucht (Lukas 12,15), Gotteslästerung (Matthäus 12,22–37), Ehebruch (Matthäus 5,27–32), Prahlerei (Matthäus 6,1–18).
Sündenlisten gibt es an mehreren Stellen des Neuen Testaments: in der Apostelgeschichte, in den Briefen von Paulus sowie in der Offenbarung des Johannes. Eine besondere Form der Sünde ist die Sünde wider den Heiligen Geist, welche nach Aussage des Neuen Testaments nicht vergeben wird.
Biblische Sicht
Sünde ist der von Menschen verursachte Grund für die geistliche Trennung von Gott, welche von Gott nicht gewollt ist (Jesaja 59,1). Diese Trennung von Gott wird auch als „Wandeln in der Finsternis“ bezeichnet (Apostelgeschichte des Lukas 26,17f). Sünde bewirkt den Tod. Damit ist nicht nur die jetzige Trennung gemeint, sondern die ewige Trennung von Gott (Römer 6,23).
Umgekehrt bedeutet die Vergebung der Sünde ewiges Leben. Sünde stört aber nicht nur die Beziehung mit Gott, sondern auch zu unseren Mitmenschen (Lukas 15,21).
Hauptsächlich wendet sich Sünde jedoch gegen Gott (Psalm 51,6).
Die Bibel setzt Sünde auch mit Gesetzlosigkeit (1 Johannes 3,4) bzw. mit Ungerechtigkeit gleich (1 Johannes 5,17). Daraus ergibt sich der Zusammenhang von Sünde und Gesetzesübertretung. Durch Gottes Gesetz wird die Sünde erkannt (Römer 3,20). Da jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben gegen Gottes Gesetz verstößt, ist jeder Mensch von sich aus ein Sünder (Römer 3,23). Die Zurechnung von Übertretungen setzt die Kenntnis (Römer 5,13, Römer 1,20, Römer 2,12–15) und Gültigkeit (Römer 6,14) des Gesetzes voraus. Nicht aus eigener Kraft wird der Mensch gerettet, sondern durch Gottes Gnade (Epheser 2,8f), so der weit verbreitete christliche Glaube.
Erkenntnis der Sünde
Die Gebote Gottes (das Gesetz) machen die Sünde und die Sünden erkennbar, nämlich als Maßstab (Römer 7,7– 13). Das wird in Beichtspiegeln angewendet, etwa bei der Vorbereitung auf die Beichte durch ein Betrachten einer Liste der zehn Gebote mit möglichen Verstößen. Anstelle einer Konzentration auf mögliche Sünden wird heute eher die Gottesbegegnung in den Focus genommen. So erläutert das Bekenntnis der Baptisten: In der Begegnung mit Jesus Christus erfahren wir das Böse in uns und in gesellschaftlichen Strukturen als Sünde gegen Gott. Das selbstkritische Erkennen des eigenen Betroffenseins von Sünde fällt den meisten Menschen schwer. Leichter ist solches Erkennen in Bezug auf die Menschheit insgesamt, als Kollektiv also. Hier lässt sich Sünde erkennen an der mangelnden Offenheit, auf Gott zu hören, an dramatischen Gräueltaten und an ungerechten gesellschaftlichen Strukturen. Ohne nun bestimmte Sünden individuell zuzuordnen, dem oft die komplexe Realität entgegensteht. Der einzelne Mensch sieht sich als mitverantwortlicher Teil des sündenverstrickten Kollektivs an.
Orthodoxe Kirche
Die Orthodoxe Kirche hebt insbesondere den Effekt der Sünde auf die Beziehungen zwischen Mensch und Gott, sowie die zwischen-menschlichen Folgen hervor. Daher wird bei der Erlösung die Aussöhnung und erneuerte Beziehung betont.
Römisch-katholische Kirche
Westliche Kirchen (katholische und evangelische Kirchen) sehen eher den rechtlichen Aspekt, der dann auch bei der Erlösung eine Rolle spielt. Die römischkatholische Kirche versteht unter Sünde nur die Handlung selbst, während die Kirchen der Reformation, die menschliche Natur selbst als sündhaft bezeichnen. In der römisch-katholischen Kirche beschäftigt sich die Moraltheologie mit der Sündenlehre. Die römischkatholische Kirche kennt eine begrifflich ausgearbeitete Lehre bezüglich der Sünde und dem Bußsakrament.Nach römisch-katholischer Lehre hat die Erbsünde zwar die ursprüngliche Vollkommenheit des Menschen beeinträchtigt, aber nicht vollständig ausgelöscht. Durch die Taufe wird die Erbsünde bis auf einen kleinen Rest, die sogenannte Konkupiszenz. Konkupiszenz kommt aus dem Lateinischen concupiscentia und bedeutet: heftiges Verlangen, Begierde und bezeichnet die Neigung oder innere Tendenz des Menschen zum Bösen oder zur Sünde, der als eine Art Zunder im Menschen verbleibt, vollständig beseitigt und zieht keine weitere Schuld nach sich. Daher ist der gefallene Mensch von sich aus bestrebt, Gottes Vergebung und Erlösung zu suchen. Die Sünden lassen sich in sichtbare Handlungen − wie etwa Totschlag oder Diebstahl −, in Haltungen − wie Neid oder Habgier, die zu weiteren Sünden führen können, sogenannte Wurzelsünden − und in Unterlassungssünden (Jakobus 4,17) unterscheiden. Sünden, die jemand aus freiem Willen und in voller Erkenntnis dessen verübt, dass es sich um eine Sünde handelt, wiegen schwerer als lässliche Sünden. Die katholische Lehre unterscheidet zwischen Totsünden, d. h. schweren Sünden und lässlichen Sünden. Das vorsätzliche Auslöschen des Lebens eines Mitmenschen gilt als zum Himmel schreiende Sünde. In der Lehre der römischkatholischen Kirche kommt auch den Mitchristen des Sünders eine Verantwortung zu, insbesondere bei schweren Sünden: Der Katholische Erwachsenenkatechismus nennt die „Pflicht zur „brüderlichen Zurechtweisung“; diese wird in der christlichen Tradition als ein Werk der Barmherzigkeit angesehen, und nimmt Bezug auf die Heilige Schrift (Matthäus 18,15–17, 1 Timotheus 5,1, Galater 2,11-14).
Evangelische Kirchen
Die Auswirkung der Erbsünde wird in vielen reformatorischen Kirchen anders gesehen. Am prägnantesten formulierte dies der Calvinismus, aber auch lutherische Kirchen kennen ähnliche Bestimmungen. Danach ist der Mensch durch die Erbsünde in einem Zustand „totaler Verderbtheit“ gefangen – also der vollständigen Abkehr von Gott, d. h. der Fixierung auf sich selbst und die Welt. Dies kann allein durch Gottes Initiative und Gnade (sola gratia) durchbrochen werden. Der damit geschenkte Glaube (sola fide) erhalte den Menschen im Zustand der Gnade.
Von der Sünde freigesprochen
Die Frage, wer von der Sünde freigesprochen wird, und wie dies geschieht, wird innerhalb christlicher Kirchen unterschiedlich gesehen. Es lassen sich jedoch einige Gemeinsamkeiten feststellen. Im Vordergrund steht die Gnade, die dem Menschen ohne sein Zutun geschenkt wird: die sogenannte Gerechtmachung des Sünders oder auch Rechtfertigung. Inwiefern der Mensch sich aus eigenen Kräften schon Gott zuwenden kann, ist umstritten. Im Zustand der Gnade jedenfalls erkennt der Mensch an, dass Gott in Jesus Christus als dem Heiland die Sünde(n) vergibt. Von Bedeutung für die Befreiung von der Sünde sind die Sakramente der Taufe und des nicht einheitlich verstandenen Abendmahls: die Taufe zur Aufnahme in die Glaubensgemeinschaft („Leib Christi“), das Abendmahl als immer wieder aufs Neue zugesprochene Sündenvergebung durch Gott. Der Christ wird durch den seelsorgerlichen Akt der Sündenvergebung von den Sünden freigesprochen, und die Gnade Gottes wird ihm zugleich zugesprochen; im Laufe der Christentumsgeschichte entwickelte sich der formale Vorgang des Bekennens, der Beichte, vor einem Priester, Pfarrer, Diakon oder Seelsorger und evtl. der von diesem auferlegten Buße. Im Einzelnen gibt es heute diesbezüglich jedoch Unterschiede:
In der römisch-katholischen Kirche gibt es das Bußsakrament, bei dem die Sünden einem Priester gebeichtet werden, durch den Jesus Christus diese vergibt. Zusätzlich kann der Priester Bußübungen auftragen.
Nach dem Verständnis der orthodoxen Kirche werden Sünden im Beisein eines Priesters direkt Jesus Christus gebeichtet, der dabei meist durch eine Ikone repräsentiert wird. Der Priester empfiehlt dann teilweise Bußübungen, nach deren Erfüllung er den Sünder im Namen Gottes von den Sünden losspricht.
In nahezu allen evangelischen und anglikanischen Kirchen gibt es üblicherweise bei jedem Abendmahl das gemeinsame Sündenbekenntnis mit Zuspruch der Vergebung durch den Pfarrer.
Ein Beichtsakrament wie in der römischkatholischen Kirche existiert in den evangelischen Kirchen nicht. Grundlegend ist die Annahme, dass der Christ sich während seines Lebens in einem Übergang vom Sündersein zum Gerechtsein befindet; deswegen ist die immer wieder aufs neue zugesprochene Sündenvergebung notwendig. Sie wird also entweder im Rahmen des Abendmahls sowie im Sprechen des Glaubensbekenntnisses selbst zugesprochen. Dies geschieht ebenso in der Taufe. Darüber hinaus ist es Aufgabe des von der Gemeinde delegierten Pfarrers oder Diakons, in seelsorgerlichen Situationen, Vergebung zuzusprechen. Dies kann aber ebenso ein Mitchrist, der kein Geistlicher sein muss, tun. Entscheidend dafür ist die Vorstellung des Priestertums aller Gläubigen.
Sühne
Sühne ist der Vorgang, durch den der Sünder wieder mit Gott versöhnt wird. Diese ursprünglich jüdische Lehre wurde zu einer zentralen Lehre in der christlichen Theologie. Die Sünde wird durch die Sühne aufgehoben; nach christlicher Lehre geschah diese Erlösung „in, mit und unter“ Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi. Im Laufe der Geschichte gab es unterschiedliche Ansätze, um die Bedeutung dieser im Christentum so zentralen Gegebenheit zu erfassen. Das Neue Testament geht von der Ähnlichkeit mit dem jüdischen Tieropfer (Sühneopfer) im Tanach aus, das die Sünden abträgt. Die Fragen zur Bedeutung des Todes und den Grund des Sterbenmüssens sind im Laufe der Geschichte folgendermaßen beantwortet worden:
Origenes lehrte, dass der Tod Christi ein dem Satan gezahlter Preis sei, um seine gerechtfertigte Forderung nach den Seelen der sündigen Menschen abzugelten.
Irenäus von Lyon lehrte, dass Christus in sich selbst alle Sünden aufnahm und somit die aus Adams Ungehorsam bedingte Erbsünde ausglich.
Athanasius von Alexandria lehrte, dass Christus kam, um Tod und Korruption zu besiegen und um die Menschheit wieder in Gottes Bildnis zu versetzen.
Gregor von Nazianz lehrte, dass der Tod Christi ein höchst freiwilliges Opfer des selbst göttlichen Christus an Gott sei, jedoch nicht um dessen Zorn zu befriedigen oder ihn mit der Menschheit zu versöhnen, sondern um umgekehrt die Menschen mit Gott zu versöhnen.
Anselm von Canterbury lehrte, dass Christi Tod Gottes Gerechtigkeitssinn zufriedenstelle. Diese Lehre ist in Anselms
Cur deus homo
entwickelt.
Peter Abaelard sah Christi Leiden (Passion) als Gottes Leiden mit seiner Schöpfung, wodurch er seine Liebe zeigte.
Johannes Calvin lehrte, dass Christus, der einzige Mensch ohne Sünde, freiwillig die Strafe aller Menschen Sünden auf sich nahm und stellvertretend gebüßt hat.
Karl Barth sah den Tod Christi als ein Zeichen der Liebe Gottes und seines Hasses der Sünde.
Diese Ansichten lassen sich (mit Einschränkungen) folgendermaßen gruppieren:
Ersatz
: Gott nahm in Christus die Strafe für die Sünden der Menschheit auf sich, damit die Glaubenden der Strafe entrinnen können.
Beispiel
: Der Tod Christi zeigt dem Christen, was es bedeutet, sich dem Willen Gottes zu unterwerfen; dadurch wird der Weg zum ewigen Leben aufgezeigt.
Offenbarung
: Christi Tod offenbart dem Christen das Wesen und die Liebe Gottes und zeigt die versprochene Auferstehung.
Sieg
: Der Tod Christi besiegte den Tod und gibt den Toten ewiges Leben.
Ein vollständiges Verständnis der christlichen Vorstellung von Sühne erfordert eine Kombination dieser Punkte.
Befreiung von der Sünde
Das Freiwerden von der Sünde betrifft erstens das Freigesprochenwerden, so dass die Sünde nicht mehr angerechnet wird. Zweitens kann damit gemeint sein, dass die sündhafte Handlung nicht mehr begangen wird, oder zumindest die Neigung dazu schwächer wird („Sieg über Sünde“). Das ist ein wichtiges Anliegen der Seelsorge. Manche Neigungen werden geradezu als Bindung oder Zwang erlebt: Der Mensch begeht diese Sünde, obwohl er den Wunsch hat, sie nicht mehr zu begehen. Das Lösen von Gewohnheiten ist ein Vorgang, der sich mitunter über längere Zeit hinzieht.
Erbsünde
Das christliche Konzept der Erbsünde beschreibt einen überindividuell – für den Einzelnen von Geburt an – bestehenden Zustand der Sünde, der irreversibel ist und nur durch die Gnade Gottes beseitigt werden kann (evangelisch), oder aber der Neigung zur Sünde, die vom Individuum handelnd aktualisiert und dadurch bejaht wird, solange die Gnade ihm nicht zu Hilfe kommt (katholisch).
Islamische Sichtweise
Im Islam ist der Mensch ständig der Versuchung ausgesetzt, Sünden zu begehen. Diese bestehen darin, Gottes Willen oder seine Schöpfung zu verletzen. Der Islam versteht Sünde als Ungehorsam gegen Gott, seinen Auftrag oder sein Gesetz. Sünde ist die „absichtliche Übertretung der göttlichen Norm“ (Smail Balic) in Gedanken, Worten und Taten. Der Koran beschreibt die erste Sünde der ersten Menschen (Adam und Eva) als Folge der Irreleitung durch Satan (2:36–38).
Der Islam lehnt aber die Vorstellung ab, dass die Sünde dieser beiden auf ihre Nachkommen vererbt wurde. Der Koran verweist auf die Barmherzigkeit Gottes und dessen Macht zu vergeben, entlastet also den Menschen von der sogenannten „Erbsünde“ und ihren Folgen. Ein Mensch wird rein geboren und wird so lange rein bleiben, bis er sich aus seinem eigenen Willen gegen Gott versündigt.