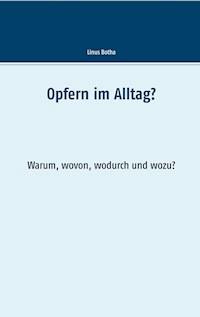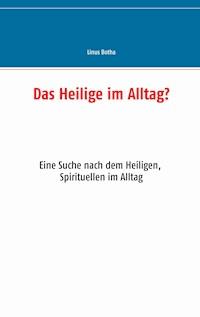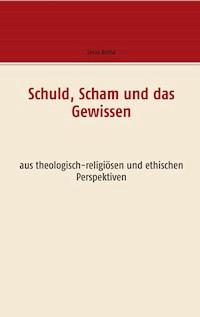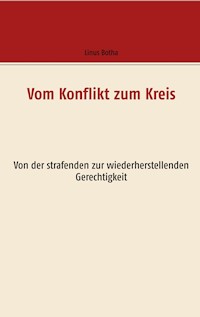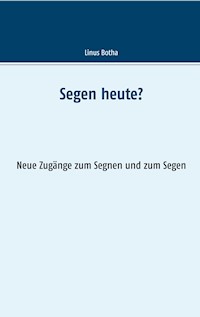
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch werden Fragen und Zugänge zum Segen und zum Segnen aufgezeigt und beschrieben. Ein bewusster, hinterfragender Umgang mit dem Segnen und dem Segen soll Erfahrungsräume ermöglichen und zum hilfreichen Segnen ermutigen. Die aktive Auseinandersetzung mit Segen im Hier und Jetzt durch "jedermann", soll der Zukunftsfähigkeit des Segens dienen, zum Nutzen aller. Nicht nur im Sinne des Christentums aller Gläubigen, sondern vielleicht auch darüber hinaus, für Menschen mit anderem Glauben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1.1 Segen - eine Einführung
1.2 Christliche Fragen und Liturgie
1.3 Phänomenologie in der Religion
1.4 Segensgebärden und Segensgesten
1.5 Gottesdienst mit Segen und Salbung
1.6 Ev. Gottesdienst Grundstruktur
1.7 Lieder und Texte
1.8 Gebete
1.9 Segensworte
Krankensegnung
2.1 Reisesegen
2.2 Weitere Segensformen
2.3 Segnung von Kindern
2.4 Segnen und Salben im Kindergottesdienst
2.5 Segen privat und in der Seelsorge
2.6 Segen für verschiedene Anlässe
Einweihung von Gebäuden und Gegenständen
3.1 Einweihung/Wiedereinweihung einer Kirche
3.2 Einweihung Gemeindehaus
3.3 Einweihung Orgel
3.1 Einweihung Glocke(n)
3.5 Einweihung Aussegnungshalle / Friedhof
3.6 Diakonische Einrichtung
3.7 Einweihung Rathaus
3.8 Richtfest / Einweihung Wohnhaus
3.9 Einweihung öffentliches Gebäude
Einweihung Kindergarten
4.1 Einweihung Schule
4.2 Einweihung Arbeitsstätte
4.3 Einweihung landwirtschaftlicher Betrieb
4.4 Einweihung Feuerwehrhaus /-fahrzeug
4.5 Einweihung Sporteinrichtung
4.6 Ingebrauchnahme Fahne
4.7 Weitere Texte und Lieder
Segnungen nach Erfahrung sexueller Gewalt
5.1 Katholische Segnungsgottesdienste
5.2 Ökumenischer Gottesdienst
5.3 Segnungsfeier für nichtchristliche Jugendliche
5.4 Kosmas-und-Damian-Segungsgottesdienst
5.5 Segnungsgottesdienst für Menschen mit Demenz
5.6 Segensfeier für Sterbende
5.7 Segensfeier mit Kindern
5.8 Segensfeier mit Jugendlichen
5.9 Segenfeier für Sternenkinder
Bausteine für Segensfeiern
6.1 Katholischer Segen in Not und Leiden
6.2 Christliche Abschiedssegen
6.3 Beispiel eines Abschieds-/ Aussegnungsrituals
6.4 Psalmen und Bibelstellen für Notsituationen
6.5 Abschiedssegen in Notsituationen
6.6 Abschiedssegen und Texte zur Auswahl
6.7 Literatur und Quellen
6.8 Schlusshinweis
1.0 Vorwort
In der Zeit meines Diakonstudiums habe ich mich auf den Weg gemacht, um einen kleinen Helfer und Begleiter zu schreiben, um Segen und Segnen leichter erfahrbar zu machen, dazu zu ermutigen, die Scheu davor abzulegen, jemandem anderen Segen zu zusprechen.
Ich hatte viele Jahre selbst Hemmnisse bei der Benutzung der „alten Wörter“: Gnade, Segen, Sünde etc., ohne dabei einen Kloß im Hals zu bekommen und selbst zu verstummen, oder eigene innere Abwehrhaltung dazu zu entwickeln aufgrund schlechter Erfahrungen.
Erst mit der Auseinandersetzung und der konkreten Erfahrung in meinem Leben, an Knotenpunkten und Momenten des Scheitern, habe ich neue Zugänge zu diesen Wörtner durch innere Erlebnisse und konkrete Gefühlsveränderungen gefunden. Ich habe mich intensiv auch mit der Kehrseite der Begriffe Segnen, Gnade, Segen etc. auseinandergesetzt. Man kann ja auch jemanden mit einen Segen oder einem Gebet überfordern, dominieren, beschämen, mit der falschen Haltung, einer unangemessenen Wortwahl, einen zu dichten Nähe- und Distanz-Verhältnis etc..
Durch die Beratung und Begleitung von Menschen in Not, in den Bereichen: Krisenintervention, Notfallseelsorge, Krankenhausseelsorge, Sterbe- und Trauerbegleitung, habe ich in den vergangen Jahren Erfahrung gesammelt. Mit diesem Hintergrund möchte ich in diesem Büchlein versuchen, Abläufe und praktische Hilfestellung beim Segnen und zum Segen zu geben.
Ich möchte Mut machen, allen denjenigen, die sich zutrauen, anderen Menschen beizustehen, ihnen zu begegnen, ohne Vorbehalt, Trost, Hilfe Beistand zu spenden durch das „einfach da sein“. Damit Menschen Hilfe erfahren und nicht allein sein müssen, damit die Hilfe und Barmherzigkeit nicht nur im Kopf bleibt.
Wenn ich selber einen Schritt zurück trete, dem anderen Raum anbiete, entsteht ein neuer Zwischenraum, der manchmal ergriffen und ungeplant und mit verblüffenden, erschütternden und auch beglückenden Gesprächen „gefüllt“ wird. Wenn ich bereit bin, dem Fremden etwas von meiner Aufmerksamheit, meiner Empathie schenke, ihm oder ihr wirklich Interesse entgegen bringe, können neue Sichtweisen auf das Leben in mir und beim Gegenüber entstehen.
Ich möchte versuchen, Mut zu machen, ein gesundes Maß zwischen dem Begleiten, Beraten, Helfen, Dasein, Aushalten und Beistehen zu finden. Auch wachsam und behutsam mit dem Bedürfnis nach Abgrenzung, Grenzen, Schutz bei sich und dem anderen, dem gegenüber ernst und wahr zu nehmen.
Aus meiner Erfahrung, können wir als „Helfende“ anderen ein Segen sein, wenn wir mit unserer Intuition, unserem Mitgefühl in Verbindung stehen. Wir freuen uns ja auch, wenn wir unerwartet auf selbstlose Unterstützer treffen und Hilfe, Zuspruch und Ermutigung erfahren. In den kleinen Dingen und Momenten wir können uns immer wieder selbst als gesegnet, als „Segen erfahren “. Wir sind nicht immer die „Wissenden“, „Mächtigen“, sondern wir dürfen ebenso Unterstützung, Dankbarkeit und Hilfe vom Gegenüber erfahren, wenn wir selbst ohnmächtig, ohne Macht sind.
Während meines Diakonstudiums hatte ich mich intensiv mit meiner Sprache, mit meiner Art des Sprechens im Gottesdienst und den Kasualien, den Sakramenten, das Feedback bekommen, besonders salbungsvoll, mit Singsang, weich, heilig zu sprechen, was nicht immer gut bei den Hörern ankam. Mit einer Übung bekam ich einen neuen Zugang. Ich sollte Karten von einem Stuhl auf einen 3 Meter entfernten Stuhl tragen und wieder zurück. Beim schnellen Gehen und Karten hin und her tragen sollte ich nun einen Segen sprechen. Das Resultat war, ich sprach nicht mehr salbungsvoll, sondern nüchtern und natürlich etwas körperlich angestrengt. Das innere Bild, des Kartenträgers hat mir geholfen, auf dem Boden der tatsachen zu bleiben.
Ein weiteres hilfreiches Bild für mich war: ein bis zwei Konsonanten besonders zu beachten und deutlich zu sprechen, die ich leicht übergehe, das N, M und das T hatte ich mir ausgesucht. Das Resultat war ähnlich, bisher skeptische Zuhörer waren nun bereit, mit meinen nüchternen Sprechen, sich von mir Segnen zu lassen.
Ein weitere Hilfe war beim Thema Gebet, Fürbitte und Segen, ein eigenes inneres Bild, eine Vorstellung vor Augen zu haben, wenn ich also „Himmel“ sage, auch ein Bild von einem Himmel vor Augen zu haben, bevor bzw. beim Sprechen „es“ zu empfinden und zu sehen, dass überträgt sich auf den Zuhörer.
Ein weiterer persönlicher Baustein zum Segnen war für mich das „Pausen machen“ beim Sprechen, das Innehalten, damit der Zuhörer auch den Raum hat, innerlich vom Gefühl und gedanklich mitzugehen und eigenes entstehen lassen zu können. Damit kann eine Verbindung entstehen und etwas kann der andere aus der Begenung mitnehmen.
Ein alter Pastor erzählte mir bei einem Spaziergang von einem Bild, dass ihm geholfen hatte, um mit Glaubensthemen Menschen nicht zu verschrecken. „Denke Dir eine Tasse Kaffee oder Tee, die steht für Raum geben, Interesse am Gegenüber, dazu gebe ein bisschen Milch, die steht für Eigenes, selbst Erlebtes, oder den eigenen Bezug zum Thema und dazu nur eine Messerspitze Zucker, das heißt Religion, Spirituelles, Geistiges, ansonsten wird der Kaffee oder Tee zu süß, klebrig und ungenießbar.
Zu guter Letzt, erinnere ich mich immer wieder an meine eigenen Segnungen, bei denen ich gesegnet wurde, dass sind in meinen Augen tiefe Erfahrungen von berührt werden, einem warmen Mantel, der sich über mich legt, einer Schutzschicht aus wohliger Wärme die mich durchströmt hat, so habe ich Segen selbst erfahren.
In Gesprächen mit anderen Menschen über das Thema Segnen und Segen, teilen die meisten Menschen eine ähnliche Intensität und bezeichnen es, als eine der tiefgreifendsten Erfahrungen im eignen Leben, gesegnet zu werden, die sie nicht vergessen werden.
1.1 Segen - eine Einführung
Viele Christinnen und Christen entdecken die Bedeutung von Segenshandlungen in unserer Zeit neu. Das betrifft nicht nur die Segnung der Gemeinde zum Abschluss eines Gottesdienstes, oder die persönliche Segnung bei Taufe, Konfirmation, Eheschließung, Ehejubiläum usw. Aber nicht nur an den Stationen des Lebens, bei denen die Kirche immer schon Segnungen als Übergangsriten angeboten hat, sondern auch bei anderen Gelegenheiten fragen Christinnen und Christen nach dem persönlichen Zuspruch des Segens Gottes.
Immer mehr evangelische Kirchengemeinden bieten Gottesdienste an, in denen sich Menschen in ihrer jeweiligen konkreten Lebenssituation die segnende Zuwendung Gottes in Jesus Christus zusprechen lassen können. Segen wird hier sehr persönlich empfangen und doch zugleich in gottesdienstlicher Gemeinschaft mit anderen Christinnen und Christen. Ebenso ist es eine Hilfe, den Segen zuhause, in Familie und Freundeskreis zuzusprechen. Dies gilt besonders auch für existenzielle Lebenssituationen, in denen Menschen durch Krankheit, Unfall, Tod bedroht sind.
Der Segen als persönlicher Zuspruch hat keine andere Qualität als der Segen am Ende jeden Gottesdienstes; aber er kann aus der Anonymität herausführen und dazu beitragen, dass Menschen sich vor Gott und in der christlichen Gemeinde ernst genommen fühlen. Nach biblischem Zeugnis ermöglicht der Segen, „dass ein Mensch sein ganzes Leben in seinem Ablauf von Tag zu Tag mit Gott in Verbindung bringen und dankbar aus Gottes Hand empfangen kann“ (Claus Westermann). Dieses Buch will Mut machen, mit Gottes Zuwendung und Hilfe im Lebensalltag zu rechnen.
Die Offenheit gegenüber Gott und die Erwartung seines Segens bedeutet allerdings nicht, dass die Kirche allen an sie herangetragenen Wünschen nach Segenshandlungen unkritisch entsprechen dürfte. Sinn einer Segnung ist nicht „etwas abzusegnen“, d.h. etwas Vorfindliches oder Erwünschtes einfach zu bejahen oder gutzuheißen bzw. religiös zu überhöhen. Dadurch würde dem Segen seine kritische Kraft genommen. Durch den Segen des Dreieinigen Gottes wird der Sündenfall, die Entfremdung des Menschen von Gott und von sich selbst, nicht überspielt oder bagatellisiert. Vielmehr wird der Segen zur Kraft Gottes gegenüber der Verkehrung, der seine Schöpfung preisgegeben ist.
Ebenso wenig geht es beim Segen um einen automatischen Schutz vor dem Bösen und um eine Garantie für Glück und Wohlergehen. Die Wirkungen des Segens sind nicht in die Verfügbarkeit des Menschen gestellt. Und der segnende Gott erspart den von ihm gesegneten Menschen die Leidensgeschichte so wenig, wie er sie sich selbst in Jesus Christus erspart. Segen bewahrt nicht vor allem Leid, sondern in allem Leid – und gibt so Anteil an Gottes Überwindung der lebens-feindlichen Mächte.
1.2 Christliche Fragen und Liturgie
Segen kann als ein Gefühl von „getragen sein“ von „beschenkt sein“ empfunden werden. Wir können uns dieses Gefühl jedoch nicht selber „geben“, sondern werden durch Situationen, durch Dialoge, durch Begegnungen „gesegnet“. Anders ausgedrückt, werden wir Segen, können gesegnet werden, dies geschieht, in der Wechselbeziehung zwischen Gott und Mensch. Wenn ich mich nicht als mächtigen Segensgeber begreife, sondern als Segensvermittler, als Verstärker, Lautsprecher des Segens, der schon da ist, aber noch ausgesprcchen werden will. Wenn ich mich als Diener des Segens, als Vermittler verstehe, in der Telefonzentrale die Verbindung herstelle, das Segen strömen kann, erfahren wird, gehört wird, dann ist dies glaube ich eine gute Grundhaltung zum Segen vermitteln, zum Segnen.
Das mit „segnen“ übersetzte griechische Wort „eulogein“ wird im Neuen Testament in Anlehnung an das alttestamentliche „brk“ verwendet, entweder um Gott für eine Segenserfahrung zu loben und zu preisen (Markus 6, 41 par.; 14, 22f par.) oder um durch ein „gutes Wort“ einen Menschen mit Gott in Beziehung zu setzen.
Liturgisch legt sich daher für eine Segenshandlung die Verbindung mit Liedern und Gebeten nahe, die Lob und Dank gegenüber Gott zum Ausdruck bringen. Als Ausdruck einer heilvollen Gemeinschaft beschränkt sich der Segen freilich nicht auf das Gottesverhältnis, sondern eröffnet ein dieser Gemeinschaft mit Gott entsprechendes Verhalten im Umgang mit anderen Menschen (vgl. Lukas 6, 28f .).
Schöpfung und Errettung
In der Bibel ist der Segen eine Kraft, die von Gott kommt und das Leben wachsen und gedeihen lässt, aber auch behütet und bewahrt, die Zugehörigkeit zu Gottes Reich, Rettung, Heil, Frieden, Gerechtigkeit und ewiges Leben als Gaben des Heiligen Geistes bewirkt und mit dem Glauben und der Gottesbeziehung zugleich auch die Gemeinde stärkt und wachsen lässt. Paulus verknüpft in seinem 2. ten Brief an die Korinther Kapitel 9, Vers 5-15 die Segens- und Wachstumsterminologie mit dem Gnadenbegriff und stellt damit den Zusammenhang zwischen dem Wirken Gottes in der Schöpfung und seinem Heilshandeln in Christus her.
Segen gehört zwar nicht zu den großen Heilsbegriffen des Neuen Testaments wie z. B. „Reich Gottes“, „Gnade“ oder „Gerechtigkeit“, wird aber von diesen her interpretiert, ohne seine kreatürliche Seite zu verlieren. Segen ist daher „gerade kein Begriff, der dazu taugt, zu differenzieren zwischen dem Handeln Gottes, mit dem er sich dem Menschen in seiner kreatürlichen Bedürftigkeit zuwendet, und einem Handeln Gottes, das den Mensch rettet aus Schuld und Gottesferne. Dagegen ist gerade das Typische des Segens, dass in ihm beides nicht auseinander gerissen wird, gerade weil sich im Segen die Ganzheit der Zuwendung Gottes ausdrückt und die Ganzheit des empfangenden Menschen erzielt werden will.“
Christliche Orientierung
Für Paulus (Galater 3, 6 – 4, 7), im Hebräerbrief (6, 1315; 11, 8-10.13-16; 11, 20f; 12, 17) und bei Lukas (Apostelgeschichte 3, 25) gilt Abraham als Verheißungsträger schlechthin. Die in ihm gegebene Segensverheißung wird von der Heilsbedeutung des Todes und der
Auferstehung Jesu Christi her theologisch interpretiert und mit einer eschatologischen Perspektive versehen. Eschatologie [ɛsça-] (aus altgriechisch τὰ ἔσχατα ta éschata ‚die äußersten Dinge', ‚die letzten Dinge' und λόγος lógos ‚Lehre') ist ein theologischer Begriff, der die prophetische Lehre von den Hoffnungen auf Vollendung des Einzelnen (individuelle Eschatologie) und der
gesamten Schöpfung (universale Eschatologie). Dieses christologische Verständnis des Segens wird insbesondere bei Paulus mit der universalen Ausrichtung auf alle Völker verklammert. Der Konzentration auf Christus entspricht die größte Ausweitung des Segens, die den ganzen Bogen von der Schöpfung bis zur Vollendung umspannt.
Auch im übrigen Neuen Testament lässt sich Segen nicht allein vom ersten Glaubensartikel her verstehen. So ist in den beiden Evangelientexten, in denen Jesus die Segenspraxis des Alten Testaments aufnimmt – die Segnung der Kinder mit Handauflegung, in der er ihnen die Teilhabe an Gottes Reich gewährt (Markus 10, 16), und die Abschiedssegnung der Jünger mit aufgehobenen Händen, die sie als Botschafter des Evangeliums aussendet (Lukas 24, 50) – die Person des Segnenden das entscheidend Wichtige. „Der grundgültige und endgültige Gottessegen hat also einen Namen: Er heißt Christussegen“.
Segen des Dreieinigen Gottes
Inhaltlich ist der Segen im Neuen Testament durch das Wirken des Dreieinigen Gottes bestimmt. Dies kommt neben dem dreigliedrigen Schlusssegen in 2. Korinther 13, 13 auch in Galater 3, 6 – 4, 7 und im Eingangslobpreis des Epheserbriefs (1, 3-14) zum Ausdruck.
Nach liturgischem Herkommen gehört zu einer Segnung eine Segensformel, durch die in sprachlich verdichteter Form zum Ausdruck kommt, welchen Inhalts der Segen ist. Der trinitarisch ausgeformte Segen stellt in knappster Form das Wirken Gottes in seiner heilsgeschichtlichen Erstreckung dar. Er integriert den Schöpfungsaspekt, die Rettung vor Sünde und Tod durch Christus und das Geschenk des neuen Lebens durch den Heiligen Geist und stellt das Segnen in die Dimension der Tauferinnerung (vgl. 2. Korinther 13, 13 mit Matthäus 28, 19).
Segnen und Taufe
Der Orientierung des Segens am Heilsgeschehen in Jesus Christus entspricht im Neuen Testament sein innerer Zusammenhang mit der Taufe. Paulus entfaltet, dass die Christen durch die Taufe auf Christus zu Kindern Gottes und zugleich zu Nachkommen Abrahams und damit zu Erben des ihm verheißenen Segens geworden sind (Galater 3, 8.14.26-29). Demnach beginnt mit der Taufe die Existenz im Segen der Gottes-kindschaft. Segnungen sind daher Fortsetzung und Bekräftigung dessen, was in der Taufe seinen Anfang genommen hat.
Auf der anderen Seite zeigt die Praxis der frühen Kirche eine auf die Taufe hinführende Unterweisung, zu der Segnungen der Taufbewerber gehörten. So gesehen können Segnungen auch öffnenden Charakter haben und zu einem Schritt auf dem Weg zur Taufe werden. Freilich, Segnungen ersetzen die Taufe nicht und sollen auch nicht zum Anlass für deren unabsehbaren Aufschub werden.
Segnen und Zeichen
In der Bibel ist der Segen Zuspruch und leibliches Geschehen in einem: Die erhobenen Hände sind Segensgebärde, wenn eine Mehrzahl von Personen gesegnet werden soll (3. Mose 9, 22; Lukas 24, 50); die Handauflegung ist sichtbares Zeichen bei der Segnung von Einzelnen (1. Mose 48, 14; Markus 10, 16). Im 2. Jahrhundert wird die Bezeichnung der zu Segnenden mit dem Kreuz erwähnt („segnen“ von lat. „signare“). Damit wird der christologische Akzent des Segnens betont und zugleich die Verbindung zur Taufe sichtbar.
Salbung
Zu einer sinnlich wahrnehmbaren Segnungspraxis kann die - neuerdings auch im evangelischen Raum zunehmend praktizierte - Salbung gerechnet werden. Das in Jakobus 5, 14 und bei der Aussendung der Jünger in Markus 6, 13 gebrauchte griechische Verbum „aleiphein“ („salben“) begegnet sonst im Neuen Testament nur für Salben mit Öl im buchstäblichen Sinn. Davon lässt sich die Rede von der Salbung in der übertragenen Bedeutung unterscheiden, für die das Verbum „chriein“ verwendet wird: In 2. Korinther 1, 21 wird erwähnt, dass Gott die Christen gesalbt hat und in 1. Johannes 2, 20.27 wird daran erinnert, dass die Christen die Salbung empfangen haben. Bei beiden Stellen ist von einer Verbindung von Salbung und Empfang des Heiligen Geistes und von einer Ausrichtung auf die Taufe auszugehen.
Im Hintergrund steht die Salbung der Könige Israels im Auftrag Gottes (1. Könige 1, 39; Psalm 2, 2 u. ö.). Sie ist Zeichen dafür, dass der Gesalbte von Gott beauftragt und bewahrt wird. Die Bedeutung der körperlichen Stärkung bleibt untrennbar mit der Vorstellung des Statuswechsels eines Menschen zum „Stellvertreter“ Gottes verbunden. In späterer Zeit (nachexilisch) begegnet die Salbung bei der Weihe des Hohenpriesters (Sacharja 4, 14; 1. Chronik 29, 22 u.ö.). Schließlich wird der eschatologische Vertreter Gottes als Gesalbter bezeichnet (Jesaja 61, 1 u.ö.).
Im Laufe der Geschichte hat sich so allmählich ein besonderer Messias-Begriff herausgebildet, der im Neuen Testament Anwendung auf Jesus finden kann. Unter seinen Jüngerinnen und Jüngern wird die Salbung daher nicht nur im Sinne einer körperlichen Stärkung und Heilung in Anlehnung an Jesu heilendes Handeln geübt, sondern erinnert im übertragenen Sinn auch an die Zugehörigkeit zu Gott.
In der Alten Kirche entstand (nachweisbar bei Tertullian u.a.) ein Ritus, in dem der übertragene Sprachgebrauch aus dem Neuen Testament in Erinnerung an die Salbungen im Alten Testament wieder in seiner buchstäblichen Bedeutung bewusst gemacht und rituell im Zusammenhang der Taufhandlung praktiziert wurde. Als biblisch gebotene Symbolhandlung steht die Salbung - gemäß Jakobus 5, 14 - für das helfende Handeln Christi an Kranken. Als biblisch orientierte Symbolhandlung steht sie - gemäß 2. Korinther 1, 21 - für die Gabe des Heiligen Geistes.
Versteht man die Salbung als „Intensivform einer Segnung“, dann kommt damit neben dem Taufkontext insbesondere die Gabe des Heiligen Geistes zur Geltung. Liturgisch legt es sich daher nahe, die Salbung mit einem trinitarisch geformten Segenswort zu verbinden.
Segnen - als eigenständige Sprachform
Indikativisch formulierte Segensworte begegnen im Neuen Testament ausschließlich im Munde Jesu in den Friedensworten der johanneischen Abschiedsreden („...meinen Frieden gebe ich euch“ Johannes 14, 27; 16, 33) sowie im Beistandsversprechen am Ende des Matthäusevangeliums (Matthäus 28, 20). Demnach wird ein Segenswort nur dann im Indikativ zugesprochen, wenn der Sprecher als göttliches Subjekt zugleich auch Urheber des Segens ist. Ist jedoch ein Mensch der Sprecher, begegnen Verbformen, die einen auffordernden Charakter haben. Mit dem indirekten Aufruf an Gott im Optativ bzw. hebräisch Jussiv („Der Herr segne....“) verbindet sich der direkte Zuspruch an den Adressaten in der zweiten Person („Der Herr segne dich...“).
Das Segnen ist so gesehen eine eigenständige Sprachform. Die modale Verbform wahrt – im Unterschied zur indikativischen - die Freiheit Gottes und die Unverfügbarkeit des Segens. Sie nimmt die segnende Person zurück und stellt Gott als Urheber der Segens in den Vordergrund. Zugleich deutet die direkte Anrede der Adressaten in der zweiten Person, verbunden mit einem sichtbaren Zeichen (z. B. mit der Handauflegung), auf einen performativen Sprechakt, d.h. auf eine sprachliche Äußerung, die die beschriebene Sache zugleich vollzieht.
Daher handelt es sich beim Segnen nicht um ein bloßes Wünschen, sondern um eine Äußerung, die das, was sie wünscht, gleichzeitig auch bewirkt. Es entsteht eine Dreiecksbeziehung: „Die segnende Person bringt Gott sprachlich mit der Segen empfangen den Person in persönliche Beziehung.“ Ihre Aufgabe fordert „Präsenz im Zurückziehen hinter die – durch den Segensspruch vollzogene – Beziehung zwischen dem als gegenwärtig geglaubten, segnenden Gott und dem Segen empfangenden Menschen“.
Im Übrigen kann eine Zusage oder Verheißung Gottes als Segenswort auch im Indikativ gesprochen werden. Doch sollte dann die göttliche Urheberschaft durch eine Zitierformel wie „Christus spricht“ kenntlich gemacht werden.
Segnen, Wortverkündigung und Sakramente
Sowohl bei der Wortverkündigung und der Feier der Sakramente als auch beim Segnen werden Gottes Gaben wirksam zugeeignet. Während freilich bei Wortverkündigung und Sakramenten die Zusage des Evangeliums im Indikativ erfolgt (z.B.: „Christus ist für unsere Sünde gestorben“), ist der typische Modus für den Segen der Optativ (z.B.: „Christus sei dir gnädig“). Der Segen berührt sich mit Taufe und Herrenmahl im performativen Charakter der Handlung, die das, was sie darstellt, auch vollzieht. Jedoch sollte der Unterschied zwischen den indikativischen Formulierungen der Sakramente und der eigenständigen Sprachform des Segnens nicht verwischt werden. Der Segenszuspruch lautet, wie in 4. Mose 6, 24 vorgegeben: „Der Herr segne dich...“ und nicht: „Der Herr segnet dich...“ oder „Ich segne dich im Namen Gottes...“; die Taufformel aber lautet: „Ich taufe dich auf den Namen Gottes...“
Dem sprachlichen Unterschied entspricht ein theologischer: Taufe und Abendmahl geschehen – anders als Segenshandlungen – auf ausdrückliche Einsetzung Christi hin. Demgemäß spricht Christus selbst in den Einsetzungsworten zum Abendmahl sein verheißendes Wort: „Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird ...“ (Verbindung einer indikativischen Aussage mit der direkten Anrede in 1. Korinther 11, 24). In der Taufe spricht zwar der Täufer bzw. die Täuferin die Taufformel, vorausgesetzt wird aber, dass Gott unmittelbar Subjekt des Geschehens – sozusagen selbst der Täufer – ist (vgl. die doppelte Passivkonstruktion in Römer 6, 3 f.).
Wem gilt der Segen?
Anders als bei einem Segensgruß ist bei einer Segenshandlung in der Regel Voraussetzung, dass der Adressat des Segens den Segen auch empfangen will. Dies zu verdeutlichen ist die Funktion des responsorischen „Amen“ im Gottesdienst. Der Segen kann entweder Glauben stärken und die Taufe „vergegenwärtigen“ oder aber auf Glaube und Taufe hinführen. Der Segen kann wie alle Gaben Gottes durch Unglauben und Missachtung des Willens Gottes zum Gericht werden.
Paulus unterscheidet zwischen „natürlichem“ und „geistlichem Menschen“ (1. Korinther 2, 14f.). Auch der Christ („geistlicher Mensch“) bleibt – wie die Welt – „Kampfplatz“ zwischen Geist und Fleisch (Galater 5, 16ff; 1. Korinther 3, 1ff; Römer 8, 3ff.), zwischen Hingabe an Gott und den Nächsten und eigener Selbstbehauptung, reformatorisch „simul iustus et peccator“ (gerecht und Sünder zugleich). So sehr der Segen Gottes allen Menschen gilt, so wenig kann sein Sinn darin liegen etwas „abzusegnen“, d.h. etwas Vorfindliches unkritisch zu bejahen, gutzuheißen bzw. religiös zu überhöhen. Dadurch würde der Segen instrumentalisiert und ihm seine kritische Kraft genommen. Gegenüber einem Segensverständnis, das das Vorfindliche bestätigt, wird durch den Segen des Dreieinigen Gottes der Sündenfall nicht bagatellisiert. Vielmehr ist der Segen „Kampfansage“ Gottes gegenüber der Verkehrung, der seine Schöpfung preisgegeben ist. Am Kreuz Jesu hat Gott stellvertretend die Gerichtsfolgen dieser Verkehrung auf sich genommen. Durch die Auferstehung Jesu gilt Gottes neuschaffender Segen der ganzen Schöpfung.
Heil und Heilung
Auch körperliche und seelische Krankheit gehört zur Symptomatik der Verkehrung von Gottes Schöpfung (Sündenfall). Heilungen bei Jesus und in der christlichen Gemeinde sind Zeichen der Gottesherrschaft, die jetzt anbricht und die Jesus Christus dereinst vollendet.
Gott heilt durch geistliche Begleitung, medizinische Behandlung und soziale Betreuung. Im Neuen Testament gehören die Wiederherstellung der Gesundheit und die Wiederherstellung der Gottesbeziehung zusammen: Sowohl in Jakobus 5, 13ff. als auch in Heilungsberichten der Evangelien werden Sündenvergebung und Heilung miteinander verknüpft. Denn Gottes heilvolles Handeln zielt auf den ganzen Menschen. Ein Irrweg ist es allerdings, von einer erfolgten (vgl. Lukas 17, 11-19) oder nicht erfolgten Heilung (vgl. 2. Korinther 12, 7-10) auf die heilvolle oder unheilvolle Beziehung zwischen einem Menschen und Gott schließen zu wollen. Gott, der sich selbst in Jesus Christus das Leiden nicht erspart, kann Menschen auch in ihrem Leiden nahe sein. Dies ändert nichts daran, dass Gottes Ziel Heil und Heilung für den ganzen Menschen ist und dass auch körperliche Heilung durch den Heiligen Geist bereits jetzt geschehen kann und auch geschieht.
Wer kann segnen?
Grundsätzlich ist jeder Christ zum Segnen berufen. Praktisch wurde in den frühen christlichen Gemeinden die Segnung unter Handauflegung von solchen Christinnen und Christen wahrgenommen, die eine besondere Stellung in der Gemeinde hatten: von Aposteln (Apostelgeschichte 6, 6; 8, 17; 19, 6; 2. Timotheus 1, 6), Propheten und Lehrern (Apostelgeschichte 13, 1-3) sowie Ältesten (1. Timotheus 4, 14; 5, 22; Jakobus 5, 14). Voraussetzung für das Segnen war nicht ein priesterliches Amt, sondern die Mitarbeit und Anerkennung in der Gemeinde. Heute werden in der evangelischen Kirche Segnungsgottesdienste in der Regel von einer Gruppe vorbereitet und gestaltet. Auch im privaten Bereich können Eltern ihre Kinder segnen, Angehörige oder Freunde die Kranken usw. Segnen ist kein Pfarrerprivileg, sondern eine der Grundtätigkeiten jedes Christenmenschen, zu der man Christinnen und Christen ermutigen und anleiten muss.
Gottesdienste mit Einzelsegnung
Einzelsegnungen und -salbungen haben ihren Ort sowohl in der Seelsorge als auch im öffentlichen Gottesdienst – im Sonntagsgottesdienst wie in besonderen Gottesdiensten, einschließlich Zielgruppengottesdiensten. Da auch der Segen im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi gründet, ist die Verkündigung des Evangeliums - in der Regel in Schriftlesung und Predigt - Bestandteil jedes Segnungsgottesdienstes (vgl. 1. Timotheus 4, 4f.). Die in einem solchen Gottesdienst bei Einzelsegnungen zur Geltung kommenden individuellen Bedürfnisse werden durch die vorangegangene Verkündigung des Evangeliums „orientiert“ und können in einer gemeinsamen Feier des Abendmahls „zusammengeführt“ werden. Wichtig - wie bei jedem Gottesdienst - ist die Haltung der Offenheit gegenüber Gott und die Erwartung seines Handelns. Die sorgfältige Vorbereitung schließt die Bewusstmachung von Nähe und Distanz der Segnungshandlung ein. Hierzu gehören Behutsamkeit und Einfühlungsvermögen.